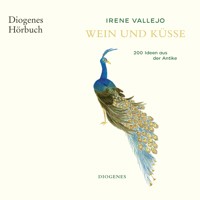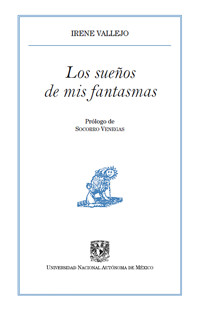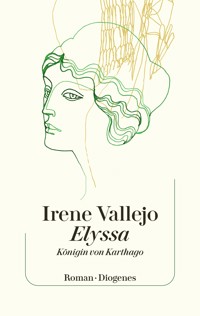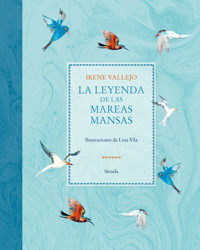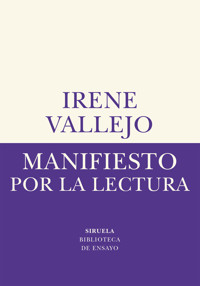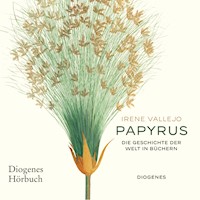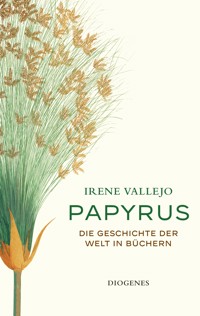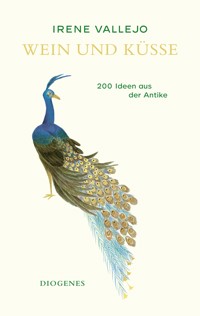
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Irene Vallejo hebt in ihren leichtfüßigen, strahlend prägnanten Kolumnen den Schatz an Lebenskunst, den die Antike noch heute für uns birgt. Mit Sokrates feiert sie den Luxus, nachdenken zu dürfen, mit dem Kyniker Krates sinniert sie, wie man das Glück im Jetzt findet, und weiß von Horaz: Wer ein Problem angeht, hat es schon halb gelöst. Wie nebenbei lernt man Mythen, Personen und ihre Geschichten kennen und bekommt wunderbare Impulse für das eigene Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Irene Vallejo
Wein und Küsse
200 Ideen aus der Antike
Aus dem Spanischen von Kristin Lohmann
Diogenes
Aller Anfang
Wie schwer ist doch aller Anfang! Gerade frisch auf der Welt, verlangen uns die nichtigsten Dinge die größte Anstrengung ab. Wie oft wirft uns das Kinderfahrrad ab, bevor wir es endlich beherrschen. Wie starr sind unsere schüchternen Gesten und Worte, wenn wir uns zum ersten Mal verlieben und nicht einmal den Mut aufbringen, uns der oder dem Begehrten auch nur ein kleines Stück anzunähern. Und als welch unbezwingbares Gebirge erscheinen uns die nichtigsten Aufgaben bei jeder neuen Arbeitsstelle.
Anfänge sind das Schlachtfeld von Ungeschick und Angst – aber auch die Sphäre, in der der Lebensdrang besonders kraftvoll zum Ausdruck kommt. Dem römischen Dichter Horaz war das sehr bewusst, musste er doch sein Leben von Grund auf neu aufbauen. Sein als Sklave geborener Vater hatte hart gearbeitet, um ihm eine solide Bildung zu ermöglichen. Das Studium, in das der Vater große Hoffnung setzte, führte Horaz schließlich von Rom nach Athen. Dort holten den vielversprechenden jungen Mann jedoch die Wirren der Geschichte ein, und seine Träume verpufften. Er lernte Brutus kennen, Cäsars Mörder, und entschied aus einer Anwandlung heraus, sich dessen Truppen anzuschließen. Der Krieg endete in einer katastrophalen Niederlage. Als Horaz gebrandmarkt als Verlierer nach Rom zurückkehrte, war sein Vermögen beschlagnahmt. Mit gestutzten Flügeln und gedemütigt rang er schwer mit dem schmerzhaften Gefühl des Scheiterns und den Geistern der Zurückweisung – wer hat dich gesehen, wer sieht dich – und wurde schließlich zum gefeierten Dichter. Die ersten Schritte sind immer die schwierigsten, das hatte Horaz auf seinem Weg begriffen. Seine Erfahrungen fasste er in einem hoffnungsvollen Vers zusammen: »Frisch gewagt ist halb gewonnen.«
Schule der Muße
Nie werde ich meinen ersten Schultag vergessen. Auf dem Weg dorthin nahm mich meine geliebte Tante Maria an die Hand und meinte: »Ab jetzt wirst du jeden Tag zur Schule gehen – ob es regnet oder schneit, ob du frierst oder dir der Wind um die Ohren pfeift.« Ich stellte mir vor, wie ich Stürmen und Orkanen trotzte. Und ich bekam Angst. Ihre Stimme klang hart, so wie die meiner Eltern, wenn sie sagten »Ich muss arbeiten«, was bedeutete, dass wir nicht zusammen spielen würden. Die Schule war Pflicht, und Hausaufgaben gab es auch noch.
Jahre später stellte ich überrascht fest, dass das Wort Schule von skholé abstammt, dem griechischen Wort für Muße. Studierzeiten dienten in den Augen der Griechen der Erholung – im Gegensatz zur Arbeit, die einen in den Dienst eines Herren oder des Geldes stellt. Aristoteles schrieb: »Die Glückseligkeit scheint (…) in der Muße zu bestehen«, soll heißen: in Bildung und Kultur. Auch der Philosoph Sokrates war ein großer Müßiggänger. Er wandelte über die Agora, streifte durch die Straßen und versuchte, die Athener davon zu überzeugen, die Arbeit ruhen zu lassen und sich stattdessen dem Gespräch hinzugeben. Damit verkörperte er ein antikes Ideal: nämlich die freie Zeit der Freundschaft, dem Dialog zwischen Lehrer und Schülern und dem intellektuellen Gespräch zu widmen. Waren die Grundbedürfnisse des Lebens gedeckt, bestand die nächste soziale Stufe der Antike im Lernen und Wissen. Und so zeigen uns die Griechen, dass die Schule zwar Pflicht ist, uns aber auch befreit.
Platonische Liebe
Herumzufantasieren und das Unerreichbare herbeizusehnen sind feste Bestandteile der Liebe. Beschränkt sie sich auf diese beiden Ingredienzien, sprechen wir von einer besonderen Art der Liebe, nämlich der platonischen. Dabei hat Platon sich nie mit der unerwiderten oder unmöglichen Liebe beschäftigt, die als Ideal die Zeit überdauert. Stattdessen erklärt der Philosoph das Verliebtsein wie folgt:
Alles beginnt im »Gefilde der Wahrheit«, das weit hinter unserem Himmel liegt. Dort drehen die Götter auf perfekt kreisförmigen Bahnen ihre Runden, gefolgt von einer Prozession körperloser, geflügelter Seelen, die sich jeweils auf von zwei Pferden gezogenen Wagen fortbewegen. Während die Götter in einträchtiger Harmonie dahingleiten, legen die Seelen ein unverwechselbar menschliches Verhalten an den Tag: Sie versuchen einander zu überholen, ihre Wagen rumpeln aneinander, sie taumeln, und manche fallen dabei mit gebrochenen Flügeln auf die Erde. Dort werden sie von einem Körper umfangen und als Kinder ohne Erinnerung geboren. Früher oder später begegnet jeder von ihnen einem Menschen, der ihn überwältigt und an die strahlende Welt erinnert, aus der die Seele ursprünglich stammt. Bei diesem herrlichen Anblick auf Erden spürt der Liebende eine warme Kraft in sich aufsteigen: Die Stummel seiner Seele kribbeln, die Überreste seiner Flügel sind in Aufruhr, weil sie wieder wachsen wollen. Genau wie zuvor bei der Fahrt im himmlischen Wagen ziehen zwei Pferde an der Seele. Ein schwarzes, das sich – beflügelt von der erotischen Faszination – losreißen will und ein weißes, gefügiges, das im Angesicht des Geliebten erzittert. Das Temperament dieser beiden Pferde ist verantwortlich für unseren inneren Kampf zwischen Trieb und Scheu, zwischen der Dringlichkeit der Begierde und dem lähmenden Abwarten. In genau diesem komplizierten Kräfteverhältnis besteht für Platon die Liebe.
Gegenpole
Die Welt gibt sich vor allem deshalb so wunderlich und wirr, weil wir Menschen so widersprüchlich sind. Wir wissen genau, was uns guttut, und stolpern doch von einer Dummheit in die nächste. Wir propagieren Ehrlichkeit und lügen. Wir sind großzügig gegenüber den einen, aber nicht gegenüber anderen, die es viel nötiger hätten. Wir streben ein freies Leben an und sind doch davon besessen, uns einer Gruppe zugehörig zu fühlen. Manche Dinge durchdringen wir mit scharfem Blick, andere sind uns völlig gleichgültig. Wir sind einfach zu komplex, als dass das Leben in vorhersehbaren Bahnen verlaufen könnte, und so suchen wir im Angesicht dieser permanenten Ungewissheit unseren Seelenfrieden schnell in undifferenzierten Pauschalaussagen. Manichäische Abhandlungen versuchen Sicherheit zu vermitteln, indem sie die Wirklichkeit in zwei Kategorien einteilen. Gehörst du nicht zu der einen, bist du zwangsläufig der anderen zuzuordnen. Gut oder böse, Wahrheit oder Lüge, Zivilisation oder Barbarei, Erfolg oder Scheitern, für oder gegen mich.
Der Begriff des Manichäismus geht auf eine Religion der Spätantike zurück, die Elemente der christlichen Lehre, des Buddhismus und des Zarathustrismus enthielt. Ihre Glaubenssätze wurden dem Religionsstifter Mani offenbart. Manis Glaube gründete sich auf dem ewigen Kampf zweier entgegengesetzter Prinzipien: des Guten, verkörpert durch das Licht, und des Bösen, für das symbolisch die Finsternis steht. Augustinus, selbst fast zehn Jahre lang Manichäer, beschreibt in seinen Bekenntnissen die Anziehungskraft einer derart vereinfachten Sichtweise von Konflikten. Auch heute bedient sich Propagandasprache nicht selten einer platten Polarisierung, um simple Lösungen zu versprechen und Anhänger zu gewinnen. Dabei werden auch die Lehren Manis zu Manipulationszwecken eingesetzt.
Ein Verbrechen liegt in der Luft
Kriminalfilme und -romane sind häufig im dunklen Universum des Verbrechens angesiedelt, um eine höchst beunruhigende Umgebung zu erkunden: die Schattenseite unserer Träume, deren Zwielicht die nebulöse Komplexität des Menschen heraufbeschwört und blinde Leidenschaften hervorbringt, Verbrechen und Verhängnis, die verborgene Welt, die unter der vermeintlichen Beschaulichkeit des Alltäglichen liegt.
Die erste Kriminalgeschichte wurde im antiken Griechenland verfasst. Der Protagonist, Ödipus, ermittelt im Todesfall des Königs von Theben, der Jahre zuvor unter mysteriösen Umständen ums Leben kam. Bei der Befragung der Zeugen kommt ihm der Verdacht, dass diese ein düsteres Geheimnis bergen. Ödipus ist genauso sturköpfig, gewalttätig, scharfsinnig und heimatlos wie die Detektive Spade und Marlowe. Er weiß, da er direkt nach der Geburt ausgesetzt wurde, nichts über seine Herkunft, und als man ihn drängt, die Nachforschungen einzustellen – noch heute typisch für das Genre –, macht er unbeirrt weiter, stemmt sich gegen Wind und Gezeiten, kämpft sich durch das Labyrinth aus Hinweisen und Andeutungen, bis er schließlich auf eine Wahrheit stößt, die er lieber nicht erfahren hätte. Der König nämlich starb bei einer abwegigen Auseinandersetzung an einer Kreuzung. Nach und nach verdichtet sich in Ödipus die Erinnerung an einen tragischen, wirren Streit, vor dem er schließlich geflohen war, nachdem er einen Unbekannten niedergeschlagen hatte. In einer meisterhaften finalen Wendung entdeckt er, wer seine wahren Eltern sind, und ergründet die verstörende Identität seiner Ehefrau. Die Auflösung dieses ersten Noirs ist noch heute verstörend: Ödipus ist Detektiv und Mörder zugleich.
Blinder Neid
Wie oft verpufft doch die Zufriedenheit mit dem, was wir haben, sobald wir erfahren, dass ein anderer etwas Besseres hat. Neid sei der schlimmste Feind der Wohlhabenden, meinte der Philosoph Epiktet – er speise sich aus dem Kummer über all die Dinge, die uns nicht gehören, und das seien nun mal die allermeisten. Das Seltsamste am Neid (lateinisch: invidere, »feindselig blicken«, »missgönnen«) aber ist, dass er stets auf die Menschen gerichtet ist, die uns nahe sind, die wir persönlich kennen. Neid ist also eine Art intime Form der Feindseligkeit. Wir beneiden niemanden um ein Vermögen, das ohnehin unerreichbar ist. Wir beneiden also nicht den Millionär in der Ferne, sondern den Nachbarn in unserer Straße, der ein bisschen luxuriöser lebt oder ein bisschen mehr Glück hat im Leben als wir selbst. Daher kann auch der bescheidenste Erfolg Neid hervorrufen und ist damit fatal für jede Form von Verdienst oder Leistung: Er schadet demjenigen, der unter ihm leidet, und kann tödlich sein für den Verursacher. Neid fordert damit stets zwei Opfer; Nutznießer gibt es keinen.
In einer Erzählung aus dem Orient geht es um einen König, der zwei gleichrangige Minister ernennt. Der eine beneidet den anderen mit Inbrunst: um dessen Erfolge, seinen allmählichen Aufstieg in der Amtshierarchie, seine vielversprechende Zukunft. Als der König den aufkeimenden Hass bemerkt, will er dem Neider eine Lektion erteilen; er will ihm beweisen, dass das Glück des einen keinerlei Schaden für den anderen mit sich bringt, denn auch der Mond könne seinen schimmernden Glanz auf Tausende Wellen zugleich werfen. »Mein treuer Diener«, sagt er, »ich will dich belohnen. Verlange, was immer du möchtest – du sollst jedoch wissen, dass ich meinem anderen Minister stets das Doppelte geben werde.« Daraufhin beschließt der Neider in seiner Verbitterung über das vermeintlich größere Glück des anderen, diesem doppeltes Unheil widerfahren zu lassen, und erwidert: »Mein Herr, dann wünsche ich, dass Ihr mir ein Auge nehmt.«
Machttrunken
Wir wählen unsere Regierenden, damit sie die Welt verändern, doch am Ende sind es häufig sie selbst, die sich verändern. Dieser Wandel von Politikerinnen und Politikern ist auf ihren Erfolg und die Bauchpinselei durch ihren innersten Kreis zurückzuführen und gilt als Berufskrankheit. Ein britischer Neurologe und ehemaliger Minister hat die Symptome dieser Erkrankung wie folgt aufgezählt: zunehmende Realitätsferne, ein Übermaß an Selbstvertrauen, messianischer Sprachgebrauch und die feste Überzeugung, sich auf dem Pfad der Wahrheit zu befinden und sich keinesfalls vor der öffentlichen Meinung zu rechtfertigen, sondern allein vor dem Lauf der Geschichte.
Im klinischen Fachjargon spricht man vom »Hybris-Syndrom«. Der griechische Begriff Hybris bedeutet »Hochmut« und »Vermessenheit«. Er steht für einen rücksichtslosen Rausch, der von Ate, der Göttin der Verblendung, angefacht wurde und Helden und Mächtige dazu brachte, ihre Mitmenschen zu unterjochen. Die Folgen dieses Rauschs waren katastrophal und wurden von der Göttin Nemesis geahndet. Ihre Aufgabe war es, die Geschädigten zu rächen und so das Gleichgewicht wiederherzustellen. In der griechischen Tragödie wird dieser Teufelskreis aus Macht, Stolz, Verblendung, fatalem Irrtum und Untergang vielfach geschildert. Der Geisteshaltung der Antike zufolge gelingt es nur durch die intellektuelle Tugend der Klugheit, das eigene Handeln an die komplexen Gegebenheiten der Welt anzupassen. Machthaber werden ab dem Moment gefährlich, würden die Menschen der Antike sagen, ab dem sie Angst haben, einen Fehler einzugestehen.
Lob dem Geheimen
Wir leben in einem Zeitalter leidenschaftlicher Selbstdarstellung. Analysen zufolge teilt die Menschheit täglich eine Million Selfies im Netz. Manche setzen sogar ihr Leben aufs Spiel, um die eigenen Erlebnisse zur Sensation zu machen. Die tödlichen Unfälle bei dem Versuch, am Rande einer Klippe, auf dem Dach eines Wolkenkratzers oder am Abgrund über der steilen Felswand ein möglichst spektakuläres Selbstporträt zu knipsen, mehren sich. Derselbe Hunger nach Aufmerksamkeit manifestiert sich in der Ich-Form von Blogs, in den sozialen Netzwerken oder der Häufung von Realityshows im Fernsehen. Begriffe wie Intimität, Zurückhaltung oder Diskretion hören sich inmitten dieses überbordenden Rauschs rückständig und feige an; viel lieber applaudieren wir der vermeintlichen Courage derer, die sich möglichst hemmungslos zur Schau stellen.
Im Gegensatz zu solch verblendeten Ruhmsuchenden zog es der griechische Philosoph Krates von Theben vor, auf seine angesehene soziale Stellung zu verzichten und seine Reichtümer zu verteilen, um fortan ein einfaches Leben mit nicht mehr als dem Nötigsten zu führen. Seine Entdeckung bestand darin, dass er, wenn er nur den Blick von sich selbst abwandte, zurück zu seiner inneren Freiheit und der Kühnheit des Denkens fand. Einmal nannte er die Armut und die Anonymität seine Heimat. Für den antiken Dissidenten waren die geistige Fruchtbarkeit des Geheimen und die Rebellion gegen den Exhibitionismus Formen des Widerstands – und das gilt in unserer von Narzissmus und Ungeduld geprägten Gesellschaft des Ich und des Immergleich-sofort vielleicht mehr denn je.
Höhenflug
Beim Anblick der Vögel, wie sie zum Flug ansetzen, wie sie flatternd mit den Flügeln schlagen und auf Luftströmungen dahingleiten, haben wir oft das Gefühl, sie seien viel freiere Geschöpfe als wir selbst. Sie rufen in uns das Verlangen nach einem einfachen Leben wach, die Sehnsucht nach den Lüften.
Vielleicht brachte der Grieche Aristophanes ja deshalb seine Zeitgenossen mit einer Komödie zum Lachen, in der zwei Abenteurer, die nicht mehr weiter Schulden anhäufen und kurz vor dem Bankrott stehen wollten, beschließen, eine Stadt hoch oben in den Lüften zu gründen, um endlich allen Verpflichtungen, Steuern und Rechtsstreitigkeiten zu entkommen und fortan glücklich wie die Vögel zu leben. Wiedehopf und Nachtigall überreichen ihren menschlichen Verbündeten die Wurzel einer magischen Pflanze, durch deren Kraft sie fliegen können: »Flügel zu besitzen – kennt ihr, sagt es selbst, ein schöner Glück?!« Tatsächlich lebt es sich wunderbar einfach in diesem sogenannten »Wolkenkuckucksheim«. Dann aber werden sich unsere Helden ihrer neuen Macht bewusst: Durch ihre neue Stellung im Himmel können sie die Götter nämlich auf ihrem Wandel entlang der Sternenpfade beeinflussen. Unseren irdischen Fluglotsen gleich, wollen die beiden fortan ihre eigenen Bedingungen durchsetzen, was die Götter in höchste Alarmbereitschaft versetzt; der Ausnahmezustand wird ausgerufen, und man tritt zwangsläufig in Verhandlung mit den neuen Herrschern der Lüfte. In der Folge macht die Hauptfigur ein Vermögen und heiratet die Göttin Basileia, ihres Zeichens die Personifikation des Königtums.
Aristophanes erzählt uns hier eine Fabel über die Flucht vor der erdrückenden Realität in eine neue Gemeinschaft, von der kurzerhand alles Belastende ferngehalten wird. Der Ehrgeiz aber macht auch vor der besten aller möglichen Welten nicht Halt. Und so zeigt uns die tückische Auflösung, dass selbst in Luftschlössern noch Machtkämpfe herrschen.
Unerkanntes Glück
Erkennen wir wirklich nur den Wert dessen, was wir einst besaßen und das wir haben ziehen lassen? Sind wirklich all unsere Paradiese verlorene Paradiese? Bevor es in all seiner Fülle schon wieder vorüber ist, kann wohl kaum jemand mit Gewissheit sagen, worin es eigentlich bestanden hat, das Glück. Wie häufig erkennen wir es erst im Nachhinein, ohne es wirklich wahrgenommen zu haben, solange es währte. Schweift die Erinnerung in die Vergangenheit, wird uns bewusst, dass wir die grünsten Oasen schon hinter uns gelassen haben, ohne innezuhalten oder sie überhaupt zu bemerken. Deshalb verkaufte auch Goethes Faust einst dem Teufel seine Seele, im Tausch gegen einen Moment, zu dem er sagen konnte: »Verweile doch, du bist so schön!« Es ging nicht nur um das Glück selbst, sondern darum, dieses Glück noch im selben Augenblick zu erkennen.
Zur Korrektur dieser vorübergehenden Blindheit empfahl Schopenhauer, wir sollten unser Glück betrachten, als würde es uns jemand nehmen wollen. »Stattdessen sollten wir öfter fragen: ›Wie, wenn das nicht mein wäre?‹« Viele Jahrhunderte zuvor meinten die griechischen Philosophen, Glück ließe sich üben und erlernen – verstanden sie es doch als jene Form der Aufmerksamkeit, die die Freude des Augenblicks einfängt und verdeutlicht. Um dies zu erreichen, schlugen sie ein ganz ähnliches Verfahren vor: Stell dir vor, du hast rein gar nichts; dann zähle nach Wichtigkeit geordnet auf, was du gerne hättest, und überlege, was davon du bereits besitzt. Es geht also darum, uns das, was wir haben, mindestens genauso bewusst zu machen wie das, was uns fehlt. Denn einfach nur glücklich sein genügt nicht – man muss sich seines Glückes auch gewahr sein: Glück mit Leichtigkeit erkennen – das ist es.
Yahoos
Wohl kaum etwas ist herausfordernder, als mitanzusehen, wie sich Gewissheiten verändern, wie sich feste Bezugsgrößen, ja die Dimensionen der Realität selbst wandeln. Wir sind Zeuginnen und Zeugen so vieler Ereignisse, die vor Jahren noch undenkbar waren, dass uns die Fähigkeit zum Misstrauen abhandengekommen ist. So akzeptieren wir inzwischen, dass wir die Wirklichkeit täglich aufs Neue erkunden und uns an ein neues, bislang unkartografiertes Habitat anpassen müssen.
Ganz ähnlich erging es Gulliver auf seinen Reisen, wie Jonathan Swift sie vor drei Jahrhunderten erzählte. Erst muss Gulliver sich unfreiwillig im Land der Zwerge zurechtfinden, später verschlägt es ihn ebenso unfreiwillig ins Land der Riesen. Über Nacht wird er zum Fremden in einer Wirklichkeit, deren Dimensionen ihm feindlich erscheinen. Nachdem er diese verdrehten Welten überlebt hat, strandet Gulliver auf einer Insel, auf der die Menschen – grobschlächtig, behaart und ohne Sprache – von einer hoch entwickelten Pferderasse als unterwürfige Haustiere gehalten werden. Yahoos nennen die dort herrschenden Pferde diese Wesen, die sie mit größter Verachtung behandeln. Swift zeichnet hier eine Satire über die menschliche Spezies, wie sie in ihrem natürlichen Zustand ebenjene Gier entwickelt, die die zivilisierten Gesellschaften in den Ruin treibt. Wirft man fünf dieser Yahoos eine Futtermenge vor, die gut für fünfzig von ihnen ausreichen würde, so berichten es die Pferde Gulliver, gehen sich diese fünf trotz der Fülle gierig an die Gurgel, statt in Ruhe zu fressen. Jeder versucht verzweifelt, alles an sich zu raffen. Swift gibt sich zwar pessimistisch in seinem Buch, aber nicht fatalistisch – immerhin bewahrt er sich den Glauben daran, dass der Mensch fähig ist, sich zu bessern. Bis dahin allerdings vergnügt er sich damit, die Welt komplett auf den Kopf zu stellen.
Fataler Sieg
Auch gewonnene Schlachten haben ihren Preis, und der ist manchmal höher als der einer Niederlage. Wer triumphiert, beißt sich eher fest an der Sache, denn warum aufgeben, wenn der Sieg doch sicher scheint? Siege sind die besseren Lügner, und deshalb kann sich Siegesgewissheit auch als der fatalere Trugschluss erweisen als die Niederlage. Genau darin lag auch das Paradox des Pyrrhus, Herrscher einer griechischen Militärmacht, der vor 2500 Jahren auf fremdem Boden einen Krieg gegen einen Feind anzettelte, den er für unterlegen und wenig zivilisiert hielt: Rom. Vom ersten Aufeinandertreffen an war Pyrrhus ein Sieger mit blutigen Händen, denn er verschonte nicht einmal sein eigenes Volk. Im Vertrauen auf die Durchschlagskraft seines anfänglichen Erfolges strebte er sodann einen raschen, ruhmreichen Friedensschluss an. Vergeblich, denn die Römer kündigten an, ihn, solange er sich auf ihrem Gebiet aufhielt, mit aller Kraft zu bekämpfen. Und so schwand der Eindruck, er wäre siegreich, nach und nach, weil der Feind einfach nicht kapitulierte. In einer anderen denkwürdigen Schlacht schlug Pyrrhus seine Gegner zwar in die Flucht, das Schlachtfeld aber war übersät von Toten. Den Chroniken zufolge waren es 6000 Römer und 3300 Griechen. Diese Schlacht brachte einen berühmten Ausspruch des Kriegsherren hervor: »Noch so ein Sieg, und wir sind verloren.« Als verfügten sie über eine unerschöpfliche Quelle, rekrutierten die Römer immer neue Kämpfer, während für Pyrrhus jedes Opfer einen herben Rückschlag bedeutete. Ihm zu Ehren bezeichnen wir kurzlebige Erfolge, die mit großen Verlusten einhergehen und keinen nennenswerten Nutzen haben, heute als Pyrrhussiege.
Als sich Pyrrhus schließlich zurückzog, waren von seinen Triumphen nur noch Scherben übrig. Die Erfahrung hatte ihn gelehrt, dass der vermeintliche Sieger manchmal nur eines erobert hat: eine fragile, unsichere Position. Und das hatte Pyrrhus gleich mehrfach erlebt.
Grenzwelten
In seinen Ursprüngen war der Comic eine Randerscheinung, und zwar im wörtlichen Sinne: Die ersten illustrierten Strips der Geschichte finden sich nämlich an den Rändern antiker Manuskripte. Bücher wurden damals zunehmend mit irrwitzigen Spitzenmustern versehen, einer Fülle gewundener, ineinander verschlungener, sich kreuzender Drachen, Schlangen und Schlingpflanzen, die sich um die Buchstaben wanden. Diese Ornamente beanspruchten immer mehr Platz, bis sie schließlich ganze Seiten einzunehmen drohten. Menschen, Tiere und Landschaften tummelten sich auf dem Papier, höchst lebendige Szenen, die in ganzen Serien fortgeführt wurden. Eingefasst wurden die Illustrationen von Pflanzenbordüren – daher kommt auch der Begriff der Vignette; denn häufig handelte es sich um gezeichnete Weinblätter (vigne = Weinblatt). Seit der mittelalterlichen Gotik kamen zudem kleine Bändchen mit gesprochenen Sätzen aus den Mündern der Figuren: Vorläufer der Sprechblasen unserer modernen Comics.
Die Miniaturen entstanden, um – über den Text hinaus – den menschlichen Appetit auf das Wunderbare anzuregen. Ob detailreich oder fantastisch, der Natur entnommen oder frei erfunden – die Illustrationen jener Zeit zeigen, wie aus untergeordneten Bereichen neue künstlerische Formen entstehen und sich behaupten können. Der Comic, Erbe dieser eleganten grafischen Vergangenheit, hat sich bis heute Spuren seiner Ursprünge bewahrt. So gehören die Figuren heutiger Strips wie auch die Geschöpfe aus antiken Manuskripten häufig einer Grenzwelt an, einer seltsamen, hypnotischen, verzerrten Welt. Und genau wie die Charaktere von damals ziehen sie noch immer unsere Blicke auf sich, um mehr als nur eine Randerscheinung zu sein.
Politisches Risiko
Wir alle haben eine bestimmte charakterliche Schwäche, einen Makel, der uns anfällig macht, einen Wesenszug, der insbesondere die Harmonie in der Beziehung zu anderen gefährden kann. Die einen sind feige, die anderen eifersüchtig oder gleichgültig, oder es mangelt ihnen an Großzügigkeit. Auf dieselbe Weise wohnt auch jedem politischen System ein Risiko inne, eine bestimmte Schwäche, die es zu zerstören droht. Im Fall der Demokratie trägt dieses Risiko den griechischen Philosophen zufolge den Namen Demagogie.
Das altgriechische Wort für Demagogie bedeutet so viel wie »Volksverführung«. Für Aristoteles ist damit eine Regierungsweise gemeint, bei der Argumente durch den Appell an die Ängste und Vorurteile, die Vorlieben und Abneigungen der Bürgerinnen und Bürger ersetzt werden. Debatten werden emotional geführt; dass sich auch rational und mit Argumenten über politische Maßnahmen diskutieren lässt, wird gar nicht erst in Erwägung gezogen. In Zeiten akuter Krisen inszenieren sich Demagogen gerne als Retter. Schaffen sie es, die Gunst des Volkes für sich zu gewinnen, sind sie in der Lage, einen politischen Richtungswechsel hin zu einer autoritäreren Staatsform einzuläuten. Aristoteles war es im Übrigen auch, der die Demagogie als Erster identifizierte und als korrupte oder degenerierte Form der Demokratie definierte. Er war der Ansicht, dass die Formeln, nach denen sich Völker organisieren, grundsätzlich dynamisch sind; so lässt sich zwar alles erreichen, aber eben auch wieder rückgängig machen. Nichts ist in Stein gemeißelt. Man tut also gut daran, sich vor denen in Acht zu nehmen, die im politischen Wettstreit auf Grundemotionen setzen, um ganz vorne dabei zu sein.
Spartanisch
Schon in der Antike gab es strenge Verfechter von eiserner Disziplin und Entbehrung. Die erbittertsten von ihnen bewohnten den Süden Griechenlands; noch heute stehen sie für Strenge, Härte und hohe Ansprüche: die Spartaner. Während sie uns heute vor allem durch ihre Hauptstadt Sparta ein Begriff sind, benannten die alten Griechen sie nach der von ihnen bewohnten Region: Lakedaimonien oder Lakonien. Selbst mit Worten galten die Lakonier als sparsam, und so hielt ihr Wesenszug im Lauf der Jahrhunderte allmählich Einzug ins allgemeingebräuchliche Vokabular: Wer sich gerne kurzfasst und die Stille schätzt, gilt als lakonisch.
Die Spartaner waren nicht nur Feinde der Athener, sondern geradezu ihr Gegenpol. Während in Athen gerade die Demokratie eingeführt worden war und sich eine elektrisierende kulturelle Atmosphäre breitmachte, in der Philosophie, Kunst und Theater nur so florierten, errichtete man in Lakedaimonien eine autoritäre, streng strukturierte Gesellschaft, in der für Kreatives kein Platz war. Im Zentrum stand die militärische Ausbildung; Männern war es untersagt, einen Beruf zu ergreifen, der nichts mit Krieg zu tun hatte. Nachbarn wurden wahlweise angegriffen, unterjocht oder versklavt, und so lebte man angesichts der zahlreichen Feinde in permanenter Alarmbereitschaft. Man bewohnte primitivste, gänzlich schmucklose Häuser und ernährte sich in gemeinschaftlichen Speisesälen, wo karge Portionen einer zwar nahrhaften, aber nicht im Geringsten appetitlichen schwarzen Suppe gereicht wurden. Auch Worte, Schönheit und Lebensfreude opferten diese Verfechter der Entbehrung und erklärten Gegner der Demokratie. Deshalb haben sie auch der Zukunft nichts hinterlassen, und niemand spaziert zwischen ihren Ruinen umher. Entbehrung und Disziplin hatten die Spartaner zwar zu wahrhaftigen Kriegern gemacht – aber ihre Herzen zu eisernen Panzern.
Bitterer Erfolg
Ein japanischer Fischer war gerade mit seinem Boot im Pazifik unterwegs, als er aus dem Nichts heraus der Atomstrahlung der auf dem Bikini-Atoll abgeworfenen Wasserstoffbombe ausgesetzt wurde. 1946, ein Jahr nach Hiroshima und Nagasaki, begannen die Nordamerikaner mit den Bombenabwürfen, die sie über ein Jahrzehnt lang fortführen sollten. Mit der Behauptung, die Atomtests dienten »dem Wohl der Menschheit«, hatte das US-amerikanische Militär die Bewohnerinnen und Bewohner des Atolls vertrieben, die der Meinung waren, später wieder zurückkehren zu können. Der später erkrankte japanische Fischer widmete den Rest seines Lebens der Anklage dieser nuklearen Lüge; im Lauf der Jahre weitete er seine düsteren Worte dann auf Kernkraftwerke aus. Später erlebte er in Fukushima eine weitere Welle von Opfern des atomaren Übels.
Die trojanische Prinzessin Kassandra war von solcher Schönheit, dass der Gott Apollo ihr aus Liebe die Gabe der Weissagung schenkte. Die junge Frau nahm das aus Bewunderung erbrachte Geschenk zwar an, wies den göttlichen Liebenden selbst aber zurück; dafür rächte sich Apollo mit einem Fluch: Keiner ihrer Prophezeiungen solle jemals Glauben geschenkt werden. Kassandras Strafe bestand also darin, dass sie fortan sämtliche Katastrophen vorhersah – was aber völlig nutzlos war. Sie wusste etwa, dass der Trojanische Krieg eine Welle von Tod und Zerstörung auslösen und ihr Vaterland auslöschen würde, doch hörte niemand auf sie, siegesgewiss, wie alle waren. So erlebte Kassandra ihre schlimmste Qual auf Erden – nämlich alles vorherzusehen und nichts dagegen unternehmen zu können. Die polnische Dichterin und Nobelpreisträgerin Wisława Szymborska stellte sich Kassandras Klage über der schwelenden Asche Trojas so vor: »Ich hatte recht/Nur heißt das nichts//Es hat keinerlei Bedeutung/Und das sind meine verkohlten Kleider/Und das meine Prophetinnenwerkzeuge/Und das die Grimasse in meinem Gesicht.«
Die zwei Raben
In Zeiten politischer Verrenkungen geraten unsere Regierungsverantwortlichen doch ziemlich ins Schwitzen, wenn sie ihre Haltung ändern. Noch während sie sich in die entgegengesetzte Richtung biegen, mühen sie sich, uns zu überzeugen, dass sich doch eigentlich gar nichts ändern werde und sie selbstredend sämtliche Versprechen halten würden. Bündnisse erfreuen sich größter Beliebtheit, doch dass man dafür auch Zugeständnisse machen muss, will niemand zugeben. Das Spektakel ist so fesselnd wie altbekannt: Auch in der Vergangenheit gab es Versuche, auf zwei Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen.
Die Generäle Marc Anton und Augustus kämpften jahrelang bis auf den Tod um die Macht über Rom. Es war kaum abzusehen, wie das Duell enden würde, bis Marc Anton überraschend in der Schlacht von Actium im Norden Griechenlands geschlagen wurde. Als Augustus triumphierend zurückkehrte, suchte ihn ein Mann mit einem abgerichteten Raben auf. So wie Papageien können auch dressierte Raben die menschliche Sprache nachahmen. Dem Vogel in dieser Geschichte war der Ausspruch »Salve, Augustus, siegreicher Feldherr« beigebracht worden. Augustus war beeindruckt und belohnte den Mann dafür, dass er so treu ergeben an seinen Sieg geglaubt hatte. Der Dresseur aber hatte einen rachsüchtigen Kumpanen dabei, der Augustus verriet, dass es einen zweiten Raben gab, dem genau das Gegenteil beigebracht worden war: »Salve, Marc Anton, siegreicher Feldherr.« Wie sich herausstellte, hatten die beiden Opportunisten ursprünglich unter einer Decke gesteckt – genau wie so einige unserer politischen Verantwortlichen wollten auch sie, ohne ein Risiko einzugehen, ins Schwarze treffen; und dafür vervielfachten sie nicht nur die Anzahl der Vögel, sondern auch ihre Dreistigkeit.
Gesunde Wörter
Es ist erfüllend, die Welt zu begreifen. Sich umzublicken und die Ursachen, Auswirkungen und verdeckten Mechanismen hinter dem Geschehen zu erkennen schützt uns vor Täuschung und Manipulation. Genau diese Vorstellung ist der Keim, aus dem die Art der Geschichtsbetrachtung hervorgegangen ist, wie wir sie heute begreifen. Thukydides war es, der im alten Griechenland das simple Erzählen der Ereignisse in ihrer zeitlichen Abfolge hinter sich ließ und einen Schritt weiter ging. Die Aufgabe des Historikers, so seine Überzeugung, bestehe vielmehr darin, zu erkennen und zu analysieren, was den Menschen in seinem Handeln antreibt. Denn der Begriff »Geschichte« bedeutete im Altgriechischen auch »Nachforschung«.
Thukydides’ Sichtweise ermöglicht es Historikerinnen und Historikern heute, uns auf Grundlage ihrer Vergangenheitsanalyse essenzielle Hinweise zum Zustand der Gegenwart aufzuzeigen. Eines der Symptome für eine latente Krise sah Thukydides, selbst Zeuge des Demokratieverfalls in Athen, in der Bedeutungsänderung bestimmter Wörter. So erkannte er etwa einen klaren drohenden Verfall der Politik, wenn kriecherisches Verhalten innerhalb der Fraktionen zunehmend als »Loyalität« bezeichnet wurde. Wenn das Gemeinwohl wie Diebesgut behandelt wurde. Wenn die gerissensten Intriganten als »schlau« bezeichnet wurden und diejenigen, die erst einmal innehalten, um nachzudenken, als »feige«. Wenn von »Bündnissen« gesprochen wurde, nur um diffuse Interessensabsprachen zu verschleiern. Weiter schrieb Thukydides, dass Eide nur vorübergehend gültig waren, wenn Vereinbarungen getroffen wurden, denn beide Seiten leisteten sie in Eile und ohne jede Grundlage. Der Gesundheitszustand einer Gesellschaft lässt sich also gut diagnostizieren, indem man ihren Worten lauscht.
Aggression
Man könnte fast sagen, die Gesellschaft, in der wir leben, bewundert und belohnt aggressives Verhalten regelrecht. Allein schon, wie sich die Bedeutung des Wortes selbst gewandelt hat, zeigt, dass sich diese Haltung immer weiter verbreitet: Vor ein paar Jahren noch galt aggressives Verhalten als brutal, beleidigend, verletzend; heute gilt es als ehrgeizig, energisch, effizient. Treten Sportlerinnen, Führungskräfte oder Verkäufer heute aggressiv auf, wird das als Verdienst gewertet – nicht als Anzeichen mangelnder Ausgeglichenheit. Das Fernsehen hält am liebsten den empörtesten, aufgebrachtesten, beleidigendsten Leuten das Mikrofon vor die Nase, das Internet dient als Kanzel für Hasspredigten, und ein Verkehrsstau, der ohne hitziges Gezeter auskommt, ist zur Seltenheit geworden. Die Atmosphäre lädt sich zunehmend auf, Aggression ist ansteckend, und wir fangen an, uns in Acht zu nehmen vor den anderen. Immer mehr Menschen laufen wie ferngesteuert durch die Gegend, starr den eingeschlagenen Kurs beibehaltend, und echauffieren sich, wenn ihnen jemand im Weg steht.
Der römische Kaiser und Philosoph Mark Aurel war mit dieser Haltung ganz und gar nicht einverstanden. Aggression betrachtete er als Schwäche, Kraftmeierei als das Gegenteil von Stärke. Wer aufbraust, tue das ihm zufolge aus einer Verletzung heraus, nur deshalb schlage er um sich, wohingegen Freundlichkeit unbezwingbar sei. Wer sich nicht aus dem Gleichgewicht bringen lässt, behalte die moralische Oberhand und gehe als Sieger hervor, schrieb Mark Aurel in seinen Meditationen. Gute Manieren hätten ihm zufolge nichts mit Angst zu tun; die wahre Mutprobe bestünde darin, sich anzupassen und Kompromisse einzugehen. Fast zwanzig Jahrhunderte später sind Mark Aurels Lehren noch immer brandaktuell. Vergessen wir nicht, dass wir uns durch Liebenswürdigkeit als würdig erweisen, geliebt zu werden, dass wir durch Freundlichkeit Freunde gewinnen und Gelassenheit die Kunst ist, andere zu lassen, wie sie sind.
Feind der Anschuldigung
In den vergangenen, reichen Jahrzehnten lebten wir ganz im Zeichen der Euphorie. Ab einem gewissen Zeitpunkt jedoch spürten wir ganz unbemerkt und unvermittelt die Bürde einer neuartigen Verpflichtung: Plötzlich sollten wir uns selbstbewusst und voller Leben geben, sollten stets vergnügt und gefragt sein. Alles zu haben, das alleine zählt; sich mit dem Mangel zu versöhnen, ist nicht vorgesehen. Und weil uns die menschliche Unvollkommenheit als Stigma und Makel erscheint, ist inmitten all der Fülle ein unerwartetes Unwohlsein entstanden. Denn wenn uns die Gesundheit im Stich lässt oder wir arbeitslos werden oder Jugend und Schönheit verblassen, haben wir das Gefühl, wie Athleten am Ende ihrer Karriere dazustehen, ausgeschieden aus der großen Olympiade des Erfolgs.
Vor rund 2500 Jahren lehnte sich ein griechischer Philosoph namens Simonides gegen diese Denkweise auf. Er stellte fest, dass viele Menschen in seinem Umfeld nach Erfolg strebten, ohne dabei zwischen Glück und eigenem Verdienst zu unterscheiden: »Geht es einem Menschen gut, ist er selbst auch gut, geht es ihm schlecht, ist auch er schlecht. Der Beste ist im Allgemeinen derjenige, der vom Glück begünstigt ist.« In seinen Versen beschreibt er, dass das Scheitern den Menschen nicht schmälere, dass wir Sterblichen ohnehin einem steten Wandel unterworfen seien und wir alle jederzeit zu Fall gebracht werden könnten, ohne etwas dagegen tun zu können. Ein Mensch frei von Fehlern werde sich wohl kaum finden, schreibt er, das Wichtigste aber sei zu erkennen, dass weder unsere Erfolge uns zu etwas Besserem machen noch unsere Misserfolge zu etwas Schlechterem. Wir alle erleben im Lauf der Jahre Triumphe genauso wie Rückschläge. Simonides bewertete die Menschen anhand des moralischen Wertes ihrer Absichten und Anstrengungen, nicht danach ob sie durch die Grenzen und Unwägbarkeiten des Lebens zu Fall gebracht wurden. »Ich mag keine Anschuldigungen; gelobt und geschätzt sei jeder, der nicht absichtlich Schaden anrichtet.«
Wie die Zeit verfliegt
Es gibt kaum jemanden, der nicht fasziniert ist von Rätseln und Spaß hat am Herumtüfteln. Dabei übersehen wir ganz, welche Mysterien wir ohnehin die ganze Zeit direkt vor der Nase haben. Wie zum Beispiel die Zeit. Wohl kaum etwas ist uns vertrauter und bekannter als der Lauf der Zeit, und doch: Wer könnte auf einfache, prägnante Weise sagen, worin sie eigentlich besteht?, fragte sich der heilige Augustinus in seinen Bekenntnissen. »Was also ist die Zeit? Wenn niemand mich danach fragt, weiß ich’s, will ich’s aber einem Fragenden erklären, weiß ich’s nicht.«
Der ratlose Augustinus hatte erkannt, dass wir über die Zeit sprechen, als könnten wir sie sehen. Sie sei lang oder kurz, sagen wir, als handelte es sich um einen Faden oder eine gespannte Schnur. Dabei ist die Zeit doch vielmehr eine unsichtbare, kontinuierlich wirkende Kraft. Vielleicht wäre es beruhigender, könnten wir ihr tatsächlich dabei zusehen, wie sie vergeht und uns dabei beständig formt, doch die Realität sieht auf beunruhigende Weise nun einmal anders aus. Wir teilen die Zeit in Einheiten ein (Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, Monate, Jahre), ohne dabei eine klare Vorstellung von ihr zu haben, so Augustinus. Wir messen sie, ohne zu wissen, was genau wir da eigentlich messen. Von klein auf haben wir gelernt, zwischen Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft zu unterscheiden, dabei spüren wir doch nichts anderes als einen einzigen Augenblick in ihrem steten Fluss. Es gibt nichts anderes für uns als diesen einen Moment, der in flüchtigen Partikeln von der Zukunft in die Vergangenheit übergeht. Die Vergangenheit nimmt zu, die Zukunft schrumpft zusammen, schrieb Augustinus, und ihn schwindelte dabei. Es überraschte ihn, dass es in unserem tagtäglichen Leben noch immer ein derart großes Rätsel geben sollte. Denn es ist doch so: Unsere Uhren sind nichts anderes als das vertraute Antlitz eines großen Mysteriums.
Eintauchen
Die Traurigkeit von Friedhöfen ist natürlich immer auch unsere eigene Traurigkeit, denn wir alle haben irgendwo einen geliebten Menschen begraben. Dabei hat die Menschheit einige Anstrengung unternommen, gerade auf Friedhöfen der Melancholie beizukommen. Das griechische Wort für Friedhof bedeutete »Schlafplatz« – die Griechen betrachteten Gräber also offensichtlich als Betten, in denen ihre Toten ruhten. Diese Gräber waren in der Antike häufig mit farbenfrohen Gemälden verziert, Szenen aus dem Leben, die zu sagen schienen, »seht, nichts war umsonst, der Verstorbene verstand es, sein Leben zu genießen und ist voll leuchtender Erinnerungen gegangen«. Auf dem Deckel eines etruskischen Sarkophags etwa ruhen die Figuren eines Mannes und einer Frau, die sich seit 2300 Jahren inniglich umarmen. Eine andere, fast 2500 Jahre alte Grabmalerei, vielleicht das schönste Bild, mit dem man einen geliebten Menschen verabschieden kann, zeigt eine rötliche Silhouette, die von einem Sprungbrett aus ins Wasser springt. Der Springer ist genau in dem Moment festgehalten, als er sich mit vorgestreckten, aneinandergelegten Händen durch die Luft schwingt, kurz davor, in die Wellen eines lieblichen, von Tamarisken umgebenen Sees einzutauchen. Die Figur wirkt aktiv und gelassen zugleich. Beim Eintauchen wird der junge Mann wohl erschaudern, Wasser wird aufspritzen, dann wird sich die Wasseroberfläche über ihm schließen, und er wird nicht mehr zu sehen sein. Dennoch zeigt die Haltung des nackten Körpers keinerlei Anspannung oder Angst. Der Maler hat hier den Tod eingefangen und zugleich der Hoffnung lebendige Flügel verliehen, dass Sterben nichts weiter ist als ein kurzer Sprung und ein leises Eintauchen.
Liebe und Humor
Wer nach der Liebe sucht, sollte unbedingt eine gute Portion Humor im Gepäck haben. Warum das so ist, erklärt der römische Dichter Ovid in seiner Liebeskunst,