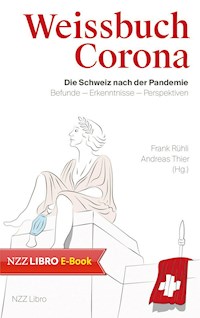
Weissbuch Corona E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neue Zürcher Zeitung NZZ Libro
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die COVID-19-Pandemie hat sich in rasantem Tempo ausgebreitet, sie hat die Welt vor umfassende Herausforderungen gestellt und tief in alle Bereiche des menschlichen Miteinanders eingegriffen. Das Gesundheitssystem, die Regierung, die Verwaltung und die Parteien, das Staatsverständnis und das Rechtswesen, die Wirtschaft, der Verkehr, die Wissenschaft, Forschung und Bildung, unser Sozialverhalten, Ethik und Religion – kein Bereich des öffentlichen Lebens blieb von der Krise unberührt. Und die Folgen dieser Umwälzungen sind noch längst nicht abschätzbar. Hier setzt das Weissbuch Corona an: Erstmals in einem interdisziplinär angelegten Band zu diesem Thema versammelt, untersuchen 40 Expertinnen und Experten, Praktikerinnen und Praktiker aus allen Lebens- und Wissensbereichen die mittel- und langfristigen Auswirkungen von Corona für die Gesellschaft und das öffentliche Leben in der Schweiz. Fachliche Analysen und Erfahrungsberichte aus der Praxis vermitteln Erkenntnisse aus der Pandemie. Sie zeigen Perspektiven für die Zeit nach der Krise auf und treiben damit auch gesellschaftliche Debatten voran. Die so gewonnenen Lehren aus der Corona-Pandemie können helfen, die Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft für künftige Krisen zu stärken. Mit Beiträgen von Matthias Egger, Eva Maria Belser, Roger de Weck, Katrin Schneeberger, Volker Reinhardt und vielen weiteren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Frank Rühli, Andreas Thier (Hg.)
Weissbuch Corona
Die Schweiz nach der Pandemie
Befunde – Erkenntnisse – Perspektiven
NZZ Libro
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der Text des E-Books folgt der gedruckten 1. Auflage 2021 (ISBN 978-3-907291-54-2) © 2021 NZZ Libro, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel
Lektorat: Ulrike Ebenritter, Giessen
Umschlaggestaltung: icona basel
Gestaltung, Satz Inhalt: Claudia Wild, Konstanz
Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werks oder von Teilen dieses Werks ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechts.
ISBN Print 978-3-907291-54-2
ISBN E-Book 978-3-907291-55-9
www.nzz-libro.ch
NZZ Libro ist ein Imprint der Schwabe Verlagsgruppe AG.
Inhalt
Frank Rühli / Andreas ThierDer Schweizer Umgang mit der Corona-Pandemie
Kultur und Gesellschaft
Konrad SchmidReligion und Werte
Heiko HausendorfKommunikation mit und durch Sprache
Marianne HochuliDie Schweiz nach der Pandemie – die Perspektive einer Nichtregierungsorganisation
Janine DahindenGenderaspekte: verschärfte Ungleichheiten
Laurence Kaufmann / Marine Kneubühler / Fabienne MalboisDas Soziale im Angesicht der Pandemie
Samia Hurst-MajnoEthik
Jeanne Devos / Egbert ThollKultur (Sprechtheater)
Numa Bischof UllmannReflexionen aus der Sicht des Intendanten eines Sinfonieorchesters
Volker ReinhardtPest 1348, Corona 2021 – ein historischer Vergleich
Lilo LätzschDigitaler Fortschritt und persönliche Beziehungen – die Schule von morgen braucht beides
Staat und Regierungshandeln
Felix UhlmannNotrecht
Eva Maria BelserExistierte die Schweiz während der Pandemie? Die Eigenheiten der Schweiz und ihre Eignung für den Krisenfall
Julia HänniRechtskultur
Roger de WeckDie Durcheinanderschweiz – starke Demokratie, schwache Öffentlichkeit? Am Beispiel von Corona und Europa: Wie die allgemeine Inkohärenz der nationalen Kohäsion dient
Matthias OeschSchweiz und Europa
Dölf BiasottoKantonale Regierungsarbeit – ein Corona-Praxisbericht aus Appenzell Ausserrhoden
Karin Kayser-FrutschiInnere Sicherheit in der Zeit der Covid-19-Pandemie
Aldo C. SchellenbergSicherheitspolitischer Handlungsbedarf bei der Bewältigung von Katastrophen und Notlagen
Michael Köpfli / Ahmet KutGrünliberale Partei Schweiz
Rebekka WylerPolitische und organisatorische Herausforderungen: die SP in der Coronakrise
Peter KellerCorona macht die gesellschaftliche Spaltung noch sichtbarer
Gesundheitswesen und Medizin
Andreas FallerDas Gesundheitswesen
Beatrix Frey-EigenmannSpitäler und Pflegezentren
Matthias EggerWissenschaft und Forschung
Abraham Bernstein / Florent ThouveninPandemie als Informationskrise: Wege aus dem «Data-Lockdown»
Wirtschaftliche Dynamiken
Daniel KaltKonjunktur
Regine SauterHandel im Spiegel der Pandemie
Alexander WagnerCovid-19 und Finanzmärkte
Hans-Ulrich BiglerDie Perspektive der KMU: Führungsmängel in der Pandemiebekämpfung
Marcel SennhauserChemie, Pharma, Lifesciences – forschende Industrien als Chance für die Menschheit
Patrick RaaflaubRisikovorsorge und Risikodialog
Thomas PorchetEnergiewirtschaft
Ulrich WeidmannVerkehr
Ludovica MoloDas Territorium nach Covid – neue Formen des Zusammenlebens
Jörg ArnoldDer Tourismus in der Schweiz nach der Pandemie
Katrin SchneebergerWar die Pandemie für die Umwelt gut oder schlecht?
Bilanz und Ausblick
Frank Rühli / Andreas ThierBilanz und Ausblick – Befunde, Erkenntnisse, Perspektiven
Autorinnen und Autoren
Frank Rühli / Andreas Thier
Der Schweizer Umgang mit der Corona-Pandemie
Die Covid-19-Pandemie hat die Welt an Abgründe geführt. Sie hat das tägliche Leben von uns allen erfasst, sie ist von Anfang an ein globales Phänomen gewesen und sie hat zu Einschränkungen von Freiheit geführt, die in ihrer weltweiten Verbreitung beispiellos zu sein scheinen.
Auch für die Schweiz bedeutete die Covid-19-Krise eine Herausforderung in einem enormen Ausmass. Das gilt umso mehr, als sie seit der Spanischen Grippe 1918–1920, anders als etwa die von SARS betroffenen südostasiatischen Regionen, keiner Epidemie ausgesetzt gewesen war.1 Jetzt, im Sommer 2021, ist es noch zu früh für eine Antwort auf die Frage, ob diese Situation sich beim Umgang mit der gegenwärtigen Pandemie ausgewirkt hat. Zudem sind die Ursprünge und die initialen Dynamiken von Covid-19 derzeit ungeklärt.2
Dagegen scheint uns der Zeitpunkt gekommen zu sein, um im Rückblick auf die Geschehnisse seit 2020 danach zu fragen, wie, mit welchen Strategien und Vorgehensweisen, zukünftig Krisen wie der Covid-19-Pandemie am besten begegnet werden sollte. Dabei haben wir den Blick von vornherein und sehr bewusst auf die Schweiz gerichtet. Sie zeichnet sich durch ein gerade für Pandemien sehr spezielles Setting aus: Das Territorium ist überschaubar, zugleich aber auch physisch mit den Territorien der Nachbarländer verzahnt. Dem entspricht die enorme Abhängigkeit der Wirtschaft von den benachbarten nationalen Märkten. Im Blick auf die Schweiz zeigen sich aber auch sehr plastisch die Vor- und Nachteile grossen nationalen wie individuellen Wohlstands und der selbst auferlegten Pflicht zur perfekten – wenn auch nicht immer schnellsten – Lösung. Hinzu treten eine stark föderalistische Herrschaftsordnung und eine basisdemokratisch ausgerichtete Legitimations- und Entscheidungskultur. Diese Rahmenbedingungen sind natürlich sehr gut bekannt. Naturgemäss nicht klar war und ist dagegen, wie die Schweiz auf die Krise reagierte, was die Krise in der Schweiz bewirkte und – vor allem – welche Befunde und Schlussfolgerungen sich für die Zukunft aus der Retrospektive ergeben.
Damit ist das zentrale Anliegen dieses Buchs beschrieben. Es soll versuchen, die Beobachtungen, Deutungen und Bewertungen aus einem möglichst breiten Spektrum von Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur zu erfassen. Das ist kein Selbstzweck, auch wenn die Beiträge dieses Bands sicherlich auch wertvolle Quellen künftiger zeitgeschichtlicher Analysen sein können. Wesentlich war für uns die Zielsetzung, als – soweit ersichtlich – schweizerischer Primeur in der Krise gewonnenes Erfahrungswissen zu bündeln und so einen kleinen Beitrag zur notwendigen Debatte über die bisherige und künftige Krisenresilienz zu leisten. Dabei musste die Auswahl der angesprochenen Themen begrenzt bleiben. Zudem geht es nicht um Schuldzuweisungen oder gar persönliche Kritik. Entscheidend ist vielmehr, welche Konsequenzen aus den bisherigen Erfahrungen mit dem Pandemiegeschehen in der Schweiz gezogen werden sollten. Die Beiträgerinnen und Beiträger dieses Bands waren deswegen gebeten, drei Fragen in der Form eines kurzen Essays zu beantworten:
•Wie hat die Covid-19-Krise die Schweiz generell verändert?
•Was sind konkrete Beispiele von mittel- und langfristig zu erwartenden Anpassungen in Ihrem gesellschaftlichen Bereich?
•Was ist die Rolle Ihres Bereichs für eine zukünftige verstärkte nationale Krisenresilienz?
Wir sind sehr dankbar, dass eine Vielzahl von Autorinnen und Autoren bereit gewesen ist, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. So sind die Beiträge dieses Buchs entstanden. Es sind Einschätzungen, die aus der Perspektive der Wissenschaft abgegeben worden sind, die aber auch vielfach die Sichtweisen von Branchen und Institutionen spiegeln und die manchmal auch anekdotisches Erfahrungswissen einfliessen lassen. In ihrer Vielfalt bieten diese Beiträge Diskussionsgrundlagen und Referenzpunkte für die weitere Auseinandersetzung mit der Covid-19-Pandemie in der Schweiz.
Anmerkungen
1Staub, Kaspar et al.: «The ‹Pandemic Gap›» in Switzerland across the 20thCentury and the Necessity of Increased Science Communication of Past Pandemic Experiences, in:Swiss Medical Weekly(2020). https://smw.ch/op-eds/post/the-pandemic-gap (Zugriff: 24.8.2021).
2Vgl. dazu Rühli, Frank et al.: «Do not call it COVID-19, it might have been the second wave», in:Medical Hypotheses144 (2020). https://doi.org/10.1016/j.mehy.2020.110285.
Kultur und Gesellschaft
Konrad Schmid
Religion und Werte
I. Die Schweiz in der Covid-19-Krise: Rückkehr zu Grunderfahrungen
Die Schweiz gehört zu den sichersten und wohlhabendsten Ländern der Welt. Für ihre Einwohnerinnen und Einwohner machte der Ausbruch von Covid-19 eine seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gekannte individuelle und kollektive Vulnerabilität sichtbar: Die Hilflosigkeit gegenüber der Krankheit und deren für viele Betroffene dramatischen Folgen, das anfängliche Fehlen einer medizinischen Prävention und eines Heilmittels sowie die gesellschaftlichen Einschränkungen aufgrund von Shutdowns (eigentliche «Lockdowns» kannte die Schweiz bislang nicht) haben die Menschen auf die Grunderfahrung zurückgeworfen, dass sie Teil, nicht Lenker ihrer Welt sind. Die Schweiz wurde damit zurückgeholt in eine Erfahrungswelt, an die sie sich kaum mehr erinnern konnte: Der kollektive, nicht nur der individuelle Gesundheitszustand ist fragil, das persönliche und soziale Leben ist brüchig und langfristige Planungen sind kaum möglich.
Was früheren Generationen selbstverständlich war, hat sich dem gegenwärtigen Bewusstsein unmittelbar und schmerzhaft wieder aufgedrängt: Unsere Lebenswelt ist nicht nur Verfügungsmaterial, zu schützende Natur oder sozialer Begegnungsraum, sondern sie hat auch unberechenbare, gefährliche Seiten. Dass sich dieses Bewusstsein wieder eine Stimme verschaffen konnte, hängt im Fall von Covid-19 auch damit zusammen, dass die moderne Schweiz Teil einer globalisierten Welt ist, mit der sie auf vielfache Weise vernetzt ist – besonders durch Handel, Wirtschaft und Tourismus. Die Covid-19-Krise ist zwar von aussen auf die Schweiz zugekommen, aber eine Schweiz ohne internationalen Kontext gibt es heute nicht mehr.
Doch nicht nur Not, sondern auch Solidarität hat die Schweiz in der Covid-19-Krise geprägt: Durch die Erfahrung der Pandemie sind grundlegende Verpflichtungen zwischenmenschlicher und ethischer Art wachgerufen worden, die nicht nur, aber auch der längerfristigen religiösen und kulturellen Tradition der Schweiz entstammen: In Notsituationen, in denen Hilfeleistungen nur beschränkt möglich sind, gilt der Schutz, den die Gemeinschaft erbringen kann, zunächst ihren schwächsten Mitgliedern und denen, die sich um diese kümmern. Natürlich ergeben sich auch hier schwierige Abgrenzungsfragen im Einzelnen, doch niemand hat sich dafür eingesetzt, in der Krise zunächst für die mächtigen, starken und wichtigen Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Militär oder welchen gesellschaftlichen Zusammenhängen auch immer zu sorgen. Ein Blick nur schon in die jüngere Geschichte zeigt, dass diese Option keineswegs immer und überall als absurd empfunden worden wäre – in der Schweiz wie auch in vielen anderen Ländern musste man hierüber nicht diskutieren.
Schliesslich hat sich gezeigt, dass das von der Schweiz erträumte, aber auch oft gelebte Modell einer Insel der Glückseligen in einer minderprivilegierten Umgebung weder realistisch noch nachhaltig ist. Die modernen Herausforderungen machen vor den Landesgrenzen nicht halt. Aber auch im Innern zeigt sich, dass man mit einem unkoordinierten Vorgehen von Gemeinden und Kantonen einer Krise wie der Covid-19-Pandemie nicht wirkungsvoll begegnen kann. Isolationismus – auf welcher Ebene auch immer – ist in modernen Problemlagen nicht möglich.
Will man diese Veränderungen schlagwortartig zusammenfassen, so lässt sich festhalten: Die Covid-19-Krise hat die Schweiz schmerzhaft daran erinnert, dass menschliches Leben verletzlich ist und bleibt, dass bestimmte Herausforderungen grösser sind als die ihnen entgegengestellten «Lösungen» und dass man einer Krise wie dieser Pandemie nur in gemeinsamen, koordinierten Anstrengungen begegnen kann. Die Herausforderungen im Zusammenhang mit Covid-19 haben die Schweiz aber auch an ihre solidarischen und humanitären Wurzeln erinnert, deren sachlicher Gehalt zumindest im innenpolitischen Bereich fraglos von allen beteiligten politischen Akteurinnen und Akteuren respektiert worden ist. Das Wahrnehmen internationaler Verantwortung durch die Schweiz ist demgegenüber limitiert geblieben: Die Impfstoffverteilung an ärmere Länder war kein vorrangiges Thema, das Agieren in der gleichzeitig sich abspielenden, nach wie vor dramatischen Flüchtlingskrise in der Ägäis blieb konturlos – um nur zwei Beispiele zu nennen.
II. Religion in der Krise und Religion im Wandel
In Zeiten der Pandemie war die Religion – konkret: die Kirchen und die Religionsgemeinschaften, aber auch die Theologie – auf verschiedenen Ebenen gefragt. Religion umfasst kognitive, soziale und emotionale Dimensionen; in ihren unterschiedlichen Traditionen und Denominationen sind sie beständigen Entwicklungen unterworfen. Die Covid-19-Krise hat zu bestimmten Ausformungen und Akzentuierungen geführt, die für die Zukunft der geglaubten und gelebten Religion von Bedeutung sein werden.
In kognitiver Hinsicht leben alle Religionen nachgerade davon, dass menschliches Leben grundsätzlich stärker durch Unverfügbares als durch Verfügbares bestimmt wird: Der Zeitpunkt und der Ort der eigenen Geburt, die Zufälligkeit prägender Sozialkontakte, die Unvorhersehbarkeit des eigenen Lebens – all dies lässt sich nicht kontrollieren oder steuern und bestimmt die Menschen doch grundlegend. Die Religionen halten mit ihren Traditionen Deutungsmöglichkeiten bereit, diese Unverfügbarkeiten in kultureller Vermittlung zu interpretieren und einzuordnen. Die Pandemie hat sich als eine Chance für sie gezeigt, diese grundsätzliche Dimension der Unverfügbarkeit des menschlichen Lebens hinter seinen konkreten Vollzügen jeweils deutlich herauszustellen – auch wenn diese Herausforderung de facto nicht immer hinreichend angenommen worden ist. Die gesamtgesellschaftliche Aufgabe der Religionsgemeinschaften besteht nicht darin, ihre eigenen Positionen zu propagieren, sondern darin, die «religious literacy» der Bevölkerung zu erhöhen. Sie dienen damit zum Beispiel der Prävention von Verschwörungstheorien, deren Verbreitung in der Covid-19-Pandemie etwa mit der Höhe der Impfbereitschaft umgekehrt proportional korreliert ist. Dass die religiösen Akteure in dieser Hinsicht natürliche Partner der Politik sind, liegt auf der Hand.
Was die soziale Dimension betrifft, so ist zweierlei zu bemerken. Einerseits erfuhren die Kirchen und Religionsgemeinschaften während der Pandemie eine bevorzugte Behandlung, da sie ihre Gottesdienste – mit bestimmten Obergrenzen – oft durchführen konnten, während dies für politische, kulturelle oder gesellschaftliche Anlässe in der Regel nicht möglich war. Die Kirchen und Religionsgemeinschaften leisteten mit ihren Anlässen einen wichtigen Beitrag zur sozialen Kohäsion in einer Zeit stark dezimierter persönlicher Begegnungen. Manche Kirchen wurden auch als Impfzentren zur Verfügung gestellt. Doch es zeigte sich auch, dass das von den Kirchen und Religionsgemeinschaften zumindest im ersten Lockdown geduldete einsame Sterben von Kranken – auch wenn deren Isolation medizinisch nachvollziehbar war – kein Konzept für die Zukunft sein kann. Die Kirchen und Religionsgemeinschaften in der Schweiz, aber auch in Europa haben sich in diesem Punkt vielleicht zu konziliant gegenüber den übergeordneten, restriktiven Bestimmungen gezeigt. So hat sich im Lauf der Pandemie das Bewusstsein ausgeformt, dass an dieser Stelle Justierungsbedarf besteht: Niemand soll allein sterben müssen. Das Sterben, dieser Prozess des Aus-dem-Leben-Scheidens, gehört elementar zum Leben hinzu. Die Begleitung dieses Vorgangs kann nicht Opfer von medizinischen Hygienevorschriften werden. Die «Letzte Hilfe» ist eine Pflicht am Nächsten, für deren Erhalt die Kirchen und Religionsgemeinschaften Verantwortung übernehmen müssen.
In emotionaler Perspektive können die Kirchen und Religionsgemeinschaften einen institutionellen Raum bieten, in dem sich neben den wirtschaftlichen und sozialen Einschränkungen, die eine Pandemie mit sich bringt, auch die seelischen Entbehrungen von Menschen in Notlagen thematisieren lassen. Dies kann öffentlich in Gottesdiensten oder auch nicht öffentlich in persönlicher Seelsorge geschehen. Wichtig ist jedenfalls, dass diesen Dimensionen menschlichen Lebens entsprechende Räume zu ihrer Darstellung und Thematisierung gegeben werden. Sowohl öffentliche Veranstaltungen wie auch seelsorgerliche Kontakte sind unter Wahrung von Distanzmassnahmen möglich – etwa über soziale Medien, Telefon oder andere Kommunikationsmöglichkeiten. Die menschliche Ultrasozialität kann nicht über längere Zeiträume hinweg eingeschränkt werden, ohne dass dies mit einer Schädigung der emotionalen Stabilität der Menschen einherginge. Die Kirchen und Religionsgemeinschaften tragen eine institutionelle Verantwortung, diesen Gefahren kreativ, wirkungsvoll und nachhaltig zu begegnen. Die nicht zu unterschätzenden digitalen Kompetenzen der älteren Generationen sind weiter zu fördern. Die Gedenkminute am 5.März 2021 für die bis damals zu beklagenden 9300 Opfer der Pandemie zeigte, dass das gesamtgesellschaftliche Engagement von Kirchen und Religionsgemeinschaften von der Öffentlichkeit geschätzt und gefordert und auch von der Politik getragen wird.
III. Die Kirchen und Religionsgemeinschaften in künftigen Krisen
Die Kirchen und Religionsgemeinschaften, aber auch die wissenschaftliche Theologie haben zunächst deutlich zu machen, dass kommenden Krisen – besonders wenn sie globales Ausmass haben oder von einer persönlichen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen Dramatik wie diejenige der Covid-19-Pandemie sind – mit dem vielleicht trivial wirkenden, aber elementaren und doch oft vernachlässigten Grundgedanken begegnet werden muss, dass der Mensch selbst im Anthropozän einem grösseren Ganzen gegenübersteht, das er nicht vollständig, ja nicht einmal zur Hauptsache kontrollieren kann. Der Homo faber vermag vieles zu tun, aber nicht alles. Die Religion kann als Resonanzraum für umfassende Fragen nach der Stellung des Menschen gegenüber dem Unverfügbaren dienen – als gute Religion lässt sie diese Fragen zu, analysiert sie und versucht sie zu verstehen und einzuordnen, aber sie wartet nicht mit vorschnellen Antworten auf. Für viele umfassende Fragen im Bereich der Religion gilt, dass sie, da sie das Unverfügbare betreffen, eher mit Nachdenklichkeit anzugehen sind als in der Erwartung, dass für sie adäquate Problemlösungsstrategien zu generieren sind. Mit dem Fokus auf Nachdenklichkeit leisten die Kirchen und Religionsgemeinschaften einen wichtigen Beitrag zu einer entwickelten intellektuellen Kultur der Schweiz.
Doch den Kirchen und Religionsgemeinschaften kommen in künftigen Krisen auch praktische Aufgaben zu. Ihre Botschaft kann weder der politische Aktivismus («aufgrund unseres Glaubens fordern wir von der Politik dieses oder jenes») noch der politische Quietismus sein («die Krise ist grösser als wir und wir können nichts gegen sie ausrichten»). Vielmehr haben sie sich für eine umfassende, respektvolle und angemessene Diskussionskultur einzusetzen und für mehr private und öffentliche Gelassenheit und Toleranz im Umgang mit den entstandenen Problemen und gescheiterten Lösungsversuchen zu sorgen. In der Covid-19-Pandemie befand sich die Schweiz oft im Blindflug – es fehlten die nötigen Daten und Erkenntnisse, um richtig handeln zu können. In den Medien, in der Politik und in der Öffentlichkeit ergab sich mitunter die eigenartige Situation, dass die Handlungsträger aufgrund von Wissensbeständen beurteilt wurden, die zum Zeitpunkt einer Entscheidung noch gar nicht vorlagen. Besonders unter solchen Bedingungen ist eine gewisse gegenseitige Fehlertoleranz nötig. Um die fundamentalen Voraussetzungen einer gesunden geistigen Atmosphäre – um einen kultivierten Diskussionston, um sachliche Argumentationen – sollen, können und müssen die Religionsgemeinschaften im öffentlichen Diskurs bemüht sein. Gegen aussen und innen werden sie aus den Traditionen schöpfen, die ihre Angehörigen über Jahrhunderte hinweg entwickelt, gehört und diskutiert haben. Manche dieser Gedanken wurden oft als hilfreich empfunden, andere nicht – dies ergibt sich aus den jeweiligen Problemlagen, Auslegungsprozessen und Anwendungsfragen.
Auch in sehr konkreten Fragen können die Kirchen und Religionsgemeinschaften in der Zukunft zu Krisenresilienz beitragen: Wenn künftige Krisen – dem Wesen ihrer Definition entsprechend – mit der Bedrohung menschlichen Lebens, ja mit Sterben und Tod zusammenhängen werden, so sind die Kirchen und Religionsgemeinschaften gefragt, ihre ureigene Kompetenz auf diesem Gebiet in die Diskussion mit einzubringen. Die Gesellschaft hat nicht nur die Aufgabe, medizinisch auf epidemische oder pandemische Problemlagen zu reagieren, sondern die dafür kompetenten und zuständigen Institutionen haben auch eine klare Vorstellung dazu zu entwickeln, wie sie mit der existenziellen Bedrohung und dem Ende menschlichen Lebens in einer Krise in persönlicher und sozialer Verantwortung umgehen wollen. Sollte sich für die Behandlung medizinischer Notfälle die Notwendigkeit von Triagen ergeben, so ist es zu spät, erst zu diesem Zeitpunkt darüber nachzudenken, wie diese gehandhabt werden sollen und auf welchen grundsätzlichen Überlegungen diesbezügliche Entscheidungen beruhen sollen.
Die Covid-19-Krise hat den Kirchen und Religionsgemeinschaften – wie dies in anderen Bereichen der Gesellschaft auch der Fall war – einen enormen Digitalisierungsschub verliehen. Die digitalen Kompetenzen haben sowohl auf der Anbieter- wie auch der Abnehmerseite stark zugenommen. Doch wenn eines deutlich geworden ist in der Pandemie, dann dies: Persönliche Begegnungen lassen sich auf Dauer nicht durch digitale Angebote ersetzen. Der Mensch ist ein ultrasoziales Wesen, und alles, was die Ausübung dieser Sozialität behindert, setzt seine persönliche Integrität aufs Spiel.
Ausgewählte Literatur
Bedford-Strohm, Heinrich (2021): «Wo ist Gott in der Pandemie? Theologische Überlegungen aus Praxis und Reflexion kirchenleitenden Handelns», in:Evangelische Theologie,81, S.87–100.
Springhart, Heike (2021): «Gottesdienstliches digitales Neuland in Zeiten der Pandemie. Ein Erfahrungsbericht in theologischer Absicht», in:Evangelische Theologie,81, S.124–135.
Striet, Magnus (2021):Theologie im Zeichen der Corona-Pandemie. Ein Essay, Grünewald: Ostfildern.
Yendell, Alexander; Hidalgo, Oliver; Hillenbrand, Carolin (Hg.):Die Rolle von religiösen Akteuren in der COVID-19-Pandemie. Eine theoriegeleitete empirische Analyse mit politischen Handlungsempfehlungen, Institut für Auslandsbeziehungen: Stuttgart 2021. https://doi.org/10.17901/akbp1.09.2021
Heiko Hausendorf
Kommunikation mit und durch Sprache*
I. Covid-19 und Kommunikation mit und durch Sprache
Seit Beginn der Pandemie sind die Zeitungen, die Talkshows und die Plattformen im Internet voll von Kommentaren, Stellungnahmen und Diagnosen zu der Frage, ob und wie die Covid-19-Krise die Gesellschaft verändert, verändern wird oder schon verändert hat. Auch nach mehr als einem Jahr sind die Versuche der Zeitgenossen und -genossinnen nicht abgerissen, reflektierend zu begleiten, was wir seither alltäglich erleben – wiewohl man wissen kann, dass es dazu eines Abstands bedürfte, den im Moment noch niemand beanspruchen kann. Auch der vorliegende Beitrag ist deshalb mit der Einschränkung versehen, dass es (viel) zu früh ist, um die mittel- und langfristigen Folgen der Pandemie für die Gesellschaft (innerhalb und ausserhalb der Schweiz) verlässlich darzulegen. Für einen sehr begrenzten Bereich – die Kommunikation mit und durch Sprache – soll gleichwohl der Versuch gemacht werden, die Relevanz etwas näher zu bestimmen, die den mit der Pandemie einhergehenden Veränderungen zukommen könnte. So spricht viel dafür, dass die Pandemie mit ihrer weitreichenden Problematisierung der Face-to-face-Interaktion zu einer Hybridisierung von Kommunikation beigetragen hat, die insbesondere die Bedingung der Kopräsenz (Goffman 1963) und damit das Sprechen und Zuhören unter Anwesenden betrifft. Wenn es längerfristige Folgen der Pandemie für Sprache als Kommunikationsmedium geben sollte, dürften sie in diesem Kontext zu finden sein.
*Der vorliegende Beitrag ist durch den Universitären Forschungsschwerpunkt Sprache und Raum der Universität Zürich (UFSP SpuR: www.spur.uzh.ch, Zugriff: 27.7.2021) unterstützt worden. Aus dem UFSP ist u. a. das SNF-Projekt «Interaktion und Architektur» (IntAkt: www.ds.uzh.ch/de/projekte/intakt, Zugriff: 27.7.2021) hervorgegangen, innerhalb dessen wir seit dem FS 2020 die Auswirkungen der Pandemie auf den Lehrbetrieb (den Übergang von Kontakt- zu Fernlehre) dokumentiert und analysiert haben. Mein Dank geht an Kenan Hochuli, Johanna Jud und Alexandra Zoller für zahlreiche Diskussionen, Anregungen und gemeinsame Datensitzungen und an Andi Gredig vom Deutschen Seminar für eine Reihe von Anmerkungen zu einer ersten Version des Beitrags.
II. Anwesenheit versus Erreichbarkeit
Ohne dass es als Versuchsanordnung irgendwo festgelegt worden wäre, ist seit März 2020 auch in der Schweiz ein einzigartiges soziales Grossexperiment angelaufen. Es besteht in der weitreichenden Einschränkung von Interaktion, die als eine auf Kopräsenz (bzw. Anwesenheit) beruhende Sozialform (Hausendorf 2020) auf einen Schlag (und zu Recht!) unter den Generalverdacht der Pandemieverbreitung geraten ist. Dabei wird die Interaktion vielleicht nicht zufällig an ihren Extremen besonders hart getroffen: Mit der Einschränkung der Versammlungsfreiheit wird einerseits die Versammlungsöffentlichkeit der Interaktion in Grossgruppen («Massen») unterbunden. Mit dem allgegenwärtigen Abstandsgebot wird andererseits nicht nur die Reichweite der Kommunikationsorgane strapaziert, sondern es werden insbesondere die Intimität und die Exklusivität der Interaktionsdyade empfindlich beeinträchtigt. Das Sozialleben moderner Gesellschaften kommt mit diesen Einschränkungen aber keineswegs zum Erliegen. Die modernen Teilsysteme unserer Gesellschaft setzen schon längst nicht mehr exklusiv und dominant auf Anwesenheit, sondern operieren unter der Bedingung von Erreichbarkeit: Sie können sich darauf verlassen, dass mehr oder weniger weltweit gesendet und empfangen, gelesen und geschrieben werden kann (Luhmann 2014). Mit dem Schreiben und Lesen von Nachrichten und Mitteilungen in mobilen und fast jederzeit und überall verfügbaren elektronischen Umgebungen ist Erreichbarkeit in Form von Lesbarkeit (Hausendorf et al. 2017) auch schon vor dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie zu einer viel kommentierten Alltagserscheinung geworden. Die Pandemie hat die auf Erreichbarkeit basierenden Formen der Kommunikation noch einmal mächtig angekurbelt und intensiviert, weil durch sie Interaktion unter Anwesenden unter Infektionsverdacht geraten ist.
Dabei tritt ein bestimmter Typus hybrider Kommunikation besonders dominant in Erscheinung. Er existiert nicht erst seit der Covid-19-Pandemie, aber er verbreitet sich ähnlich rasant wie das Virus selbst und beruht auf einer Kreuzung der Merkmale von Anwesenheit und Erreichbarkeit. Schon Anwesenheit ist nicht einfach eine physi(kali)sche Gegebenheit, sondern eine kommunikative Konstruktion, die darauf beruht, dass man wahrnehmen kann, dass man wahrgenommen wird (Goffman 1963). Wie genau diese Wahrnehmungswahrnehmung im konkreten Einzelfall bewerkstelligt wird, ist dann schon eine empirische Frage. Zwei Leute im gleichen Zimmer, die einander zum Beispiel aufgrund einer Trennscheibe nur einseitig wahrnehmen können, sind also im hier angesetzten Sinn nicht wechselseitig «anwesend», zwei Leute, die über ein Telefon sicherstellen können, dass sie sich gegenseitig hören können, aber sehr wohl (auch wenn zwischen ihnen der Atlantik liegen mag). Wenn man folglich das Telefongespräch als Fall von anwesenheitsbasierter Interaktion verortet, wird man gleichwohl darauf bestehen wollen, dass in diesem Fall auch Erreichbarkeit im Spiel ist: Ich muss den anderen ja offenkundig auch erreichen können, bevor ich ihn wahrnehmen kann. Um das gebührend in Rechnung zu stellen, bietet sich die in der Systemtheorie verbreitete Figur des «re-entry» an (Luhmann 2002). Sie besteht abstrakt gesagt darin, eine Unterscheidung auf der einen Seite derselben Unterscheidung noch einmal ein- und durchzuführen, das heisst «wiedereintreten» zu lassen:
Abbildung 1:Anwesenheit vs. Erreichbarkeit als Ausgangspunkt hybrider Kommunikation
Wir können (und müssen) dann im Bereich der anwesenheitsbasierten Kommunikation den weiteren Fall unterscheiden, dass Anwesenheit auf Erreichbarkeit beruht, die Wahrnehmungswahrnehmung also medial hergestellt wird. Damit haben wir einen Spezialfall hybrider Kommunikation («Telekopräsenz» im Sinn von Zhao 2003). Am Fall des Telefonierens kann man sich gut klarmachen, was dabei passiert: Die Interaktion wird anfälliger, weil sie sich nicht mehr auf die «Bordmittel» der beteiligten Körper verlassen kann, sondern auf Medientechnologien (z. B. in Form der Übertragung, der Sendung und des Empfangs elektrischer Signale) und -institutionen (z. B. eine Art Fernmeldewesen) angewiesen ist. Aber sie bleibt doch unzweifelhaft Interaktion. In genau diesem Sinn haben wir es mit einer «Kreuzung» zweier sonst unterscheidbarer Merkmale bzw. mit dem Wiedereintritt einer Unterscheidung auf der einen Seite der Unterscheidung zu tun. Eben dieser Typus hybrider Kommunikation, der auf Telekopräsenz beruht, hat sich seit dem Ausbruch der Pandemie rasant verbreitet. Man denke dazu an all die neuen, inzwischen schon längst routinisiert verwendeten Softwaretools für Meetings und Videokonferenzen. So ist Zoom bereits zur Bezeichnung für einen neuen Typus von Kommunikation geworden (vom Marken- zum Gattungsnamen), und unter dem Stichwort «zoom fatigue» werden bereits erste Begleiterscheinungen dieser Kommunikation medienwirksam kritisch diskutiert.
III. Telekopräsenz als hybride Kommunikationsbedingung
Ihre erste Welle der Verbreitung hat Telekopräsenz mit der Allgegenwart des Telefons erlebt, die zweite Verbreitungswelle ist seit Ausbruch der Pandemie mit der Nutzung des Internets und mobiler Endgeräte für Video- bzw. Bildtelefonie angelaufen. Zwar ist die dafür notwendige Technologie schon sehr viel älter, aber in ihrer gesellschaftlichen Relevanz ist sie gleichwohl ein noch junges Phänomen: «In 2020, video conferencing went from a novelty to a necessity, and usage skyrocketed due to shelter-in-place throughout the world» (Fauville et al. 2021). Viele der mit dieser Verbreitungswelle einhergehenden Tipps aus der Ratgeberliteratur leben von der Hypostasierung eines Ur- und Reinzustands «natürlicher» Kommunikation. So wird zum Beispiel immer wieder moniert, dass die Wahrnehmung eingeschränkt und eingeengt, Blickkontakt nicht möglich und der Sprecherwechsel erschwert sei (vgl. z. B. Benini 2021).
Das alles ist nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Auch im Gespräch unter unmittelbar Anwesenden ist beispielsweise nicht alles automatisch in der kommunikativen Zone, was für die Beteiligten sinnlich wahrnehmbar sein mag, sondern es wird nur ein kleiner Ausschnitt in seiner Wahrnehmbarkeit systematisch wahrnehmbar gemacht (Hausendorf 2003); der Blickkontakt ist seit je sehr viel stärker regelbasiert, als uns das bewusst ist (Brône und Oben 2018). Und das, was wir über den Sprecherwechsel aus der Konversationsanalyse wissen (Sacks et al. 1974), stammt originär aus der Beschäftigung und Konfrontation mit Telefongesprächen! Vieles von dem, was jetzt als «künstlich», «belastend» oder «erschwerend» mit Blick auf das «Zoomen» ins Feld geführt wird, ist also nichts Neues. Die auf Anwesenheit beruhende Interaktion war nie ein Wohlfühlsetting, sondern schon immer ein durch und durch strukturiertes, regel- und gesetzmässig ablaufendes Geschehen, das an die Beteiligten systematische Anforderungen stellt, darunter auch eine nicht zu unterschätzende Körperdisziplin. Man musste, vereinfacht gesagt, schon immer zeigen, dass man auch anwesend ist. Weil das so ist, ist Interaktion wandel- und entwickelbar, das heisst mit dem Entstehen neuartiger Technologien auch über den Kreis des Hier und Jetzt ausdehnbar, und überhaupt sehr robust und anpassungsfähig an interaktionsfeindliche Umwelten, in denen zum Beispiel die menschliche Sinneswahrnehmung massiv eingeschränkt ist. So ist Interaktion bekanntlich auch unter Anwesenden möglich, die weder hören noch sehen können (aber dafür womöglich ganz andere Sensorien für die Interaktion zugänglich machen können). Anwesenheit ist also eine Konstruktion und als solche auch und gerade sprachlicher Natur. Auf Plattformen wie Zoom oder Teams wird sie deshalb nicht nur technisch hergestellt, sondern im Krisenfall unsicherer Wahrnehmung(swahrnehmung) auch sprachlich sichergestellt («Kann man mich hören?»).
Im Übrigen ergeben sich auf diesen Plattformen nicht nur Be- und Einschränkungen für Interaktion (zu denen das «Blickkontaktdilemma» gehört, vgl. Held 2019), sondern auch neue Ressourcen, die auf Sichtbarkeit beruhen. Zum Beispiel rücken die Gesichter näher und es wird möglich, das Schreiben und Lesen von Mitteilungen systematisch einzubeziehen. Damit wird nicht nur ein weiteres Tool neben anderen ausgenutzt, sondern Lesbarkeit mit Telekopräsenz verknüpft. Ein weiterer Effekt von Telekopräsenz ist das Auseinanderfallen der Räume, in denen sich die Beteiligten jeweils befinden. Allerdings ist schon in der auf Kopräsenz beruhenden Interaktion der Raum als geteilter Raum nicht einfach gegeben, sondern muss in dem, was für die Interaktion gerade relevant sein soll, von den Beteiligten «hergestellt» werden. Mit dem Übergang von Kopräsenz zu Telekopräsenz verändern und verlagern sich also nur die Möglichkeiten der Herstellung des Interaktionsraums: Verkörperte Motorik und Sensorik wird durch Kameras und Mikrofone nicht nur begrenzt, sondern auch ergänzt. An die Stelle gebauter und möblierter «Interaktionsarchitektur(en)» (Hausendorf und Schmitt 2016), die eine wirkmächtige Ressource der Interaktion darstellen, treten die «affordances» (Gibson 1977) der Videokonferenzplattformen. Damit ragen zum Beispiel Aspekte von (auch und gerade privater) Räumlichkeit (im Sinn des «Wohnens» und des «Zuhauses») in die kommunikative Zone, womit sie nolens volens zum geteilten Interaktionsraum dazugehören (können). Viel spricht dafür, dass wir hier erst und noch am Anfang einer Entwicklung stehen, die das eigene Wohnen mehr und mehr zum «natürlichen Zuhause» (Goffman 1964) von Telekopräsenz umgestalten wird (Smart Home), sodass wir, um telekopräsent zu sein, beispielsweise nicht länger darauf angewiesen sein werden, ein Endgerät mit Internetzugang auf- und anzustellen.
Bis es so weit ist, werden wir wohl noch eine Weile damit leben müssen, uns wechselseitig darauf hinzuweisen, dass das Mikrofon nicht angeschaltet, das Kamerabild eingefroren oder die Stimme zu leise ist. Fast keine der vielen telekopräsent abgehaltenen Treffen und Sitzungen der letzten Monate dürfte entsprechend ohne situationsreflexives sprachliches Krisenmanagement ausgekommen sein. Aber klar ist auch, dass wir es hier mit Übergangsphänomenen zu tun haben, wohingegen sich deutlich abzeichnet, dass die auf Telekopräsenz beruhende Kommunikation mit und durch Sprache so schnell nicht aus unserem Alltag verschwinden wird. Ob und wie das neben der Kommunikation und mit ihr auch die Sprache selbst verändern wird, ist im Moment noch nicht abzusehen, muss uns aber auch nicht weiter kümmern: Die Sprache ist als Medium nicht weniger robust und anpassungsfähig als die Interaktion, in der sie ihr natürliches Zuhause hat.
Literatur
Benini, Sandro (2021): «Die grosse Meetingmüdigkeit», in:Tages-Anzeiger,10.3.2021, S.27.
Brône, Geert; Oben, Bert (Hg.):Eye-tracking in interaction. Studies on the role of eye gaze in dialogue,Benjamins: Amsterdam, Philadelphia 2018.
Fauville, Geraldine; Luo, Mufan; Queiroz, Anna C. M.; Bailenson, Jeremy N.; Hancock, Jeff (2021): «Zoom Exhaustion & Fatigue Scale», in:SSRN Journal. DOI: 10.2139/ssrn.3786329.
Gibson, James J. (1977): «The theory of affordances», in: Shaw, Robert; Bransford, John (Hg.):Perceiving, acting, and knowing. Toward an ecological psychology,Erlbaum: Hillsdale, N. J., New York, S.67–82.
Goffman, Erving (1963):Behavior in Public Places. Notes on the Social Organization of Gatherings,New York: Free Press.
Goffman, Erving (1964): «The Neglected Situation», in: Gumperz, John J.; Dell, Hymes (Hg.):The ethnography of communication,American Anthroplogist (6/2), American Anthropological Association: Menasha, S.133–136.
Hausendorf, Heiko (2003): Deixis and speech situation revisited. «The mechanism of perceived perception», in: Friedrich Lenz (Hg.):Deictic Conceptualisiation of Space, Time and Person,Benjamins: Amsterdam, Philadelphia, S.249–269.
Hausendorf, Heiko (2020): «Geht es auch ohne Interaktion?», in:Aptum. Zeitschrift für Sprachkritik und Sprachkultur,16/202 (2 und 3), S.196–199.
Hausendorf, Heiko; Kesselheim, Wolfgang; Kato, Hiloko; Breitholz, Martina (2017):Textkommunikation. Ein textlinguistischer Neuansatz zur Theorie und Empirie der Kommunikation mit und durch Schrift,de Gruyter: Berlin, New York.
Hausendorf, Heiko; Schmitt, Reinhold (2016): «Interaktionsarchitektur und Sozialtopographie. Basiskonzepte einer interaktionistischen Raumanalyse», in: Hausendorf, Heiko; Schmitt, Reinhold; Kesselheim, Wolfgang (Hg.):Interaktionsarchitektur, Sozialtopographie und Interaktionsraum,Narr: Tübingen, S.27–54.
Held, Tobias (2019): «Face to Face. Sozio-interaktive Potentiale der Videotelefonie», in:Journal für Medienlinguistik,2(2), S.157–194.
Luhmann, Niklas (2002):Die Wissenschaft der Gesellschaft,Wissenschaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt.
Luhmann, Niklas (2014): «Ebenen der Systembildung – Ebenendifferenzierung. (Unveröffentlichtes Manuskript 1975)», in:Zeitschrift für Soziologie,Sonderheft «Interaktion – Organisation – Gesellschaft revisited». Hg. von Bettina Heintz und Hartmann Tyrell, S.6–39.
Sacks, Harvey; Schegloff, Emanuel A.; Jefferson, Gail (1974): «A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation», in:Language,50 (4), S.696–735.
Zhao, Shanyang (2003): «Toward a Taxonomy of Copresence», in:Presence: Teleoperators & Virtual Environments,12 (5), S.445–455.
Marianne Hochuli
Die Schweiz nach der Pandemie – die Perspektive einer Nichtregierungsorganisation
I. Armut und prekäre Lebenssituationen werden sichtbar
Menschen stehen in Schlangen stundenlang für Essen an. Dieses Bild, das bis anhin mit ärmeren Ländern in Verbindung gebracht wurde, erschien nun auch in der reichen Schweiz. Es erschütterte die vielerorts herrschende Gewissheit, dass in der Schweiz mindestens die Notversorgung für alle garantiert sei. Ein Bild vermochte der breiten Öffentlichkeit vor Augen zu führen, dass auch wir in der Schweiz ein Armutsproblem haben. Eigentlich ist dies längst bekannt. Das Bundesamt für Statistik veröffentlicht seit über einem Jahrzehnt regelmässig Armutszahlen: 735 000Menschen lebten 2019 offiziell unter der Armutsgrenze, davon 115 000Kinder, und jede fünfte Person kann eine Rechnung von 2500 Franken nicht innerhalb eines Monats bezahlen.1 Das Bild mit den für Essen anstehenden Menschen zeigt also nur die Spitze des Eisbergs von prekären Lebenslagen, die nun immer deutlicher zutage treten. Die Coronakrise hat die Armut in der Schweiz sichtbar gemacht und weiter verschärft.
II. Nichtregierungsorganisationen nehmen zentrale Rolle in der Unterstützung wahr
Unmittelbar nach Beginn des ersten Lockdowns stiegen bei Hilfswerken die Anfragen um Informationen für finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten und konkrete Hilfegesuche sprunghaft an. Die Hilferufe waren auch dann nicht rückläufig, als der Bundesrat staatliche Unterstützungsmassnahmen ankündigte, die er laufend erweiterte. Auf den ersten Blick schien sich der Sozialstaat Schweiz zu bewähren und gab vielen Menschen Hoffnung, die Krise überstehen zu können. Die Gesuche bei den Hilfswerken zeigten jedoch bald, dass viele prekäre Alltagssituationen nicht mitbedacht wurden, oder etwas auf den Punkt gebracht: Die Menschen mit kleinem Einkommen und ungesicherten Arbeitsverhältnissen wurden ganz einfach vergessen.
Einen umso grösseren Stellenwert bekam darum die Corona-Hilfe von privaten Organisationen, die wiederum nur dank der grossen Solidarität und Spendenbereitschaft der Schweizer Bevölkerung durchgeführt werden konnte. Damit bauten die Organisationen in kürzester Zeit – oft in diversen Partnerschaften – Nothilfestrukturen vor Ort auf oder dehnten bereits vorhandene Beratungsangebote aus. Sie berieten und unterstützten die Hilfesuchenden persönlich, was umso notwendiger war, als vielerorts die Schalter bei den öffentlichen Anlaufstellen geschlossen und nur noch online zugänglich waren. Dies bereitete vielen grosse Mühe. Sie waren verzweifelt und wussten nicht, wohin sie sich wenden sollten. So agierten die privaten Organisationen noch mehr als sonst als Triagestellen und Scharnier zu den staatlichen Stellen. Je nach Kanton beteiligten sich allmählich auch der Kanton oder die Städte an der Finanzierung dieser sozialen Aktivitäten der Hilfswerke. Der Staat konnte in dieser Krise auf deren grosse Erfahrungen mit basisnaher Tätigkeit zählen.
III. Es klaffen Lücken im Sozialsystem
Das Hilfswerk Caritas führte seit dem Frühling 2020 schweizweit seine grösste Hilfsaktion für Armutsbetroffene durch. Seit über zwei Jahrzehnten mit der wachsenden strukturellen Armut in der Schweiz beschäftigt, genügte es ihm nicht, Hilfe vor Ort zu leisten. Er analysierte laufend seine Erfahrungen, um daraus sozialpolitische Erkenntnisse ziehen und an Politik und Öffentlichkeit gelangen zu können. Die private Corona-Hilfe wurde subsidiär geleistet, also nur an Personen, die keine staatliche Unterstützung in Anspruch nehmen konnten. Wer konnte denn nicht auf die staatlichen Corona-Massnahmen zählen? Aus welchen Gründen? Welche Lücken zeigten sich im Sozialsystem?
Der Grossteil der Menschen – viele Familien –, die Hilfe suchten, lebten bereits vor der Coronakrise in schwierigen finanziellen Verhältnissen. Sie zählen zu den Working Poor, die trotz Arbeit ihre Existenz nur mit Mühe bestreiten können. Oder sie arbeiten in tiefen Pensen, obwohl sie mehr arbeiten möchten. Hinter dieser Unterbeschäftigung, die mehr die Frauen betrifft, versteckt sich eine zunehmende Arbeitslosigkeit, die noch zu wenig wahrgenommen wird.2 Arbeitnehmende haben auch immer öfter Arbeit lediglich auf Abruf mit stark schwankenden Arbeitsstunden, und sie sind schlecht bezahlt. Die zuvor schon sehr prekären Arbeitsverhältnisse wirkten sich in der Coronakrise sofort aus und hatten akute finanzielle Probleme zur Folge. Angestellte wurden auf Kurzarbeit gesetzt oder verloren gar ihre Stelle. Die 80-Prozent-Entschädigung ihres bisherigen niedrigen Lohns reichte nicht mehr. Im Stundenlohn Angestellte erhielten weniger Arbeitseinsätze und Selbstständigen brachen die Aufträge weg. Viele verloren ihre kleinen Nebenverdienste, die geholfen hatten, sich über Wasser zu halten. Nun reichte das bereits vorher knappe Budget nicht mehr, um die Rechnungen bezahlen zu können.
Man hätte erwarten können, dass die Anmeldungen bei der Sozialhilfe explodieren würden. Dem war nicht so. Bis man sozialhilfefähig ist, braucht es viel. Oftmals ist ein zweijähriger Gang durch die Arbeitslosigkeit mit vermindertem Arbeitslosengeld nötig. Dies bedeutet nebst finanziellen Einbussen gerade für Menschen mit einem kleinen Bildungsrucksack vergebliche Stellensuchen mit immer neuen Absagen, wachsenden Zweifeln an sich selbst, eine immer grössere Existenzangst, an der auch die einem Nahestehenden leiden. Nie wurde deutlicher als in dieser Krise, dass die Sozialhilfe wirklich das letzte Sicherungsnetz ist. Eine schwerwiegende Versorgungslücke gibt es für alle, deren Einkommen knapp über der Grenze zur Sozialhilfe liegt. Viele Haushalte, die ihre Rechnungen für Miete, Krankenkassenprämien und Steuern kaum oder nicht mehr bezahlen können, benötigen ein Budget, das nicht zum Bezug von Sozialhilfe berechtigt. Der Bedarf eines Menschen im untersten Mittelstand liegt also noch einiges über der sehr tief definierten Armutsgrenze. Die Armutsgrenze richtet sich an den Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe SKOS aus und ist für viele Haushalte nachweislich zu tief und reicht nicht aus, um den grundlegenden Bedarf zu decken. Bestehen noch finanzielle Reserven, müssen diese vor dem Gang zur Sozialhilfe praktisch aufgebraucht werden. Aufgrund dieser strikten Bedingungen verzichten viele Menschen darauf, Sozialhilfe zu beziehen, sogar wenn sie das Recht dazu hätten. Nicht zuletzt haben die politischen Attacken auf die Sozialhilfe dazu geführt, dass Armut in der Schweiz noch immer als individuelles Versagen empfunden wird. So schämen sich viele und versuchen lieber, irgendwie durchzukommen. Auch trägt die Aussicht, später die Sozialhilfe zurückzahlen und also in Raten abstottern zu müssen, nicht dazu bei, dass Menschen ihr Recht auf Unterstützung wahrnehmen.
Gar riskant ist der Gang auf das Sozialamt für Migrantinnen und Migranten. Bei ihnen hat eine kürzliche Verschärfung des Ausländer- und Integrationsgesetzes dazu geführt, dass sie um ihren Aufenthaltsstatus fürchten müssen, wenn sie längerfristig Sozialhilfe beziehen. Zwar haben Bund und Kantone versichert, dass diese Verknüpfung in der Coronakrise nicht gelten soll. Aber wie werden das Staatssekretariat für Migration oder die kommunalen Einbürgerungskommissionen in einem oder zwei Jahren oder später beurteilen, ob die Notlage direkt auf Corona zurückzuführen ist? Diese Unsicherheit führt dazu, dass die sich in Not Befindenden zögern, staatliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Zu gross scheint ihnen die Gefahr, die Zukunft ihrer Kinder in der Schweiz aufs Spiel zu setzen. Sie suchen stattdessen die Hilfswerke auf. Diese können für kurze Zeit Überbrückungshilfe leisten, aber auf die Dauer niemals die nötige Unterstützung über einen längeren Zeitraum geben, die die Menschen brauchen. Noch verheerender ist die Lage für Sans-Papiers. Sie haben keinerlei Anspruch auf staatliche Leistungen, obwohl sie zum grössten Teil seit Jahren in der Schweiz gearbeitet haben. Etliche wurden von ihren Arbeitgebern buchstäblich auf die Strasse gestellt, fristlos entlassen und haben kein Einkommen mehr. Viele Sans-Papiers waren daher während der Coronakrise komplett von der Unterstützung von Hilfswerken oder spezialisierten Beratungsstellen für Sans-Papiers abhängig. Erst nach und nach haben insbesondere Städte wie Genf und Zürich Unterstützungsfonds geschaffen.
IV. Armut als künftige Herausforderung
Die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise werden sich erst noch zeigen – auf die Gesundheitskrise wird eine wirtschaftliche und soziale Krise folgen. Bis Anfang 2021 hat sich die Arbeitslosigkeit in der Schweiz beinahe verdoppelt. Auch wenn Prognosen schwierig sind, wird es mit Sicherheit zu weiteren Entlassungen kommen. Viele Menschen werden ihre Arbeit verlieren, finanzielle Einbussen erleiden und mittel- bis langfristig auf Unterstützung angewiesen sein. Die SKOS geht in ihrer Analyse davon aus, dass es in der Sozialhilfe bis ins Jahr 2022 einen Zuwachs von über 21 Prozent geben könnte.3
Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass Armut in der reichen Schweiz die zukünftige sozialpolitische Herausforderung sein wird. Wie hat die Politik auf die bisherigen Auswirkungen der Coronakrise und auf die steigende Armut reagiert? Kleine Bewegungen sind möglich geworden. Vermehrt sind Parlamentarierinnen und Parlamentarier sensibilisiert auf Armutsfragen. So haben die eidgenössischen Räte den Bundesrat im Juni 2020 beauftragt, ein regelmässiges Monitoring der Armutssituation in der Schweiz einzurichten. Ein solches hatte der Bundesrat ein Jahr zuvor noch als unnötig abgelehnt. Ein schweizweites Armutsmonitoring soll Bund, Kantonen und Gemeinden wichtige Erkenntnisse für die Prävention und Bekämpfung von Armut liefern und auf Bestandesaufnahmen der Armutssituation in den Kantonen aufbauen. Denn es sind die Kantone, die für viele Bereiche einer umfassenden Armutspolitik verantwortlich sind. Dazu gehören etwa die Bildungs- und Wohnungspolitik, die Gesundheits-, Familien- und Finanzpolitik. Viele Kantone wissen noch viel zu wenig, wer bei ihnen armutsgefährdet ist, nur die Hälfte der Kantone hat in den letzten zehn Jahren Armutsberichte erstellt. Um vorzuführen, wie sinnvoll solche Bestandesaufnahmen sind, haben die Berner Fachhochschule und Caritas ein Modell für ein kantonales Armutsmonitoring erarbeitet, das auf vorhandene Daten, inklusive Steuerdaten, zurückgreift.4 So kann nebst der Einkommensarmut auch das Vermögen erfasst werden. Auf diese Weise gewinnt ein Kanton ein genaueres Bild, welche Bevölkerungsgruppen besonders von Armut bedroht sind und wie die bereits vorhandenen Instrumente wirken.
Das Modell ist bei einzelnen Kantonen, aber auch beim Bund und in der Politik auf Interesse gestossen. Dies zeigt, wie fruchtbar eine Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Zivilgesellschaft, öffentlicher Verwaltung und Politik sein kann, um in der Armutsbekämpfung einen Schritt weiterzukommen.
V. Es bedarf kurz- und längerfristiger Perspektiven
Um nicht noch mehr Menschen in die Armut abzudrängen, werden kurz- und langfristige Perspektiven benötigt. Dazu sollte die Politik ideologische Grabenkämpfe überwinden und diejenigen vor Augen haben, die im Moment daran sind, alles zu verlieren. Dass die aktuellen Hilfsprogramme und Massnahmen des Bundes bis zum Ende der Krise weitergeführt werden müssen, darüber herrscht allgemeine Einigkeit. Sie müssen aber nicht nur bis zum Ende der Gesundheitskrise, sondern darüber hinaus andauern. Viele Massnahmen zielen zudem stark auf den Mittelstand, und die KMUs, die «kleinen Menschen», stehen nicht im Fokus der Politik. Für Menschen, die finanziell nicht mehr zurechtkommen und doch noch nicht in der Sozialhilfe sind, müssen neue Instrumente wie beispielsweise unbürokratische Direktzahlungen eingeführt werden.
Dies kann in der Form von Ergänzungsleistungen sein, wie dies bereits vier Kantone für Familien praktizieren. Menschen mit niedrigem Einkommen, die auf Kurzarbeit gesetzt wurden oder gar ihre Arbeit verlieren, benötigen Kurzarbeits- oder Arbeitslosenentschädigung, die zu 100 Prozent ihrem bisherigen Lohn entspricht. Und zentral ist für viele, dass ihre Haushaltsbudgets entlastet werden. Würden Bund und Kantone ihre Prämienverbilligung stark erhöhen, würden sie damit einen entscheidenden Beitrag leisten. Die in den letzten Jahren stark gestiegenen Krankenkassenprämien bringen viele Menschen in prekären Situationen in die Schulden. Viele Kantone haben in den vergangenen Jahren bei der Prämienverbilligung gespart.
Die Coronakrise hat auch dazu geführt, dass sich die Digitalisierung stark beschleunigt hat. Dadurch sind bereits weitere Arbeitsplätze für Menschen mit geringer Bildung oder nicht mehr genügender Qualifizierung verloren gegangen. Die Regionalen Arbeitsvermittlungen RAV und die Sozialdienste werden darum die Begleitung und Coachings stark ausbauen und sich viel intensiver mit Bildungsfragen auseinandersetzen müssen. Bis jetzt richtete sich der Blick vor allem darauf, möglichst schnell wieder eine Arbeit zu finden. Ohne entsprechende Weiterbildungen werden viele keine Chancen auf dem sich schnell verändernden Arbeitsmarkt mehr haben. In der Schweiz leben über 800 000Menschen mit ungenügenden Grundkompetenzen in Lesen, Schreiben und IT-Kenntnissen. Sie dürfen nicht sich selbst überlassen werden. Armut bedeutet nicht nur, zu wenig finanzielle Mittel zu haben. Armut bedeutet fehlende Perspektiven, Verlust des Selbstvertrauens, Ausgrenzung von allem, was in einer Gesellschaft als üblich angesehen wird. Wir alle werden in den nächsten Jahren unseren Beitrag leisten müssen, um dem Zusammenhalt in der Schweiz Sorge zu tragen und jedem und jeder in dieser Gesellschaft einen Platz zuzugestehen, um ein Leben in Würde leben zu können. Die Schweiz kann und muss sich dies leisten. Sie steht – trotz aller Krise – wirtschaftlich an einem ganz anderen Ort als viele ärmere Länder, die diese Möglichkeit nicht haben. Weltweit werden laut Weltbank in den nächsten Jahren zusätzliche 150 Millionen Menschen um die nackte Existenz und 150 weitere Millionen Menschen gegen akuten Hunger kämpfen müssen. Auch gegen die weltweit zunehmende Ungleichheit kann die Schweiz einen Beitrag leisten. Aber dies wäre der Inhalt eines eigenen Beitrags.
Anmerkungen
1BFS: https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-82382.html (Zugriff: 20.7.2021).
2BFS: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/gleichstellung-frau-mann/erwerbstaetigkeit/unterbeschaeftigung.html (Zugriff: 20.7.2021).
3SKOS: Analysepapier zur Corona-Pandemie: Aktuelle Lage und zukünftige Herausforderungen für die Sozialhilfe. Bern, 7.Januar 2021.
4Fluder, Robert; Hümbelin, Oliver:Ein Armutsmonitoring für die Schweiz: Modellvorhaben am Beispiel des Kantons Bern,Bern, September 2020.
Janine Dahinden
Genderaspekte: verschärfte Ungleichheiten*
I. Einleitung
Seit Ausbruch der Corona-Pandemie wiesen Genderforscher*innen1





























