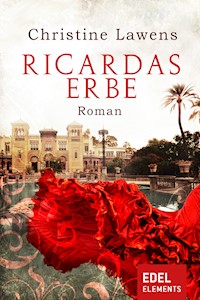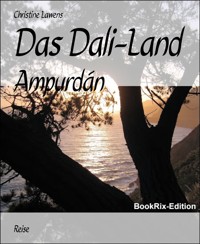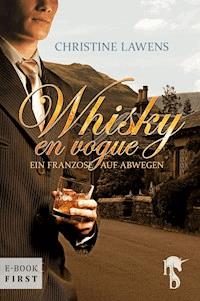Kurzbeschreibung
Florence Letrec ist eine junge, erfolgreiche Schriftstellerin in Paris. Lange war sie nicht mehr in ihrer Heimat, an der wild-romantischen Küste der Bretagne – zu schmerzlich sind die Erinnerungen. Florences Eltern starben bei einer Explosion auf einem Leuchtturm, als sie gerade zwölf Jahre alt war. Sie wuchs gut behütet bei ihrer Großmutter im malerischen Locronan auf. Eines Tages erhält Florence einen Brief ihrer totgeglaubten Mutter aus einem Kloster, der sie zurück in die Bretagne führt. Dort begibt sie sich gemeinsam mit ihrer Jugendliebe Serge auf eine Reise in die Vergangenheit ihrer Familiengeschichte, in tiefe menschliche Abgründe. Dabei entdeckt sie die Memoiren ihrer Mutter und begreift, warum ihre Großmutter alles getan hat, um ein Verbrechen zu vertuschen und Serge und sie auseinanderzubringen. Florence riskiert dabei nicht nur ihren guten Ruf, sondern auch ihr Leben in Paris und den Zusammenhalt ihrer Familie und einstiger Freunde.
Edel eBooks
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2015 Edel Germany GmbH
Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2015 by Christine Lawens
Vermittelt durch die AVA international GmbH Autoren- und Verlagsagentur, München
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Jouve
Inhaltsverzeichnis
Kurzbeschreibung
TiteleiImpressumErster Teil
Kapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19
Zweiter Teil
Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Kapitel 28Kapitel 29Kapitel 30Kapitel 31Kapitel 32Kapitel 33Kapitel 34Kapitel 35Kapitel 36Kapitel 37Kapitel 38Kapitel 39Kapitel 40Kapitel 41Kapitel 42Kapitel 43Kapitel 44Kapitel 45Kapitel 46Kapitel 47Kapitel 48Kapitel 49Kapitel 50Kapitel 51
EpilogAnmerkung der Autorin
Erster Teil
Kapitel 1
Paris, September 2012
Das kleine Mädchen rennt über Wiesen und Felder hinunter zum Atlantik. Seine langen schwarzen Haare flattern im Wind, und als es sich bückt, um einen locker gewordenen Schnürsenkel zuzubinden, leuchtet das blaue Kleid hell in der Sonne des frühen Herbstes.
»Maman«, ruft es. »Maman, wo bist du?« Suchend dreht das Mädchen sich um. Und plötzlich sieht es die Mutter. Sie steht auf dem Leuchtturm und lässt den Wind durch ihr Haar streifen. Sie wird immer blasser, vergänglicher. Entfernt sich immer weiter von der Tochter, weg aus deren Leben.
Der Himmel wird dunkel, die Wellen des Atlantiks schlagen tosend gegen die Felsen. Die Mutter reagiert nicht auf die Rufe der Tochter, die nun in lautes Schluchzen übergegangen sind, sie wendet sich ab, dahinter steht der Vater. Und langsam verschwinden sie in der Düsternis des herbstlichen Nebels. Überall schwarzer Rauch, ohrenbetäubender Lärm und Feuerzungen auf dem Wasser. Die Eltern sind gegangen.
Die restliche Nacht warf sich Florence unruhig im Bett hin und her. Sie wachte schließlich um neun Uhr am folgenden Morgen vollkommen erschöpft auf. Obwohl sie sich so zerschlagen fühlte, konnte sie nicht mehr einschlafen. Also ging sie ins Bad, putzte sich die Zähne und wusch sich mehrmals das Gesicht, bis ihr klar wurde, dass die dunklen Ringe unter ihren Augen keine verschmierte Wimperntusche waren.
»Tränensäcke«, murmelte sie. »Ich bin zu jung für Tränensäcke, und dies sind keine Säcke, sondern Koffer. Große Schrankkoffer.«
Nach dem Duschen fühlte sie sich besser. Sie zog sich an und ging in die Küche, um den Kaffeeautomaten einzuschalten.
Es läutete an der Tür, und Florence sah durch den Türspion, dass es der Postbote war. »Madame Letrec, verzeihen Sie die Störung, aber ich bekomme Ihre Post nicht in den Briefkasten.« Er überreichte ihr einen großen Stapel Umschläge.
»Vielen Dank für Ihre Mühe«, sagte Florence und schenkte ihm ein Lächeln. Sie sah ihm nach, wie er die Treppe hinuntereilte, und nahm dann ihre Post mit nach drinnen, wo sie ein heißer Kaffee erwartete. Sie stellte die Tasse auf den Tisch und sichtete den Stapel. Zwischen dem üblichen Sortiment von Leserbriefen, Werbesendungen und Rechnungen befand sich ein Brief aus einem Kloster in Südfrankreich, an sie persönlich adressiert. Sie
trank ihren Kaffee und drehte den Umschlag unschlüssig in den Händen. Während Florence das Kuvert öffnete, keimte eine unerklärliche Vorahnung in ihr auf.
Sie setzte ihre Brille auf und begann zu lesen. Ihr Puls beschleunigte sich, ihr Mund wurde trocken, und ihre Hand zitterte, als sie die Zeilen nochmals überflog. Irrtum ausgeschlossen.
Florence’ Hand mit dem Briefpapier sank kraftlos herunter. Sie hatte das Gefühl, die Welt um sie herum breche zusammen. Nach einer Weile bückte sie sich, um das Schriftstück, das ihr entglitten war, aufzuheben.
Mehrmals las sie den Brief durch, der aus einem Kloster in den Pyrenäen stammte. Langsam stand sie auf, ging zu dem Familienfoto und brachte nur ein Wort heraus: »Maman!«
Dann stolperte sie in ihr Schlafzimmer, stopfte einige Sachen in ihre Reisetasche, nahm ihre Autoschlüssel und ihre Handtasche. Schon zum Gehen gewandt, ließ sie ihr Gepäck fallen, griff noch einmal nach dem Telefon und wählte Patricks Nummer in der Anwaltskanzlei. Sie wusste, dass er bereits hinter seinem Schreibtisch saß. Er war ein Perfektionist, und Florence kannte seine Marotte, alles bis ins Kleinste vorzubereiten, nichts dem Zufall zu überlassen, ganz gleich, wie unwichtig der Klient war.
»Hallo, ich hoffe, es gibt einen triftigen Grund für deinen Anruf. Du weißt, unter welchem Zeitdruck ich stehe und …«
»Patrick«, unterbrach ihn Florence hastig, »Patrick, hör mir jetzt bitte genau zu! Wenn du nach Hause kommst, bin ich bei meiner Großmutter in der Bretagne. Ihr geht es nicht gut, und sie will mich sehen.«
Patrick schwieg, dann antwortete er unsicher: »Das tut mir leid, aber ich denke, du musst nicht gleich so überreagieren. Außerdem«, hier machte er eine bedeutungsvolle Pause, »haben wir heute Abend ein wichtiges Abendessen.«
Unwillkürlich musste Florence lachen. »Du hast ein wichtiges Abendessen. Dir fällt schon etwas ein, um mich zu entschuldigen. Migräne. Genau, sag ihnen, ich hätte Migräne, das klingt stets glaubhaft.«
»Florence, ich versteh wirklich nicht, warum du dir das antun willst. Ich bin mir sicher, dass deine Großmutter eine Handvoll von Medizinkoryphäen um sich geschart hat. Wäre heute nicht …«, Patrick zögerte einen Moment, ehe er weitersprach, »dieses Abendessen, dann würde ich dich …«
»Geh du zu diesem wichtigen Dinner«, fiel ihm Florence rasch ins Wort, glücklich darüber, dass er offensichtlich in Erwägung zog, sie zu begleiten. Patrick war kein Mann der großen Worte.
»Lass mich bitte ausreden, Florence! Ich wollte sagen, dass ich dich begleiten würde,
wenn es den Termin nicht gäbe, aber ich möchte dabei sein. Es ist eben wichtig.«
Florence war enttäuscht, doch nach kurzem Zögern überspielte sie diese Regung und antwortete mit betonter Heiterkeit: »Ich muss jetzt los. Viel Erfolg bei deinem Termin. … Sicher wird der Gastgeber mit deiner Anwesenheit zufrieden sein«, setzte sie noch hinzu.
»Melde dich, wenn du angekommen bist, Florence.«
Florence entschloss sich, nichts von dem Brief zu erzählen, sie hätte dadurch nur eine endlose Diskussion entfacht. Sie legte auf und verließ das Haus.
Vor ihrem Wagen blieb sie stehen. Seltsamerweise hatte sie es nicht mehr eilig, wegzukommen, nach Locronan in die Bretagne zu fahren und vielleicht eine Antwort auf die Frage zu bekommen, die auch heute noch wie eine unsichtbare Wand zwischen ihr und ihrer Großmutter stand. Sie hatte Angst vor der Wahrheit, Angst vor dem, was sie dort erwartete. Wie ein kalter Hauch streifte sie die Endgültigkeit des Todes, der ihrem heimlichen Traum von einer Rückkehr ihrer Eltern unbarmherzig und für alle Ewigkeit ein Ende gesetzt hatte. Als Florence die Autotür öffnete, wusste sie, der Moment war gekommen, um endlich das Schweigen zu brechen, das über dem Leben ihrer Eltern lag.
Das schöne Pariser Herbstwetter war irgendwo unterwegs verschwunden, im Westen türmten sich Wolken übereinander. Die Landschaft vor Florence’ Autofenster hatte sich verändert. Die Bäume wurden spärlicher und kleiner, bogen sich leicht immer in die gleiche Richtung. Der Wolkenberg vor ihr riss unvermittelt auf und ließ schräge Sonnenstrahlen hindurch, wie ein starker Projektor.
Die sanfte smaragdgrüne Hügellandschaft erstreckte sich vor ihr und brachte sie ihrem Ziel näher. Es war, als könnte der Wagen einfach keinen anderen Ort ansteuern.
Dieses Gefühl der Gewissheit hielt an, als sie Locronan erreichte und hügelabwärts an Granithäusern vorbei und durch gepflasterte Gässchen fuhr. Rasch erreichte sie den Marktplatz, der zusammen mit dem Brunnen und der mittelalterlichen Kirche das Herz des Dorfes bildete. An jedem Haus hingen die Geranien in ihrer vollen Üppigkeit herunter. Florence musste sich beherrschen, um nicht den Wagen zu stoppen und herauszuspringen. Sie bog in eine kleine mittelalterliche Gasse ein, auf deren Kopfsteinpflaster man noch das Getrappel der Pferde zu hören vermeinte, die wie der ganze Ort den früheren Charme bewahrt hatte. Plötzlich ging ihr das alles zu schnell. Sie wusste nicht, ob sie schon bereit war, herauszufinden, was sie hier nach fast zwanzig Jahren erwartete.
Kapitel 2
Locronan, 2012
Florence stützte sich auf das rostige schmiedeeiserne Tor und sah hinauf zum alten Schloss. Wie lange war sie nicht mehr zu Hause gewesen? Acht Jahre? Zehn Jahre?
Zu lange. Und doch nicht lange genug.
Eine Zeile aus einem Werk von Thomas Wolfe kam ihr in den Sinn: »Du kannst nicht nach Hause zurück zu deiner Familie, zurück nach Hause zu deiner Kindheit.« Aber jetzt war sie hier.
Der Knoten in Florence’ Magen wurde fester. Ihr Gewissen warf ihr vor, ihre Großmutter vernachlässigt zu haben. Die Stimme in ihrem Inneren sprach die Wahrheit. Noch während sie am Tor stand, wurde ihr eines klar: Die Tatsache, dass sie dieses Haus mied, hatte nichts mit mangelnder Liebe zu tun. Sie liebte die Bretagne, liebte diesen Ort, liebte ihre Großmutter Adélaide – und doch widerstand irgendetwas in ihr, ganz tief und unerreichbar in ihrem Inneren verborgen, dem unerbittlichen Drang, nach Hause zu gehen. Zu viele traurige Erinnerungen. Zu viel Verwirrung.
In Paris, knapp sechshundert Kilometer entfernt, achtzehn Jahre nach den Geschehnissen, war Florence Letrec eine gänzlich andere Person – eine Person, die für sich eine Nische geschaffen hatte. Sie hasste die verstopften Straßen, den Lärm und die Hektik dieser großen Stadt, aber die Anonymität gefiel ihr gut. Ihr Leben seit der Sorbonne hatte sie sich selbst geschaffen. Jetzt war sie nicht mehr das verhätschelte, introvertierte Kind von früher. Sie hatte sich aus eigener Kraft neu erfunden und sich zu einer lebendigen Frau entwickelt.
Sie hatte auch ihren Kleiderstil angepasst. Bevor sie nach Paris kam, hatte sie sich über ihr Aussehen und ihre Kleidung keine Gedanken gemacht. Sie beobachtete die Frauen, mit ihrer Eleganz und einem Hauch Nonchalance. Ihr Casual Look wurde durch einen weiblichen, edlen Stil ersetzt.
Eine Kommilitonin nahm sie unter ihre Fittiche. »Präge dir ein, was Coco Chanel mal gesagt hat: ›Eine Frau sollte sich jeden Tag so anziehen, als könnte sie ihrer großen Liebe begegnen.‹« Gemeinsam zogen beide durch die trendigen Läden, und Florence hatte noch nie in ihrem Leben so viel an einem Tag eingekauft: zwei Röcke, einen Mantel, einen Trenchcoat und Kaschmirpullover in dezenten Farben. Und das Wichtigste: Lingerie. Florence musste schmunzeln, als sie daran dachte, wie Jacqueline sie in die Dessousabteilung des Kaufhauses Galeries Lafayette schleifte. Florence fühlte sich inmitten der Slips, BHs und Strapse so verloren wie an ihrem ersten Tag in der
Universität.
An der Sorbonne hatte Florence alles gefunden, was sie sich gewünscht hatte. Einen Platz, an den sie gehörte. Intellektuelle Herausforderung. Einen Sinn.
Sie hatte ihrer Großmutter nicht nachgeeifert und nicht ihrem Wunsch entsprochen, das Letrec-Unternehmen zu führen. Sie wollte Schriftstellerin werden. Mit Leib und Seele war sie Autorin historischer Romane und konnte sich nichts vorstellen, was sie mehr ausfüllte, als ihre Leser mit der Schönheit der französischen Literatur vertraut zu machen. Ihr Vater hatte ihr als Kind die Bedeutung von Aufrichtigkeit und Bildung eingeimpft. Für ihn schien es nichts Wichtigeres im Leben gegeben zu haben. Bildung hatte Arnaud Letrec stets als unabdingbare Voraussetzung für eine zivilisierte Gesellschaft betrachtet.
So war Florence inmitten von Büchern aufgewachsen und in der sanften, aber bestimmten Art eines engagierten Unternehmers mit pädagogischen Merkmalen erzogen worden. Er erwartete von ihr, dass sie außergewöhnliche Leistungen in der Schule erbrachte, wie sie später auch ihre Großmutter erwartete. Sie enttäuschte diese Erwartungen nie. Nur ein einziges Mal.
Jetzt war sie zweiunddreißig Jahre alt und entsprach äußerlich dem Klischee einer Schriftstellerin. Sie trug ihr mittellanges schwarzes Haar aufgesteckt. Ihre Lesebrille aus Horn hob sich stark von dem hellen Teint ihres Gesichtes ab. Hohe Wangenknochen verliehen ihr ein etwas hochmütiges Aussehen, das jedoch von ihren rehbraunen Augen gemildert wurde.
Endlich hatte sie die Vergangenheit hinter sich gelassen – so vollkommen, dass ihr Freund Patrick sie unbarmherzig neckte. Sie sei eine geheimnisvolle Frau, die nie über sich sprechen würde.
»Ich rede immerzu über mich«, hatte sie das letzte Mal, als dieses Thema aufgekommen war, protestiert. »Wir reden doch über alles.«
Er hatte den Kopf geschüttelt. »Wir reden über das Leben, über Literatur, das Gesetz, deine Arbeit und meine. Wir sprechen über Bücher, Filme und Politik. Manchmal sogar von einer Heirat. Ich weiß, was du von all dem hältst. Ich kenne deine Meinung, kenne deinen Standpunkt zu vielen Dingen.« Er lachte und beugte sich eindringlich vor. »Ich weiß, was da drin ist …« Er tippte ihr mit dem Zeigefinger gegen den Kopf. »Aber oft denke ich, dass ich noch nicht einmal angefangen habe, zu erahnen, was da drin vorgeht.« Er ließ die Hand auf ihr Herz hinabgleiten.
Völlig überrascht von Patricks plötzlichem Wortschwall, wandte Florence den Blick ab. »Da gibt es nicht viel zu wissen, Patrick. Ich bin bei meiner Großmutter aufgewachsen, nachdem meine Eltern bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen
waren.«
Dass sie fast jede Nacht von einem schrecklichen Ereignis träumte, verschwieg sie.
»Ich möchte mich einfach lieber auf die Gegenwart und die Zukunft konzentrieren, als bei der Vergangenheit zu verweilen.«
»Dann verbirgst du also nichts vor mir, du geheimnisvolle Frau? Irgendein schreckliches Geheimnis?« Er grinste und verdrehte die Augen.
Florence lachte. »Touché, du hast mich erwischt. Ich bin aufgeflogen.« Sie stieß einen melodramatischen Seufzer aus. »Bevor ich nach Paris gekommen bin, habe ich im Haus meiner Großmutter ein Bordell betrieben, habe aus dem Kofferraum meines Wagens mit Drogen gedealt und das Geld über Bankkonten in Genf gewaschen. Ich bin unverschämt reich und auf der Flucht vor dem Mossad.«
»So was Ähnliches habe ich mir schon gedacht.« Patrick zuckte die Achseln. »Ich bin am Verhungern. Lass uns nebenan ins Bistro gehen.«
Bei der Erinnerung an dieses Gespräch und den Ausdruck in Patricks Augen, als er davon sprach, ihr Herz kennenlernen zu wollen, atmete Florence tief durch. Sie hatte nicht einkalkuliert, wie verletzlich die Liebe einen Menschen machte. Emotionen waren so unberechenbar und grausam. Mit dem Intellekt kam sie sehr viel besser zurecht. Ihr war es lieber, eine Beziehung auf einer philosophischen Ebene zu halten. Patrick war in ihr Leben gekommen, aber nicht in ihr Herz. Der Verteidigungswall war, seit sie ihn verlassen hatte, undurchdringbar.
Patrick war ein faszinierender Mann, der ganz genau wusste, was er vom Leben erwartete.
Geliebt und begehrt zu werden war eine mächtige Verlockung, wie Florence feststellen musste. Nur konnte sie nicht über ihren Schatten springen. Ihre tiefe Liebe gehörte Serge Renaud. Damals hatte sie das Gefühl gehabt, als würde sie die erste Stufe einer steilen Treppe verfehlen und die ganze Treppe herunterpurzeln, ohne sich irgendwo festhalten zu können. In dieser Zeit schlang sich die Macht ihrer Liebe zu Serge um die Wurzeln ihrer Seele, und je stärker diese Liebe wurde, umso mehr verspürte sie den Drang zu fliehen.
Bei Patrick ließ sie es erst gar nicht so weit kommen. Sie hatte sich rechtzeitig zurückgezogen und ein Kontrollsystem dazwischengeschaltet. Ihr wurde bewusst, dass sie, seit sie Patrick kannte, nichts anderes tat, als sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren. Sie hatte sich nie richtig Zeit genommen, all diese Veränderungen in ihrem Leben und in ihrer Beziehung zu überdenken und zu überlegen, was sie sich für die Zukunft wünschte. Vielleicht würde es ihr guttun, wenn sie sich mal eine Pause gönnen, allein wegfahren würde und »auf das hören, was dein Herz dir sagen möchte«. Aber wohin? Zu Großmutter. Ins Schloss, in dem die Erinnerungen an ihre Jugend schlummerten. Sie
Kapitel 3
In all den Erinnerungen, die Florence’ Kindheit betrafen, stand das Schloss hoch, gewaltig und stolz da wie auf den Fotos in ihrem alten Album, mit der einladenden geschwungenen Steintreppe und dem in den Himmel ragenden Turm.
Aber jetzt wirkte es dunkel und verwittert. Einer der Fensterläden hing schief herunter. Hatte es beim letzten Mal auch schon so ausgesehen? Oder hatte Florence nur das gesehen, was sie hatte sehen wollen?
Florence atmete tief durch, umklammerte den Griff ihrer Reisetasche und ging zur Haustür. Oben im ersten Stock bewegte sich ein Vorhang. Florence läutete, wartete und läutete noch einmal.
Sie wollte gerade in ihrer Tasche nach ihrem eigenen Schlüssel suchen, als die Haustür von einer finster dreinblickenden Matrone in Schwesternkleidung geöffnet wurde.
»Ja bitte?«, fragte die Frau. »Was wollen Sie?«
»Ich bin Florence Letrec. Und wer sind Sie?«
Die Frau antwortete einen Moment lang nicht, sondern blieb reglos in der Tür stehen. »Die Enkelin aus Paris. Richtig. Nun, ich denke, Sie kommen besser herein«, sagte sie schließlich.
Florence drängte sich an ihr vorbei in die Halle. Alle Vorhänge waren zugezogen, um die Nachmittagssonne auszublenden. Im Haus roch es muffig. Der Geruch der Vergangenheit lastete über allem. Dieser Gedanke durchzuckte Florence plötzlich. Doch genauso schnell schob sie ihn wieder beiseite und sah sich um. Alles war vertraut und doch ganz anders, als sie es in Erinnerung hatte. Es fehlten die frischen Blumen in der Eingangshalle. Florence nahm alles ringsherum in Augenschein. Der riesige Kristalllüster, der seit alters von der Decke schwebte, war mit Spinnweben verhangen, als würde hier eine Riesenspinne ein ganz besonderes Abendessen vorbereiten. Sie betrachtete die Seidenbespannungen an den Wänden und die Ahnenporträts, welche ihre Gedanken in eine längst vergangene Zeit abschweifen ließen. In diesem Gemäuer, dachte Florence, finden sich Erinnerungen an alle bedeutenden Epochen der bretonischen Geschichte. Ein Labyrinth von Gängen, Fluren, Treppen und Passagen führte über die Salons mit bedeutenden Gemälden und Wandzeichnungen hinauf in das Obergeschoss.
»Ich bin die Krankenschwester«, erklärte die Frau. »Ich heiße Lucienne Rocher.«
»Ich sehe, dass Sie eine Schwester sind. Was tun Sie hier?«
»Ich pflege Ihre Großmutter.«
Florence runzelte die Stirn. »Seit wann braucht Großmutter denn eine Pflegerin?«
»Seit sie sich eine Lungenentzündung geholt hat.«
Alle Luft entwich aus Florence’ Atemwegen. »Lungenentzündung? Wann ist das passiert?«
Lucienne Rocher zuckte die Achseln. »Vor drei Wochen. Die Antibiotika schlagen mittlerweile an, aber sie ist noch sehr schwach.«
Wie angewurzelt stand Florence da, während sich Schuldgefühle in ihr breitmachten und sie nach unten zogen, als würde sie im Treibsand stehen. Sie hätte früher kommen sollen.
Sie öffnete den Mund, um weitere Fragen zu stellen, aber die Schwester hatte ihr bereits ihre breite Rückseite zugewandt und marschierte zu der Doppeltür auf der anderen Seite des Wohnzimmers.
»Hier entlang«, brummte Rocher, als würde Florence den Weg zum Schlafzimmer ihrer Großmutter nicht kennen. Die Pflegerin stieg die Eichentreppe hoch, und Florence ging ihr nach. Oben angekommen, stolperte sie fast über eine große graue Katze, die sich auf dem Treppenabsatz niedergelassen hatte.
»Weg mit dir, du Miststück!«, rief Lucienne und stieß sie mit dem Fuß an.
Die Katze fuhr zusammen und sprang maunzend auf. Dann begann sie um Florence’ Knöchel zu streichen.
»Na, du, dich kenne ich ja gar nicht«, sagte Florence. Sie nahm den Kater hoch und kraulte ihn unter dem Kinn, bis er wie ein leiser Motor zu schnurren begann. »Du bist aber ein Lieber.«
Rocher wandte sich um und blickte finster in Florence’ Richtung. »Tiere sind im Zimmer der Patientin nicht gestattet.«
Florence’ Zorn flackerte auf.
»Die Patientin«, sagte sie, »heißt Madame Adélaide Letrec. Ich bin ihre einzige Enkelin Florence Letrec. Und dieser Kater gehört offensichtlich genauso zu dieser Familie wie ich.«
»Pah«, schnaubte Lucienne und stapfte in Großmutters Zimmer davon. Florence wollte etwas erwidern, ließ es aber bleiben.
Am Ende des dunklen Flurs, am Ende eines Korridors voller geschlossener Türen, stand eine Zimmertür offen. Rocher eilte geschäftig umher, säuberte das Tablett, auf dem die Medikamente standen. In dem großen Bett mit den vier Pfosten lag Adélaide auf Kissen gestützt und mit einer Satindecke zugedeckt. Ihre Augen waren geschlossen, ihre Atmung war schwer und mühsam. Einen Augenblick lang sagte Florence keinen Ton und beobachtete nur die knorrigen Finger ihrer Großmutter, die die Decke umklammert hielten. Ihre Haut wirkte brüchig und durchsichtig wie altes Pergamentpapier.
Wie hatte es dazu kommen können? Als Florence ihre Großmutter das letzte Mal gesehen hatte, trug sie ein edles Kostüm mit viel Schmuck und ein dezentes Make-up. Sie rauchte nur mit einer Zigarettenspitze. Trotz ihrer heute dreiundachtzig Jahre hatte Großmutter immer zehn Jahre jünger ausgesehen und sich auch so verhalten. Jeden Tag hatte sie ein stundenlanges Pflegeprogramm und Gymnastikübungen allem anderen vorgezogen.
Und jetzt hatte sich ihre Großmutter auf einmal in eine alte Frau verwandelt, im Augenblick eine sehr kranke. Schließlich öffneten sich die hellgrauen Augen, und ein schwaches Lächeln erhellte das faltige Gesicht. »Florence, mein liebes Kind!«, flüsterte die vertraute Stimme. »Endlich bist du gekommen.«
»Ich bin hier, Großmutter.« Florence’ Stimme zitterte. Sie nahm die faltige Hand von Adélaide.
Die Berührung schien ihr Kraft zu verleihen, sie wandte sich ihrer Enkelin zu. Ihr Blick hing fest an Florence’ Gesicht. »Danke, Madame Rocher.«
»Aber, Madame Letrec«, protestierte sie. Doch die faltige Hand winkte sie aus dem Raum. Die Krankenschwester schoss einen giftigen Blick in Florence’ Richtung, marschierte aus dem Zimmer und schloss die Tür hinter sich.
Adélaide lächelte schwach und sank zurück auf die Kissen. Florence’ Hand hielt sie noch immer umklammert.
»Sie ist eine gute Seele«, beteuerte die alte Frau leise, »aber ein wenig zu herrschsüchtig. Du wirst sie in ihre Schranken weisen müssen.«
»Das werde ich, Großmutter«, antwortete Florence mit mehr Zuversicht, als sie tatsächlich empfand. An der Herrschsucht der Pflegerin hatte sie keinen Zweifel. Wo die gute Seele begraben lag, war Florence bislang verborgen geblieben.
»Würdest du bitte die Vorhänge öffnen, mein Liebes?«, bat ihre Großmutter. »Rocher hält immer alles dunkel, und dadurch wird es muffig. Sie scheint zu denken, mein Zustand würde sich bessern, wenn sie die Welt ausschließt. Aber jetzt bist du da, und ich will dich ansehen.«
Florence ging zum Fenster und zog die schweren Samtvorhänge zurück. Die gelbe Herbstsonne fiel durch die verschmutzte Fensterscheibe ins Zimmer.
»Jetzt komm hier herüber«, befahl Großmutter.
Florence gehorchte sofort und setzte sich auf die Bettkante.
Eine schmale, von starken Venen durchzogene Hand hob sich von der Decke, umfasste Florence’ Kinn und drehte ihr Gesicht ihrer Großmutter zu. Der Griff war sanft, gleichzeitig aber auch fest.
»Sieh mich an. Geht es dir gut?«
Florence’ Eingeweide krampften sich zusammen, und sie wandte den Blick ab. »Sicher, Großmutter, mir geht es gut«, sagte sie. »Es tut mir leid. Ich wäre eher gekommen, wenn ich gewusst hätte, dass du so krank bist.« Und gewusst hätte, dass meine Mutter noch vor einigen Tagen gelebt hat, schob sie in Gedanken nach.
»Das weiß ich doch, Kindchen. Darum habe ich dir ja auch nichts davon erzählt.«
»Was sagen die Ärzte?«
Adélaide verdrehte die Augen. »Ärzte praktizieren Medizin«, sagte sie. »Ich bin nie davon überzeugt gewesen, dass sie sie perfektioniert haben. Wenn du es genau wissen willst, sie sagen, dass eine Lungenentzündung in meinem Alter gefährlich sein kann. Ich habe aber ganz gut auf die Antibiotika angesprochen, darum haben sie nicht darauf bestanden, mich ins Krankenhaus einzuliefern. Ich kann nur nicht genau sagen, wie lange es dauern wird, bis ich wieder gesund bin.«
»Aber du wirst doch wieder gesund werden«, entgegnete Florence und gab sich die größte Mühe, die Aussage nicht wie eine Frage klingen zu lassen.
»Ob ich sterben werde, meinst du?« Adélaide lachte. »Ja, ich werde sterben. Irgendwann. Aber noch nicht in naher Zukunft.«
Ein nervöses Lachen zwang sich auf Florence’ Lippen. Sie atmete aus und entspannte sich etwas. Ihre Großmutter war krank, aber sie war immer noch Adélaide. Diese Erkenntnis brachte ihr ein gewisses Maß an Trost und Sicherheit. Nicht genug, aber ein wenig.
»Du siehst verändert aus«, sagte Adélaide gerade. »Du bist sehr dünn. Und dein Haar …«
»Ich hatte noch keine Gelegenheit, zum Friseur zu gehen.« Florence fuhr sich mit der Hand durch das glatte Haar. »Ich bin …«, sie suchte nach dem passenden Wort, »beschäftigt gewesen.«
Adélaide kämpfte mit den Kissen und versuchte, sich etwas höher aufzurichten. Selbst solch eine kleine Anstrengung schien sie zu erschöpfen. Sie lehnte sich zurück und schloss die Augen.
»Wenn du dich ausruhen musst, werde ich später wiederkommen«, sagte Florence.
»Das wirst du nicht tun. Wir haben uns seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen, und wir müssen miteinander reden.«
In Paris hatte sich Florence vorgenommen, ihre Großmutter gleich zur Rede zu stellen, was es mit diesem seltsamen Brief auf sich hatte. Doch als sie die zerbrechliche Frau vor sich sah, hatte sie sich anders entschieden. Der Sog der Schuldgefühle zog Florence noch weiter herunter. Sie wandte den Blick ab. »Großmutter, es tut mir leid, dass ich nicht für dich da war.«
»Wie viel Uhr ist es?«
Florence runzelte die Stirn und sah auf die Uhr. »Es ist Viertel nach vier. Warum?«
»Ich habe mich gerade gefragt, wie lange du dich noch mit Schuldgefühlen quälen willst, nur weil du dein eigenes Leben führst.«
Florence starrte sie an, dann lachte sie. »Natürlich hast du recht. Ich sollte an dich denken und wie du dich fühlst.«
Großmutter schüttelte den Kopf. »Nein, ich meine es ernst. Wie lange? Werden zehn Minuten ausreichen? Prima. Ich warte zehn Minuten, während du dich schlecht fühlst, dann können wir vielleicht unsere Unterhaltung fortsetzen.« Sie schloss die Augen.
Florence saß auf der Bettkante. Stille senkte sich über den Raum, die nur von dem leisen Ticken der Uhr und dem rasselnden Atem ihrer Großmutter unterbrochen wurde. Eine Erinnerung aus ihrer Kindheit. Von Anfang an, selbst in den ersten schwierigen Tagen von Florence’ Aufenthalt in diesem Haus, war Großmutter offen und direkt zu ihr gewesen, eine Ehrlichkeit, die in der Regel mit einer gesunden Prise Humor gewürzt war. Florence mochte sich selbst zwar infrage stellen, aber sie wusste immer genau, woran sie bei Großmutter Adélaide war. Sie brauchte nicht unnötig Energie darauf zu verwenden, Gedankenspiele zu spielen. Großmutter war die einzige Person in ihrem Leben, der Florence uneingeschränkt vertraute, und dieses Vertrauen hatte ihr in einer Angst machenden und unsicheren Welt einen kleinen Kokon der Sicherheit gegeben.
Nach einer Weile öffnete Großmutter ein Auge. »Ist die Zeit um?«
Florence sah auf die Uhr. »Es sind jetzt achteinhalb Minuten, aber ich werde die letzten eineinhalb Minuten einfach überspringen, wenn es dir recht ist.«
Großmutter tätschelte ihre Hand. »Einverstanden. Und jetzt erzähl mir von deinem neuen Roman, dem Mann in deinem Leben und von deinen Plänen.«
Florence nickte. »Ja. Es ist alles in Ordnung.«
Großmutter sah sie an. »Das klingt nicht sonderlich begeistert. Ich dachte, das sei, was du dir immer gewünscht hast – eine erfolgreiche Schriftstellerin zu werden. Was du ja auch erreicht hast.«
Florence atmete ein und hielt die Luft eine Weile an. »Sicher, das wollte ich auch. Aber im Augenblick ist alles ein wenig verwirrend. Patrick hat mich gebeten, ihn zu heiraten.«
Großmutters Lippen verzogen sich zu einem Lächeln. »Ist er ein guter Mann? Du hättest es schlechter treffen können.«
Florence wusste, dass sie mit dem letzten Satz auf Serge anspielen wollte.
Serge Renaud, der Sohn des Leuchtturmwärters. Als sie hier ankam, hatte sie für einen Augenblick an ihn gedacht. Jetzt stellte Florence erstaunt fest, wie lebendig er in ihr
geblieben war. Je mehr sie darüber nachdachte, je weniger wusste sie, was dieser Mann ihr bedeutet hatte. Florence war überwältigt von einem tiefen Gefühl des Verlustes. Nach all den Jahren war Serge plötzlich wieder real für sie geworden. Es war so, als hätte er einen Winterschlaf in ihrem Inneren gehalten. Die Erinnerung an ihn stieg an die Oberfläche und löste ein körperliches Verlangen in ihr aus, das Florence gleichzeitig beunruhigte und traurig machte.
»Was ist mit dir, Kind?« Ihre Großmutter sah sie mit einem prüfenden Blick an.
»Was?«
»Ich habe dir eine Frage gestellt.«
»Entschuldige, ich bin etwas müde von der langen Fahrt.«
»Ist er gut zu dir?«
»Ja, er ist ein anständiger Mann.« Sie sah zum Fenster. Ohne Zweifel, dachte sie, konnte Patrick freundlich und großzügig sein, humorvoll und verlässlich, aber Florence kannte genauso gut Wesenszüge wie bitteren Sarkasmus, Arroganz, Stolz und einen knallharten Willen, die Welt und die Menschen darin nach seinen Vorstellungen zu formen.
Adélaide nahm Florence’ Hand. »Dein Verlobungsring ist wunderschön. Und auch dein Äußeres, deine Frisur und wie du dich kleidest, gefällt mir sehr gut. Dieser Patrick scheint einen guten Einfluss auf dich zu haben.« Sie sah ihre Enkelin an. »Da ist doch noch etwas, was du nicht aussprichst.« Adélaide zog eine Augenbraue in die Höhe.
Florence schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht genau, ob ich für eine Ehe bereit bin. Zumindest jetzt.« Ihre Antwort sollte die Wahrheit verbergen, denn die konnte Florence nicht artikulieren. Wie sollte sie auch Gefühle erklären, die sie selbst nicht verstand?
Adélaide wandte den Kopf und wisperte eine Frage, an die Florence bisher nicht zu denken gewagt hatte. »Willst du dich von ihm trennen?«
»Was? Nein, natürlich nicht«, stotterte Florence.
»Das ist normalerweise der Grund, wenn eine Frau … allein zu ihrer Großmutter fährt.«
»Was redest du da?« Florence verschränkte krampfhaft die Finger ineinander. Sie presste ihre Füße fest auf den Teppich und wappnete sich gegen die bevorstehende Predigt über Verantwortung, Jugendsünden und frühere Dummheiten.
Sie blieb aus.
Großmutter nahm einen Schluck Wasser aus einem Glas, das auf ihrem Nachttisch stand, lehnte sich wieder in die Kissen zurück und blickte Florence an. »Du musst dir sicher sein.«
Dieser einfache Satz hallte in Florence’ Kopf mit der Macht eines prophetischen
Orakels nach. Ihr fiel keine passende Antwort ein, darum beschäftigte sie sich mit den Kissen ihrer Großmutter. »Du scheinst müde zu sein. Soll ich gehen?«
»Noch nicht. Ich werde ein wenig ruhen müssen, aber erzähl mir zuerst von dir. Ich möchte mehr von dem hören, was in deiner Welt vorgeht.«
Florence setzte sich wieder auf die Bettkante und überlegte, was sie erzählen könnte – etwas, das nicht die Unsicherheit enthüllte, die sie nun schon seit Wochen plagte. »Nun, mal sehen … Patrick soll Partner in der Anwaltskanzlei werden. Sehr vielversprechend.«
Großmutter winkte mit der Hand, um sie zum Weitersprechen aufzufordern.
Florence gehorchte, flatterte von einem Thema zum nächsten. Sie erzählte von Patrick, ihren umfangreichen Recherchen für den nächsten Roman, von der Wochenendreise mit einer Bekannten, die sie nach Lourmarin in die Provence geführt hatte, wo sie Albert Camus’ Grab besucht hatte, von ihren älteren Werken und deren Verkaufszahlen. Von allem Möglichen, nur nicht von sich selbst und dem Brief aus dem Kloster. Alles oberflächliche Dinge, Plaudereien bei einer Cocktailparty.
Kapitel 4
Was, grübelte sie niedergeschlagen, tue ich hier eigentlich?
Sie lag auf dem Bett und dachte an den Brief in ihrer Handtasche.
Maman war dreiunddreißig Jahre alt gewesen, als sie angeblich bei einer Explosion am Leuchtturm mit ihrem Vater und Gérard Renaud umgekommen war. Florence vernahm bis heute noch die Detonation und das Vibrieren der Erde.
Oft fuhr sie nachts aus dem Schlaf, hörte den ohrenbetäubenden Knall und sah die lodernden Feuerzungen auf dem Atlantik.
An diesem späten Abend hatte solch ein Chaos geherrscht. Es schien, als sei der ganze Ort auf den Beinen. Der untere Teil des Leuchtturms stand noch, der obere Teil fehlte.
Niemand konnte sich vorstellen, was die Explosion ausgelöst hatte.
Man fand die Leichen einige Tage später am Strand. Das erzählte man sich. Und bei der Beerdigung standen drei Särge in der Kirche. Sie und Serge standen eng beieinander. Und doch jeder für sich, einsam und allein. Lobeshymnen und Beileidsbekundungen wurden Hunderte von Malen wiederholt. Was jeder der drei doch für ein liebenswerter Mensch gewesen sei.
Vielleicht sollte Florence es einfach glauben, weil es so häufig wiederholt worden war. Aber wenn Wortfülle ein Mittel gegen den Schmerz sein sollte, so hatte die Überdosis nicht gewirkt. Trotz ihrer vierzehn Jahre hatte Florence es besser gewusst.
Es war Großmutter, die ihr sagte, dass Gott für den Tod ihrer Eltern nicht verantwortlich sei, dafür, dass schreckliche Dinge auf dieser Welt passierten. Alle diese wohlmeinenden Menschen, die behauptet hatten, ihre Eltern und Serges Vater seien liebenswerte Menschen gewesen, hatten nur eine einfache Antwort auf eine sehr schwierige Frage gesucht.
Nach dem Tod ihrer Eltern war Florence hiergeblieben, um bei ihrer Großmutter zu leben.
In den ersten Jahren ihres Heranwachsens hatte Florence noch an den Rockschößen ihrer Großmutter gehangen. Großmutter wusste, was es bedeutete, Gott gegenüber aufrichtig zu sein. Dem Allmächtigen gegenüber nahm sie nie ein Blatt vor den Mund. Sie war der Überzeugung, Gott sei groß genug und könne mit ihren Fragen, ihrem Zorn und ihrem Schmerz fertigwerden.
Das war eine wichtige Lektion, aber eine Lektion, die für Florence zunehmend schwieriger zu lernen war, vor allem aus zweiter Hand. Als sie der Kindheit entwuchs, und damit dem Heiligtum und dem Schutz ihres überlieferten Glaubens, und sich an ihre eigenen geistigen Überzeugungen heranzutasten begann, lernte sie, ihre beharrlichen
Fragen zu unterdrücken. Sie boten oberflächliche Antworten statt tief gehender Gespräche.
Sehr schnell verstand Florence die Botschaft: Gute Christen behielten ihre Zweifel für sich. Sie begruben ihren Schmerz, um Gott damit nicht in Verlegenheit zu bringen. Sie fanden Entschuldigungen für nicht erhörte Gebete. Gute Christen stellten keine Fragen, wie zum Beispiel die, ob man sich auf Gott verlassen könne oder warum Leid passierte, wenn er die Menschen doch liebte.
Glauben hieß, das Boot nicht zum Wanken zu bringen. Mit der Frage nach dem Warum sprach man Gott gleichzeitig auch sein Misstrauen aus.
Und so hielt Florence den Mund. Zumindest in der Öffentlichkeit. Nie mehr wollte sie das junge Mädchen sein, das sie damals gewesen war – das Tod und Schmerz erlebt hatte und keine Erklärung für das Warum finden konnte. Florence begann langsam, ihre Kindheit fein säuberlich wegzupacken. Sie spürte bereits in frühen Jahren, dass da draußen in der Welt irgendetwas auf sie wartete, etwas, das sie finden oder verlieren musste. Trotzdem machte sie alles mit, besuchte jeden Sonntag den Gottesdienst und gab sich den Anschein der Frömmigkeit, doch nur selten fand sie unter den guten Christen, die neben ihr auf der Kirchenbank saßen, einen Geist wie den ihrer Großmutter.
Bis der Brief aus dem Kloster eintraf.
Jemand klopfte an Florence’ Tür. Nur mühsam wurde sie wach, jede Bewegung war schmerzlich langsam. Ihr rechter Arm war eingeschlafen. Vorsichtig bewegte sie ihn. Es kribbelte wie unzählige Nadelstiche in ihrer Handfläche. Das Licht im Zimmer hatte sich verändert. Es war nicht mehr so hell. Wie viel Uhr war es jetzt? Wie lange hatte sie geschlafen? Florence fuhr sich mit der Hand über die Wange, um ihr Haar zurückzustreichen; auf ihrem Gesicht hatte sich das Muster der Chenillebettdecke eingedrückt.
Das hartnäckige Klopfen hörte nicht auf. Sie schüttelte den Kopf, um ihre Gedanken zu ordnen, rollte sich vom Bett herunter und taumelte zur Tür.
Rochers finsterer Blick begrüßte sie, als sie die Tür öffnete. »Das Abendessen wird kalt«, fuhr die Frau sie an. »Unten im Salon.«
Florence zog ihre Schuhe an und folgte der Krankenschwester den Flur entlang und die hintere Treppe hinunter. Noch immer im Halbschlaf, stolperte Florence und wäre beinahe hingefallen. Rocher beachtete sie nicht, sondern stapfte unbeirrt weiter und verschwand um eine Ecke.
Im Salon war das Essen bereits angerichtet, und Florence nahm Platz.
»Ihre Großmutter hat schon vor einer Stunde zu Abend gegessen«, murmelte Rocher
und kam damit der Frage zuvor, die Florence auf den Lippen hatte. »Noch einen Wunsch?«
»Nein. Danke, Madame Rocher. Sie sind doch nicht die Haushälterin, sondern nur die Krankenschwester.«
Wortlos ergriff Rocher die Fleischplatte und begann, ein Stück vom Rinderbraten in Salzkruste auf Florence’ Teller zu balancieren. Doch bevor sie ihn abstellte, richtete sich ihr Blick auf Florence.
Florence sah auf das Stück Fleisch und musste ein Lachen unterdrücken, weil eine Erinnerung in ihr aufstieg. Sie, Serge und sein Bruder Pierre wollten deren Eltern mit einem Essen zu ihrem Hochzeitstag überraschen. Die kleine Schwester Angélique tänzelte in der Küche umher und redete ununterbrochen. Serge und Pierre würzten den Rinderbraten und legten ihn auf das Backblech. Sie forderten Angélique auf, in den Keller zu gehen und viel Salz zu holen, während Florence sich um die Kartoffeln und das Gemüse kümmerte. Die beiden Brüder gaben sich viel Mühe, das Fleisch schön mit Salz zu ummanteln. Nach einer halben Stunde im Backofen war der Braten bereits verbrannt. Und es roch noch dazu sehr merkwürdig. Alle schauten sich fragend an, und Florence griff nach der Tüte, die Angélique aus dem Keller gebracht hatte. Es war Streusalz anstatt Meersalz.
»Stimmt was nicht?« Lucienne Rocher riss Florence aus ihren Gedanken.
»Was? Doch, doch, es ist alles in Ordnung. Ich habe mich nur an etwas erinnert.«
»Im ganzen Leben werde ich euch junge Leute nicht verstehen«, sagte sie, während sich ihre Augen in Florence’ bohrten. »Warum sind Sie hier?«
»Was für eine Frage ist denn das?«, platzte Florence heraus. Sie stützte ihre Ellenbogen auf den Tisch, zog die Serviette mit der rechten durch die linke Hand und schnappte nach Luft. Sie spürte, wie erschöpft sie war. »Ich bin hier, weil ich meine Großmutter liebe.«
Rocher stellte den Teller ab, aber ihr Blick hing nach wie vor an Florence’ Gesicht. »Tatsächlich.«
»Ja, tatsächlich.«
Rocher schwieg, starrte Florence aber weiter an, bis diese stammelte: »Und ich muss mir über ein paar Dinge klar werden. Persönliche Dinge. Ich brauche Zeit für mich.«
»Das ist wenigstens ein wenig ehrlicher.« Triumphierend nahm sie die Schüssel mit den Kartoffeln und reichte sie Florence.
»Ich wusste nicht, dass sie krank ist.«
»Krank oder nicht, sie hätte ihre Familie gebraucht. Und wird sie auch in Zukunft brauchen.«
Florence unterdrückte die aufsteigenden Schuldgefühle. »Ich weiß. Im August habe ich mit Großmutter am Telefon gesprochen. Sie sagte, sie hätte eine leichte Erkältung.«
Schwester Rocher zog eine Augenbraue in die Höhe. »Phh.«
»Das stimmt. Ich liebe sie, und ich würde alles für sie tun.«
»Alles?«
Florence nickte. »Alles.« Sie beugte sich vor. »Was kann ich tun, Madame Rocher, um meiner Großmutter zu helfen?«
Ein seltsamer Ausdruck trat auf das Gesicht der älteren Frau, als würde sie einen Geist aus einer lange tot geglaubten Erinnerung sehen. Dann entspannte sich ihre Miene wieder.
»Hören Sie zu«, sagte sie. » Und was meine Arbeit hier im Hause betrifft: Ich bin Mädchen für alles.«
Lucienne Rocher hatte sich schon abgewandt, ging mit strammen Schritten in Richtung Küche, als sie sich plötzlich umdrehte und zurück zu Florence ging. »Ihrer Großmutter geht es gut. Es wird nur ein wenig Zeit brauchen, bis sie wieder bei Kräften ist.« Sie berührte Florence vorsichtig am Arm.
Florence hob den Kopf und starrte die Pflegerin an, als befände sie sich in Trance. Sie nickte – und dann kamen die Tränen. Plötzlich umklammerte sie wie eine Ertrinkende den Arm von Schwester Rocher. »Ich mache mir solche Vorwürfe«, brachte sie mühsam hervor, »ich habe doch nur noch sie …«
»Sie ist in Ordnung.« Lucienne Rocher tätschelte ihre Hand. »Sie braucht viel Ruhe. Wollen Sie mit mir nach draußen gehen und eine Zigarette rauchen?«
»Ja.«
Sie gingen auf die Veranda, stiegen die Stufen hinunter in den Park und setzten sich auf eine Bank. Wortlos klopfte die Pflegerin zwei Zigaretten aus ihrer Schachtel.
»Wird meine Großmutter das Bett wieder verlassen können?« Ihre Stimme war nicht mehr als ein heiseres Krächzen in dem herbstlichen Garten.
»Aber ja doch.« Die Schwester sprach plötzlich ganz sanft, kein Anzeichen mehr von Feindseligkeit. Ihre glühende Zigarettenspitze drehte sich in ihre Richtung.
»Ich wusste nie, was Angst ist«, flüsterte Florence, blickte an ihr vorbei und in die Blätter über ihnen. »Ich dachte, Angst hätten nur andere. Ich habe nie verstanden, wie Menschen mit Angst leben können. Menschen, die sich vor der Dunkelheit fürchten, vor der Nacht, vor der Zukunft.« Florence sah, dass sich die Blätter leicht im Wind bewegten. »Aber jetzt schließt sie mich in einen Kokon ein, aus dem ich nicht entfliehen kann.« Sie zog an ihrer Zigarette und sah dem Rauch nach, der sich in Richtung Baumwipfel verzog.
»Das kann ich gut verstehen. Aber es ist auch eine ganz normale Reaktion. Glauben Sie mir, Mademoiselle …«
»Florence!«, unterbrach sie die Schwester. »Nennen Sie mich Florence.«
Die Pflegerin nickte, hielt ihr die Hand hin und lächelte zum ersten Mal. »Lucienne!«
Kapitel 5
Das Gesicht ihrer Mutter. Eine im Regen stehende Gestalt mit Kapuze. Ein Schatten am Fenster. Das Signalfeuer des Leuchtturms, das in der Ferne aufblitzte, ein herzzerreißender Schrei.
Sie saß aufrecht im Bett, fuhr sich mit den Händen durch die Haare und stieß einen tiefen Seufzer aus. Die Bilder des Traumes verfolgten sie. Von irgendwo tief aus ihrer Erinnerung tauchte ein keltisches Märchen auf: Einst lebte die wunderschöne Etain zusammen mit den anderen Unsterblichen – mit Angus, dem ewig jungen Weltenwanderer, Fuamnach, der dunklen Zauberin, und Midir, dem Weltenbauer – in der lichten Anderswelt Tir-na-nog …
Großmutter hatte ihr dieses Märchen vor fast zwanzig Jahren erzählt, als Florence nach dem Tod ihrer Eltern allein mit ihr im Schloss wohnte. In jener Zeit hatte alles ihr Angst gemacht – die knackenden Geräusche in dem großen alten Gemäuer, der Wind in den Blättern, das Klappern der Fensterläden. Und natürlich der Traum – vor allem der Traum.
Gemeinsam hatten sie dann über die Geschichte gesprochen, immer und immer wieder, bis sie bei den Wörtern »Geister« und »Gespenster« beide in Lachen ausbrachen. Dann hatte Großmutter ihr über das Haar gestrichen und ihr leise etwas vorgesungen, bis sie eingeschlafen war.
Die Erinnerung an diese beruhigende Berührung war für Florence immer noch lebendig. Auch hatte sie diesen Wänden ihre Geheimnisse, Träume und Wünsche anvertraut. Sie, Florence, gehörte hierher. Warum nur beschlich sie dieses Gefühl, eine Fremde in ihrem eigenen Heim zu sein?
Mit weit aufgerissenen Augen legte sie sich wieder hin und beobachtete das Spiel von Licht und Schatten an der Decke. Eine kühle Brise wehte durch das geöffnete Fenster, und in der Ferne hörte sie das Schnauben eines Pferdes und das leise Klingeln eines Telefons.
Florence fuhr im Bett hoch. Das Telefon! Sie hatte versprochen, Patrick sofort nach ihrer Ankunft anzurufen. Sie schnappte sich den Wecker auf ihrem Nachttisch und starrte die Leuchtanzeige an. Viertel vor drei. Sollte sie ihn jetzt stören oder bis zum Morgen warten?
Sie stand auf und suchte in ihrer Handtasche nach ihrem Handy. Sie musste feststellen, dass der Akku leer war. In dem riesigen Haus hatte Großmutter nur zwei Telefone – eines unten in der Eingangshalle und das andere in ihrem Schlafzimmer. Als Florence auf die Universität gegangen war, hatte sie darauf bestanden, dass Großmutter sich einen Anschluss in ihrem Schlafzimmer installieren ließ. Sie zog ihren Morgenrock an und
schlich die Treppe hinunter.
Patrick nahm beim zweiten Läuten ab.
»Ich bin so froh, dass du anrufst«, sagte er. »Ich habe mir Sorgen gemacht.«
»Es tut mir leid, dass ich mich nicht früher gemeldet habe. Ich … ich habe es vergessen.«
Es folgte eine lange Pause. »In letzter Zeit vergisst du ziemlich viel«, bemerkte er. »Du wirkst … ich weiß nicht, ein wenig distanziert. Als würde dich etwas beschäftigen, über das du nicht reden kannst.« Seine Stimme wurde rau. »Ich kenne dich, Florence. Ich weiß, wenn etwas nicht stimmt.«
Innerlich protestierte Florence. Wie konnte er sie kennen, wenn sie sich nicht einmal selbst kannte? Er kannte das Bild, die Person, die sie geschaffen hatte, und das, was er sehen wollte. Und diese Person liebte er: die geheimnisvolle Frau. Wenn sie ihn näher an sich heranließ, ihn hinter das Geheimnis blicken ließ …
Sie schob den Gedanken beiseite. »Mit mir ist alles okay.«
Ein langes Schweigen folgte. Schließlich sagte er: »Also gut.« Sie hörte ihn seufzen. »Wie geht es deiner Großmutter?«
»Sie hat eine Lungenentzündung. Schon seit drei Wochen.«
»Das tut mir leid.« Seine Stimme war sanft und mitfühlend. »Richte ihr liebe Grüße aus, okay?«
»Das werde ich.«
»Du fehlst mir.« Sie konnte ihn beinahe vor sich sehen, wie er vorgebeugt am Telefon saß, mit eindringlichem Blick, ganz auf sie konzentriert. »Bist du sicher, dass du mir nichts erzählen möchtest?«
Florence zögerte. Dann sagte sie: »Nein, Patrick. Mir geht es gut. Wirklich. Ich muss nur über ein paar Dinge nachdenken, eine Bestandsaufnahme machen. Vielleicht habe ich hier bei Großmutter die Gelegenheit dazu.«
»Also gut. Ich rufe dich morgen an. Ich liebe dich.«
Für immer?, dachte sie. Eher unwahrscheinlich. Sie schloss die Augen und schluckte den Kloß in ihrem Hals hinunter. »Ich liebe dich auch. Gute Nacht.«
Florence legte auf und schlich die Stufen wieder hoch. Sie sah den dunklen Flur entlang, straffte die Schultern, öffnete jede Tür und sah in jedes Zimmer. Neben dem Schlafzimmer ihrer Großmutter befand sich das Badezimmer. Dann zwei Zimmer, die ihre Eltern bewohnt hatten. Das erste war deren Schlafzimmer, und Florence ging hinüber in den angrenzenden dazugehörigen Salon. Dies war ein reizvoller Raum, groß, luftig, mit hoher Stuckdecke und mehreren Fenstern mit Blick auf den zwei Hektar großen Park. Er war wie das Schlafzimmer in sanften Tönen gehalten – apricot, cremefarben und ab und
zu ein Tupfer Rosa und Gelb – und atmete jene verblichene Eleganz, die von würdigem, altem Adel zeugte. Unter den wertvollen Möbelstücken stach ein Louis-XV-Sekretär ins Auge, ein Unikat mit Messingbeschlägen. Dieser Schreibtisch, der zwischen zwei Fenstern an der Stirnseite des Zimmers stand, gefiel Florence ganz besonders. Er hatte ihrer Mutter gehört. Die bequeme Sitzgruppe sowie die zwanglos verteilten Beistelltische, auf denen früher frische Blumengebinde zu stehen pflegten, vervollständigten die Einrichtung. Florence wischte mit dem Handrücken eine Träne fort, die über ihre Wange lief. Dann straffte sie die Schultern und verließ den Raum.