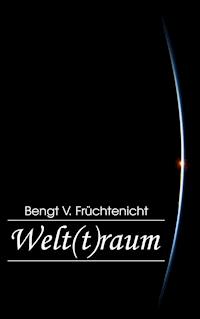
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Das Universum ist ein unwirtlicher Ort. Es ist kalt, leer und dunkel, es gibt kein Oben und kein Unten, alles dreht sich und ist unüberschaubar relativ. Gleichzeitig stellt es ein majestätisches Kunstwerk von atemberaubender Schönheit dar; es ist ein Spielplatz der Götter, der umso unwirklicher und traumartiger erscheint, je mehr wir unsere Perspektive erweitern können. Nur wo ist der Platz des Menschen in einem solchen All? Ein Streifzug durch die physikalische und philosophische Kosmologie, bei welchem Bengt V. Früchtenicht sich nicht scheut, zusätzlich zu naturphilosophischen auch ästhetische, anthropologische und bewusstseinsphilosophische Fragestellungen aufzugreifen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 685
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Welt zu sehn im Korn aus Sand
Das Firmament im Blumenbunde
Unendlichkeit halt’ in der Hand
Und Ewigkeit in einer Stunde.
~ William BLAKE1
Inhalt
Vorwort
Stochern im Dunkeln
1.
Außenschau und Innenschau
2.
Der Mensch und das All
Das unbeschriebene Blatt
Nach den Sternen navigieren
3.
Kosmologie im Spiegel kultureller Vielfalt
Die erträumte Welt
Nichtdualität
Polarität des Seins
4.
...und im Abendland
Hellenisches Erbe
Himmel und Hölle
Expansion in die Leere
5.
Kosmische Einsamkeit
Muster im Himmel
Die anderen Menschen
Ambitionen
Himmel und Erde vereinen sich
Auslotung von Raum und Zeit
6.
Kreuzfahrt im Vorgarten
Schall und Rauch
Fluchtgeschwindigkeit und Swing-by
Tulpen und Gänseblümchen
7.
Raum und Zeit vereint
Wundern wie Einstein
Krumm und schief
8.
Der Geist in der Materie?
Wahrscheinlichkeitswellen
Raum und Zeit als Schleier
Den Ball flach halten
9.
Fragen über Fragen
Passt das zusammen?
Auf der Suche nach Symmetrie
Alles schwingt
10.
Die Grenze der Wissenschaft
»Esse« und die Gegenwart des Seienden
Kausalität und Causa sui
Überlegungen zum Bewusstsein
Reise in den Welt(t)raum
11.
Dem Auge entrückt
Eine Frage der Ästhetik
...und der Authentizität
12.
Vom Leben und Sterben der Sterne
Sternenstaub
Wir basteln uns ein Sternsystem
Im Hexenkessel
Schicksale
13.
Galaxien
Blick auf die Heimat
Ferne Welten
14.
Jenseits der Galaxien
Haufen und Superhaufen
Voids und Supervoids
15.
Der Horizont des Alls
Glühende Schwärze
Alles aus Einem
Eine Vielzahl von Universen
16.
Rückkehr von den Sternen
Referenzen
Quellenverzeichnis
Index
Vorwort
»Den Weltraum erzählen.« So lässt sich die ursprüngliche Idee, aus der dieses Buch entstanden ist, wohl auf den Punkt bringen. Sie kam mir im Januar 2016 spontan und impulsiv und brachte mich dazu, sogleich mit diesem Sachbuch zu beginnen.
Um einer Erzählung über den Weltraum folgen zu können, benötigt der Rezipient einen gedanklichen Zugang. Wer sich einfach nur den Sternenhimmel oder Bilder des Hubble-Teleskops anschaut, wird vielleicht verstummen und offenen Mundes staunen – doch dieses gedankenlose Staunen ist keine gute Voraussetzung für ein Buch, das ja an das Medium der Sprache und der Gedanken gebunden ist.
Der gängigste Zugang erfolgt heute über die Naturwissenschaft – die Physik und Astronomie. Da ich selbst Physiker bin, nimmt dieser notgedrungen einen großen Platz in diesem Buch ein, etwa die Hälfte. Darin enthalten sind zunächst die allgemein-physikalischen Grundlagen der Newtonschen Gravitationstheorie, der modernen Physik (Relativitätstheorie, Quantenphysik und noch Ambitionierteres), ein wenig Thermodynamik; im speziell-astronomischen Gebiet geht es dann um Sterne, Galaxien, Galaxienhaufen und schließlich um das Universum als Ganzes, den Kosmos.
Der physikalische Zugang festigt das Verständnis und erweitert die Vorstellungskraft. Er stellt gleichsam einen stabilen Rahmen dar – und um diesen Rahmen nicht zu sprengen werde ich Sie, lieber Leser, auch mit mathematischen Formeln verschonen –, aber was man auch tut: er bleibt ein bloßer Rahmen, der allein niemals zu einer bildhaften Erzählung werden kann.
Gefüllt wird der Rahmen also über weitere Zugänge: Der Physik am nächsten ist noch der wissenschaftshistorische, welcher die Entwicklung unseres kosmologischen Weltbilds berücksichtigt. Anfangen werden wir dabei nicht erst im ausgehenden Mittelalter, auch nicht in der Antike, sondern bereits in der Steinzeit.
Seitdem sind einige Jahre vergangen, und der Mensch hat sich gewandelt. Wenn er sich biologisch gesehen nicht gewandelt haben sollte, so hat er doch wenigstens seine Welt verwandelt und denkt und verhält sich in dieser anders, als es damals der Fall war.
Das eröffnet philosophische Fragen: Wie verhalten sich Mensch und Natur, Welt und auch Weltraum zueinander? Ist der Mensch dem Universum gegenüber gleichgültig? Lässt sich diese Frage heute überhaupt noch verneinen? Gibt es einen Gott, einen transzendenten Geist, ein »Göttliches«? Was ist der Kosmos?
Weltraum und Weltbild hängen eng miteinander zusammen. Zum Weltbild wiederum gehört das Verständnis des Menschen, das Menschenbild: ist er mutierter Primat oder Krone der Schöpfung – oder von beidem etwas? Kann die Naturwissenschaft die gesamte Wirklichkeit abbilden oder nur einen Teilausschnitt von ihr? Für den letzteren Fall: Wo liegt die Grenze der empirischen Forschung, welche sie prinzipiell nicht überschreiten kann, ja, niemals können wird?
Im Lauf der Diskussion werde ich diesbezüglich dafür plädieren, dass sich das Bewusstsein niemals auf Gehirnaktivität reduzieren lassen wird. Doch dabei wird es nicht bleiben: Wir werden sehen, dass der immaterielle Geist nicht bloß passiv den Erscheinungen der Welt unterworfen ist, sondern mit ihnen interagiert. Derartige Erkenntnisse können die Richtung, die unsere Erzählung nimmt, beeinflussen, denn sie betreffen unser grundlegendes Gefühl des Inder-Welt-Seins und damit auch das, was wir im Weltraum erblicken, wenn wir nach oben sehen; dieser stellt, wie wir noch sehen werden, stets eine hervorragende Projektionsfläche für menschliche Sehnsüchte dar.
Abgerundet wird die Erzählung als solche aber erst von dem ästhetischen Zugang, der darum bemüht ist, zu beschreiben, wie die Erscheinungen des Weltalls auf uns wirken und was sie in uns auslösen. Der »Welttraum« ist dabei niemals zu verstehen in dem Sinn, dass die Welt nur eine Illusion wäre. In erster Linie bietet sich dieses Wortspiel an, um zwischen der nüchtern-naturwissenschaftlichen und der schwärmerisch-ästhetischen Perspektive zu unterscheiden. Doch wer sich Realist nennt und gedanklich in den Weltraum begibt, der muss sich schließlich auch die Frage gefallen lassen, wie realistisch ihm dieses Universum, in dem fast nichts – und andererseits alles Mögliche – zu sein scheint, wirklich noch erscheinen kann. Selbst, wer sämtliche Ergebnisse der Physik in Frage stellt, wird nicht leugnen können, dass der Nachthimmel nun einmal dunkel ist.
Der Text ist grob in drei Teile gegliedert, welche jedoch aufeinander aufbauen. Teil I ist in erster Linie historisch und philosophisch. Er bildet vor allem für die philosophischen Überlegungen das Fundament. Teil II ist, bis auf das letzte Kapitel, physikalisch. Das letzte Kapitel setzt sich dann eben mit jener »Grenze der Wissenschaft« auseinander, von der ich eben sprach – hierbei spielt das menschliche Bewusstsein eine wesentliche Rolle. Teil III springt thematisch endgültig in den Weltraum. Das erste Kapitel gliedert sich dabei noch an das Ende des zweiten Teils an. Anschließend werden die Größenskalen immer größer – von den Sternen bis hin zum gesamten Universum – und die Schilderung wechselweise physikalisch und ästhetisch, bis das Thema Paralleluniversen schließlich wieder philosophische Fragen aufwerfen wird. Das letzte Kapitel stellt in erster Linie ein Fazit dieses facettenreichen Buchs dar.
Ich entschied mich für das Wagnis, die Illustrationen per Hand anzufertigen, um ihnen einen lebendig-spielerischen Charakter zu verleihen. Dieser erschien mir im Rahmen dieses Buchs passender als die Verwendung eleganter, aber steril und leblos wirkender Vektorgrafiken.
Schon jetzt verstehe ich mich als Autor, der mit seinen Werken wächst. Da ich Physik, aber nicht Philosophie studiert habe, gibt es für mich vor allem in Bezug auf letztere noch viel zu lernen. Bei Fragen, Anregungen und Kritik freue ich mich auf Ihre Nachricht an: [email protected]
Oldenburg, 23.05.2017
I Stochern im Dunkeln
Sonnenaufgänge werden heute oft nur als »schön« oder »romantisch« beschrieben. Für die ersten Menschen, welche sich mit der Sonne bewusst auseinandersetzten, muss es sich dagegen um ein alltägliches, aber dennoch großes Wunder gehandelt haben. Es erscheint nur verständlich, wenn unser Stern mit einem göttlichen Wesen assoziiert wurde, scheint er doch heller als alles andere und ist essenziell für das Leben auf der Erde. Wir spüren seine Wärme direkt, wenn wir aus dem Schatten treten und seine Strahlen auf unsere Haut treffen. Wie ein Gott erscheint uns die Sonne gleichzeitig unerreichbar fern und so nah, dass kein Haar mehr dazwischen passt. Heute wissen wir, dass es sich bei der Sonne um einen Feuerball handelt, welcher um ein Vielfaches größer ist als unser Planet. Sie ist vielleicht kein göttliches Wunder mehr, aber noch immer ein Naturphänomen, und es ist doch faszinierend, wie eng unser Leben und Schicksal mit diesem Feuerball in Millionen Kilometern Entfernung verflochten ist.
Bild: NASA/Ben Smegelsky (zugeschnitten)
Der Erdmond treibt im Wolkenmeer. Als Gestalt der Nacht verbinden wir den Mond mit der Dunkelheit und vor allem mit dem Mysteriösen, dem Mystischen, welches dem weiblichen Prinzip viel näher steht als dem männlichen – dem Starken, Kraftvollen, wie es durch die Sonne gegeben ist. Insofern überrascht es eigentlich, dass »der« Mond in der deutschen Sprache maskulin und »die« Sonne feminin ist (im Französischen beispielsweise ist es umgekehrt – »le soleil« und »la lune«).
Bild: Anders Jildén
Auf der Südhalbkugel lässt sich die Milchstraße deutlich besser am Himmel erblicken als auf der Nordhalbkugel, weil man dort in Richtung ihres Zentrums schaut, welches hier zwischen den Kakteen hell aufleuchtet. Dagegen blicken wir auf der Nordhalbkugel nach außen. Die dunklen Bereiche sind riesige Staubwolken. Sie blockieren das Licht der hinter ihnen liegenden Sterne wie Wolken in der Erdatmosphäre das Licht der Sonne. Sich vorzustellen, dass so ziemlich alle Sterne am Nachthimmel Teil der Milchstraße sind, ist schwindelerregend – denn es bedeutet, dass die Milchstraße so massiv groß ist, dass diese einzelnen, weit voneinander entfernt aufglimmenden Lichtpunkte zu einem kontinuierlichen Leuchten verschmelzen können. Fairerweise ist hier das Zugeständnis zu machen, dass auch einige der Wolken leuchten. Als eine gewaltige, unüberbrückbare Kluft erscheint die Milchstraße trotzdem.
Bild: »skeeze«
1. Außenschau und Innenschau
Wir träumen von Reisen durch das Weltall – ist denn das Weltall nicht in uns? Die Tiefen unseres Geistes kennen wir nicht – nach innen geht der geheimnisvolle Weg. In uns, oder nirgends ist die Ewigkeit mit ihren Welten – die Vergangenheit und Zukunft. Die Außenwelt ist die Schattenwelt – sie wirft ihren Schatten in das Lichtreich. Jetzt scheints uns freilich innerlich so dunkel, einsam, gestaltlos – aber wie ganz anders wird es uns dünken – wenn diese Verfinsterung vorbei, und der Schattenkörper hinweggerückt ist. Wir werden mehr genießen als je, denn unser Geist hat entbehrt.
~ NOVALIS: Blütenstaub2
Über unseren Häuptern eröffnet sich in einer sternenklaren Nacht die Tiefe einer ungeheuren Weite. In dieser Weite leuchten viele weißliche Punkte. Sie ist erfüllt von Leuchten, doch das ändert nichts an der Tatsache, dass all diese Punkte weiter voneinander entfernt sind, als wir jemals in unserem Leben reisen werden. Allesamt bedeuten sie nur ein kurzes Aufblitzen in einer gewaltigen Leere.
Viele Menschen sagen, dass sie sich diese ungeheuerliche, diese gigantische Weite nicht vorstellen können. Dass man vor dieser Aufgabe zurückschreckt, ist nur nachvollziehbar. Im Gegensatz zu jeder irdischen Weite besitzt diese Weite keinen erkennbaren Horizont, den man mit den eigenen fünf Sinnen wahrnehmen könnte. Anscheinend spiegelt eine pauschale Ablehnung dieser Aufgabe ein Gefühl der Trennung wider: ein Gefühl des Getrenntseins von der Leere und Weite des Alls. Dies hat wohl damit zu tun, dass wir mit unseren Augen zwar das Licht von dutzenden von Lichtjahren entfernten Sternen empfangen können, aber kaum Bezüge herstellen können zu Dingen, die wir benutzen oder berühren können, die für uns von praktischem Nutzen sind, sofern wir uns nicht aktiv mit Astronomie, Astrologie oder ähnlichem auseinandersetzen. Außerdem fühlen wir stets den festen Boden unter unseren Füßen oder zumindest das Band der Gravitation, über welches wir mit der Erde unzertrennlich verbunden sind. Es fällt schwer, sich dieses wegzudenken, und unseren Heimatplaneten gleich mit. In diesem Fall gäbe es nicht viel, das noch übrig bliebe.
So sind die Sterne – bei schlechtem Wetter jenseits der Wolkendecke – immer da, Nacht für Nacht, und kaum jemand kümmert sich um sie, es sei denn vielleicht, er befindet sich in romantischer Stimmung an einem Lagerfeuer oder übernachtet unter freiem Himmel. Die Sterne tun nicht viel für uns. Sie bringen heutzutage, wo die Navigation nach Sternen lange durch den Kompass und jüngst durchs GPS ersetzt wurde, wenig unmittelbaren Nutzen. Als Kalender oder Uhr haben sie ebenso ausgedient. Sie sind einfach nur da, und um sie schätzen zu lernen, reicht es nicht, nur nach draußen zu blicken – man muss auch Innenschau betreiben. Nur, wer es schätzt, die Ruhe in sich selbst zu suchen, wird der ewigen Ruhe des Sternenhimmels nachhaltig etwas abgewinnen können.
Schnell zeigt sich dann, dass die himmlische Ruhe jene Ruhe einer toten Wüste aus Gas und Gestein ist, denn Vorstellungen über uns bergende Sphären, wie sie bis zu Kopernikus, Newton und Galilei üblich waren, gibt sich heute niemand mehr hin. Dennoch liegt in dieser Wüste, die vielmehr primordiales Chaos denn beseelter Kosmos zu sein scheint, der Ursprung unseres Seins und damit der ständige Beweis, dass aus dem Tod das Leben entsteht. Denjenigen, der auf diese Weise ins Weltall blickt, wird vielleicht die Ahnung rühren, dass er von der tödlichen Weite dort oben nicht getrennt, sondern allgegenwärtig von ihr umgeben ist, dass er, auf einem kleinen blauen Planeten sein Leben lebend, tief eingebettet ist in die Weite der Schöpfung. Wer auf diese Weise ins Weltall blickt, schaut auch hinein in sich selbst.
Manche Menschen wollen gar nicht erst versuchen, sich diese interstellare (von Stern zu Stern) oder intergalaktische (von Galaxie zu Galaxie) Weite vorzustellen – oder gar die noch weiteren Voids, Wüsten des Weltraums, abstrakt anmutende Räume schier unendlicher Weite, in denen der Himmel so leer und schwarz ist wie nirgendwo sonst –, weil sie ihnen Angst macht. In diesem unseren Weltbild, in welchem der heimatliche Kosmos längst verlorengegangen ist, erscheint auch das nur allzu verständlich. Wenn es Ihnen, lieber Leser, ähnlich geht, dann möchte ich mich für die obige Verwendung von Wörtern wie »ungeheuerlich« und »gigantisch« entschuldigen. Sie klingen, als ob Sie gleich einem Monster gegenübertreten müssten, das gleichzeitig riesengroß wäre.
Agoraphobie, die Angst vor weiten Plätzen, ist den Meisten vermutlich ein Begriff. Weniger bekannt ist die Apeirophobie, abgleitet vom Begriff Apeiron (von altgriechisch τὸ ἄπειρον, »das Unbegrenzte«), die Angst vor der Unendlichkeit sowohl im physischen, als auch im spirituellen, im kosmischen Sinn3: das unbehagliche Gefühl beim Gedanken an die Ewigkeit; der Schwindel erregende Strudel der Verwirrung, zu dem unsere Existenz zu werden scheint, wenn wir im falschen Moment über sie nachsinnen. Dieses Gefühl befällt jeden irgendwann mal – ohne dass es sich dabei gleich um eine psychiatrische Phobie handeln muss – und auch Astronomen und Philosophen bleiben davon nicht verschont. Als zu Zeiten des Astronoms Johannes Kepler (1571-1630) die Frage im Raum stand, ob das Weltall unendlich und die Sonne nur ein Stern wie jeder andere sei, gestand dieser, dass er »einen dunklen Schauder« empfinde bei dem Gedanken, sich »in diesem unermesslichen All umherirrend zu finden«4 .
Von dieser Weite, wie sie uns die moderne Astronomie vermittelt, sind wir tagein, tagaus umgeben – ob wir es wollen oder nicht. Sie beginnt direkt vor unserer Haustür, man kann sie nachts durchs Fenster sehen, und sie ist somit all-täglich wie ein nächtlicher Traum, oder wie die Erde, mit der wir ununterbrochen in Kontakt stehen. Insbesondere lässt sich daraus schlussfolgern, dass sie uns nicht plötzlich etwas antun wird, wie sie ja schon unser ganzes Leben friedlich über uns schwebte, egal, ob wir uns jemals um sie geschert haben oder nicht. Das Unangenehme, welches bei dem Sinnieren über diese Dinge an die Oberfläche tritt, kommt weder vom Himmel über uns noch aus der Ewigkeit, sondern stets aus den Tiefen unseres eigenen Inneren, und wenn es erscheint, ist das ein Akt der Befreiung, auf den einzulassen sich lohnt. Was wir in der Weite des Alls suchen, können wir – im übertragenen Sinn – in uns selbst entdecken, wobei wir hier vorsichtig sein müssen, aber diesen Aspekt werden wir noch zur Genüge beleuchten. Zunächst fangen wir harmloser an und betrachten kurz die Frage, inwiefern wir die Weite des Alls auch im profanen, im ganz und gar physikalischen Sinn »in uns«, sprich in unserem Körper finden können.
Im Jahr 1905, lange bevor er als Mitbegründer der sogenannten »Deutschen Physik« mit Hitler persönlich bekannt war5, beschrieb Philipp Lenard das Atom als »leer wie das Weltall«6. Damit gab er seinem Erstaunen über die Entdeckung Ausdruck, dass der allergrößte Teil der in einem Atom befindlichen Masse, der Kern, in seiner Ausdehnung viel kleiner ist als der Durchmesser des gesamten Atoms, welches sich aus ebendiesem Kern und einer weitaus größeren Hülle zusammensetzt, in der aber lediglich ein paar leichte, flüchtige Elektronen herumschwirren.
Zum allergrößten Teil besteht Materie also aus leerem Raum, aus Energie und aus den Kräften, die sie zusammenhalten. Die Atomkerne sind in diesem Raum verteilt wie die Sterne am Himmelszelt, in einer quantitativ geringeren, ihrem unermesslichen Wesen nach aber vergleichbaren Leere. Ein Atomkern treibt dieser Vorstellung zufolge einsam durch den Raum wie ein Stern, umkreist lediglich von ein paar Elektronen, Planeten gleich.
Dass ich, der demzufolge hauptsächlich aus nichts besteht, nicht einfach mit dem Stuhl verschmelze, auf dem ich sitze, dass dieser Stuhl nicht einfach durch den Fußboden fällt, anschließend in die Erde sinkt und ich mir schließlich, am glutheißen Erdkern angelangt, das Gesäß ansenge, das liegt vor allem an den Elektronen in der Atomhülle, die noch viel kleiner und leichter sind als der Kern, die einem Material aber seine Beschaffenheit geben, indem sie in gegenseitiger Wechselwirkung für einen mikroskopischen, aber unüberwindlichen Abstoßungseffekt sorgen. Wenn es diese Abstoßung nicht gäbe, dann würden Sie, lieber Leser, wie ein Geist durch Wände gehen können, sofern die Wand noch nicht in sich zusammengefallen wäre und sich, wie Sie auch, bereits in Richtung Erdkern verabschiedet hätte. Auch Sie bestehen also vor allem aus Leere, aus Weite und Energie, wie alles andere auch.
Später hat die Quantenmechanik zudem gezeigt, dass sich Atome und andere Teilchen verhalten können wie Wellen auf dem Wasser, die sich, je nachdem, wie sie aufeinander zu laufen, einerseits gegenseitig verstärken, andererseits aber auch auslöschen können. Dieses Phänomen wird allgemein als Interferenz bezeichnet. So kann aufgrund dieses Welle-Teilchen-Dualismus in einem geschickten Versuchsaufbau auch Materie plötzlich verschwinden. In der Forschung hat sich in dem Bestreben, diese Eigenschaft bei möglichst großen Molekülen nachzuweisen, unter manchen Arbeitsgruppen ein regelrechter Sport entwickelt.8
Neben den eben genannten Aspekten lieferten Relativitätstheorie und Quantenphysik noch bahnbrechendere Erkenntnisse, aber zunächst halten wir fest: Materie ist somit Energie, besitzt zudem einen wandelbaren, fast alchemistisch wirkenden Charakter, der sie in Wechselwirkung mit anderen Teilchen erscheinen und verschwinden lässt, und unter diesem Gesichtspunkt gibt es in der Welt überhaupt nichts Anderes außer Leere, Weite und besagter Energie, die mittels einer Vielzahl von Wechselwirkungen das bunte Farbenspiel erzeugen, welches wir unseren Kosmos nennen. So ähnlich lauten auch manche Aussagen aus »esoterischer« Richtung; wie gesagt wollen wir diese Begriffe zunächst nur profan-physikalisch verstehen.
Dass wir diese Leere nicht sehen können, dass also überhaupt etwas sichtbar ist und nicht einfach alles unsichtbar, liegt daran, dass Photonen, Lichtteilchen, mit Elektronen wechselwirken können, wobei sie verschluckt, ausgesandt oder reflektiert werden, und daran, dass unser Gehirn das Licht, welches auf die Netzhaut in unseren Augen trifft, eben so verarbeitet, wie es sich in Millionen und Abermillionen Jahren der Evolution als hilfreich für unser Überleben erwiesen hat. Ähnliches gilt für unsere übrigen Sinne, vor allem den Tastsinn (der physiologisch nicht als ein Tastsinn existiert, sondern sich aus vielen taktilen »Untersinnen« zusammensetzt9 ), welcher uns von der Weite zwischen zwei Atomkernen nicht viel spüren lässt, insbesondere bei harten Materialien wie Stahl und Diamant, oder auch bei einem schmerzvollen Bauchklatscher vom Dreimeterbrett. Dennoch sollte nun klar sein, dass es zumindest langfristig, im Gesamtbild, vor der Weite und Leere gar kein Entkommen gibt, dass sie uns allgegenwärtig umgibt, dass sie in uns ist und es schon immer war. Gleichzeitig tut sie uns nichts an, genauso wenig, wie sie all unseren Vorfahren etwas angetan hat, genauso wenig, wie hinter Ihrem Rücken, lieber Leser, gleich ein riesenhaftes Monster erscheinen wird. Wir werden weder in den Erdkern fallen noch ins Weltall gesogen, weil die physikalischen Gesetze sind, wie sie schon immer waren, seit Anbeginn der Zeit. Ohne die gleichen Naturgesetze, die das Universum in all seiner Pracht geschaffen haben, könnten wir nicht existieren. Ohne sie hätten wir uns nicht entwickeln können, wie wir heute sind, und würden uns nicht so entwickeln, wie wir es zu jedem Zeitpunkt der Gegenwart unaufhörlich tun.
Als Gegebenheiten, die dem materiellen Geschehen übergeordnet sind, sind die Naturgesetze selbst immateriell und somit geistiger Art, denn bloße Materie kann weder denken noch ausrechnen, wie sie sich zu verhalten hat. Der Glaube an die Existenz universeller Naturgesetze ist folglich der Glaube an einen transzendenten Geist, welcher der Welt ihre Gestalt gibt – ein Umstand, der nur allzu gern übersehen wird, und auf den wir noch öfters zurückkommen werden.
2. Der Mensch und das All
Der Mond stand als scharf umrissene Sichel am kristallklaren Himmel. Die Sterne schienen mit solch vehementer, konzentrierter Macht, dass es abwegig schien, die Nacht dunkel zu nennen. Die See lag still da, gebadet in ein scheues, leichtfüßiges Licht, ein Ballett aus Schwarz und Silber, das rund um mich wogte bis ins Unendliche. Unermesslich schien der Himmel über und der Ozean unter mir. Halb war ich fasziniert gebannt, halb vor Schrecken starr. Ich fühlte mich wie der heilige Markandeya, der dem schlafenden Vishnu aus dem Munde fiel und so das ganze Universum bis in die kleinste Kleinigkeit erblickte. Beinahe wäre der Heilige vor Schrecken gestorben, doch im letzten Augenblick erwachte Vishnu und holte ihn zurück in seinen Mund.
~ Yann MARTEL: Schiffbruch mit Tiger10
So ziemlich alles, was wir über das Weltall wissen, entstammt den Forschungsergebnissen von Wissenschaftlern, ihren altertümlichen Vorgängern und vielleicht dem einen oder anderen Hobby-Astronomen. Hätten wir diese Informationen nicht, wären uns aus unserer alltäglichen Erfahrung nur Sonne, Mond und Sterne – eventuell unterteilt in Planeten und Fixsterne – bekannt und vielleicht der seiden schimmernde Ausschnitt der Milchstraße, welchen wir bei hinreichend klarem Himmel von der Erde aus sehen können. Dazu kämen Polarlichter und Sternschnuppen, welche zwar durch Gegebenheiten des Weltraums ausgelöst werden, letzten Endes jedoch irdische Phänomene darstellen, und vielleicht noch einige andere Erscheinungen.
Bei alledem wüssten wir jedoch nichts von der Größe der anderen Planeten, würden nicht ahnen, dass die Sonne nicht um uns kreist, sondern wir um sie. Vor allem aber würden wir die unvorstellbare Größe des Universums massiv unterschätzen. Dass sämtliche Himmelskörper sich weit entfernt von uns befinden, könnten wir vielleicht noch anhand dessen erahnen, dass sie sich nicht zu bewegen schienen, egal, wie schnell wir selbst unterwegs wären – aber unterschätzen würden wir das Weltall trotzdem.
Befänden wir uns auf einem technologischen Stand, der dem vor einigen tausend Jahren entspräche, dann würden wir unsere höchste Geschwindigkeit vermutlich auf dem Rücken eines Pferdes erreichen und könnten aufgrund eines sich laufend verändernden Blickwinkels wohl die Bäume im Wald vorbeiziehen sehen, nicht aber die untergehende Sonne, die zwischen ihnen hervorblitzen und dabei vergleichsweise statisch wirken würde. Während die Bäume nur so vorbei rasten, begleitet vom Geklapper der Hufe, würde die Sonne uns ihr Licht stets vom gleichen Ort aus leuchten – einmal abgesehen von ihrem langsamen Untergang Richtung Horizont. Das Gleiche träfe dabei auf große, jedoch in erreichbarer Ferne befindliche Objekte zu, wie zum Beispiel einen Gebirgskamm, sodass wir ohne fortgeschrittene mathematische Berechnungen lediglich zu dem Schluss fähig wären, dass die Himmelskörper noch weiter entfernt liegen müssen, weiter als der Horizont, vielleicht auch weiter noch als das Ende der Welt, und höher als der höchste Berg, höher wohl, als ein Vogel fliegen kann.
Jede dabei erdachte Entfernung bliebe im Vergleich zur realen Situation aber noch immer eine maßlose Untertreibung, denn nie kämen wir auf die Idee, dass – aus der Distanz betrachtet – diese unsere Erde nur ein Staubkorn ist in einem gigantischen Universum, getrieben von Gezeiten, welche um ein Vielfaches mächtiger sind als alles Irdische, mächtiger womöglich, als wir es auch den potentesten unserer Gottheiten je zugetraut hätten.
Damals waren aber auch wir noch nicht so mächtig, wie wir heute zu sein scheinen: Überall greift heute der Mensch ein, überall kontrolliert er, überall leitet er, führt oder bildet sich zumindest ein, es zu tun. In Europa muss man schon lange suchen, um an einen Ort zu gelangen, an welchem der Mensch noch nicht seine Spur hinterlassen hat. Wie subtil, wie vergänglich, wie rar gesät sind da die Spuren anderer Tiere? Heute haben wir wenigstens theoretisch die Möglichkeit einer globalen nuklearen Katastrophe. Wir selbst sind so mächtig geworden wie die einstigen Götter des Altertums, dabei jedoch nur allzu sterblich geblieben, und um das Ausmaß der Schöpfung wieder schätzen zu lernen, müssen wir mit Sicherheit genauer hinschauen, als es früher der Fall war – oder aber einen Blick in den Weltraum werfen und uns vergegenwärtigen, dass das Universum uns nichts schuldet, sondern dass wir selbst es sind, die für unser Schicksal die volle Verantwortung tragen. Das mag etwas abgedroschen klingen, ist jedoch ein Fakt, welcher umso greifbarer wird, je weiter der Mensch technologisch voranschreitet, je fataler die Folgen von Fehlentscheidungen sich auswirken können. Mit möglichen Weltuntergangsszenarien möchte ich mich an dieser Stelle jedoch nicht zu eingehend auseinandersetzen; sie gehören nur bedingt in dieses Buch, denn es soll zunächst auf einer persönlicheren Ebene wirken.
Das unbeschriebene Blatt
Wann aber wurde der Mensch zum Menschen? Zu welchem Zeitpunkt der Evolution hörte er auf, einfach nur Tier zu sein? An welchem Tag brach er aus dem Kreislauf der Natur heraus, um sich schließlich, wie es scheint, mehr und mehr gegen sie zu wenden?
Den dieser Entwicklung zu Grunde liegenden Prozess bezeichnet man, zumindest in biologischer und soziologischer Hinsicht, als Hominisation. Heute lässt sich kaum mehr bestreiten, dass Mensch und Natur – der gewöhnlichen Auffassung des Begriffs »Natur« gemäß – zwei unterschiedliche Dinge sind, während das offensichtlich nicht immer der Fall gewesen sein kann. Die Natur ist älter als der Mensch und wer nicht gerade die Evolution bezweifelt, kann nicht leugnen, dass wir einst ein Teil von ihr waren.
Doch eines Tages aßen Adam und Eva, getrieben von ihrer menschlichen Neugier, verführt von der Schlange, den Apfel vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Daraufhin wurden sie aus dem Garten Eden, aus dem paradiesischen, jedoch indifferenten Einssein mit der Natur verstoßen.11 Hiermit bezahlten sie den Preis für die Erkenntnis ihrer selbst als selbstbestimmte Menschen, die sich nun, gebunden an die Vergänglichkeit ihres Fleisches, der Natur und ihrem Schöpfer gegenüberstehend sehen und sich auf eigene Faust behaupten müssen – das Erwachen des menschlichen Intellekts.
Menschwerdung beginnt dort, wo sich der von Naturzwängen befreite Mensch durch die Offenheit seines Geistes als Individuum erfährt, das in seinem Wesen radikal von allem anderen getrennt ist.12
Die Steinzeit ist insofern spannend, als sich in ihr ebendieser Wandel vollzog, als der Mensch vom Tier schied. In ihr wurde die Flamme des menschlichen Geistes entfacht und nahm nach und nach Besitz von der Welt, bis sie zu einem lodernden Feuer wurde, welches den Menschen an die Spitze, auf den Thron der Nahrungskette setzte, mit Zepter, Krone und allem, was dazugehört.
Für unseren zivilisierten, aber zweifelsohne auch konditionierten Verstand ist es vielleicht möglich, einzelne Aspekte der Hominisation intellektuell nachzuvollziehen. So gilt beispielsweise noch vor der Entdeckung des Werkzeugs der aufrechte Gang als ein wesentliches Element: Abgesehen von der offensichtlichen Möglichkeit, die Hände für andere Tätigkeiten, vor allem eben Werkzeuge, benutzen zu können, machte dieser es durch eine resultierende Einengung des Geburtskanals notwendig, dass die Gehirnentwicklung im Leben eines Menschen im Vergleich zu anderen Tieren eher verzögert stattfindet (wenngleich alle Gehirnzellen in einem unentwickelten Stadium bereits vor der Geburt vorhanden sind). Damit die Geburt eines Menschen überhaupt möglich blieb, musste ein wesentlicher Teil auf die postnatale Zeit verschoben werden.13 Durch diesen Umstand bleibt dem Menschen jedoch mehr Zeit, von seiner Umwelt zu lernen, weniger auf die Vorprogrammierung durch Instinkte angewiesen zu sein.14 Andererseits wächst er langsamer und ist als unbeschriebenes Blatt zunächst schutzbedürftiger.15
Alle unsere Anschauungen jedoch einmal fallen zu lassen und die Welt zu betrachten, wie ein Tier es tut, instinktiv eben, das fällt uns nicht so leicht. Automatisch verpacken wir unsere Gedanken in Worte, und wenn wir diesen Worten Gehör schenken, ist der Versuch bereits gescheitert, denn als der Mensch noch Tier war, gab es keine Sprache. Wie dachten wir aber, bevor es die Sprache gab?
Für Wissenschaftler, die sich mit diesen Fragestellungen beschäftigen, ist heute das größte Problem zumeist die eigene Modernität, die eigene moderne Denkstruktur... Unser heutiges Wissen verbaut uns in gewisser Hinsicht den freien Blick auf die Denkstrukturen früherer Menschheitsepochen. Wir sehen häufig den Wald vor lauter Bäumen nicht.16
Wenn ein Hund freudig ins Auto seines Besitzers springt, dann fragt er sich nicht, wie das Auto funktioniert. Er kennt nicht einmal das Funktionsprinzip des Rads, sondern ist zufrieden damit, einfach nur mitfahren zu dürfen, auch ohne das Reiseziel zu kennen. Es ist anzunehmen, dass die entferntesten unserer Vorfahren einen ähnlichen Blick auf die Welt pflegten. Der Mensch saß nicht immer auf seinem Thron, von wo aus er dann alle anderen Geschöpfe dominierte. Auf dem Weg dorthin verbrachte er zunächst Hunderttausende von Jahren damit, sich in der Wildnis zurechtzufinden, sich in ihr zu behaupten, und war mit dieser Beschäftigung wohl gänzlich ausgebucht. Dabei stellte er einen Teil dieser Wildnis dar, und genau wie er sich selbst als organisches Lebewesen zu erleben begann, erlebte er die Welt um sich herum: als Organismus, in welchem alles miteinander zusammenhängt, verwoben ist, sodass sich die Frage nach dem kausalen Ursprung einzelner Phänomene noch gar nicht ergab.17
»Das Fühlen und Denken unserer Vorfahren war stark räumlich geprägt.«18 Durch den aufrechten Gang gewann für den Menschen eine zusätzliche räumliche Dimension an Bedeutung, nämlich die der Höhe. Der Mensch konnte sämtliche seiner Gliedmaßen verwenden, um sich zu bücken, zu strecken, zu hocken oder sich schlafen zu legen. Insbesondere seine Arme besaßen dabei eine große Bewegungsfreiheit. Ähnlich komplizierte Raumverhältnisse fanden nur Baumbewohner beim Klettern vor.19
Während diese Raumwahrnehmung unserer heutigen entspricht, war das Zeitgefühl des Menschen damals noch von einer völlig anderen Art als heute. In seinem Essay Bætyl: Eine kurze Geschichte der Astronomie in der Steinzeit (2008) erklärt Theo Köppen, dass die Zeit sozusagen im Raum eingebettet gewesen sei. Anstelle der abstrakten Vorstellung, die wir heute von einer Zeitspanne haben, hätten die Menschen der Steinzeit lediglich über die eigenen Strapazen des Weges von einem Ort zum anderen sinniert, ohne sich nach der Dauer desselben zu fragen.20 Wie sehr wir auch heute noch den Lauf der Zeit mit der Bewegung durch eine räumliche Dimension assoziieren, spiegelt sich in Begriffen wie »Zeitraum«, »Zeitspanne« oder auch »Zeitfenster« wider. Ein Fenster ist schließlich auch eine Öffnung, durch die wir hindurchsehen und den Raum um uns erblicken können.
Der Zeitbegriff, den unsere Vorfahren nach und nach entwickelten, war zunächst nicht von geradlinigen Verläufen, sondern von zyklischen Mustern geprägt. Diese ließen sich in der Natur in eindrucksvoller Manier finden. Allen voran steht hier der Wechsel von Tag und Nacht, welcher sich stets in einem hohen Tempo vollzog und nicht nur radikale Auswirkungen auf die Erscheinung der Welt, sondern auch auf das Erlebnis des eigenen Körpers und Bewusstseins hatte, nämlich das der Müdigkeit, des Schlafes, des mysteriösen Traumes und schließlich des Erwachens.21 Mit geringerer, aber dennoch deutlich beobachtbarer Bedeutung folgten diesem kosmischen Zyklus der der Jahreszeiten und die Mondphasen.
In einem zyklischen Erleben der Zeit befindet sich die Gegenwart nicht eingepfercht irgendwo zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen Anfang und Ende, wie wir sie heute wahrnehmen. Stattdessen ist jeder Tag eine Wiederholung des vorherigen und eine Vorhersage des folgenden, sodass es außer der Gegenwart gar keine andere Zeitform gibt (und somit eigentlich auch keine Gegenwart, sondern bloß Zeitlosigkeit). Vergangenheit und Zukunft existieren nur in unseren Köpfen und erfordern bereits ein hohes Maß an Abstraktion. Für die Steinzeitmenschen hingegen war alles zeitlose Gegenwart.
Heute ist unumstritten, dass die Astronomie die erste wissenschaftliche Disziplin darstellte. Anscheinend hat der Sternenhimmel die vorgeschichtlichen Menschen zu intellektuellen Höchstleistungen inspiriert. Dieser Inspiration lag einerseits mit Sicherheit die Projektion einer anderen Welt, eines Jenseits, eines Himmels in ebendiesen zu Grunde. Andererseits gibt es kaum eine andere Erscheinung in der Natur, welche so konstant, so universell ist und sich – mit ausreichend Geduld – so leicht in Zahlen fassen lässt. So hat das Jahr 365 Tage, der Mondzyklus ungefähr 30, und so weiter. Die Zahlen und Zahlensysteme entstammen wohl dem Handel, fanden in der Astronomie aber ihre erste wissenschaftliche Anwendung.22
Auch für mich als Autor dieses Buchs eignet sich das Weltall hervorragend als Projektionsfläche. Andernfalls würde ich es nicht schreiben. Was für eine derartige Projektion jedoch notwendig ist, ist die intellektuelle Trennung von Himmel und Erde, und die Frage ist, wann der Mensch, welcher die Welt bis dahin als Einheit erlebte, sich zu diesem Schritt genötigt sah.
Während Religionshistoriker oftmals argumentieren, dass der sakrale, ehrfurchtgebietende Charakter des Himmels ausschlaggebend für diese Teilung der Welt gewesen sei, weist Köppen darauf hin, dass auch vor allem das Wasser, die Bäume und die Berge auf eine ähnliche Weise verehrt wurden und dieser Umstand allein nicht für den vorgenommenen, in gewisser Hinsicht ja auch schmerzvollen Prozess der Teilung verantwortlich gemacht werden könne.
Das Gleiche treffe auf das ebenso häufig bemühte Argument zu, dass die Steinzeitmenschen die Bedeutung des Himmels (das heißt seiner saisonabhängigen Erscheinung) für den Ackerbau erkannten und ihn fortan genauer studierten.23 Gerade durch den Umstand, dass dieser Himmel systematisch mit der irdischen Welt wechselwirkt, müsste er schließlich eher mit ihr verbunden zu sein scheinen als von ihr getrennt.
Stattdessen, so Köppen, biete sich eine geschlossenere Theorie an: Vom Himmel stürzende Meteoriten wurden beobachtet und für Zeichen aus einer anderen Welt gehalten. Da sie von oben gekommen waren, mussten sie vom Himmel stammen, und somit musste der Himmel mehr sein, als das bloße Auge zu sehen vermochte: eine eigene Welt, nicht weniger substanziell als die irdische, wie durch die steinharten Meteoriten schließlich bewiesen war.24 Gleichzeitig schien dieser Himmel, wenigstens für irdische Geschöpfe, unerreichbar zu sein. Dies ist ein Gedanke, welcher wirklich Sehnsucht zu wecken vermag. Der Mensch wird sich in seiner Begrenztheit, in seiner Endlichkeit bewusst. Diese metaphysische Erkenntnis hatte zweifelsohne eine Auswirkung auf das magische, animistische Denken unserer Vorfahren.
Sowohl Meteoriten als auch Sternschnuppen zählen zu den Meteoroiden. Was beide unterscheidet, ist lediglich der Umstand, dass erstere die Erdoberfläche erreichen, bevor sie gänzlich verglühen, und letztere nicht. Meteoroide sind dabei einfache Materieklumpen, bestehend beispielsweise aus Gestein oder Eisen, welche durchs All schwebten, bevor sie mit der Erdatmosphäre in Kontakt traten. Die Luftreibung (umgangssprachlich als »Fahrtwind« bekannt), welche im Weltraum nicht vorhanden ist, bremst den Meteoroiden ab, begleitet von einem strahlenden Leuchten der ionisierten Luft und einer Menge Lärm. Meteoroiden wiederum zählen zu den Meteoren, ein Begriff, welcher noch viele weitere Himmelserscheinungen einschließt, zum Beispiel die des Wetters, wie Wolken, Blitze und Regen – daher auch der Begriff Meteorologie, welcher umgangssprachlich ja meist mit »Wetterkunde« gleichgesetzt wird.
Einen wichtigen Faktor für das Schicksal eines Meteoroids stellt seine Größe dar. Als deren untere Grenze ist heute ein Durchmesser von zehn Mikrometern festgelegt, was einem hundertstel Millimeter entspricht – zu klein, um für das bloße Auge sichtbar zu sein. Nach oben hin ist die Skala offen, wobei ab einem Durchmesser von mehreren Metern oftmals von einem Asteroiden gesprochen wird. Im Gegensatz zu Meteoroiden heißen Asteroiden bereits Asteroiden, wenn sie friedlich und unerkannt durchs All schweben, zum Beispiel im Asteroidengürtel des Sonnensystems. Der 70 Kilometer große Morokweng-Krater in Südafrika rührt vom Einschlag eines Asteroiden in der Größenordnung mehrerer Kilometer her.25 Die Größe der Gesteinsbrocken aus dem All kann also massiv variieren.
An dieser Stelle sei noch gesagt, dass im Gegensatz zu den vorher genannten Erscheinungen ein Komet nicht mit der Erde in Kontakt steht – wenngleich sein berühmter Schweif im All Partikel auf der Erdumlaufbahn hinterlassen kann, die später als Meteoroiden enden –, sondern frei durch den Weltraum fliegt, oftmals auf einer Umlaufbahn um die Sonne. Sein Leuchten entsteht entsprechend nicht durch Luftreibung in der Erdatmosphäre, sondern durch seine Nähe zur Sonne, welche ihn einerseits erhitzt und andererseits mit elektrisch geladenen Teilchen, dem Sonnenwind, bombardiert.
Bei einem Meteoriten bleibt trotz des Verglühens am Ende noch genug Materie übrig, um auf der Erde für einen Einschlag zu sorgen, welcher entsprechend eindrucksvoll ausfallen kann. Im Vergleich mit einer Sternschnuppe, wie jeder sie kennt, ist das Leuchten am Himmel weitaus ausgedehnter, dauert länger und ist oft hell genug, um selbst tagsüber unübersehbar zu sein. Dieses Leuchten ist begleitet von Rauchwolken und einer Geräuschentwicklung, die Donnergrollen, Explosion und Feuerwerk gleichzeitig zu sein scheint. Eine solche Erscheinung ist eindrucksvoll und unheimlich, und das umso mehr, wenn sie auf der Erde Zerstörung anrichtet. Diese Zerstörung kann verheerende Folgen haben. Das Aussterben der Dinosaurier wurde durch den Einschlag eines Asteroiden vielleicht nicht eingeleitet, aber zumindest beschleunigt.
Anhand von Berichten Dritter schildert Rolf Bühler den Einschlag eines Meteoriten durch das Dach eines Tempels:
Am 19. Mai des Jahres 861 ereignete sich Außergewöhnliches in der Gegend des Shinto-Tempels Suga Jinja, nahe der westjapanischen Stadt Nogata auf Kyushu: Die Nacht wurde plötzlich hell erleuchtet. Eine fürchterliche Explosion zerriss die Stille. Durch das Dach des im 7. Jahrhundert erbauten Heiligtums sauste ein schwarzes Etwas und bohrte sich in den Tempelboden. Dorfbewohner, die sich am nächsten Morgen angsterfüllt im Tempel umsahen, entdeckten auf dem Grund des Loches einen merkwürdigen faustgroßen schwarzen Brocken... / Obwohl sein irdisches Alter durch physikalische Methoden nicht ermittelt werden konnte, schließen die Bearbeiter... daß der Stein mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich vor mehr als 1100 Jahren in den Tempelboden schlug.26
Bei einer solchen Geschichte scheint es fast unausweichlich, dass dem eingeschlagenen Meteoriten eine transzendente Bedeutung zugeschrieben wird. Aber auch auf zahlreiche Meteoriten, die nicht direkt in Tempel stürzten, trifft dies zu. In Europa wurden Meteoriten in jungsteinzeitlichen Grabanlagen entdeckt. Der bekannteste Fall dürfte jedoch der »Schwarze Stein« an der Kaaba in Mekka, dem wichtigsten Wallfahrtsort des Islams, sein. Allerdings ist sein Ursprung bisher nicht endgültig geklärt, da Wissenschaftlern Untersuchungen bisher verwehrt wurden. Diese müssen ihre Vermutungen anhand weniger Fotos und religiöser Aussagen aufstellen, welche unter anderem besagen, dass der Stein vom Himmel gekommen sei und weiß gewesen sei, bevor er sich – symbolisch für die Sünden der Menschen – verfärbt habe. Möglich scheint vor diesem Hintergrund auch, dass der Stein selbst kein Meteorit ist, jedoch durch die Wucht eines Meteoriteneinschlags aus irdischem Material entstand.27 Für die Muslime ist die Kaaba das Haus Gottes, für welches es den Begriff »Bätyl« gibt. Dieser lässt sich auf die Stadt Bethel (von hebräisch Bet-El, »Haus Gottes«) zurückführen, in deren Nähe Abraham in der Bibel einen Altar baute.28 Der Begriff hat sich für derartige Götzensteine auch in der Wissenschaft durchgesetzt.29
Natürlich schlugen schon immer Meteoriten auf der Erde ein. Aber für die geringe Wahrscheinlichkeit, einen solchen Einschlag direkt zu beobachten, spielt auch die Bevölkerungsdichte der Menschheit eine große Rolle: Je mehr Menschen es gibt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, einen Meteoriteneinschlag zu sehen. Die Bevölkerungsdichte war bekanntermaßen deutlich geringer als heutzutage, wo es normal geworden ist, dass übereinander gestapelte Mietwohnungen so platzsparend wie möglich in quaderförmige Bereiche unterteilt werden. Es ist jedoch nicht zu vernachlässigen, dass es auch in der Steinzeit zu rapiden Wachstumsphasen kam, die eng mit dem landwirtschaftlichen Fortschritt verknüpft waren. Dieser erschloss dem Menschen, welcher lange Zeit als Jäger und Sammler unterwegs war, zusätzliche Lebensmittel und effizientere Methoden. Viehzucht und schließlich Ackerbau wurden erst innerhalb der letzten zehntausend Jahre etabliert.30
Abgesehen davon spielt hier wieder das Abstraktionsvermögen eine Rolle. Der logische Schluss, dass ein gefallener Stein vom Himmel kommen muss, ist kein trivialer. Wenn wir heute etwas auf dem Boden einschlagen sehen, schauen wir, nachdem wir uns besonnen haben, automatisch nach oben, um zu überprüfen, ob uns noch mehr Objekte entgegenkommen könnten, oder um einen möglichen Ursprung auszumachen. Ein Tier jedoch kommt nicht auf diese Idee; es untersucht bestenfalls das gefallene Objekt. Diesem abstrakten Schluss liegt auch Wissen über das Wesen der Schwerkraft zu Grunde, welches sich unsere Vorfahren möglicherweise durch Jagdmethoden erarbeitet hatten. Neben der Verwendung von ballistischen Waffen wie Speer, Pfeil und Bogen etc. gruben sie auch Fallen, in die sie Tiere jagten, um sie schließlich von oben mit Steinen zu bewerfen und auf diese Weise zu töten.31 Von welch zornigem Gott muss also ein Stein stammen, der vom Himmel aus auf uns Menschen geworfen wird!
War das Phänomen von Tag und Nacht noch durch einen fließenden Übergang gekennzeichnet und außerdem mit der ständigen Erfahrung des eigenen Körpers verbunden, weckte die Trennung von Himmel und Erde Sehnsüchte nach dem unbegreiflichen Höheren, das da über uns schwebt. Man könnte hier spekulieren, dass die Trennung von Himmel und Erde ein so prägendes, eventuell auch traumatisierendes Ereignis war, dass Menschen fortan mit weiteren Prozessen radikaler, dualistischer Trennung begannen. Wenn der Mensch sich von Anderem getrennt erlebt, dann erfährt er erstmalig das Gefühl von Mangel. Erst aus einem Gefühl von Mangel heraus kann sich eine große Sehnsucht und, damit einhergehend, auch ein Bedürfnis nach Macht entwickeln. So lässt sich vermuten, dass die Suche nach einem »Platz an der Sonne« steilere soziale Hierarchien beim Menschen erst entstehen ließ. Zwar darf an dieser Stelle nicht vergessen werden, dass es auch bei Tieren soziale Ordnungen gibt, von flachen, sozial bedingten Hierarchien bei Wolfsrudeln bis hin zu steilen, biologisch bedingten bei den Bienenvölkern. Man geht jedoch davon aus, dass bei vielen Gruppen von Jägern und Sammlern noch Gleichberechtigung herrschte.32
Gleichzeitig stellt die Trennung von Himmel und Erde für den Menschen einen wesentlichen Schritt in der Entdeckung seiner eigenen Endlichkeit dar (die sicher schon mit der Entdeckung des Werkzeugs begonnen hatte). Auf diese Weise facht sie seine Fähigkeit zum abstrakten Denken an, denn Abstraktion setzt die Fähigkeit voraus, Dinge als Einzeldinge und somit als endlich wahrzunehmen. Auf dieser Grundlage kann dann gedanklich ein entsprechend begrenztes Modell von ihnen entworfen werden, eine Idee, wie Platon (428-348 v. Chr.) sagte, wobei dieser den Prozess allerdings umgekehrt sah.
In seiner »Ideenlehre« behauptete Platon, dass die rein geistige, nur in unserer Vorstellung enthaltene Idee eines Dinges dessen physischem Sein vorausgehe. Das bedeutet, dass die Vorstellung, die wir von einer Kuh haben, schon vor der Kuh selbst existierte, ja, jede real existierende Kuh ist, salopp gesprochen, nur ein »Abklatsch« der Idee, da jede Kuh vergänglich, veränderlich und individuell ist (keine Kuh ist einer anderen identisch), unsere Idee von ihr jedoch absolut und allgemein.
Diesem Denken liegt vielleicht noch die bereits beschriebene archaische Empfindung zu Grunde, dass die Welt ein organisches Ganzes sei, welches sich nicht einfach so in Teile zerlegen lässt. Die Teile, die Einzeldinge, besitzen in der Welt keine echte Wirklichkeit, sondern sind auf Erfahrungswerten basierende Erfindungen. Nur in unserem Geist sind sie »wirklich« wirklich – als abstrakte Ideen – und insofern sind die Einzeldinge, wenn wir sie in der Welt erkennen, tatsächlich nur Spiegelungen, ja, Projektionen unseres eigenen Geistes. Nimmt man zudem an, dass die physische Welt an sich zunächst ein gänzlich formloses Geschehen ist (eben jenes »organische Ganze«) und dass es erst unser Geist ist, der die konkreten Formen aus ihr »aussticht« wie ein Keksausstecher Kekse aus einem zuvor undifferenzierten Plätzchenteig, gewinnt Platons Ideenlehre auf beeindruckende Weise an Substanz. Der Keksausstecher ist dabei die Idee, während der vergängliche Keks, welcher niemals genau der perfekten Form des Keksausstechers gleicht, das physisch manifestierte Einzelding darstellt. Aus heutiger Sicht muss aber zumindest der Plätzchenteig als physische Welt, als physische »Gesamtheit« vorausgesetzt werden. Ohne Teig kann die Keksform keinen Keks erzeugen.
Abstraktion bedeutet immer Grenzziehung. Um ein Ding als Einzelding erkennen zu können, muss eine Grenze gezogen werden zwischen dem, was es ist, und dem, was es nicht ist. Der Nachteil im abstrakten Denken liegt freilich darin, dass eine Fragmentierung der Welt als Objekt schnell eine Fragmentierung des sie erfahrenden Subjektes, des Menschen selbst zur Folge haben kann. (Tatsächlich beginnt diese Fragmentierung schon mit der Wahrnehmung der Welt als Objekt, da das Subjekt sie bereits auf diese Weise von sich abspaltet.)
Man könnte noch einwenden, dass es unwahrscheinlich sei, dass ein einzelner Schritt für eine ganze Denkstruktur eine so große Folge gehabt haben könnte, und dass es sich vielmehr um einen fließenden Übergang handeln müsse. Das eine schließt das andere jedoch nicht aus, da ein Trauma nicht zeitlich unmittelbar wirken muss, sondern seine Wirkung auch mit zeitlichem Abstand zunehmen kann. Es kann sein, dass ein solches Trauma nur langsam in das kollektive Unbewusste einsickert, dass es Zeit braucht, bisherige Auffassungen der Welt umzupolen, da die neue Information erst eingeordnet werden muss, indem sie auf Bisheriges bezogen wird. So könnte die Trennung von Himmel und Erde durch einzelne Ereignisse ausgelöst worden sein, ohne dass diese ihre Wirkung von heute auf morgen entfalteten.
Die These, dass Meteoriteneinschläge die Auslöser dieser Änderung im Denken und in der Wahrnehmung unserer Vorfahren waren, ist zunächst Spekulation, welche ich nur unzureichend belegen kann. Möglicherweise gilt sie auch für einige Kulturen und für andere nicht, und möglicherweise entfaltete sie ihre Wirkung erst zusammen mit anderen Ereignissen. Aber sie ist immerhin eine These, die erklärt, wie es zu dieser Trennung gekommen sein könnte, ohne behaupten zu müssen, dass diese Änderung, dieser radikale Schritt, dem Menschen schlicht immanent sei. Hierbei geht es letztendlich um die Natur des Menschen, um die Frage, inwiefern sich nicht nur das abstrakte Denkvermögen, sondern auch die Sehnsucht, der seelische Hunger, der Drang nach Erkenntnis, aber auch das oftmals pathologische Bedürfnis nach Macht in seinem Kern befinden. In jedem dieser Fälle handelt es sich auf die eine oder andere Art um den Versuch, gen Himmel empor zu steigen, nicht mehr an die Erde gebunden zu sein, nicht mehr unter der eigenen Endlichkeit leiden zu müssen. Es geht darum, ob die intellektuelle Fähigkeit zur Abstraktion prinzipielleine seelische Spaltung des abstrahierenden Wesens bedeutet, oder ob Abstraktion (ohne Verlust ihrer Effizienz) auch schonender auf eine mildere, vorsichtig differenzierende Weise geübt werden könnte.
In ihrer symbolischen Bedeutung kann die Trennung von Himmel und Erde schlussendlich gleichgesetzt werden mit dem Sündenfall aus der Bibel, auf welchen ich oben nicht umsonst hinwies. Auf eine ähnlich symbolische Weise möchte ich sie im Kontext dieses Buchs verstanden wissen: als die Urspaltung des Menschen, den Beginn der Entfremdung des Menschen von sich selbst, nicht nur von der äußeren, sondern auch von seiner inneren Natur, und gerade darin als einen wichtigen Schritt in seiner Menschwerdung, als endgültiges Entfachen der lodernden Flamme seines Geistes. Es ist möglich, dass hierfür noch ganz andere Dinge eine Rolle gespielt haben. Vielleicht verliert der Mensch schon dadurch den Kontakt zur Erde (zum Subjekt), dass er auf zwei Beinen läuft. Er hat den Kopf in den Wolken. Er gerät leichter aus der Balance.
Ein sehr ästhetischer Aspekt der Meteoriten-These besteht noch darin, dass die Erkenntnis der Kleinheit der Erde gegenüber dem Himmel auch heute noch uneingeschränkt gilt – dies wird vermutlich immer der Fall sein – und als solche sicher eine psychologische Wirkung besitzt. Der Unterschied zur Auffassung aus der Steinzeit besteht lediglich darin, dass der Himmel, aus welchem die Steine herab bröckeln, kein von Göttern bevölkertes Jenseits mehr ist, sondern ein von Naturgewalten erfüllter Weltraum.
Im Science Fiction-Klassiker 2001: A Space Odyssey (1968) ist es ein mysteriöser, von Außerirdischen gesandter Quader, ein pechschwarzer, glatt geschliffener »Monolith«, welcher die Menschenaffen zur Erfindung des Werkzeugs beziehungsweise der Waffe inspiriert. Möglicherweise könnte eine vergleichbare (wenngleich intentionslose) Manifestation des Himmels auf der Erde tatsächlich eine solche Wirkung erzeugt haben.
Mit der mit Viehzucht und Ackerbau verbundenen Sesshaftigkeit des Menschen wurde ihm die Möglichkeit eröffnet, den täglichen Verlauf der Sonne im Wandel der Jahreszeiten zu dekodieren. Als Nomade war ihm dies nur eingeschränkt möglich gewesen, da aufgrund der Kugelgestalt der Erde ihr genauer Verlauf vom Breitengrad abhängig ist. Für fruchtbare Beobachtungen muss dieser jedoch über Jahre hinweg konstant bleiben.
In dem Bestreben, die geringen Änderungen des Sonnenstandes präzise nachzuvollziehen, entwickelten die Babylonier schließlich die Einteilung des Kreises in 360 Grad, passend zu der ungefähren Anzahl der Tage eines Jahres, die natürlich auch erst entschlüsselt werden musste. Diese Skalierung öffnete das Tor zu weiteren Skalen. Beispielsweise ließ sich der lichte Tag – gemeint ist der Zeitraum, während dessen die Sonne am Himmel steht – am Mittag, dem Zeitpunkt des höchsten Sonnenstandes, zeitlich und räumlich in zwei gleich große Hälften teilen: Zeitlich, weil die bis zum Sonnenuntergang verbleibende Zeit dann noch genau so lang sein würde wie die seit dem Sonnenaufgang bereits vergangene; räumlich, weil die nachmittägliche Bahn der Sonne am Himmel sich stets als Spiegelbild der vormittäglichen erweisen würde. Man erkannte dabei nicht nur, dass mittags die Schattenlänge minimal ist, sondern auch, dass dann alle Schatten in eine Himmelsrichtung zeigen, die unabhängig von der Jahreszeit konstant bleibt, nämlich nach Norden (da die Sonne mittags von Süden aus scheint). So wurde die Nord-Süd-Achse entdeckt. Die Ost-West-Achse konnte dann schlicht durch eine 90°-Drehung derselben definiert werden. Die so vorgenommene Entdeckung der Himmelsrichtungen stellte nicht nur eine gewaltige Orientierungshilfe, sondern auch die Grundlage für das erste Koordinatensystem dar, welches als kartesisches Koordinatensystem auch heute noch das wohl meistgenutzte ist.33
In den Kreisgrabenanlagen, welche im fünften Jahrtausend v. Chr. errichtet wurden und über ganz Europa verteilt liegen, werden astronomische Bezüge vermutet. Oftmals sind Eingänge anhand der Sonnenwendepunkte ausgerichtet, also in Richtung der Positionen, an welchen die Sonne an den entsprechenden Tagen den Horizont zu berühren scheint. Bei den Kreisgrabenanlagen handelt es sich um grabenförmige Aushöhlungen des Bodens, welche erst im letzten Jahrhundert durch die Luftbildarchäologie entdeckt werden konnten. Diese ebene Bauweise legt den Schluss nahe, dass es nicht wirklich darum ging, mittels eines Monuments Macht und Fortschrittlichkeit zu demonstrieren.
Es scheint eher so, dass unsere Vorfahren ein Zeichen für Betrachter von oben in die Erde gekratzt haben, frei nach dem Motto: wir wissen, dass dort oben im Himmel noch eine Welt ist, und wer auch immer dort lebt, soll sehen, wo wir sind...34
Lange bekannt sind die Steindenkmäler mancher Megalithkulturen, wie zum Beispiel Stonehenge. Die Aufstellung großer Findlinge in der Jungsteinzeit und später in der Bronzezeit ist oftmals nach präziser, mathematischer Vorschrift erfolgt.
Wenn es auch von diesen Zeiten keine schriftliche Überlieferung gibt, so vermögen doch die Steine zu sprechen. Es ist eine stumme und doch eindringliche Sprache, die der Astronom wohl versteht, und die ihm zu sagen vermag, welch geschickte Beobachtungen die Priesterastronomen etwa über ihre Steinkreise hinweg mit ihren steinernen Ziellinien oder Visiereinrichtungen vollbrachten.35
Es gibt neben Sonne und Mond jedoch viele Sterne am Himmel, und bei ebenfalls vielen Steinen ist es schnell möglich, dass mehr in die Steine hineingelesen wird, als tatsächlich der Intention ihrer Erbauer entspricht. Bei der bronzenen Himmelsscheibe von Nebra, auf welcher die Gestirne aus Gold appliziert sind, ist die astronomische Bedeutung allerdings über jeden Zweifel erhaben.
Zwar sind Bauwerke mit astronomischer Bedeutung nicht auf allen Teilen der Erde zu finden. Dennoch ist anzunehmen, dass der menschliche Geist überall eine ähnliche Entwicklung erfuhr: der Mensch nahm seine Umwelt immer differenzierter war und entwickelte langsam seine Fähigkeit zu Vernunft und Analyse. So nahm die Geschichte ihren Lauf. Natürlich geschah dies nicht überall zum gleichen Zeitpunkt und war auch kein linearer Prozess. Noch heute leben vor allem in den Tiefen des Dschungels Naturvölker, welche sich damit zufrieden geben, mittels Subsistenzwirtschaft im Einklang mit der Natur zu leben, ohne von Ideen wie Fortschritt, Wohlstand oder wirtschaftlichem Wachstum geprägt zu sein. Dass eine solche Entwicklung zeitversetzt stattfindet, spielt absolut keine Rolle, solange die verschiedenen Völker nicht miteinander in Kontakt treten. Vor der Existenz moderner Transport- sowie Kommunikationsmöglichkeiten und einer allgemein geringeren Bevölkerungsdichte waren die Völker deutlich stärker voneinander abgeschnitten, als es heute, in Zeiten der Globalisierung, der Fall ist.
Nach den Sternen navigieren
»Alles dreht sich... irgendwie.« So oder so ähnlich könnte die hilflose Antwort eines Passanten auf der Straße ausfallen, wenn man ihn oder sie nach der Bewegung des Sternenhimmels fragt. In mancher Hinsicht ist das astronomische Geschehen tatsächlich vergleichbar mit einem Fahrgeschäft auf der Kirmes, aber um die folgenden Abschnitte nachvollziehbarer zu gestalten, ist hier ein Einschub sinnvoll, welcher diese Frage kompetenter beantwortet. An das Vorherige gliedert er sich insofern an, als hier wieder vor allem zwei Dinge eine Rolle spielen: die Drehung der Erde um sich selbst, welche den Zyklus von Tag und Nacht erzeugt, und das Kreisen der Erde um die Sonne, welches die Jahreszeiten und sämtliche saisonalen Abhängigkeiten zur Folge hat.
Zunächst einmal benötigen wir zur Beschreibung der Sternpositionen am Himmel ein passendes Koordinatensystem. Hier kommt uns der Umstand zugute, dass die Entfernungen sämtlicher Himmelskörper so groß sind, dass sie für unser Auge gleich weit entfernt zu sein scheinen. Es ist nicht dafür konstruiert, in solcher Entfernung noch Unterschiede erkennen zu können. Für die Sterne gilt dies erst recht. Da trifft es sich, dass eine Kugel gerade definiert ist als die Menge aller Punkte, welche gleich weit von einem weiteren Punkt, nämlich ihrem Mittelpunkt, entfernt liegen. Dieser immer gleiche Abstand heißt bekanntermaßen Radius, und die Punkte bilden auf diese Weise eine geschlossene Oberfläche.
Wir können uns um uns herum also eine Himmelskugel denken, in deren Mittelpunkt wir uns befinden. Auf dieser positionieren wir die Sterne so, dass die Kugel für uns aussieht wie der echte Sternenhimmel, dass sie sozusagen eine optische Täuschung erzeugt, die nur von unserem Betrachtungspunkt aus funktioniert. Man könnte sagen, dass die Sterne auf der Himmelskugel Projektionen des echten Sternenhimmels auf unsere Kugel seien. So, wie bei einem Schattenspiel das dreidimensionale Geschehen auf eine zweidimensionale Fläche, nämlich die Leinwand, projiziert wird, werden die im dreidimensionalen Raum verteilten Sterne auf unsere ebenfalls zweidimensionale Kugeloberfläche projiziert. Die Dimension der Tiefe beziehungsweise der Entfernung geht dabei verloren.
»Zweidimensional« bedeutet hier, dass jeder Ort auf der Kugel sich bereits durch die Angabe von zwei passend gewählten Koordinaten bestimmen lässt, sodass eine dritte Koordinate, deren Notwendigkeit das Ganze eben dreidimensional machen würde, überflüssig wird. Im Fall der Himmelskugel handelt es sich dabei um zwei Winkelangaben, welche analog zum Längen- und Breitengrad auf der Erdoberfläche funktionieren. Auch Längen- und Breitengrad werden in Form von Winkeln angegeben, und an ihrer erfolgreichen Verwendung wird offensichtlich, dass sie zur Positionierung auf der Erdkugel ausreichen. Die Oberfläche einer Kugel ist also ein zweidimensionaler Raum, eingebettet in einen dreidimensionalen Raum. Mit unserer Himmelskugel verfahren wir ganz analog zur Erdkugel.
Das so gewählte Koordinatensystem heißt Äquatorsystem. Wenn man auch noch die Entfernung der Sterne berücksichtigen möchte und somit wieder eine dreidimensionale Situation vorfindet, kann man zusätzlich zu den beiden Winkelangaben, welche bereits die Richtung anzeigen, nun einfach die Entfernung als dritte Koordinate verwenden. So kann jeder Punkt im Weltall eindeutig und sinnvoll beschrieben werden.
Entfernungen interessieren uns an dieser Stelle jedoch noch nicht. Der Radius der Himmelskugel ist entsprechend nicht genau festgelegt. Allerdings ist er sehr groß, viel größer als der Radius der Erde, welche ja auch näherungsweise eine Kugel ist. Indem der Radius ausreichend groß gewählt wird, wird sicher gestellt, dass das Erscheinungsbild der Himmelskugel von allen Orten auf der Erde aus gleich ist, dass die Bewegung um ein paar tausend Kilometer auf der Erde also keine merkliche Rolle mehr spielt, dass die optische Täuschung nun also überall auf der Erde funktioniert. In diesem Fall – den man, im Gegensatz zum topozentrischen (den Beobachter umgebenden) als geozentrischen Fall bezeichnet – kann auch der Mittelpunkt der Erde als Mittelpunkt der Himmelskugel festgelegt werden, ohne dass dies erkennbare Auswirkungen auf die Erscheinung des Sternenhimmels hat. In der Abbildung ist der Radius der Himmelskugel im Vergleich zum Erdradius stark verkleinert dargestellt. Idealerweise denkt man sich die Erde als Punkt, was jedoch nur zutreffend ist, wenn es um die weit entfernten Sterne geht. Der Mond beispielsweise wäre hierfür bereits zu nah an der Erde.
In Wahrheit sieht der Sternenhimmel nicht von jedem Standort auf der Erde aus gleich aus. Das liegt jedoch nicht an der Himmelskugel, sondern ausschließlich daran, dass unser eigener Planet uns den Blick versperrt. Um wieder auf die Analogie mit dem Schattentheater zurückzukommen: Es ist, als ob sich ein Kleiderschrank von Mann direkt vor uns setzen würde und wir nun nur noch die Hälfte sehen könnten – das Schattenspiel selbst würde sich dadurch aber in keiner Weise ändern. Auf der Erde wird uns vom Boden, auf dem wir stehen, der Blick tatsächlich derart versperrt, dass wir ziemlich genau eine Hälfte der Kugel sehen können, deren Schnittfläche immer vom Beobachtungsort abhängig ist. Diese halbe Himmelskugel ist in sämtlichen Himmelsrichtungen begrenzt durch den irdischen Horizont.
Der geographische Nord- und Südpol sind die Schnittpunkte der Erdoberfläche mit der Erdachse, der Rotationsachse der Erde. Die an anderen Orten gelegenen magnetischen Pole hängen mit dem Erdmagnetfeld zusammen, welches beispielsweise für die Entstehung von Polarlichtern essenziell ist und als Abschirmung gegen den Sonnenwind unsere Atmosphäre stabilisiert, für die Astronomie sonst jedoch keine Bewandtnis besitzt. Verlängert man die Rotationsachse der Erde in beide Richtungen so weit, dass sie die fiktive Himmelskugel schneidet, erhält man so den Himmelsnord- und den Himmelssüdpol. Eine Eigenschaft der Himmelspole ist, dass dort befindliche Sterne, beobachtet man sie von der Erde aus, nachts an Ort und Stelle bleiben. Alle anderen Sterne drehen sich scheinbar um sie, was aber wieder nicht an einer Drehung der Himmelskugel liegt, sondern an der Drehung der Erde um sich selbst.36
Sehr dicht am Himmelsnordpol befindet sich der Polarstern (Polaris/α Ursae Minoris). Durch diese Position bewegt er sich über Nacht nicht beziehungsweise nur sehr gering, während sich der restliche Sternenhimmel um den Himmelsnordpol zu drehen scheint. Auf der Erde kann er zur Orientierung nach Norden dienen. Das heißt, dass ein Beobachter, der in Richtung Polarstern schaut, immer auch nach Norden blickt. Je nach Breitengrad, auf welchem sich der Beobachter befindet, steht der Polarstern unterschiedlich hoch über dem Horizont. Von der Südhalbkugel aus kann er nicht gesehen werden, da er dann von der Erdkugel verdeckt wird, sich also unterhalb des Horizonts befindet.
Analog zum Polarstern auf der Nordhalbkugel kann auf der Südhalbkugel das Kreuz des Südens (Crux) als Orientierungshilfe dienen. Es befindet sich in der Nähe des Himmelssüdpols und kann somit nur von der Südhalbkugel aus gesehen werden. Ein weiterer Unterschied zum Polarstern besteht darin, dass es kein einzelner Stern ist, sondern ein kleines Bild, bestehend aus vier Sternen. Außerdem befindet es sich nicht direkt am Pol (wo sich überhaupt kein auffälliger Stern befindet), kann jedoch verwendet werden, um diesen zuverlässig anzuvisieren. Als treuer Diener der europäischen Seefahrer in der Kolonialzeit ist es auf der Flagge einiger südlicher Staaten zu sehen.
Die Himmelspole wurden durch eine Verlängerung der Erdachse bis zur Himmelskugel konstruiert. Auf vergleichbare Weise lässt sich auch der irdische Äquator bis zur Himmelskugel erweitern. Der dadurch entstandene Kreis wird – bar jeglicher Kreativität, dafür systematisch und anschaulich – als Himmelsäquator bezeichnet.
Ein Beobachter, welcher sich am Nordpol befindet, erblickt erstens den Polarstern senkrecht über sich – wenn dem nicht so wäre, hätten wir hier ein Paradoxon, da man sich am Nordpol nicht weiter nach Norden orientieren kann – und sieht zweitens exakt die nördliche Hemisphäre der Himmelskugel, welche auch als Nordhimmel bezeichnet wird. Der Horizont ist dabei identisch mit dem Himmelsäquator. Ein Beobachter am Südpol sieht den Südhimmel. So, wie der irdische Äquator die Erde in Nord- und Südhalbkugel unterteilt, teilt der Himmelsäquator die Himmelskugel in Nordhimmel und Südhimmel.
Kommen wir zur Bewegung der Erde um die Sonne. Eine scheinbare Drehung des Sternenhimmels erfolgt nicht nur im Tages-, sondern auch im Jahreszyklus. Während die Jahreszeiten allein durch die Schrägstellung der Erdachse entstehen, trifft dies auf die saisonalen Unterschiede des Sternenhimmels nicht vollständig zu. Sie wären größtenteils auch dann noch vorhanden, wenn die Erdachse senkrecht auf ihrer Bahn um die Sonne stünde.
Wenn man sich das Geschehen wie in der Abbildung vom Nordhimmel aus anschaut, sieht man, wie die Erde sich um sich selbst entgegen dem Uhrzeigersinn dreht und die Sonne in gleicher Richtung umkreist. Da das siderische Jahr, welches Schaltjahre berücksichtigt, etwa 365, 25 Tage hat, legt die Erde jeden Tag einen entsprechenden Bruchteil auf ihrer Kreisbahn zurück. Dieser Bruchteil entspricht einem Winkel von ungefähr einem Grad, da ein ganzer Kreis schließlich 360 Grad enthält. Als Folge dieser Verschiebung scheint, wie in der Abbildung zu sehen, die Sonne aus verschiedenen Richtungen auf die Erde. Selbstverständlich ist auf der Seite der Erde, welche der Sonne zugewandt ist, Tag, und auf der anderen Seite Nacht. Nur in der Nacht lassen sich aber die Sterne beobachten, da sie sonst





























