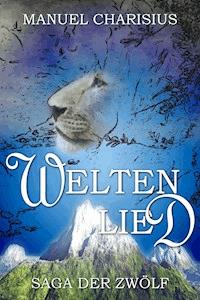
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Saga der Zwölf
- Sprache: Deutsch
Der 14-jährige Waisenjunge Léun lebt bei seinem Großvater ein normales, beschauliches Leben - bis er eines Tages im Wald von einem wilden Löwen angefallen wird. Als er völlig unverletzt wieder aufwacht, muss er feststellen, dass er von da an Löwengestalt annehmen kann. Anfangs hat er keine Kontrolle über seine Fähigkeit. Um ein Haar kommt es zur Katastrophe. Der Waldhüter Héranon schlägt vor, Léun auf dem Weg in die nächste große Stadt zu begleiten. Dort soll ein Weiser leben, der ihm den Umgang mit der Verwandlungsgabe beibringen kann. Zusammen mit Arrec, Léuns bestem Freund, und der Nachbarstochter Ciára brechen sie auf. Zur selben Zeit wird Ríyuu, ein junger Steppenläufer, vom Stammesführer aus der Zeltstadt Wáhiipa verstoßen. Von seinem langjährigen Gefährten getrennt, macht er sich auf den verzweifelten Weg zum nördlichen Horizont, um die schier unlösbare Aufgabe des Anführers zu erfüllen und irgendwann ehrenvoll in seine Heimat zurückzukehren. Sie alle werden gejagt - und sie alle sehen sich immer wieder mit der vollen Härte ihres Schicksals konfrontiert. Erst in der Siedlung des Weisen treffen Léun und seine Freunde mit Ríyuu zusammen. Sie müssen erkennen, dass ihre Schicksale eng miteinander verwoben sind: Káor der Löwe, Ashúra der Adler und Ríyuu der Windreiter sind dazu ausersehen, das im Verborgenen über Nýrdan heraufziehende Unheil abzuwenden. Doch ihr Feind ist mächtig und skrupellos. Längst hat Prinz Gúrguar, Erbe des Throns von Düsterland, ihre Spur aufgenommen. Er verfolgt nur ein Ziel - Ríyuu die sagenumwobene Flöte des Yleriánt zu rauben. Und spätestens als er Ciára in seine Gewalt bringt, ist es Gúrguar, der alle Trümpfe in der Hand hält. Können die Freunde dem Bösen gemeinsam die Stirn bieten? Und wird es ihnen gelingen, die Zerstörung Nýrdans abzuwenden ...?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Manuel Charisius
Weltenlied
– Saga der Zwölf –
Roman
Für Káor
Für Ashúra
Und für den Windreiter
Inhalt
Das Buch
Vorspiel
Erste Strophe: Verwandlung
Weltenlied
Sturm
Káor
Dämon
Schwarzhaar
Ciára
Zwischenspiel
Zweite Strophe: Verdunkelung
Flut
Tímu
Grünau
Sárim
Tanz
Arrec
Zwischenspiel
Dritte Strophe: Vereinigung
Seemannsgarn
Storchenhof
Regen
Verrat
Ashúra
Zwischenspiel
Vierte Strophe: Vollendung
Überall
Windreiter
Larkhâ
Panóris
Léun
Nirgendwo
Nýrdan
Nachspiel
Dank
Über den Autor
Das Buch
Zwei junge Gestaltwandler. Ein Ausgestoßener, unterwegs zum Horizont. Ein skrupelloser Herrschersohn. Ihr aller Schicksal erfüllt sich in dem einen Lied …
Der 14-jährige Waisenjunge Léun lebt bei seinem Großvater ein normales, beschauliches Leben – bis er eines Tages im Wald von einem wilden Löwen angefallen wird. Als er völlig unverletzt wieder aufwacht, muss er feststellen, dass er von da an Löwengestalt annehmen kann. Anfangs hat er keine Kontrolle über seine Fähigkeit. Um ein Haar kommt es zur Katastrophe.
Der Waldhüter Héranon schlägt vor, Léun auf dem Weg in die nächste große Stadt zu begleiten. Dort soll ein Weiser leben, der ihm den Umgang mit der Verwandlungsgabe beibringen kann. Zusammen mit Arrec, Léuns bestem Freund, und der Nachbarstochter Ciára brechen sie auf.
Zur selben Zeit wird Ríyuu, ein junger Steppenläufer, vom Stammesführer aus der Zeltstadt Wáhiipa verstoßen. Von seinem langjährigen Gefährten getrennt, macht er sich auf den verzweifelten Weg zum nördlichen Horizont, um die schier unlösbare Aufgabe des Anführers zu erfüllen und irgendwann ehrenvoll in seine Heimat zurückzukehren.
Sie alle werden gejagt – und sie alle sehen sich immer wieder mit der vollen Härte ihres Schicksals konfrontiert. Erst in der Siedlung des Weisen treffen Léun und seine Freunde mit Ríyuu zusammen. Sie müssen erkennen, dass ihre Schicksale eng miteinander verwoben sind: Káor der Löwe, Ashúra der Adler und Ríyuu der Windreiter sind dazu ausersehen, das im Verborgenen über Nýrdan heraufziehende Unheil abzuwenden.
Doch ihr Feind ist mächtig und skrupellos. Längst hat Prinz Gúrguar, Erbe des Throns von Düsterland, ihre Spur aufgenommen. Er verfolgt nur ein Ziel – Ríyuu die sagenumwobene Flöte des Yleriánt zu rauben. Und spätestens als er Ciára in seine Gewalt bringt, ist es Gúrguar, der alle Trümpfe in der Hand hält.
Können die Freunde dem Bösen gemeinsam die Stirn bieten? Und wird es ihnen gelingen, die Zerstörung Nýrdans abzuwenden …?
~ Lass Mich Singen ~
~ Und Ich Schenke Dir ~
~ Eine Welt ~
Vorspiel
»Das kannst du mir nicht antun, Vater!«
Die Luft roch schwer und abgestanden. Sonnenlicht fiel in grellen Strahlen durch die Rundbogenfenster in den Thronsaal von Larkhâ, ohne seine Ecken und Winkel zu erreichen. Dort lauerte dieselbe Düsternis, die als schwärzlicher Schleier über dem ganzen Schloss hing und das Tageslicht welk und entfärbt wirken ließ. Vielleicht war daran der Fluch irgendeines Vorfahren der Herrscherfamilie schuld, vielleicht aber auch nur der Qualm, der Tag und Nacht aus den Gewölben emporstieg. Bestimmt würde heute noch der saure Regen niedergehen.
Mit einem Wort, der Tag war perfekt für den Prinzen von Larkhâ. Oder vielmehr, er war es gewesen – bis zu dem Moment, als er durch die schwarze Flügeltür in den Thronsaal trat, um sich von seinem Vater König Efuwâk zu verabschieden. Eigentlich hatte Prinz Gúrguar vorgehabt, das Schloss für einen vollen Monat zu verlassen und durch das Zwielicht Düsterlands zu reiten. Jetzt sah es so aus, als könnte er diesen Plan fürs erste vergessen.
In ein kohlschwarzes Gewand mit uralten schwarzmagischen Runenstickereien gehüllt, hatte ihn der König vor dem leicht erhöhten Thronbereich erwartet. Neben dem Herrscher stand ein Gast, der bereits am Vortag angereist war. Kaum hatte Gúrguar seinem Vater seine Aufwartung gemacht – die dunklen Edelsteine an dessen Fingerringen waren eiskalt und hatten beim Begrüßungskuss ein taubes Gefühl auf seiner Oberlippe hinterlassen –, da machte König Efuwâk mit knappen Worten, die keinen Widerspruch duldeten, all seine Vorfreude auf den angenehm zweckfreien Ritt zunichte.
»Mein Pferd ist schon gesattelt«, wagte Gúrguar dennoch zu protestieren. »Dass ich heute aufbrechen wollte, hast du lange im Voraus gewusst, Vater! Warum bestrafst du mich ausgerechnet jetzt mit diesem …« Er raffte seinen Jagdumhang und sandte dem Fremden einen vernichtenden Blick. »… diesem Auftrag?«
»Du bist ein Rüpel, Gúrguar.« Aus seinen hellen Augen musterte König Efuwâk den Prinzen voller Verachtung. »Gönne deiner Stimme und unseren Ohren eine Pause und verhalte dich gegenüber Syr Páno und mir gefälligst dem an diesem Hof geltenden Kodex gemäß!«
Gúrguar atmete scharf ein.
»Wie mir Syr Páno gerade mitgeteilt hat, hatte er gestern keine Gelegenheit, mit dir zu plaudern«, fuhr der König fort. »Sonst wüsstest du nämlich bereits, dass er ein Meistermusiker ist. Er beherrscht jedes denkbare Instrument in allen nur möglichen Tonlagen.«
Gúrguar warf dem Gast einen desinteressierten Blick zu. Syr Páno war ein hagerer Mensch, der in einem viel zu weiten Lederwams steckte. Um seine Beine schlapperte eine silberblaue Gauklerhose, die er zweimal nicht ausgefüllt hätte und die so gar nicht zu der adeligen Herkunft passen wollte, die das »Syr« andeutete. Ein roter, etwas abgetragener Umhang hing ihm schlaff über den Rücken; der vordere Teil des Kleidungsstücks zog sich bis zum Nasenbein hinauf und verhüllte so die untere Hälfte seines Gesichts. Nicht ohne Respekt erwiderte Syr Páno den Blick des Prinzen aus wachen grünen Augen. Seine Stirn war hoch und glatt, das nussbraune lange Haupthaar am Hinterkopf zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden.
»Was hab ich mit irgendwelchen Spielleuten zu tun?« Der Prinz wollte sich abwenden, da streckte sein Vater die Hand aus und packte ihn hart bei der Schulter.
»Sieh mich an, wenn ich zu dir spreche.« König Efuwâk flüsterte beinahe, doch seine Stimme klang umso bedrohlicher.
Gúrguar gehorchte widerwillig.
»Hier geht es um wichtigere Dinge als dein persönliches Vergnügen. Du bist der rechtmäßige Erbe meines Throns, und deshalb wirst du dazu beitragen, das Wohlergehen dieses Reiches zu sichern. Die politische Situation ist nicht allzu stabil, wie du weißt. Gerade die Handelsbeziehungen zwischen Düsterland und der Alten Stadt frieren allmählich ein. Wir müssen uns einen Vorteil verschaffen, einen Trumpf, den wir, falls die Umstände es erfordern sollten, ausspielen können.« Efuwâk senkte die Stimme. »Unser Erzfeind verfügt über einen solchen Trumpf. Es gibt Anzeichen dafür, dass er ihn demnächst einsetzen wird, um die nächste Partie für sich zu entscheiden.«
»Die Zwölf?«, riet Gúrguar. »Ich dachte, diese Gefahr wäre gebannt, immerhin ist es uns gelungen, viele von ihnen …«
»Ich spreche nicht von den Zwölf«, unterbrach ihn der König. »Obwohl auch sie als Diener des Feindes nach wie vor eine ernstzunehmende Bedrohung darstellen. Sondern ich spreche von Magie, genauer gesagt, von einem uralten Zauber, der Düsterland vernichten kann.«
»Was für ein Zauber soll das sein?«
Efuwâk schloss die Augen halb.
»Die magische Flöte des Yleriánt«, sagte er.
»Was?«, entfuhr es Gúrguar. »Das ist unmöglich. Sie ist seit Jahrhunderten verschollen!«
»Das dachten Syr Páno und ich bis gestern Abend auch.« Der König schüttelte bedächtig den Kopf. »Einzelheiten können wir aus Zeitmangel nicht noch einmal aufrollen. Für dich ist nur wichtig zu wissen, dass ein Mann namens Tímu als letzter im Besitz der Flöte gewesen sein soll. Er lebt – oder lebte bis vor ein paar Jahren, genauer wissen wir es nicht – in der Nähe des Felsabsturzes von Urtán. Das sollte dir reichen.«
»Um ihn zu finden?« Der Prinz starrte seinen Vater entgeistert an. »Um … um die Flöte zu finden?«
»Und ihren Träger unschädlich zu machen.« Efuwâk lächelte kühl. »Syr Páno wird dich begleiten. Er wird die Echtheit des Instruments feststellen und es unter deinem persönlichen Schutz nach Larkhâ bringen. Der Verlust der Flöte wird unseren Erzfeind lähmen, und wir werden endlich zum entscheidenden Gegenschlag ausholen können.«
»Aber Vater«, wandte Gúrguar ein, »ich wollte eigentlich etwas Anderes suchen. Hier in Düsterland. Du weißt, was mir prophezeit wurde und …«
»Prophezeit, pah!« König Efuwâk winkte ab. »Wer bist du, dass du auch nur einen Gedanken an das Gestammel einer verrückten alten Frau verschwendest? Du bist zu Höherem berufen. Derjenige, den du fürchtest, wenngleich ebenfalls ein Diener des Erzfeindes, ist ein kleiner Fisch im Vergleich zu den Zwölf, und schon gar zum Vermächtnis Yleriánts.«
Bei diesen Worten spürte Gúrguar ein bitteres Brennen in seiner Kehle. Verärgert strich er sich eine Haarsträhne zurück.
»Wozu haben wir die Armee, Vater? Warum schickst du nicht an meiner Stelle einen Spähtrupp los? Oder noch besser, lass die Hárkyds ausschwärmen, um sicherzugehen, dass …«
»Überlass das strategische Denken mir«, erwiderte der König schroff. »Die Soldaten zu mobilisieren, wäre viel zu auffällig. Diese Mission muss geheim bleiben. Niemand darf erfahren, dass der Herrscher von Larkhâ nach der Flöte des Yleriánt sucht. Jetzt geh und sattle dein Pferd! Syr Páno kommt gleich nach. Ich bin sicher, ihr werdet euch gut verstehen, du und er, wenn ihr euch erst einmal näher kennengelernt habt.«
»Mein Pferd ist schon gesattelt«, knirschte Gúrguar wütend, »und das sagte ich bereits, Vater.« Zackig wandte er sich um und verließ den Thronsaal mit laut hallenden Schritten, ohne dem König seinen Abschiedsgruß entboten zu haben.
»Für ein rasches Mittagsmahl bleibt noch Zeit«, bot Efuwâk seinem Gast mit dünnem Lächeln an. »Was sagt Ihr zu einem butterweichen Hirschbraten mit Nusshonigkruste?«
Anstatt etwas zu sagen, nickte Syr Páno anerkennend. Der König kehrte ihm den Rücken zu, um ins Speisezimmer vorauszugehen. Lautlos und mit einem selbstzufriedenen Lächeln unter dem Schleier schlich der Spielmann ihm hinterher.
Auf halbem Weg zog er einen Dolch aus seinem Gauklerwams.
Erste Strophe: Verwandlung
Weltenlied
Schweißgebadet fuhr Léun aus dem Schlaf hoch. Ächzend ließ er sich zurück auf sein Lager fallen, als ihm klarwurde, dass er das Grauen wieder einmal überstanden hatte. Er schloss die Augen und lauschte eine Weile seinem eigenen keuchenden Atem. Endlich rieb er sich den Schlaf aus dem Gesicht, gähnte, streckte sich und stand auf.
Wieder dieser Alptraum. Seit Jahren suchte er ihn heim, immer und immer wieder, in letzter Zeit fast jede Nacht. Im Traum war Léun auf der Flucht, jemand – oder etwas – trachtete ihm nach dem Leben. Atemlos hetzte er durch eine leere, öde Welt, ohne sich verstecken zu können.
Seltsamerweise wusste er nach dem Aufwachen nie, wovor er eigentlich flüchtete und warum. Manchmal sah er im Traum ein glühendes Augenpaar, dessen geschlitzte Pupillen ihn mordlüstern anstarrten. Dann rannte er weiter, ohne sich umzusehen. Oft hörte er ein dumpfes Grollen in der Ferne, wie von einem herannahenden Gewitter. Das wütende Gebrüll seines Verfolgers. Bisher war er ihm immer entkommen.
Diesmal allerdings hatte der Traum eine grässliche Wendung genommen: Das Biest, das ihn jagte, hatte ihn eingeholt. Ein blutrotes Maul mit spitzen, tödlichen Reißzähnen war das Letzte, was er sah, bevor er aufgewacht war.
Léun schauderte. Er trat an die Waschschüssel, tauchte beide Hände in das kalte Wasser und wusch sich gründlich das Gesicht und, so gut es ging, den restlichen Körper. Obwohl er sich Mühe gab, nichts zu verschütten, stand er danach in einer Wasserlache. Wie hatte er am Vorabend nur vergessen können, einen frischen Waschlappen mit auf seine Stube zu nehmen? Egal, er würde später sowieso an den See gehen. Da brauchte er es jetzt mit dem Waschen nicht allzu genau zu nehmen.
Bevor er sich anzog, vergewisserte sich Léun einmal mehr der krausen dunkelblonden Haarbüschel, die ihm neuerdings unter den Achseln und an weiteren unerwarteten Körperstellen sprossen.
Hier fehlt noch was!, dachte er und betastete etwas skeptisch den Flaum an seinem Kinn. Aber selbst wenn der Bart noch auf sich warten ließ – nächstes Frühjahr würde er sein fünfzehntes Jahr vollenden.
Dann bin ich endlich entscheidungsfrei, und niemand kann mir mehr was vorschreiben, nicht mal Lóhan.
Nicht dass er seinen Großvater nicht mochte und bewunderte. Der alte Mann hatte ihn als Kleinkind bei sich aufgenommen und mit Liebe und Fürsorge aufgezogen. Er ertrug seine dümmsten Streiche und manch ungerechtfertigten Vorwurf und gab ihm nicht zuletzt immer das Gefühl, dass er ihm blind vertrauen und alles erzählen konnte, was sein Herz bewegte.
Trotz alledem kam sich Léun in letzter Zeit durch seinen Großvater zunehmend eingeschränkt vor. Es war schwer zu beschreiben, aber es fühlte sich an, als schnürte ihm jemand die Luft ab oder als wäre er nur zur Hälfte er selbst. Der Teil, der ihm fehlte, den hoffte Léun anderswo zu finden: im See, auf einem Baum, im Kreis seiner Freunde, am Hang eines Hügels in der Sonne dösend – oder auch wann immer er Ciára, dem Mädchen von schräg gegenüber, in die Augen schaute.
Nachdem er sich angezogen hatte, verließ Léun seine kleine Kammer und betrat die Wohnstube. Sein Großvater war dabei, mit hochgekrempelten Ärmeln und schwungvollem Einsatz Brotteig zu kneten. Unter wild wuchernden Augenbrauen hervor sandte er ihm einen Blick, ohne die Arbeit zu unterbrechen.
»Guten Morgen, mein Lieber. Willkommen im Licht dieses vielversprechenden vierten Mén-Tages. Der Mén ist ein guter Monat.«
Léun brummte etwas Unverständliches.
»Das dachte ich vorhin auch«, sagte der Alte.
Léun musste grinsen.
»Aber leider haben wir für heute früh nicht vorgesorgt – nicht mal Eier und Speck sind im Haus. Gestern Abend hast du den ganzen Reis aufgefuttert, also wird es noch eine Weile dauern, bis das Frühstück fertig ist. Mach dich nützlich und hack mindestens zwei Dutzend Scheite Feuerholz, ja?«
Missmutig stürzte Léun drei Becher Wasser hinunter, damit ihm während der Arbeit nicht der Magen knurrte.
Sein Großvater ließ den Teig ruhen und säuberte sich die Hände.
»Wieder der Alptraum …?«, fragte er.
»Hm«, entgegnete Léun. Er hatte keine Lust, jetzt darüber zu reden.
»Irgendwann heute früh hast du laut aufgeschrien …«
Léun knallte den Becher auf den Tisch.
»Musst dich verhört haben«, sagte er und ging hinaus.
Als er drei Dutzend Scheite Holz gehackt hatte und sie in die Stube schleppte, war sein Großvater dabei, einen Laib Käse aufzuschneiden. Den aufgehenden Brotteig hatte er mit einem Leinentuch abgedeckt. Léun machte sich daran, das Feuer anzufachen. Er schichtete einige Holzscheite kegelförmig im Herd auf und stopfte die Zwischenräume mit trockenem Heu aus, das in einem Eimer bereitstand. Mit Stein und Feuereisen schlug er Funken. Er hatte Übung darin. Wenig später loderte ein schönes Feuer im Herd. Mit einem Lederhandschuh öffnete sein Großvater die glühendheiße Metalltür zur Ofenkammer und stellte den tönernen Behälter mit dem Teig hinein.
»So«, sagte er, klappte die Tür zu und entledigte sich des Handschuhs. »Jetzt dauert es nicht mehr lang, bis wir frühstücken können.«
Es klopfte.
»Ah, das wird Ciára mit der Milch sein. Machst du ihr bitte auf?«
Beim Namen der Nachbarstochter zuckte Léun zusammen. Schon beim Holzhacken hatte er ständig zum Weg hin gespäht und gehofft, sie würde vorbeikommen. Wie jeden zweiten Tag würde sie heute eine Kanne Ziegenmilch bringen; manchmal brachte sie auch ein paar Eier mit. So hätte sich eine der seltenen Gelegenheiten ergeben, mit ihr allein zu sein. Ciáras Mutter ließ sie kaum je allein länger von zu Hause wegbleiben. Ihr Vater dagegen scherte sich wenig um sie, saß er doch ohnehin fast ständig in der Mittelhager Schenke und wusste vor lauter Trinken nicht, ob gerade Morgen oder Abend war.
Léun fühlte sein Herz hämmern, als er zur Tür eilte. Fast stolperte er über eine lose Diele. Das Lächeln seines Großvaters im Nacken, öffnete er.
»Guten Tag, Lóhan!«, rief das Mädchen fröhlich und winkte an ihm vorbei in die Hütte hinein. Sie richtete den Blick auf ihn. »Morgen, Léun. Ich … wie geht es dir?«
Er spürte, wie ihm heißes Blut ins Gesicht schoss. Sämtliche Worte, die er ihr sagen wollte, schienen ihm an der Zunge zu kleben wie ausgehungerte Motten an einem Fliegenfänger.
»Du wirkst, äh, ausgeschlafen«, sagte Ciára mit dem Anflug eines Lächelns und nahm die Milchkanne von der einen in die andere Hand.
Léun versuchte vergeblich, einen klaren Gedanken zu fassen. Wenn es nach ihm ging, konnte sich die Übergabe der Milch ruhig noch länger hinauszögern. Beim letzten Mal hatten sich ihre Fingerspitzen berührt, als er ihr die Kanne abgenommen hatte. Seltsamerweise hatte sich das angefühlt, als hätte ihn der Blitz getroffen, wenn auch nicht so stark wie bei der Sache vor zwei Monaten. Zum Glück schien sie nichts von seinem Schock bemerkt zu haben. Ob sie sich noch an das Erlebnis am See erinnerte?
Und ob sie wohl zu allen Jungen so nett war wie zu ihm?
Ciára galt nicht gerade als umschwärmt. Ihre mausbraunen Haare, die etwas engstehenden Augen – nicht jeder fand sie hübsch. Er schon. Sehr sogar. Dieses Lächeln! Wie sie ihn anblickte, wie sie sich mit der freien Hand eine Strähne zurückstrich, wie sie die überschwappende Milch zu balancieren versuchte! Warum stellte sie die Kanne eigentlich nicht ab, sie war doch sicher ziemlich schwer?
»Du … du hast da was«, sagte Ciára mit leicht gepresster Stimme. Flüchtig deutete sie auf eine Stelle unterhalb seiner Gürtellinie.
Ihm stand doch nicht etwa der Hosenstall offen? Peinlich berührt, schaute Léun an sich herunter. Er zwang sich zu einem ratlosen Grinsen.
»Ich meine den Fleck auf deiner Hose. Da, am Oberschenkel, siehst du?«
Mist, schoss es ihm durch den Kopf. Hätte er doch nur besser aufgepasst, als er am Ofen herumhantiert hatte! Fahrig wischte er über die Aschespur, die nicht daran dachte zu verschwinden.
»Wie sieht’s denn aus mit der Milch, ist die noch frisch?«, brummelte jemand hinter ihnen. Léun hatte die Anwesenheit seines Großvaters angesichts des Mädchens komplett vergessen.
Eine Handbewegung, die Milch wechselte den Besitzer. Ein Lächeln, ein Winken, die Tür schloss sich. Ihm wurde klar, dass er sich Ciára gegenüber idiotischer und unhöflicher angestellt hatte als jemals zuvor.
»Setz dich ein Weilchen zu mir«, schlug sein Großvater mit funkelnden Augen vor. »Was hast du heute sonst noch vor, außer angeregt mit Ciára zu plaudern?«
Léun murmelte etwas von Baden im Mittleren See.
»Geht in Ordnung, aber sei vor dem Gewitter am späten Nachmittag zurück.«
Ihm war schleierhaft, woher der alte Mann jeden Tag aufs Neue wissen konnte, wie sich das Wetter entwickeln würde. Schon gar, wo doch die Sonne heute von einem wolkenlosen Himmel auf Grüntal hinunter lachte!
»Danke übrigens der Nachfrage, ich habe sehr gut geschlafen.«
Léun grinste verschmitzt und schämte sich ein wenig.
»Oder das, was man in meinem Alter sehr gut nennt«, fuhr Lóhan augenzwinkernd fort. »Weißt du, wenn man ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hat, dann ist man froh und dankbar für jeden Moment, den man in dieser Welt noch wach und bewusst erleben darf.«
»Und gesund«, ergänzte Léun abwesend. Ciáras Worte klangen ihm noch ebenso im Ohr wie ihre glockenhelle Stimme.
»Genau!« Die blauen Augen seines Großvaters strahlten. »Du weißt es, nicht wahr? Ich meine, dass Gesundheit das höchste Gut im Leben ist?«
Léun hatte die Frage nicht gehört und nickte.
»Ich erinnere mich noch genau, als dein Vater so alt war wie du jetzt, da …« Plötzlich wurde der Alte ernst. Er starrte ihn an, und seine Augenlider zuckten.
»Was?«, wollte Léun wissen. Es war nicht das erste Mal, dass sein Großvater Anstalten machte, ihm die ganze Geschichte zu erzählen. Alles, was er bislang wusste, war, dass sein Vater als Jugendlicher fast gestorben wäre.
»Bei Fuertýna … Göttin der Saat und der Ernte«, sagte Lóhan stockend und mit gesenkter Stimme. »Du bist ihm so ähnlich, nicht äußerlich zwar, aber Láhen … fast scheint es mir, als ob ich zum zweiten Mal …« Er unterbrach sich erneut. Auf einmal fasste er Léun über den Tisch hinweg bei der Schulter und musterte ihn eindringlich.
»Versprich mir eins«, fuhr er mit bebender Stimme fort, »wenn du eines Tages hier in Grüntal eine Hütte hast, und eine Frau, und vielleicht einen Sohn …«
»Ja? Was dann?«
»Lass sie nicht im Stich, hörst du? Lass deine Familie nicht allein zurück wie Láhen, dieser Nichtsnutz. Versprichst du mir das?«
Fast hätte Léun genickt und es ihm versprochen.
Láhen, dieser Nichtsnutz!
»Er war kein Nichtsnutz«, brauste er auf und schüttelte Lóhans Hand von seiner Schulter. Dieser starrte ihn verdutzt an.
»Aber ich meinte doch nur …«
»Mein Vater ist kein Nichtsnutz!«, wiederholte Léun, warf beim Aufspringen seinen Stuhl um und polterte aus der Hütte. Die Tür warf er krachend hinter sich ins Schloss.
Er fühlte sich erst besser, als er, das Dorf Grünhag im Rücken, die halbe Wegstrecke zum Mittleren See hinter sich gebracht hatte. Um diese Tageszeit pflegten bei Sonnenschein viele Leute dort einzutrudeln. Ihm war danach, die Gesichter seiner Freunde zu sehen, ihre Stimmen zu hören und Neuigkeiten auszutauschen. Stán war meistens da und auch Néna und Mían, die Zwillinge aus Süderhag. Am meisten hoffte Léun jedoch, seinen besten Freund Arrec aus Mittelhag zu treffen. Der wusste immer allerlei verrücktes Zeug zu berichten und war nie abgeneigt, irgendwelchen Unsinn anzustellen.
Zu seiner Enttäuschung war Arrec noch nicht gekommen, und auch von den anderen konnte Léun niemanden am See entdecken. Nur ein paar kleine Kinder planschten kreischend vor Vergnügen im flachen Uferwasser, während ihre Mütter etwas weiter draußen Kleider wuschen.
Vermutlich war er heute einfach zu früh dran. Er beschloss, um den See herumzulaufen. So würde er nicht nur die Zeit totschlagen, sondern auch an Mittelhag vorbeikommen, dem Dorf am Nordufer. Vielleicht konnte er Arrec von zu Hause abholen – vorausgesetzt, dieser verbrachte nicht den ganzen Tag über mit seinem Vater Erric in den Grünen Auen. Erric trieb mit den Reisbauern von Bergau regen Handel und ließ Arrec das Getreide säckeweise zurück nach Grüntal schleppen, um die zwei Goldmünzen Leihgebühr für einen Ochsenkarren zu sparen. Léun wusste, dass sein Freund diese Arbeit hasste wie nichts auf der Welt.
Nach einer Weile drang das alarmierte Gebell von Grantis Hunden an seine Ohren. Granti, eine weißhaarige Alte mit den Augen und Ohren eines Luchses und der Zunge einer Schlange, hauste allein in einer umzäunten Hütte am Westufer des Sees. An nichts und niemandem pflegte sie ein gutes Haar zu lassen. Die Menschen seien schlecht, das Wetter sowieso, ja selbst die prächtigen Blüten in ihrem Garten waren ihr in einem Jahr zu mickrig, im nächsten zogen sie lästige Bienen und angeblich auch Blumendiebe an.
Wie das gehen sollte, war Léun schleierhaft. Zwei riesenhafte schwarzbraune Köter bewachten Grantis Garten. Wenn jemand vorbeikam, benahmen sie sich schlimmer als die rüpelhafte Garde vor dem Palast von Sonnenau im Nachbartal. Léun mochte keine Hunde, und bei denen von Granti beruhte das wohl auf Gegenseitigkeit. Wann immer er an ihrem Grundstück vorbeikam, sprangen sie an der Innenseite des Zauns hoch, überschlugen sich in drohendem Gekläff und schienen sich vor Raserei fast gegenseitig zerfleischen zu wollen.
Auch diesmal wurde er von den beiden kalbsgroßen Ungeheuern verbellt, dass ihnen der Schaum nur so von den Lefzen sprühte. Natürlich hatte er sich vergewissert, dass das Gatter geschlossen war, bevor er sich Grantis Reich überhaupt zu nähern wagte. Man sagte zwar, dass Hunde, die bellten, nicht bissen, aber Léun war nicht erpicht darauf zu überprüfen, ob die beiden Exemplare der Alten sich auch daran hielten.
Als er an ihrem Zaun fast vorbeigegangen war, riskierte er einen Blick in Grantis Garten. Eine rostige Schere in den Klauen, stand die Alte vor ihren Stockrosen und kappte die schönsten Blütenkelche, bestimmt um sie drinnen in eine Schale mit Wasser zu legen. Sie hatte innegehalten, um auf die Hunde einzureden, die sich nicht im Mindesten darum scherten. Als sie Léuns Blick bemerkte, keifte Granti ihn fast noch lauter an.
»Mach, dass du weiterkommst, du Strolch! Siehst doch, dass Lóbo und Çerbero ganz verwirrt sind. Aus, ihr Burschen! Platz! Gleich kehrt hier wieder Ruhe ein.«
Léun zog ihr eine lange Nase und beeilte sich, Grantis Revier hinter sich zu lassen.
Doch sie hatte die Grimasse gesehen.
»Dir werd ich Beine machen«, kreischte sie über das Knurren und Bellen hinweg. »Sich über eine arme alte Frau wie mich lustig zu machen. Wart nur, du Racker!«
Léun drehte sich um. Zu seinem Entsetzen löste die Alte den Riegel ihres Gatters. Er wusste, was passieren würde, und verlor keine Sekunde.
»Fass, ihr Burschen! Aber nur spielen, ja?«
Wie rastlose Geister der Unterwelt fuhren die Hunde durch das Gatter in die Freiheit und jagten mit ohrenbetäubendem Gekläff hinter ihrer Beute her.
Léun rannte mit seinen Freunden oft genug um die Wette über die Wiesen Grüntals. Er war ein schneller Läufer, aber eben nur ein Mensch. Außerdem war der Boden auf tückische Weise uneben. Die Biester hinter ihm ließen sich weder durch Senken noch durch herumliegendes Geäst ins Straucheln bringen; er dagegen stolperte alle paar Schritte. Die Erinnerung an seinen ständigen Alptraum lähmte ihn zusätzlich.
Es gab kein Entkommen.
Mit auf und ab nickenden Köpfen und heraushängenden Zungen holten die Hunde ihn scheinbar mühelos ein. Sie sprangen an ihm hoch und versuchten, nach seinen Waden und Handgelenken zu schnappen. Er wich aus, rannte weiter, wich wieder aus.
Nur nicht stehenbleiben!
Kläffend und schwanzwedelnd hetzten die beiden Köter ihn fast die ganzen zwei Meilen bis nach Waldhag. Als die Hütten des Dorfes vor ihm auftauchten, ließen sie endlich von Léun ab. Winselnd hechteten sie in die Richtung davon, aus der sie gekommen waren.
Erschöpft beugte er sich vornüber, stützte die Hände auf die Knie und atmete so lange durch, bis das Brennen in seiner Kehle endlich nachließ. Dann begutachtete er seine Unterarme und Waden. Überall hatten ihm die schnappenden Fänge der Hunde Kratzer und Abschürfungen beigebracht.
»Mistviecher«, knurrte er wütend. »Das habt ihr zum ersten und zum letzten Mal mit mir gemacht.«
Die Verletzungen waren nicht schlimm, er spürte kaum den Schmerz. Umso heftiger brannte das Gefühl der Demütigung in ihm. Er räusperte sich lautstark und spuckte angewidert aus. Könnte er sich doch nur den Geifer der Hunde von der geschundenen Haut waschen!
Zum Mittleren See zurückzugehen kam nicht in Frage. Womöglich würde die alte Granti ihre schwarzen Biester noch einmal auf ihn loslassen. Außerdem hatte er das westlichste Dorf fast erreicht – und damit den Grünwald, der die Grenze des Tals bildete.
Von Waldhag aus führten zwei Pfade hinauf in die Berge. Der nördliche endete bei der Hütte von Héranon, dem Waldhüter. Der südliche querte nach einem steilen Aufstieg einen Rundweg, der um das ganze Tal herumführte und an einigen Stellen atemberaubende Ausblicke bot. Wenn man nicht abbog, sondern dem Pfad weiter nach Westen in die Höhe folgte, erreichte man eine Quelle. Die Bewohner Grüntals nannten sie die Löwenquelle.
Der Wasserlauf, der an dieser abgelegenen Stelle an die Oberfläche trat, hatte im Laufe der Jahrzehnte den weichen Waldboden ausgespült. Ein kleiner Teich war entstanden. An Sommerabenden kamen manchmal frisch verliebte Pärchen hierher. Oder einsame, unglückliche Liebende. Tagsüber ging niemand zur Löwenquelle hinauf, obwohl das Wasser um einiges klarer und frischer war als das aus dem Mittleren See.
Obwohl es längst Mittag war und sein Magen sich mit lautem Knurren bemerkbar machte, beschloss Léun, sich zur Quelle zurückzuziehen. Falls ihm der Hunger keine Ruhe ließ, konnte er ja später immer noch in Waldhag jemanden um einen Becher Milch und eine Waffel bitten.
Er umging Waldhag in südlicher Richtung, um nicht entfernten Bekannten neugierige Fragen beantworten zu müssen. Gut zwei Steinwürfe von der letzten Hütte entfernt schlug er sich in die Büsche, die den Grünwald säumten. Im Schutze des Laubs bewegte er sich auf das Dorf zu. Er hörte Hühner gackern und das gedämpfte Lachen einer Familie, die sich vermutlich zum Essen zusammenfand. Der köstliche Duft von Gebratenem stieg ihm in die Nase. Sein Magen krampfte sich zusammen. Endlich stieß er auf die Mündung des Waldpfads. Er schnaubte entschlossen, kehrte Grüntal den Rücken und machte sich an den Aufstieg.
Als Léun auf den Rundweg stieß, blieb er stehen um zu verschnaufen. Von dem Gewaltmarsch, den er hingelegt hatte, rann ihm der Schweiß von der Stirn. Er wandte sich um und schaute zurück. Weit unter ihm, von den Baumwipfeln teilweise verdeckt, lag Grüntal. Von hier oben aus gesehen hatte das Wasser des Mittleren Sees eine grünbraune, brackige Farbe. Die Luft war diesig geworden. Der Himmel war nicht mehr blau wie am Morgen, sondern von milchigem Weiß, das sich an manchen Stellen zu einem regenverheißenden Grau verdichtet hatte. Noch dazu türmten sich am östlichen Horizont Gewitterwolken auf, die die südlich stehende Sonne fast erreicht hatten. Unwetter zogen laut Léuns Großvater meistens von Osten heran.
Hoffentlich schaffe ich es vor dem Sturm noch nach Hause, dachte er säuerlich.
Der obere Teil des Pfades zur Quelle wurde selten benutzt. Zweige von Buchen und Kastanien hingen bis auf den Boden, und an einer Stelle versperrte eine umgestürzte Tanne den Weg. Léun musste den Baumriesen umgehen und holte sich weitere Schrammen, als er sich mühsam zwischen Ästen und Zweigen hindurchschob.
Kurz danach wurde das Gelände steiler und noch unwegsamer. Beim letzten Regen musste sich der Pfad in einen reißenden Bach verwandelt haben; der Erdboden war zu großen Teilen mitgerissen worden, so dass die darunterliegenden Felsen freilagen. Die kleinsten davon waren faustgroß und kullerten in die Tiefe, wenn Léun darauf trat. Andere Brocken saßen zwar noch fest im Boden, hatten dafür aber tückisch scharfe Kanten. Er musste doppelt vorsichtig sein. An vielen Stellen blieb ihm nichts anderes übrig als zu klettern, weil der Pfad plötzlich von einem hüfthohen Felsabsatz durchbrochen war. Oder er wand sich in einer engen Kehre um einen riesigen Findling herum, den fünf Männer mit ausgestreckten Armen gemeinsam nicht hätten umfassen können.
Léun begegnete niemandem. Froh, für eine Weile dem emsigen Treiben im Tal entflohen zu sein, gab er sich mit allen Sinnen der Stille des Waldes hin. Sie klang anders als die Stille einer Nacht, die sich auch über Grüntal herabsenkte; hier oben sangen kaum Vögel, und keine einzige Grille oder Zikade war zu hören. Nicht einmal die Bäume rauschten. Mittlerweile wehte absolut kein Wind mehr. Nur ab und zu ratschte ein Häher, oder ein paar Waldtauben flogen mit klatschenden Flügeln auf.
Einmal sah Léun ein Reh, das keine zwanzig Schritt vom Pfad entfernt dastand wie ein Bildnis aus Stein. Er blieb ebenfalls stehen, und das Tier und er starrten einander eine Weile reglos an. Wie auf Kommando verfiel es in gemächlichen Galopp, um nahezu lautlos in nördlicher Richtung den Hang hinab zu verschwinden.
Die Wegstrecke zur Löwenquelle war länger, als Léun sie in Erinnerung hatte. Aber damals waren Stán und Arrec dabei gewesen. Sie hatten die ganze Zeit über herumgealbert. Die Zeit war wie im Flug vergangen. Umso erleichterter war er, als das Gelände nach einem schier endlosen, beschwerlichen Aufstieg flacher wurde.
Léun kannte die Stelle – ein erster bewaldeter Hügelkamm, mit dem die Rockenberge begannen. Jetzt musste er noch ein letztes Stück nach Norden marschieren, dann war er am Ziel.
Das Wasser der Löwenquelle entsprang einem felsigen Buckel, der aus dem Hügelkamm herausragte. Er hatte unverkennbare Ähnlichkeit mit dem erhobenen Kopf eines Löwen. An der Seite lief das Wasser herunter und bildete am Boden den kleinen Teich. Dahinter zog sich ein schmaler Bachlauf durch den Wald bis nach Grüntal hinunter.
Beim letzten Besuch hatte sich Stán einen Spaß daraus gemacht, den Felsen zu erklettern, um von dort aus ins Wasser zu springen. Er hatte es doch nicht gewagt. Sie hatten ihn als Feigling verspottet, obwohl Léun sich insgeheim vorstellte, dass die Höhe von oben bedrohlicher wirkte als von hier unten. Außerdem hätte auch er sich nicht unbedingt den Hals brechen wollen.
Der kleine Wasserfall schien ihm diesmal höchstens halb so mächtig wie damals zu sein. Das Wasser des Teichs wirkte schwarz und abgestanden; erst aus der Nähe sah er, dass ihn eine ungünstige Spiegelung des Lichts getäuscht hatte. Weit und breit war niemand zu sehen.
Kurzerhand schleuderte er sämtliche Kleider von sich und watete langsam in den Teich hinein, um sich an das eiskalte Wasser zu gewöhnen. Es reichte ihm immerhin bis zum Bauchnabel. Er hielt beide Hände in den Wasserfall und löschte seinen Durst, tat einen weiteren Schritt und stellte sich direkt darunter. Als das kühle Nass über seine Schultern rann, stockte ihm für einen Moment der Atem.
Das Wasser nahm seinen Schweiß und den klebrigen Geifer der Hunde mit sich fort. Es überspülte seine brennenden Schrammen, bis die Kühle den Schmerz völlig betäubte. Léun hatte seinen inneren Gleichmut wiedergewonnen. Noch einmal schöpfte er Wasser und schüttete es sich ins Gesicht. Er lehnte sich mit beiden Händen gegen den Felsen und legte das Kinn auf die Brust, so dass ihm das Wasser auf den Hinterkopf prasselte. Er schloss die Augen, genoss die klare, reine Kälte des Stroms und stand eine Weile da, ohne zu denken.
Mit einem Mal überkam ihn das untrügliche Gefühl, beobachtet zu werden. Ruckartig hob er den Kopf, wandte sich um und wischte sich mit einer Hand das Wasser aus dem Gesicht. Niemand war zu sehen, nicht einmal ein Tier. Der Pfad und der ganze Hügelkamm, soweit er ihn überblicken konnte, lagen still und verlassen da. Trotzdem – höchste Zeit, dass er sich wieder aufmachte. Mit langen Schritten ging er zurück zum Ufer, stieg aus dem Wasser und schüttelte sich die Nässe aus den Haaren.
Wo war seine Hose? Er hatte sie über eine Baumwurzel geworfen, keine drei Schritt vom Teichufer entfernt. Auch sein Hemd und seine ledernen Sommerschuhe waren verschwunden. Ein Schauder lief ihm über den Rücken. Er ging um den Stamm des Baumes herum, suchte den Waldboden mit hastigen Blicken nach seinen Kleidern ab. Nichts. Er blieb stehen, versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen.
»Arrec?«, rief er auf gut Glück. »Stán?«
Niemand antwortete.
»Verflixt nochmal«, murmelte Léun ärgerlich. Solche Späße konnte er überhaupt nicht leiden, zumal sich die Sonne mittlerweile ganz hinter die Wolken verzogen hatte. Der Himmel war grau, stellenweise schwärzlich. Fahles Zwielicht und stickige Hitze herrschten unter dem Blätterdach des Grünwalds. Es war vollkommen still. Nur in seinem Rücken plätscherte der Wasserfall. Er musste sich endlich auf den Heimweg machen, wollte er noch rechtzeitig vor dem Gewitter zu Hause sein!
Da kam ihm eine Idee. Seine Freunde, wenn sie es denn waren, hatten all seine Sachen geklaut und sich unbemerkt hinter den Löwenfelsen verzogen. Natürlich! Jetzt lachten sie sich ins Fäustchen und warteten nur darauf, dass er ihnen seine Kleider, nackt, wie er war, wieder abzujagen versuchte. Blöde Kindsköpfe. Den Spaß würde er ihnen gründlich verderben.
Plötzlich kribbelte es ihn unangenehm zwischen den Schulterblättern. Da musste jemand direkt hinter ihm stehen. Er wandte den Kopf.
Niemand. Léun war das einzige menschliche Wesen in diesem Wald.
Doch sein Gefühl sprach dagegen. Langsam drehte er sich um die eigene Achse. Die Wasseroberfläche des Quellteichs sah wieder so schwarz und ölig aus wie vorhin, als er angekommen war. Vor Grauen stellten sich ihm am ganzen Körper die Haare auf.
Er war nicht allein, soviel stand fest. Doch wo waren die anderen? Zitternd ließ er den Blick den Wasserfall entlang bis zur Spitze des Felsens hinauf schweifen.
Léun erstarrte.
Dort oben war jemand. Oder vielmehr, etwas.
Das muss ein Traum sein, schoss es ihm durch den Kopf. Ganz ruhig, gleich wirst du aufwachen.
Hinterher konnte er nicht sagen, wie lange er vor Angst wie gelähmt dastand und das Wesen anstarrte, das da aufrecht auf dem Felsen thronte und ihn aus gelben Augen unverwandt musterte. Allerdings brachen währenddessen tausend Gedanken zugleich über ihn herein, an die er sich sein ganzes Leben lang erinnern sollte.
Das kann kein Löwe sein, der letzte wurde vor zehn Jahren in Grüntal gesichtet … Ein Sprung, und er reißt mich in Stücke … Götter, hat das Vieh Augen und Pranken, meine Freunde werden mir kein Wort glauben … Wo hab ich bloß meine Steinschleuder gelassen?
»Zu Hause in Grünhag«, half ihm der Löwe.
Léuns Gedanken versiegten. Er brauchte eine Weile, um zu begreifen, dass gerade ein wildes Tier zu ihm gesprochen hatte.
Der Traum ist gleich vorbei, versuchte er sich zu beruhigen. Ich muss nicht kämpfen. Ich muss nicht weglaufen.
»Fast richtig. Lange genug bist du weggelaufen. Jetzt ist es Zeit, dich mir zu stellen. Kämpfen?« Der Löwe spreizte die Schnurrhaare und schnaubte vergnügt. »Das wäre zwecklos. So zwecklos, wie sich auf den Weg zum Horizont zu machen, mit einem Sieb Wasser zu schöpfen oder die Flamme von der Kerze loszuschneiden.«
Die Stimme klang tief und sonor, zugleich hatte sie einen knurrig-belustigten Tonfall, eine Mischung, genau wie sie Léun von einem Raubtier erwartet hätte, das nichts und niemanden zu fürchten brauchte. Einerseits klang sie so weich und samtig, wie das Fell des Löwen aussah, andererseits aber auch so bedrohlich und tödlich, wie seine scharfen Krallen Wunden rissen. Seltsamerweise kam Léun die Tonlage dieser Stimme unendlich vertraut vor.
Was jetzt?, dachte er.
»Das weißt du doch«, erwiderte der Löwe freundlich. »Ich werde dich verschlingen, auf dass du mich dir einverleibst und endlich zusammengefügt wird, was so lange getrennt gewesen ist.«
Wenn ich nur endlich aufwachen könnte!
»Wovor hast du Angst?«, fragte der Löwe.
Ungläubig starrte Léun ihn an.
Vor dir, dachte er.
»Wovor hast du Angst?«, wiederholte der Löwe mit dröhnend lauter Stimme.
Vor deinen Krallen. Deinen Zähnen. Vor Schmerzen und davor, zu bluten. Vor dem Tod.
Der Löwe erhob sich, spannte die Muskeln. Sein Schwanz peitschte die Luft. Er riss den Rachen auf.
»Wovor hast du Angst?«, brüllte er zum dritten Mal.
Vor dem Sterben, dachte Léun.
»Du lügst«, sagte der Löwe. Und sprang fauchend auf ihn zu.
Mächtige Pranken trafen Léun an den Schultern. Er wurde rücklings zu Boden geschleudert. Sein Hinterkopf schlug hart irgendwo auf, und für einen Moment sah er nichts mehr außer bunten, tanzenden Funken. Verzweifelt versuchte er sich herauszuwinden aus dem unbarmherzigen Griff der Raubtierpranken, doch er war gefangen. Dem jagenden Untier hilflos ausgeliefert.
Und dieses riss ohne Gnade seine Beute.
Léun stöhnte vor Schmerz, als der Löwe ihm die Krallen ins Fleisch grub. Er spürte, wie sein eigenes warmes Blut aus tiefen Wunden hervorschoss und an seinem Körper herunterlief. Er schrie, wie er nie zuvor geschrien hatte. Das Leben in seinem Körper bäumte sich gegen die Bedrohung auf … und für einen kurzen Augenblick kehrte die klare Sicht zurück.
Der Löwe öffnete das Maul und entblößte blitzende, fingerlange Reißzähne. Dann senkte er den Kopf, um seinem Opfer die Kehle durchzubeißen.
Es ist aus mit mir …
Da geschah etwas Unerwartetes.
Dunkelheit kroch aus dem Rachen des Löwen und breitete sich über Léuns Gesichtsfeld wie ein samtenes schwarzes Tuch. Tausend Funken glommen auf und erfüllten die Dunkelheit wie Sterne einen klaren Nachthimmel.
Augenblicklich fühlte er sich leicht. Seine Schmerzen waren wie weggeblasen, sein Leben nicht mehr in Gefahr. Es gab kein Hier, kein Dort, kein Gestern und kein Morgen – nur ein unbegreifliches Überall.
Wo bin ich?, wollte Léun fragen, doch die Worte blieben reine gedankliche Regung, bevor sie Form annehmen konnten; fast wie wenn er die erste Note eines vertrauten Liedes anstimmte und seine Freunde nach und nach einfielen. Auf einmal nahm er den Widerhall dieses Liedes aus allen Richtungen und sämtlichen Zeiten wahr – und er wusste, dass es auf seine Frage nur eine einzige Antwort gab.
Ja.
Blödsinn, wollte er widersprechen.
Die Frage war nicht zu beantworten; sie stellte sich erst gar nicht. Trotzdem war sie berechtigt und willkommen. Wie eine passende, durch nichts zu ersetzende Note in einem unendlichen, vielstimmigen Weltenlied.
Deshalb Ja.
Und Léun begriff staunend, dass dies auch die richtige Antwort auf die Frage des Löwen gewesen wäre.
Siehst du, sagte der Löwe und lachte.
Wer bist du?, sandte Léun verzweifelt eine neue Note in das Lied hinein.
Da erloschen die Lichter, die Musik verklang, und es wurde dunkel um ihn herum.
Sturm
Donnergrollen ließ ihn zu sich kommen. Er schlug die Augen auf. Über sich sah er das Blätterdach des Grünwalds, dahinter ballten sich gelbschwarze Wolken. Ein knorriger Auswuchs der Baumwurzel drückte ihn im Nacken. Er setzte sich auf, um Arme und Oberkörper beäugen zu können.
Kein Blut. Bis auf die Schrammen, die er Grantis Hunden zu verdanken hatte, war er unverletzt.
Léun kam nicht umhin prustend loszulachen. Er ließ sich wieder zur Erde sinken, wälzte sich laut lachend auf den Bauch und legte die Stirn auf die Baumwurzel. Tief sog er den Duft von Laub und Erde ein, atmete aus und lachte, bis ihm die Tränen kamen und der Bauch wehtat.
Dieser verflixte Alptraum!
Kein Zweifel – er war gestürzt und hatte für kurze Zeit das Bewusstsein verloren. Das Monster, das ihn angefallen hatte, war eine Illusion gewesen. Dieselbe Illusion, die ihn fast jede Nacht im Traum heimsuchte.
Er erhob sich, wischte sich ein paar klebende Blätter von Brust und Bauch und wollte seine Kleider aufsammeln.
Sie waren nicht da.
Dafür war starker Wind aufgekommen. Die Wipfel der Bäume wogten. Äste knarrten, Stämme ächzten. Schon gingen die ersten dicken Regentropfen nieder. Innerhalb weniger Atemzüge schwoll das Geräusch zu einem gleichmäßigen Rauschen an.
Léun hob den Kopf, um die Lage des Unwetters abzuschätzen. Im selben Moment zuckte ein gleißender Blitz über den dunklen Himmel, dicht gefolgt von einem ohrenbetäubenden Donnerschlag.
»Verflixt«, knurrte er, duckte sich und zitierte mechanisch den dritten Vers aus einem alten Lied, das ihn sein Großvater hatte auswendig lernen lassen: »Halt dich im Zaum, Gypto! Ich habe kein Dach über dem Kopf … und außerdem hab ich nichts an!«
Doch davon ließ sich Gypto, der Gott der Stürme, nicht beeindrucken. Schon goss es wie aus Eimern. Die einzelnen Tropfen waren groß wie Kastanien. Das Laubwerk hatte ihnen nichts, aber auch gar nichts entgegenzusetzen.
Léun beeilte sich, die Umgebung nochmals nach Hemd und Hose abzusuchen. Er lief um den Löwenfelsen herum, doch vergebens. Wenn seine Freunde hier gewesen waren, dann hatten sie seine Kleider mitgenommen.
Blödiane.
Mit jeder Minute, die verstrich, wurde der Regen stärker. Es war unglaublich dunkel geworden. Das zur Erde strömende Wasser hatte den Grünwald sämtlicher Farben beraubt. Die Sicht verringerte sich bis auf wenige Schritte. Blitz und Donner jagten einander in immer kürzeren Abständen, und der Wind fegte heulend durch den Wald. Blätter und kleinere Zweige trudelten zu Boden. Auf einmal glaubte Léun, in unmittelbarer Nähe einen Baum krachend umstürzen zu hören.
Er gab auf und trat den Rückzug an. Bis nach Hause würde er es nie schaffen; seine einzige Chance bestand darin, die nächste Hütte zu finden. Hoffentlich gewährte der Waldhüter Héranon ihm Unterschlupf, bis der Sturm vorüber war. Und vielleicht überließ er ihm ein paar alte Sachen zum Anziehen.
Während Léun blindlings durch Wald und Unwetter hechtete, kam er sich unbeschreiblich schutzlos und verletzbar vor. Die Bewohner des Grünwalds waren entweder auf der Flucht oder hatten sich tief in ihre Höhlen verkrochen. Er fühlte sich wie ein Tier unter Tieren, nackt und voller Furcht – hoffentlich hatte ihn nicht längst irgendein Wind und Wetter trotzender Räuber zur Beute auserkoren. Wenn er es sich recht überlegte, schien sein Alptraum jetzt erst gnadenlose Wirklichkeit geworden zu sein.
Die Lage der beiden Waldpfade hatte er ungefähr im Kopf; Héranons Behausung befand sich einige Meilen nordöstlich der Löwenquelle. Léun folgte dem Hügelkamm nach Norden und bog irgendwann auf gut Glück in Richtung Grüntal ab. Als er glaubte, weit genug gelaufen zu sein, wandte er sich nach rechts, den Hang hinunter. Hoffentlich verpasste er die Hütte nicht. Mittlerweile war der Waldboden vom Regen so durchweicht, dass er mit jedem Schritt fast bis zu den Knöcheln in matschiges Laub und ekelhaft weiche Erde einsank. Noch dazu holte er sich im dicht wuchernden Strauch- und Nadelgehölz neue blutige Schrammen an Schultern, Armen und Schenkeln.
Nach etwa drei Steinwürfen stieß er auf eine kleine Lichtung. Léun hielt an und verschnaufte. Hier war der Wind schon weniger spürbar, dafür schaukelten die Baumkronen über ihm bedrohlich hin und her. Seine triefnassen Haare klebten ihm an Stirn und Schläfen, und der ständige kalte Regen ließ ihn trotz des anstrengenden Laufs mittlerweile erbärmlich frieren. Flüchtig überlegte er, ob er sich nicht einfach im Unterholz verkriechen und dort besseres Wetter abwarten sollte.
Auf der anderen Seite brach etwas krachend durchs Geäst. Léun fuhr herum.
Ein Wildschwein.
Als das Tier ihn bemerkte, stieß es ein erschrockenes Quieken aus, schlug einen jähen Haken und verschwand raschelnd im Tannengehölz. Léun beeilte sich, ihm das Revier nicht länger streitig zu machen, und rannte in entgegengesetzter Richtung los.
Das war sein Glück. Kaum fünfzig Schritte weiter stieß er auf einen Pfad, der, den zahlreichen Trittspuren nach zu urteilen, regelmäßig benutzt wurde. Léun folgte ihm für weitere hundert Schritte. Nacheinander kam er an einer grob gezimmerten leeren Futterkrippe, einem Holzblock mit Hackspuren und einer auf einem Holzgestell montierten Zisterne vorbei.
Und endlich sah Léun die Hütte.
Er wollte schon aufatmen, da krachte ein Donnerschlag hernieder, der ihm durch Mark und Bein ging. Er beschleunigte seine Schritte, rannte wie um sein Leben und blieb erst stehen, als er die dicke Bohlentür erreicht hatte. Mit beiden Fäusten hämmerte er dagegen.
»Mach auf, Waldhüter!«
Abrupt wurde die Tür aufgerissen.
Léun ließ die Hände gerade noch rechtzeitig sinken. Notdürftig seine Blöße bedeckend, trat er von einem Fuß auf den anderen. Er schlotterte vor Kälte.
»Wer bei allen Göttern …«, rief Héranon über das Getöse des Sturms hinweg. »Léun aus Grünhag? Was führt dich her? Mach schon, komm rein, Kerl! Oder willst du da draußen Wurzeln schlagen?«
Im Haus des Waldhüters war es warm und gemütlich. Auf dem Herd in der Ecke brodelte ein Kessel Suppe vor sich hin. Der Tisch im linken Bereich der Wohnstube war gedeckt; ein Laib Brot, ein gefüllter Krug und ein paar tönerne Becher standen bereit.
Von der Galerie, die über eine steile Holztreppe zu erreichen war, hingen Decken und Wäschestücke herab. Quer durch den Raum spannte sich eine Leine, an der getrocknete Kräuter und Blumen, verschrumpelte Pilze und ein Dachsfell befestigt waren. An der Wand neben der Tür stand ein Regal mit grobem Geschirr. Den rechten Teil des Raums nahmen ein erhöhtes, fellbehangenes Lager und eine hölzerne Truhe ein. Darüber an der Wand hingen eine Trommel, ein Wanderstock, ein Hirschgeweih und eine Art Pergament mit wilden Kritzeleien.
Héranon selbst war ein breitschultriger Mann, stark wie ein Bär, mit blauen Augen, Stoppelbart und von der Arbeit schwieligen Pranken. Er steckte in einem ärmellosen Lederhemd, knielangen Arbeitshosen und sandalenartigen Hausschuhen, außerdem hatte er eine kalte Pfeife im Mundwinkel. Seine dunklen Haare waren kurzgeschoren, das wettergegerbte Gesicht kantig, aber nicht unfreundlich. Léun war nicht gut im Schätzen, aber so alt wie sein Vater mochte der Waldhüter mindestens sein.
»Hier.« Héranon zerrte eine Wolldecke von der Galerie und legte sie ihm um die Schultern. »Wärm dich erst mal auf, Kerl. Du siehst aus, als könntest du was Kräftiges zu essen vertragen, stimmt’s?«
Léun nickte und mummelte sich in die Decke.
»Setz dich, du bist gerade pünktlich.«
Dankbar nahm er am Tisch Platz. Héranon holte eine weitere Suppenschale und einen Löffel aus dem Regal. Er ging zum Herd hinüber und schöpfte aus dem Topf Suppe in beide Schalen. Als er fertig war, setzte er sich Léun gegenüber und schwang einladend den Löffel.
»Hau rein. Ist nichts Besonderes, macht aber satt.«
Unbeholfen griff Léun nach dem Löffel. Die Suppe war dick und so heiß, dass er sich gleich beim ersten Schluck die Zunge verbrannte. Außerdem war sie versalzen. Dafür schmeckten die darin schwimmenden Fleisch- und Gemüsebrocken ausgezeichnet. Es tat ungeheuer gut, sich den seit dem Morgen leeren Magen zu füllen. Er spürte, wie er wieder zu Kräften kam. Gierig vertilgte er auch die zweite Portion und stopfte dazu Brot in sich hinein.
»So«, sagte Héranon, als sie fertig waren, und füllte ihm einen Becher aus dem bereitstehenden Krug. »Jetzt erzähl, was dir zugestoßen ist.«
Léun nahm einen Schluck, um Zeit zu gewinnen. Honigwein, lauwarm und süß – sein Großvater hatte ihn einmal in der Dorfschenke von Mittelhag an der Leckerei schnuppern lassen. Fieberhaft überlegte er sich eine glaubwürdige Antwort.
»Hab mich im Wald verirrt«, murmelte er schließlich.
»Ach.« Der Waldhüter grinste. »Hätte ich nicht gedacht.«
Léun zog es vor zu schweigen. Säuerlich beäugte er die Kratzer an seinem rechten Unterarm.
»Vom letzten Drachenkampf?«, meinte sein Gastgeber augenzwinkernd. »Oder hat dich unterwegs ein Löwe angefallen?«
Er zuckte zusammen und hätte sich beinahe übel an seinem Honigwein verschluckt.
»Nicht direkt«, druckste er herum. »Grantis Hofhunde.« Er hustete verstohlen.
Héranon wurde ernst.
»Haben sie dich gebissen?«
Statt einer Antwort schob Léun seinen Stuhl zurück und streckte missmutig ein Bein unter der Decke hervor.
»Ziemliche Schrammen …« Héranon erhob sich. »Ich koche dir erst mal einen Kräutersud gegen Wundfieber. Und zur Sicherheit noch einen zum Trinken.«
»Brauch ich nicht«, winkte Léun ab. »Ist doch halb so wild!«
»Nichts da, Kerl. Nachher entzündet sich was. Du liegst mit Krämpfen auf der Nase und redest wirres Zeug. Was glaubst du, wie mir Lóhan da die Hölle heiß machen würde. Also sorg ich lieber gleich dafür, dass sein Lieblingsenkel schön gesund bleibt.«
Léun musste grinsen und griff nach seinem Becher. Der Waldhüter war schneller.
»Erst der Kräutersud, klar?«
Léun verkniff sich allzu deutlichen Protest. Er beobachtete, wie Héranon mit zügigen Bewegungen die Suppe zum Abkühlen auf ein Gestell hängte und einen weiteren Topf auf den Herd stellte. Während das Wasser zu sieden begann, pflückte der Waldhüter scheinbar völlig willkürlich Blüten und Kräuter von der Trockenleine herunter und warf sie in den Topf. Kurz darauf nahm er das Gebräu vom Feuer und tunkte summend eine Art Schwamm hinein – vielleicht war es auch ein Baumpilz, wer konnte das wissen. Schließlich kniete er sich neben Léun hin.
»Das wird jetzt wehtun«, sagte er zur Warnung. »Versuch stillzuhalten!«
Mit unsanftem Druck tupfte Héranon ihm die Wunden ab. Léun unterdrückte ein Ächzen, so sehr brannte der Kräutersud.
»Danke, Waldhüter«, presste er hervor, um nicht unhöflich zu erscheinen. Er kam sich ungeheuer schäbig vor. Zum Glück konnten seine Freunde nicht sehen, wie er sich von Héranon verarzten lassen musste.
»Wer Hilfe braucht, kriegt sie auch«, sagte dieser. »Denk dran, wenn du selber mal jemanden in Not siehst.« Er ließ den Rest des Suds noch einmal aufkochen, gab weitere Kräuter hinzu und schenkte Léun endlich einen Becher voll ein.
»Trink das leer«, befahl er, »und zwar bis auf den letzten Tropfen. Ich schau in der Zwischenzeit nach, ob hier nicht noch irgendwo was Passendes für dich zum Anziehen rumliegt.«
Léun pustete in den Becher und tat, wie ihm geheißen. Der Sud war genießbar, zumindest wenn er sich vorstellte, hinterher wieder zum Honigwein übergehen zu dürfen. Während er sich den Trunk in kleinen Schlucken genehmigte, beobachtete er aus dem Augenwinkel, wie der Waldhüter die Truhe neben dem Lager öffnete. Er kramte darin herum und zog schließlich ein paar abgewetzte Fetzen heraus. Rasch schloss er den Deckel und warf seinem Gast über die Schulter einen argwöhnischen Blick zu.
Welche Geheimnisse mochte Héranon wohl haben? In den Dörfern gingen Gerüchte um, wonach er weit in der Welt herumgekommen sei. Tatsächlich sollte der Waldhüter zwar aus Grüntal stammen, hieß es, aber bereits als Jugendlicher sei er weggegangen und habe die meiste Zeit seines Lebens in der Fremde verbracht. Erst vor zehn Jahren, so sagte man, sei er zurückgekehrt, um sich dauerhaft in seiner alten Heimat niederzulassen.
Léun konnte sich nicht daran erinnern. Für ihn gehörte der Waldhüter seit jeher zu Grüntal, genau wie Granti und ihre Hunde. Nur dass er um einiges umgänglicher war.
Das Hemd war zu weit und die Hose zu eng. Trotzdem war Léun froh über die geliehenen Kleidungsstücke. So ließ sich der Sturm schon viel eher aushalten – mit einem Dach über dem Kopf, einem vollen Becher Honigwein auf dem Tisch und dem würzigen Rauch in der Nase, den Héranons Pfeife verströmte. Heftiger Regen trommelte auf das Dach der Hütte, und in der Dunkelheit hinter den winzigen Fenstern konnte man immer wieder Blitze zucken sehen. Jetzt kam es Léun absurd vor, dass er tatsächlich die Idee gehabt hatte, sich bei den Wildschweinen im Unterholz zu verkriechen.
»Wo waren wir stehengeblieben?« Der Waldhüter sog genüsslich an seiner Pfeife. »Ach ja, du wolltest mir gerade erzählen, wo du deine Kleider gelassen hast.«
»Irgendjemand hat sie mir geklaut«, erwiderte Léun. »Denke ich jedenfalls. Ich war baden, und als ich zurückkam, waren sie nicht mehr da.«
Héranon lehnte sich zurück, verschränkte die Arme auf der Brust und schloss die Augen halb.
»Glückwunsch«, knurrte er, wobei er so fest auf den Stiel seiner Pfeife biss, dass seine Kiefermuskeln hervortraten. »Du hast wirklich Glück!«
»Womit?«, fragte Léun verwirrt.
»Na, mit den Mädchen natürlich.«
Er öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, und klappte ihn verwundert wieder zu. Ciára sollte ihm bis zur Löwenquelle gefolgt sein? Das konnte er sich nicht vorstellen.
»Zu meiner Zeit war das alles noch ganz anders«, behauptete Héranon. Er nahm die Pfeife aus dem Mund und hustete so lautstark, dass die ganze Hütte zu wackeln schien. »Früher hatten Grüntals Väter ein Auge auf ihre Töchter. Zwei Augen! Auch nur einmal mit unserer Auserwählten allein zu sein – unmöglich. Wenigstens das scheint nicht dein Problem zu sein, oder?«
»Doch, Waldhüter«, sagte Léun ärgerlich. »Aber darum geht es nicht.«
»Sondern?« Héranon musterte ihn scharf. »Wer blond ist wie du – und ein auch nur annähernd hübscher Bengel –, dem rennen die Mädels doch in Scharen hinterher! Ich weiß aus eigener Erfahrung, wovon ich rede. Fast immer waren meine Kleider weg, sobald ich wieder aus dem See stieg. Hinter den Büschen haben sich die frechen Gören prustend die Augen nach mir ausgeguckt.« Er lachte grimmig.
»Aber da waren keine Mädchen«, widersprach Léun.
»Dann vielleicht ein paar Jungen?« Héranon zuckte die Achseln. »Oder ein einzelner Junge. Der sich zufällig in dich verguckt hat anstatt in ein Mädel.«
»Ich war ganz allein«, beharrte Léun.
»Am Mittleren See ist man nie allein«, gab der Waldhüter zu bedenken.
Léun kniff die Lippen zusammen und schaute in seinen Weinbecher.
»Ach, ich verstehe. Du warst gar nicht am See.«
»Grantis Hunde haben mich bis nach Waldhag gejagt«, gab er zerknirscht zu. »Danach bin ich rauf zur Löwenquelle.«
Ein Donnerschlag ließ ihn zusammenzucken. Selbst Héranon zeigte für einen Moment Respekt vor dem draußen tobenden Sturm. Er hustete ungesund, legte seine Pfeife auf die bereitstehende tönerne Schale und lehnte sich, Atem holend, zurück.
»Wenn ich eins in meinen Jahren als Waldhüter gelernt habe«, sagte er in düsterem Tonfall, »dann, dass in den Wäldern dieser Welt andere Gesetze herrschen, als uns Menschen lieb ist. Zwischen Wipfeln und Baumstämmen leben Kreaturen, die älter sind, als du dir vorstellen kannst. Sie bestimmen, was in ihrem Reich geschieht. Sie dulden uns, keine Frage. Doch nicht alle von ihnen sind uns wohlgesinnt.«
Schluckend verschanzte sich Léun hinter seinem Becher. Der Alte war offenbar nicht ganz bei Trost!
»Die Löwenquelle zählt zu den geheimnisvollsten Orten im ganzen Grünwald. In ihrem Umkreis geschehen seltsame, unerklärliche Dinge. Selbst die Zeit vergeht dort anders. Die Quelle ist …« Héranon brach ab, als er Léuns unverhohlenes Grinsen sah. »Weißt du, woher sie ihren Namen hat?«
»Ja, Waldhüter, aber …«
»Eben nicht«, fiel ihm dieser ins Wort. Er griff nach seiner ausgegangenen Pfeife. »Du weißt es eben nicht. Es hat nicht nur mit diesem Felsen zu tun. Die Löwenquelle ist ein magischer Ort!«
»Aber es gehen doch ständig Leute hin«, rief Léun mit einem unguten Gefühl. »Noch nie ist jemand verzaubert von dort zurückgekommen.«
»Stimmt, Kerl.« Tatkräftig stopfte Héranon seine Pfeife neu. »Trotzdem hast du dort etwas erlebt, das dich an deinem Verstand zweifeln lässt, nicht? Weshalb du im edelsten Gewand, das der Gott der Männer dir schenkte, bei Nacht durch den Wald geirrt bist!«
Léun schwieg betreten.
»Erzähl schon.« Der Waldhüter goss ihm Honigwein nach.
Léun rang mit sich. Sollte er ihm wirklich auf die Nase binden, dass er einen leibhaftigen Löwen auf dem Felsen gesehen hatte? Der noch dazu wie ein Mensch mit ihm gesprochen hatte, bevor er ihn anfiel und ihm mit seinen Krallen die Haut zerfetzte, wovon jetzt aber dummerweise nichts mehr zu sehen war? Ganz zu schweigen davon, dass er im Rachen des Löwen sämtliche Sterne des Alls erblickt hatte?
Nein, da kam ihm die Baumwurzel als Ursache der ganzen Probleme doch wesentlich überzeugender vor.
Wann genau bin ich nochmal gestürzt und ohnmächtig geworden?
Wenn er sich recht erinnerte, war der Löwe schon vorher auf dem Felsen erschienen. Das Vieh hatte doch erst dafür gesorgt, dass er stürzte! Davon abgesehen hatte es bestimmt nicht seine Kleider gefressen.
Oder?
Er leerte seinen Becher so schwungvoll, dass der Honigwein überschwappte und ihm in den Hemdkragen lief.
»Ist anscheinend eine komplizierte Geschichte«, stellte Héranon grinsend fest. Er hatte seine Pfeife wieder in Gang gebracht und blies einen vollkommen runden Rauchring zur Decke.
»Vergiss es«, knurrte Léun.
Der Waldhüter musterte ihn wieder mit halbgeschlossenen Augen.
»Wie alt bist du eigentlich, Kerl?«
»Sechzehn«, log er ohne zu zögern. So alt war Stán. Léun fand, er sah mindestens genauso erwachsen aus. Seine Stimme klang sogar ein bisschen tiefer als die von Stán. Das hatte ihm auch schon Arrec bestätigt.
»Das Alter stimmt schon mal nicht«, murmelte Héranon, ohne ihn anzusehen.
Léun spürte, wie er rot wurde. Wie hatte der Waldhüter das nur merken können?
»Geburtsmond?«, lautete abrupt die nächste Frage.
»Tríl«, antwortete er wahrheitsgemäß.
»Tatsächlich?«, grunzte Héranon, den Pfeifenstiel zwischen die Zähne geklemmt. »Ich wüsste ja zu gern …« Er unterbrach sich und paffte eine Weile grübelnd und schweigend.
»Was?«
Der Waldhüter machte eine wegwerfende Handbewegung.
»Weißt du schon, was du mal werden willst?«
Léun schüttelte den Kopf.
»Irgendwas mit Holz würde mir gefallen. Zimmermann zum Beispiel.« Er überlegte. Arrec würde wohl oder übel Reishändler werden wie sein Vater, Stán schwärmte von der Fischerei.
»Ich könnte einen Lehrling gebrauchen«, meinte Héranon. »Wenn du dir zutraust, Holz zu schlagen und die wilde Sau zu erlegen, neue Waldpfade anzulegen und alte freizuhalten, Nächte durchzuwachen, viel allein zu sein und noch mehr dummes Gerede über dich ergehen zu lassen – dann ist der Posten des Waldhüters vielleicht etwas für dich. Du bist dein eigener Herr, musst aber umso härter schuften, willst du von deiner Arbeit leben.«
Ratlos zuckte Léun die Achseln.
»Überleg’s dir. Ist nur ein Angebot.« Héranon klopfte seine Pfeife aus. »So, Schluss für heute. Fast Mitternacht! Dein Schlafplatz ist oben, oder willst du bei dem Sturm noch nach Hause laufen?«
Auf der Galerie hatte Héranon Decken und Strohsäcke als notdürftiges Nachtlager hergerichtet. Während Léun es sich darauf bequem machte, wurde ihm bewusst, dass er sein Zeitgefühl völlig verloren hatte. Vermutlich war es schon später Abend gewesen, als er an der Quelle wieder zu sich gekommen war – und er hatte geglaubt, es wäre kurz nach Mittag. Bestimmt war er stundenlang bewusstlos gewesen.
Draußen heulte nach wie vor der Sturm ums Haus. Die Wandbalken ächzten, und durch die Fugen im Dach klangen manche Windstöße wie der unstete, zischelnde Atem eines Sterbenden. Léun fröstelte und zog sich die Decke bis unter das Kinn. Seine geschundene Haut brannte. Er war kein bisschen müde. Doch nicht nur der trommelnde Regen, gelegentliche Donnerschläge und der heulende Wind hielten ihn wach; auch die Vorstellung, von dem Ungeheuer mit den Reißzähnen verfolgt zu werden, sobald er nur die Augen schloss, raubte ihm den Schlaf. Nicht zu vergessen der Alptraum mit dem sprechenden Löwen auf dem Felsen.
Wenn es ein Traum gewesen war.
Zumindest hatte er die Attacke des Untiers heil überstanden. Das bewies doch, dass das alles nicht wirklich passiert war! Andererseits hatte es sich ziemlich danach angefühlt. Wenn man sich an einen Traum erinnerte, wusste man im Nachhinein immer, dass es ein Traum gewesen war, fand Léun. Doch wenn er sich jetzt den Moment in Erinnerung rief, als der Löwe ihn angefallen hatte, dann kam ihm dieser Moment genauso wirklich vor wie das Gebell von Grantis Hunden oder der einladende Bratenduft, den er in der Nähe von Waldhag gerochen hatte.
Die Löwenquelle ist ein magischer Ort, kamen ihm die Worte des Waldhüters wieder in den Sinn.
Quatsch, widersprach er in Gedanken. Du hast wohl ein paarmal zu oft die wilde Sau gejagt und zu viele Nächte durchgewacht.
Léun unterdrückte ein glucksendes Lachen und überlegte sich, wie es wohl wäre, Holz zu schlagen. Und alte Pfade freizuhalten, mit einer Art Dschungelmesser oder so.
Du musst umso härter schuften, willst du von deiner Arbeit leben, gab der Héranon in seinem Kopf zu bedenken.
Härter als Arrec bestimmt nicht, wiegelte er ab. Außerdem, das kriege ich hin.
Kriegst du nicht, sagte Arrec.
Wart’s ab, sagte Léun. Was du kannst, kann ich schon lange.
Ja, schon. Arrec grinste schelmisch. Aber nicht so gut wie ich.
Léun schnaubte empört und legte den Kopf in den Nacken. Der Himmel war strahlend blau, die Sonne schien warm auf das Seeufer herab, und ein paar hoch oben dahingleitende Mauersegler stießen ihre sirrenden Rufe aus.
Was ist denn das Komisches?, rief er alarmiert.
Arrec hob verwundert den Kopf, um seinem Blick zu folgen. Blitzschnell stieß Léun ihm mit dem Handrücken freundschaftlich gegen die Nase.
Au … Idiot!, rief Arrec und musste doch lachen.
Sprichst von dir, was?, neckte er ihn.
Arrec schaute ihn skeptisch an.
Ashúra, sagte er dann.
Was?
Ashúra, wiederholte Arrec.
Léun schüttelte den Kopf.
Ich versteh kein Wort.
Ashúra è Káor khi malchû rábæ Ríyuu è láksonû don Yleriánt,





























