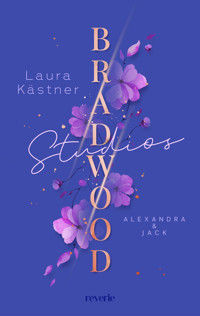Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Harper Audio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Er war der Wind, der meine Stille zerbrach.
Für Cleo gibt es nichts Schöneres, als inmitten der grünen Hügellandschaft Ohios auf einer Schmetterlingsfarm zu leben. Zwischen Zitronenfaltern, Bläulingen und Schwalbenschwänzen geht die zwanzigjährige Management-Studentin ganz in der Hege und Pflege ihres persönlichen Lebenstraums auf. Als ihr Vater ihr offenbart, dass die Farm kurz vor der Pleite steht, kann Cleo daher nicht tatenlos zusehen. Voller Panik sucht sie die Baufirma auf, die das Grundstück kaufen will, um die Übernahme zu verhindern. Als man fälschlicherweise annimmt, sie sei eine Bewerberin für die Assistenzstelle bei Miles Corvey, dem Sohn des Geschäftsführers, sieht Cleo ihre Chance, den jungen Mann und seinen Vater vom Kauf des Grundstücks abzubringen. Doch je mehr Zeit Miles und Cleo miteinander verbringen, desto mehr drohen die Grenzen zu verschwimmen …
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zum Buch:
"Er war der Wind, der meine Stille zerbrach. Für Cleo gibt es nichts Schöneres, als inmitten der grünen Hügellandschaft Ohios auf einer Schmetterlingsfarm zu leben. Zwischen Zitronenfaltern, Bläulingen und Schwalbenschwänzen geht die zwanzigjährige Management-Studentin ganz in der Hege und Pflege ihres persönlichen Lebenstraums auf. Als ihr Vater ihr offenbart, dass die Farm kurz vor der Pleite steht, kann Cleo daher nicht tatenlos zusehen. Voller Panik sucht sie die Baufirma auf, die das Grundstück kaufen will, um die Übernahme zu verhindern. Als man fälschlicherweise annimmt, sie sei eine Bewerberin für die Assistenzstelle bei Miles Corvey, dem Sohn des Geschäftsführers, sieht Cleo ihre Chance, den jungen Mann und seinen Vater vom Kauf des Grundstücks abzubringen. Doch je mehr Zeit Miles und Cleo miteinander verbringen, desto mehr drohen die Grenzen zu verschwimmen …"
Zur Autorin:
Geboren im Mai 1995 in einer Kleinstadt in Sachsen-Anhalt, schrieb Laura schon in der Schule gerne Geschichten. Nach dem Abitur studierte sie Deutsche Literatur sowie Kunst- und Bildgeschichte und schrieb unter ihrem Mädchennamen ihre ersten Bücher. Heute lebt sie mit Mann und in Berlin und arbeitet als Redakteurin.
Laura Kästner
Wenn der Wind die Stille zerbricht
reverie
Originalausgabe
© 2025 reverie in der
Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH
Valentinskamp 24 · 20354 Hamburg
Covergestaltung von Emily Bähr
Coverabbildung von New Africa, BenChaYaPa / Shutterstock
E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 9783745704884
www.reverie-verlag.de
Jegliche nicht autorisierte Verwendung dieser Publikation zum Training generativer Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) ist ausdrücklich verboten. Die Rechte der Urheberin und des Verlags bleiben davon unberührt.
Liebe Leserinnen und Leser, dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Deshalb findet ihr am Romanende eine Themenübersicht, die demzufolge Spoiler enthalten kann.
Wir wünschen euch das bestmögliche Erlebnis beim Lesen der Geschichte.
Eure Laura und euer Team von reverie
Für meinen Onkel, der jetzt auch ein Schmetterling ist.
»Wer Schmetterlinge lachen hört, der weiß, wie Wolken schmecken.«
– Novalis
PLAYLIST
Love Me Now – John Legend
Wildest Dreams – Taylor Swift
Cruel Summer – Taylor Swift
Lights – Ellie Goulding
Almost Everything – Wakey!Wakey!
Breakeven – The Script
Where The Shadow Ends – BANNERS ft. Young Bombs
Home – mgk ft. X Ambassadors & Bebe Rexha
Someone You Loved – Lewis Capaldi
Green Light – Lorde
See You Again – Wiz Khalifa ft. Charlie Puth
When I Look At You – Miley Cyrus
You Found Me – The Fray
Stay – Steph Schlueter
Wherever I Go – OneRepublic
Iris – Mitchell Tenpenny
Someone To You – BANNERS
Good Life – OneRepublic
PROLOG
Cleo
»Entschuldigen Sie, Mrs. Winston?«, höre ich jemanden mit sanfter Stimme fragen, während Mom und ich im Wartezimmer des Krankenhauses sitzen und jede von uns in einem dieser herumliegenden Klatschmagazine blättert.
Aus dem Augenwinkel bemerke ich, wie meine Mutter aus den Gedanken gerissen wird und leicht zusammenzuckt.
»Verzeihen Sie, ich wollte Sie nicht erschrecken«, erklärt der Mann, beide Hände in den Taschen seines weißen Kittels vergraben. Mit den Füßen schlurft er ein wenig über den Boden, als scharrte er wie ein Pferd nervös mit den Hufen.
Ich habe Mom schon häufiger zu den Untersuchungen begleitet, doch ihn sehen wir heute zum ersten Mal: Dr. Harvey Eaton – Facharzt für Onkologie.
»Würden Sie bitte mitkommen?«, fragt er und deutet mit einer Handbewegung auf uns beide. Ich greife nach Moms Hand, bemerke, dass sie so schwitzig ist wie meine. Dennoch schenke ich ihr ein – wie ich hoffe – zuversichtliches Lächeln, auch wenn mein Herzschlag dem eines Kolibris Konkurrenz machen könnte. Heute ist Tag X. Heute erfahren wir, wie es weitergehen wird.
»Na, dann los«, sagt meine Mutter und streicht mir im Gehen sanft über den Rücken.
Es ist erstaunlich, wie viel Kraft Menschen aufbringen können, um anderen Liebe und Zuneigung zu schenken, obwohl es ihnen selbst schlecht geht.
Während Mom vor mir das Untersuchungszimmer betritt, betrachte ich sie: Ihre Silhouette ist schmaler als früher, ihre Haut etwas blasser. Sie ist nur noch ein Schatten ihrer selbst, was wenig verwunderlich ist angesichts all der Untersuchungen, Behandlungen und kräftezehrenden Gespräche, ganz abgesehen von ihrer Arbeit auf der Farm, auf die sie nach wie vor besteht. Ich weiß beim besten Willen nicht, wie sie all das die letzten Monate geschafft hat, ohne zusammenzubrechen. Dennoch hoffe ich, dass ihr starker Wille ausgereicht hat, um wieder gesund zu werden. Man sagt ja »Glaube kann Berge versetzen«, und vielleicht ist es Mom gelungen, den ganzen Mount Everest vom Fleck zu bewegen.
»Ähm, entschuldigen Sie, mein Dad kommt auch noch dazu. Er hat nur keinen Parkplatz gefunden«, erkläre ich dem Arzt, während ich das Behandlungszimmer drei betrete. Rasch tippe ich eine Nachricht an Dad, wo wir sind, und bete, dass er rechtzeitig hier sein wird, damit wir beide Mom beistehen können.
Als Mom vom Arzt auf die Untersuchungsliege gebeten wird, nehme ich auf einem der schwarzen Stühle Platz, der an ihrem Fußende steht. Kurz lasse ich meinen Blick durch den Raum schweifen und fröstele beim Anblick der weißen Wände, die in einen alten PVC-Boden übergehen, welcher mit einschüchternd aussehenden Gerätschaften vollgestellt ist. Jeder Winkel dieses so hell gestalteten Zimmers erinnert mich daran, dass Menschen in ihren dunkelsten Momenten hier erscheinen.
»Dann würde ich noch einen Augenblick warten, bis Ihr Mann dazustößt«, murmelt der Arzt und bedeutet meiner Mutter mit einer Handbewegung, liegen zu bleiben.
Als sie zu mir hinüberschaut, zwinkere ich ihr zu. Das wird schon gut gehen. Auch, wenn Mom sich immer viel zu große Sorgen macht. Wenn etwas nicht in Ordnung wäre, würde der Arzt sicherlich niemals so entspannt bleiben. Stattdessen beobachte ich ihn, wie er ein Formular aus einem der Schubfächer im Schreibtisch holt, um etwas darauf zu notieren.
Es klopft zweimal leise, ehe die breite Tür geöffnet wird. Mein Vater schaut zunächst neugierig durch den kleinen offenen Spalt hinein, und als er Mom und mich erblickt, lösen sich die Falten auf seiner Stirn und werden von welchen um seine Mundwinkel ersetzt.
»Ah, der Ehemann. Guten Tag, ich bin Harvey Eaton, der behandelnde Arzt Ihrer Frau«, stellt sich der Doktor nun auch meinem Dad vor. Dieser reicht ihm die Hand und lässt sich anschließend neben mir auf den Stuhl fallen.
»Möchten Sie sich vielleicht auch zu Ihrer Frau setzen? Ich weiß, dass solche Termine oft sehr herausfordernd sind und eine Belastungsprobe darstellen – da ist es gut, wenn man seine Liebsten direkt bei sich hat.«
Augenblicklich schnappt Dad sich den angebotenen Stuhl auf der anderen Seite, und auch ich rutsche noch etwas näher an die Liege heran. Fast zeitgleich greifen Dad und ich jeweils eine von Moms Händen. Ich reibe mit meinem Daumen über ihren Handrücken, wo unter der kühlen Haut die Knochen leicht hervortreten, um ihr Wärme und auch Trost zu spenden.
»Nun gut, Mrs. Winston, wie Sie wissen, sprechen wir heute über die Ergebnisse Ihrer letzten Untersuchungen. Wir wollten herausfinden, ob der Tumor gewachsen ist und welche Therapiemöglichkeiten wir in den verschiedensten Fällen haben.«
Erneut lächle ich Mom zu. Alles wird wieder gut. Ich weiß es.
»Leider muss ich Ihnen sagen, dass wir Metastasen in Ihrem Magen und auch in Ihrer Lunge festgestellt haben.«
Stille flutet den Raum, und ich habe das Gefühl, alles wie unter Wasser wahrzunehmen: dumpf, verschwommen, verlangsamt. Nur das Ticken der Uhr an der Wand verrät mir, dass die Zeit um uns herum nicht einfach stehen geblieben ist.
»Warten Sie, was bedeutet das?«, fragt mein Vater und drückt Moms Hand so fest, dass die Adern an seiner hervortreten. Sofort breitet sich ein eiskalter Schauer auf meinem Rücken aus, der sich langsam bis zu meinem Herzen arbeitet.
»Es gibt leider keine Aussicht auf Heilung«, entgegnet der Arzt und senkt den Kopf.
Binnen dieser drei Sekunden, die er benötigt, um den Satz auszusprechen, kann ich spüren, wie mein Leben an mir vorbeizieht. Ich habe es nie glauben wollen, wenn Menschen davon berichteten, doch jetzt, in dem Augenblick, der mein ganzes Leben verändern soll, laufen mit einem Mal meine schönsten Momente mit Mom vor meinem inneren Auge ab. Das gemeinsame Schwimmen auf Hawaii, als ich sechs wurde, oder ihr von Tränen überströmtes und dennoch stolzes Gesicht an meinem ersten Highschool-Tag. Die Bilder wirbeln durch meine Gedanken und reihen sich hintereinander wie in Endlosschleife. Und mit einem Mal verstehe ich: Alles endet irgendwann.
Tränen rinnen meine Wange hinab, weil ich weiß, was der Arzt uns zu sagen versucht, auch wenn keiner sich traut, ihn aktiv danach zu fragen. Niemand außer Mom.
»Wie lange hab ich noch?« In ihrer Stimme liegt eine Schwere, unterlegt mit Trauer, Fassungslosigkeit und Angst. Ihr Blick ist leer.
»Das kann doch nicht sein«, murmelt mein Vater und schüttelt den Kopf. »Das kann nicht sein! Nein, das geht nicht. Es muss doch Behandlungsmöglichkeiten geben. Menschen fliegen auf den Mond, um Himmels willen, und tauchen bis zu den tiefsten Stellen der Ozeane hinab. Und dennoch wollen Sie mir sagen, dass wir keinerlei Optionen haben?« Seine Stimme wird mit jedem Satz lauter, meine Sicht mit jedem seiner Worte verschwommener.
»Chris, bitte«, raunt ihm meine Mutter zu, doch Dad erhebt sich.
»Es muss doch etwas geben!«, richtet er das Wort erneut an den Arzt.
»Jede Therapie, die denkbar wäre, schenkt Ihrer Frau lediglich ein wenig Zeit. Und niemand kann genau sagen, wie viel. Hören Sie, Mr. Winston, natürlich gibt es Studien, und ich habe Ihnen bereits meine Empfehlungen diesbezüglich zusammengestellt, doch Sie müssen sich bewusst machen, dass all diese Therapien nicht nur sehr kostspielig, sondern auch kraftraubend sind. Und Letzteres kann Ihre Frau gerade kaum durchstehen. Ich würde Ihnen gerne sagen, dass es andere Mittel und Wege gibt, aber der Tumor wurde leider erst entdeckt, nachdem er sich bereits einige Zeit entwickeln konnte.«
Aufgebracht läuft mein Vater im Zimmer auf und ab, während Mom versucht, sich langsam aufzusetzen. Ich stütze sie, obwohl ich mich am liebsten selbst an ihr anlehnen würde.
»Nein, das akzeptiere ich nicht! Ich werde nicht zusehen, wie du stirbst! Das werde ich nicht tun! Wir klappern jedes Krankenhaus ab! Wir werden uns andere Meinungen einholen. Irgendjemand wird uns helfen können, das weiß ich! Es kann gar nicht anders sein!« Während mein Vater noch mit den Tränen ringt und bei mir schon alle Dämme gebrochen sind, bleibt Mom ruhig. Aus ihren trüben blauen Augen spricht etwas, das noch viel schlimmer ist als Angst – Akzeptanz. Und es bricht mir das Herz, sie so zu sehen.
Meine Mutter ist mittlerweile so geschwächt, dass ich ihr helfen muss, aufrecht sitzen zu bleiben. Dennoch bringt sie den letzten Rest Energie auf, um Dad zu beruhigen. »Chris, hör bitte auf. Das bringt doch nichts.«
Dad hält inne, blickt zu ihr, und als er bemerkt, wie sie kaum merklich den Kopf schüttelt, bricht er endgültig zusammen. Schluchzend sackt er auf die Knie und vergräbt das Gesicht in Moms Schoß. Ich habe Dad in all meinen Jahren nur selten weinen sehen und wenn, dann liefen ihm nur leise ein paar Tränen an der Wange entlang, die er rasch wieder wegwischte. Doch hier passiert gerade etwas, das mein Herz in Millionen kleine Splitter zerspringen lässt: Mein Vater beginnt zu begreifen, dass selbst der größte Wille manchmal nicht ausreicht, um eine Schlacht zu gewinnen.
»Ich kann nicht mehr«, murmelt Mom und lässt sich wieder auf die Liege zurücksinken.
Es gibt Momente, in denen Kinder ihre Eltern nicht sehen sollten. Weil sie eigentlich diejenigen sind, die uns beschützen, vor solchen Erlebnissen abschirmen und behüten. Jetzt, in diesem Augenblick, verstehe ich, wieso das so ist. Meinen Eltern dabei zuzusehen, wie sie aufgeben, macht etwas mit mir. Es lässt etwas unwiderruflich zerbrechen, das niemand mehr reparieren kann, genauso wie ich weiß, dass niemand den wichtigsten Menschen in meinem Leben reparieren kann …
1
Träume
Cleo
Meine Mutter sagte einmal, es gebe genau drei Arten von Menschen. Die, die ihre Träume verwirklichen, egal welche Hindernisse ihnen den Weg versperren. Jene, die einfach alles auf sich zukommen lassen und für die Träume nicht das Wichtigste im Leben sind. Und schließlich diejenigen, die so sind wie Patrick Biedermeyer in der ersten Reihe des Hörsaals. Für mich ist er die perfekte Definition des Menschen, den Mom immer unter Punkt drei genannt hat. Die, die sich über die Träume anderer echauffieren, obwohl sie selbst noch nichts Weltbewegendes zu Papier gebracht haben.
»Also würden Sie sagen, dass der Wunsch von Mr. Carmichael, ein eigenes Unternehmen zu gründen und damit das Bruttoinlandsprodukt anzukurbeln, ein Witz ist?«, erkundigt sich Mrs. Abernathy, unsere Dozentin für Wirtschaftsrecht. Ihre Stimme hallt durch den gesamten Saal und lässt mich ehrfürchtig aufblicken.
Von meinem Platz in der letzten Reihe des Hörsaals aus, wo ich mit meinem alten und lauten Laptop sitze, betrachte ich das Geschehen.
Ich lasse meine Finger über die teils locker sitzenden Tasten gleiten und starre auf den Bildschirm, der ein Spiegel dessen ist, was unsere Dozentin in den bisherigen fünfundvierzig Minuten alles an der Tafel notiert hat.
»Was ich doch nur sagen will, ist, dass es bereits unfassbar viele Unternehmen in den USA gibt. Wozu brauchen wir da noch weitere? Der Markt ist in vielen Bereichen gesättigt mit Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden Mitbewerbern. Es ist Wahnsinn, sich diesem Wettkampf auszusetzen.«
»Schnarchnase«, gebe ich bei Biedermeyers Worten von mir. Erst, als ein allgemeines Raunen wie angestoßene Dominosteine Reihe für Reihe zu mir hinüberrollt, bemerke ich, dass ich anscheinend nicht gemurmelt habe. Mein Herz macht einen Satz, als ich in knapp siebzig Gesichter schaue. Eins von ihnen gehört Mrs. Abernathy, die mich mit einer Mischung aus Verärgerung und Neugierde mustert. Kurz zupft sie an ihrer hellblauen Bluse, ehe sie – den Blick starr auf mich gerichtet – die Arme vor der Brust verschränkt.
Einen Moment lang herrscht eine erwartungsvolle Stille im Raum, ehe meine Dozentin ihre Arme löst und mit dem linken davon auf mich deutet. Ups. »Ms. Winston, möchten Sie näher darauf eingehen?«
Normalerweise wäre es mir eine Ehre, von ihr bemerkt zu werden – kaum jemand hat im Wirtschaftsrecht so viel Erfahrung wie sie. Schließlich hat sie es vor knapp zehn Jahren auf Platz vierundzwanzig der Fortune-Liste mit den einflussreichsten Managerinnen und Managern der USA geschafft.
Aber jetzt versuche ich verzweifelt, die richtigen Worte zu finden. Meine Augen wandern zu Eddie Carmichael, der von Biedermeyer für seinen Wunsch, ein eigenes Unternehmen zu gründen, gedemütigt wurde. Ich stehe vor der Wahl, ihm zu helfen oder mich kleinlaut zurückzuziehen. Mich räuspernd, fahre ich mir durch mein langes rotes Haar. Es ist mein letztes Semester vor dem Abschluss – ich habe also nicht mehr wirklich was zu verlieren.
»Allein im Jahr 2023 wurden in den USA für 6569 Unternehmen Insolvenzanträge gestellt. Sicherlich erschweren es die hohen Zinsen und Kreditraten, einen Fuß in die Tür zu setzen. Aber machen wir uns nichts vor: Die USA sind eine Wirtschaftsmacht, und das wären sie sicher nicht, wenn alle so negativ denken würden. Es ist gut, dass wir Nachwuchsunternehmer in unseren Reihen haben, die diese Lücken mit guten Ideen füllen wollen.«
Anerkennendes Nicken hier und da, verbunden mit leisen Pfiffen und »dem hat sie es aber gezeigt«, wehen wie eine seichte Brise durch den Saal. Ich klappe meinen Laptop zu und halte den aufmerksamen Blicken aller um mich herum stand, eingeschlossen dem Biedermeyers, dessen pechschwarzes Haar ihm in dünnen Strähnen ins Gesicht fällt.
»Nun, mir scheint, Ms. Winstons verständliche Aufschlüsselung der aktuellen Lage ist etwas stichhaltiger als Ihr persönlicher Geschmack, Mr. Biedermeyer. Auch, wenn Ihre Ansätze nicht gänzlich falsch sind. Da wir gerade bei Zukunftsaussichten sind, Ms. Winston, soweit ich weiß, machen Sie in wenigen Monaten Ihren Abschluss. Was ist Ihr Ziel, nachdem Sie das Studium in Wirtschaftsmanagement abgeschlossen haben?«
Verdammt, die Frau scheint genau zu wissen, wer ich bin.
»Nun, ich sollte doch wissen, wer in diesen drei Jahren eine meiner besten Studentinnen war, oder?«, quittiert sie meinen offenbar überraschten Ausdruck mit einem freundlichen Lächeln.
»Das ist nett, danke, Mrs. Abernathy. Und um auf Ihre Frage zu antworten: Ich studiere hier, damit ich die Schmetterlingsfarm meiner Eltern übernehmen kann.«
Als ich mich von meiner Dozentin abwende, kann ich in den Gesichtern der anderen Überraschung erkennen. Verständlich, immerhin wird kaum jemand Leute im eigenen Freundeskreis haben, deren Eltern das Gleiche tun wie mein Vater … und meine Mom, als sie noch lebte. Und ich, sobald ich die Farm von Dad übernommen habe.
»Sehen Sie. Sie alle sind aus bestimmten Gründen hier. Manche wollen riesige Konzerne gründen, andere nur studieren, um sich Chancen auf einen besser bezahlten Beruf zu sichern. Und dann gibt es diejenigen, die die Familientradition fortführen wollen. Es gibt bei all diesen Wegen kein Richtig oder Falsch. Wobei, doch: Falsch wäre es, wenn Sie es gar nicht erst versuchen.«
»Na, Champ, wie ich gehört hab, hast du dich mal wieder für die Jüngeren starkgemacht«, höre ich Will von hinten rufen, als ich über den leuchtend grünen Campus der Ohio State University schlendere. Mit meinen beiden Büchern für Wirtschaftsrecht im Arm und meinem schwarzen Rucksack auf den Schultern, war ich eigentlich gerade auf dem Weg zur Cafeteria, um ihn dort zu treffen. Ich drehe mich nach links, wo mein groß gewachsener bester Freund steht. Mit seinen hellblonden kurzen Haaren und der breiten Statur würde ihn ausnahmslos jeder für den Quarterback der Footballmannschaft halten. Doch Will könnte, was seine Interessen anbelangt, gar nicht weit genug von einem Sportler entfernt sein, denn als Mitglied im Literaturklub bespricht er lieber Werke von Jane Austen oder Ernest Hemingway.
»Ach, hör doch auf. Wer hat dir das denn wieder erzählt?«, frage ich ihn, obwohl ich die Antwort eigentlich bereits kenne. Sein Freund Jean, Austauschstudent aus Frankreich, muss die Quelle sein. Kurz nachdem er vor einem halben Jahr hergekommen war, hatte bereits die Hälfte aller Mädels aus meinem Studiengang ein Auge auf ihn geworfen. Sie alle staunten allerdings nicht schlecht, als es bei der letzten Verbindungsparty mein bester Freund war, der an den Lippen dieses hübschen Franzosen klebte wie Karamell an einem Stück Popcorn.
»Jean. Er ist mit Pam im Statistikkurs, und sie ist wiederum mit dir bei Abernathy. Aber ich muss schon sagen, dass ich stolz auf dich bin. Ich kenne dich mein halbes Leben, und immer kümmerst du dich um diejenigen, denen es schlechter geht als dir.« Seine starke Hand umfasst meine schmale Schulter, als würde er einen Vogel schützen wollen.
»Danke. Aber ich werde einfach nie verstehen, wieso man die Träume anderer schlechtmachen muss. Seit Mom gestorben ist, ist es mein Traum, die Schmetterlingsfarm weiterzuführen, weil sie es sich gewünscht hat und weil ich damit der Natur etwas zurückgeben will. Es ist alles, was mir geblieben ist. Schmetterlinge sind eine so wunderbare Bereicherung und geben unserer Umwelt einfach eine bunte Vielfalt. Ich wäre nicht nur dumm, wenn ich es nicht fortführen würde, sondern auch ignorant unserem Ökosystem gegenüber.« Was ich nicht sage, ist, dass es für mich nichts Wichtigeres gibt, als zu verhindern, dass die Erinnerung an Mom ebenso verfliegt wie ihr Geruch aus den Kleidern in ihrem Schrank.
Will umfasst mit der freien Hand seine braune Ledertasche, die er über der Schulter trägt. In dem hellgrünen T-Shirt, gepaart mit der schlichten Jeansjacke, den sehr abgetragenen weißen Chucks und der getönten Sonnenbrille auf seinem Kopf strahlt er den typischen 90er-Vibe aus und wirkt fast schon ein wenig, als wäre er wirklich einer Zeitkapsel entsprungen. Wenn man mich fragt, ist Will das, was man eine »alte Seele« nennt. Jemand, der trotz seiner jungen Jahre eine Weisheit besitzt, die mir in schwierigen Momenten schon oft geholfen hat.
»Weißt du, was ich denke? Ich glaube, die Leute, die sich über andere lustig machen, wollen eigentlich nur von sich selbst ablenken. Stell dir vor, wie leer ein Leben sein muss, wenn das Herz nicht von Sehnsucht nach etwas Bestimmtem geprägt wird.«
Wo er recht hat …
»Da spricht ein wahres literarisches Genie aus dir«, murmele ich, während wir dem Kieselweg zum mehrstöckigen Backsteinhaus vor uns folgen. Bodentiefe weiße Sprossenfenster erstrecken sich entlang der Hausfassade des Hauptgebäudes wie unzählige Augen.
»Du kennst mich, an mir ist ein Franz Kafka verloren gegangen.« Will grinst bis über beide Ohren, doch ich schüttele den Kopf.
»Vergiss es, das ist der mit den langen Schachtelsätzen. Du bist eher ein Oscar Wilde.«
Will zwinkert mir zu und schnalzt mit der Zunge, als wir die Ohio Union, das imposante Gemeinschaftsgebäude der Uni, erreichen. Das Treiben von drinnen dröhnt bis ins Freie. Eine doppelflügelige Tür führt uns über einen Seiteneingang in die Haupthalle. Weißgrauer Marmor schimmert auf dem Boden wie ein seidenes Tuch, während sich links und rechts von uns hohe Säulen erheben, an denen rot-silberne Flaggen gehisst wurden. Understatement war vermutlich noch nie das Ding unserer Uni.
Im Zentrum der Union sind etliche rote Sofas platziert, auf denen einige unserer Kommilitonen sitzen. Überall sind kleine und große Menschentrauben, die sich miteinander unterhalten. Wortfetzen dringen mir ins Ohr. Von »Mr. Turner hat mir dafür eiskalt eine 4 reingehauen« bis hin zu »Kommt ihr zum Football nächsten Samstag?« ist alles dabei.
»Wollen wir uns kurz setzen, ehe du losmusst?«, erkundigt sich mein bester Freund und deutet auf eine der freien Sitzgelegenheiten.
Ich nicke und betrachte die roten T-Shirts und Pullover unserer Footballmannschaft, die jeder trägt, da sie bereits achtmal die nationalen Meisterschaften gewonnen haben und die Spieler hier in Columbus beinahe wie Helden verehrt werden.
Wir lassen uns auf den samtig weichen Stoff der roten Couch fallen, und ich lehne den Kopf nach hinten, Blick gen Decke gerichtet. Selbst von hier unten erkenne ich die deckenhohen Bücherregale aus dunklem Holz, die das obere Stockwerk schmücken.
»Wie läuft es auf der Farm?«, fragt Will und stellt seine Tasche ab. »Seid ihr fertig mit dem Gärtnern?«
Kopfschüttelnd streiche ich mit den Händen über meine Oberschenkel, die in einer mittlerweile abgetragenen Jeans stecken. »Nein, leider noch nicht. Ich hab letztens noch ein paar neue Pflanzen aus dem Handel geholt. Dad und ich wollten sie heute zusammen einpflanzen. Ansonsten ist nicht mehr viel zu tun, außer ein paar neue Samen für die Wildblumenwiese zu kaufen.«
Will kramt eine schwarze Trinkflasche hervor. Nachdem er einen Schluck daraus genommen hat, schaut er mich eindringlich an. »Willst du das eigentlich überhaupt?«
Ich ziehe die Stirn in Falten. »Was meinst du?«
»Na, dieses Studium. Und die Farm. Ich habe dich in all den Jahren unserer Freundschaft nie gefragt, ob es das ist, was du möchtest.«
»Wie kommst du denn darauf?«, hake ich nach und kann förmlich spüren, wie sich bei den letzten beiden Worten ein Kloß in meinem Hals formt. Noch nie hat mir irgendjemand diese Frage gestellt. Vielleicht, weil schon immer klar war, dass es so sein muss. Cleo ist gleich Schmetterlingsfarm.
»Na ja, du siehst in den letzten Wochen einfach so müde und sorgenvoll aus. Du hetzt zwischen Farm und Uni hin und her, machst Abstecher zu Gartencentern, und zwischendrin sitzt du am Laptop und überarbeitest die Website eurer Farm oder lernst. Versteh mich nicht falsch«, fährt Will mit einem Schulterzucken fort, »wenn es das ist, was du über alles liebst, dann helfe ich dir, und dann kommen wir auch gut durch diese anstrengende Phase. Aber ich will einfach nur sichergehen, dass die Sache, für die du dich da aufopferst, auch das Richtige für dich ist. Schließlich ist es nicht mehr lang bis zu den Abschlussprüfungen.«
Seine Worte sind wie ein Spiegel. Er hält sie mir vor und zwingt mich, einen Blick zu riskieren. Er liegt nicht ganz falsch damit, dass ich müde und ausgelaugt bin. Doch es ist das letzte Semester an der Uni, und ich will die Prüfungen unbedingt bestehen. Hinzu kommt, dass ich Mom momentan einfach schrecklich vermisse, und all das, zusammen mit der Arbeit auf der Farm, ist wie eine Variable in der Gleichung, die das Ganze ins Wanken bringt.
»Bist du verrückt?«, gebe ich ein bisschen überspitzt zurück. »Es gibt nichts Schöneres als diese Farm«, erwidere ich noch etwas energischer und nicke meinem besten Freund zu. »Ich würde eher Sand kauen, als irgendeinen Bürojob zu machen oder so. Ich muss in der freien Natur sein. Dieses Studium dient lediglich dafür, damit es mir später einfacher fällt, den Überblick über unsere Lage zu behalten. Dad lässt mich aktuell noch im Dunkeln, was die Finanzen anbelangt, und ich kann es ihm auch nicht verübeln. Seit Moms Tod hat das Leben auf der Farm für mich an Leichtigkeit verloren, und er will mir nicht noch mehr Arbeit aufhalsen, als ich ohnehin gerade mit dem Studium habe. Doch sobald das in trockenen Tüchern ist, hat er mir versprochen, dass ich mehr Einsicht erhalte und mich mehr einbringen darf. Früher musste ich mir keine Gedanken darüber machen, wie viele Gäste in den kommenden Monaten die Farm anschauen würden und ob die Eintrittsgelder reichen, um alle Pflanzen zu kaufen, zu düngen oder das Haus instand zu halten. Das waren Dinge, die meine Eltern stets vor mir verborgen gehalten haben. Doch spätestens, sobald ich richtig ins Management der Farm einsteige, wird Dad mir mehr Verantwortung übertragen müssen.«
Erinnerungen an entspannte Picknicks mit Mom auf den bunten Wiesen unserer Farm und lustige Grillabende mit unseren Mitarbeitern überschwemmen mich wie eine Welle.
Immer wieder spiele ich in Gedanken durch, wie wichtig die Farm ist. Für den Artenschutz, all unsere Mitarbeitenden und auch die Gäste, die – auch, wenn es nicht viele sind – es bei uns lieben. Ich studiere, damit ich all das weiterführen kann. Das ist das Wichtigste.
2
Zuhause
Miles
»Ich habe gerade mit den Anwälten gesprochen, Miles. Sie haben ein Schreiben aufgesetzt, das bereits vor ein paar Tagen bei der Bank angekommen sein müsste. Genauer gesagt, wird heute oder morgen auch der Besitzer dieser kleinen Flatterfarm die Info bekommen, dass wir ihm das Stück Land zu einem mehr als fairen Preis abkaufen.« Mein Vater steht an dem Fenster seines Büros, den Rücken zu mir gewandt, die Hände in den Taschen seiner Anzughose vergraben. Von hier aus hat man einen weiten Blick auf den Eriesee, an dessen Ufern Cleveland liegt. Die Bäume sind passend zu den immer wärmer werdenden Temperaturen in der Stadt in ein tiefes Grün getaucht. Im Vergleich zu früher ist die Aussicht allerdings schon deutlich grauer geworden. In den vergangenen Jahren haben sich immer mehr Firmen hier in Cleveland angesiedelt. Industriegebäude, die Rauch in den Himmel jagen, und meterhohe Wolkenkratzer, die schon fast die Sonne verdecken. Zwar sieht diese Stadt trotzdem noch deutlich grüner aus als beispielsweise New York City, doch der Charme der Metropole schwindet immer mehr, je stärker sich Firmen ansiedeln. Wo es einst auf dem kleinen Hügel nahe des Wendy Parks nur unsere Baufirma gab, sind es heute gleich drei Stück.
»Du bist dir sicher mit der Übernahme?«
Ich schaue zu meinem Vater, dessen volles kurzes Haar bereits leicht ergraut ist. In seinem schwarzen Anzug strahlt er diese Autorität aus, mit seinem Lächeln zu einem spöttischen, gehässigen Gesichtsausdruck verzogen. Ein Anblick, der anderen einen Schauer über den Rücken jagen würde, doch ich bin ihn gewohnt, denn ich kenne keinen anderen.
»Ich möchte, dass das dein Projekt wird, Miles. Corvey Industries wird sich mit diesem Bürokomplex einen ganz neuen Namen machen. Nach deinem Ingenieurstudium bist du so weit, den Millennium-Komplex zu übernehmen und das Vorhaben zum Erfolg zu führen.« Die Worte meines Vaters streicheln mein Ego und sind genau das, was ich schon lange von ihm hören möchte.
Seit Ewigkeiten wünsche ich mir, dass er diese Worte zu mir sagt, denn noch vor ein paar Jahren wäre das, was er nun von mir erwartet, undenkbar gewesen. Seit meinem Abschluss an der Ohio State University hatte ich noch keine Gelegenheit, mich in der Firma zu beweisen. Entweder sind die Projekte nicht zustande gekommen, weil die Investoren zurückgerudert sind, oder mein Dad hat die Verantwortung für die Bauten selbst an sich genommen. Dass er mir bei einem der größten Bauprojekte seit Jahren diese Chance gibt, ist fast schon ein Ritterschlag, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Genauer gesagt ist es einer, von dem ich nicht weiß, wieso ich ihn gerade jetzt erhalte.
Nachdem Mom sich dazu entschieden hat, sich aus der Geschäftswelt rauszuhalten, und meine Schwester der Branche ebenfalls den Rücken gekehrt hat, gibt es nur noch Dad und mich. Zumindest im Beruf. Es ist ein Weg, den ich immer gehen wollte, doch seit einiger Zeit habe ich auch gar keine andere Wahl.
»Dann ist es dir ernst, ja? Ich soll irgendwann deinen Posten übernehmen?« In meiner Stimme klingt ein Unterton mit, der mich selbst verunsichert. Doch wenn man Ewigkeiten nach mehr Verantwortung strebt und sie dann schließlich bekommt, fällt es einem schwer zu glauben, dass man endlich an der Reihe ist. Zumal sich in den letzten Jahren vieles geändert hat. Dachte der junge, naive Miles noch, dass all das sein Traum ist, weiß ich mittlerweile, dass Träume etwas für Kinder sind. Sie zeigen ihnen Möglichkeiten, aber keine Realitäten.
Fragend schaut mein Vater zu mir und hält einen Moment lang inne, als könnte er nicht verstehen, wieso ich Zweifel hege. Dann lässt er seinen Blick durch das Büro schweifen, als brauchte er Zeit, um die richtige Antwort zu finden.
Dunkelgraues Laminat, weiße Wände mit zahlreichen, silbern schimmernden Wandlampen zieren den Raum. In der Mitte steht ein Glastisch, an dem Dad stets seine Meetings abhält. Müsste man seinen Arbeitsplatz mit nur wenigen Worten beschreiben, wären es: kalt, geordnet und fokussiert. Ohne Platz für Persönliches wie Fotos von der eigenen Familie. Alles erinnert lediglich an die steile Karriere eines erfolgreichen Ingenieurs, der mit seiner Baufirma weltweit etliche Gebäude konstruiert. An den kühlen Wänden prangen in Gold gerahmte Urkunden oder Fotos von meinem Vater vor den Bauten, die er geplant und betreut hat. Es ist das Wertvollste, das er je auf die Beine gestellt hat. Unsere Familie könnte da nicht heranreichen.
»Ich weiß, ich habe viele Jahre gesagt, dass du niemals die Nachfolge übernehmen wirst. Doch jetzt ist deine Chance gekommen zu zeigen, dass du es wert bist. Das alles könnte bald dir gehören, wenn ich in den Ruhestand gehe. Und der Bau dieses Bürogebäudes würde deine junge Karriere steil nach oben treiben. Stell dir nur vor, du startest mit einem solchen Projekt deine Laufbahn als Bauingenieur! Jeder Mauerstein der alten Farm, jede abgetragene Pflanze und sogar jeder umgesiedelte Schmetterling ist am Ende genau das, was du brauchst. Mit der Lage nahe dem Eriesee ist es der perfekte Standort für Unternehmen. Sie würden uns die Türen eintreten, wenn jetzt schon bekannt wäre, dass wir uns das Gelände unter den Nagel gerissen haben. Alles, was ich von dir erwarte, ist die Bereitschaft, hundert Prozent zu geben. Du wolltest das doch schon so lange, oder nicht? Also zeig, was du draufhast!«
Seine letzten Worte lassen mich einen Moment innehalten. Wie üblich sind sie von Kälte und wenig Interesse an mir gefüllt. Doch in einer Sache unterscheidet sich das, was er eben zu mir gesagt hat, von den simplen Zwei-Wort-Sätzen, die ich sonst immer von ihm zu hören bekomme. Es schwingt erstmals ein Hauch von dem mit, was irgendwann sein könnte: Ich könnte die Verantwortung für die Firma tragen. Nach so vielen Jahren, die ich immer wieder gehofft hatte, dass uns der Job hier einander etwas näherbringt.
Während all der Jahre habe ich mir kaum Gedanken darum gemacht, wer die Leidtragenden auf den Grundstücken waren, ehe wir dort unsere Projekte errichtet haben. Es ging immer nur um den Erfolg und um schwarze Zahlen, wie wir dorthin kamen, hat mich bisher nie interessiert. Aber jetzt wird das anders sein, denn am Ende steht zwar Corvey Industries auf dem Papier – doch genau darunter wird nun mein Name zu lesen sein.
Prickelnde Vorfreude sammelt sich in meinem Bauch, gepaart mit der Sorge, ihn zu enttäuschen, und auch mit Zweifeln, denn der Sinneswandel meines Vaters kommt so plötzlich wie ein Donnerschlag bei klarem Himmel. Ich kann endlich ans Steuer und zumindest versuchen, meinen eigenen Weg zu gehen. Ob und wie weit Dad das zulässt, wird sich zeigen.
»Also gehört uns das Gelände schon?«
In den Sekunden, die mein Vater braucht, um zu reagieren, spüre ich das Adrenalin in mir aufsteigen. Doch dann schüttelt er den Kopf.
»Noch nicht, aber das ist nur noch eine Frage der Zeit. Ich bin schon lange hinter diesem Grundstück her, irgendwann wird der Eigentümer dem Verkauf zustimmen. Gerüchten zufolge steht er kurz vor der Pleite. Kein Wunder. Wer interessiert sich heutzutage noch für läppische Falter? Er kann bald weder die Farm noch sein eigenes Leben finanzieren. Ich hab keine Ahnung, ob er Familie hat oder Ähnliches, aber Fakt ist, er wird demnächst verkaufen müssen, wenn er keine Lust hat, auf der Straße zu sitzen.«
Der Gedanke, diesem Mann die Existenz zu nehmen, trifft mich beinahe wie ein Schlag in die Magengrube. Ich bin davon ausgegangen, er will freiwillig verkaufen, und nicht, dass ihn seine Notlage dazu drängt. Gleichzeitig ist er ein erwachsener Mensch, der längst hätte die Reißleine ziehen können, wenn ihm das Wasser bis zum Hals steht. So betrachtet, helfen wir ihm ja sogar.
»Dann gib mir Bescheid, wenn du mehr weißt«, sage ich an meinen Vater gewandt.
Dieser streicht sich durch die kurzen grau melierten Haare, ehe er sich in seinen schwarzen Bürostuhl fallen lässt, dessen Leder ein wenig knarzt.
»Mach dir keinen Kopf, mein Junge. Unsere Anwälte sind dran, und die Bank wird sicher auch bald reagieren. Da mache ich mir keine Gedanken.«
Ich schenke meinem Vater einen weiteren nachdenklichen Blick, denn plötzlich übermannen mich Zweifel bezüglich seiner Gründe, mich irgendwann an die Spitze der Firma zu lassen. Geht es dabei um …? »Dad, überträgst du mir wegen damals diese Verantwortung? Hat es damit zu tun?«, setze ich an.
Mein Dad mustert mich kurz interessiert, während ich mich gegen einen der beiden Bürostühle auf meiner Seite seines Schreibtisches lehne. Augenblicklich kann ich meine eigene Anspannung förmlich spüren. Es nervt mich, dass sich dieses unangenehme Ziehen in der Magengrube jedes Mal in mir breitmacht, wenn ich mit ihm über das sprechen möchte, was mich beschäftigt.
»Wie oft möchtest du noch darüber reden, Miles? Die Angelegenheit hatte die Polizei geklärt.« Die Furchen auf seiner Stirn werden noch tiefer, und vor mir steht der verbohrte Ignorant, der er immer dann ist, wenn ich auch nur versuche, ein wenig hinter seine Fassade zu schauen. Bei anderen könnte ich es ja verstehen. Aber ich bin sein verdammter Sohn!
»Ich werde so oft nachbohren, bis ich von dir eine richtige Antwort bekomme. Ich will doch nur wissen, ob ich deshalb hier bin. Ob dieser Vorfall damals der Grund ist, weshalb du mich hier arbeiten lässt, oder ob du wirklich an mich glaubst.« Jetzt ist es raus.
Ein Seufzen meines alten Herren saust durch den Raum und hallt von den Wänden zurück zu mir. Ich bin so am Arsch. Denn Schweigen ist auch eine Antwort.
»Darum geht es dir? Ist das deine einzige Sorge? Statt dich einfach um deine Arbeit zu kümmern, setzt du dich mit so einem Humbug auseinander?« Das Grollen in seiner Stimme verrät mir, dass seine Zündschnur immer kürzer wird. Aber es ist mir egal. »Pass auf. Ich sage es dir noch ein Mal: Vanessa hat sich damals gegen die Nachfolge entschieden, und ich weiß, dass du es immer wolltest. Ich sah in ihr die perfekte Nachbesetzung für mich, aber offensichtlich war und ist deine Schwester anderer Meinung. Ob nun dein dummer Fehler von vor Jahren eine Rolle spielt, dass du jetzt mehr Verantwortung bekommen sollst, oder nicht – welche Bedeutung hat das? Du bist hier, ich bin hier, und alles ist, wie es ist.«
Seine Worte sind wie in Gift getränkte Watte. Außen kuschelig, doch innen sind sie gefährlich. Was mein Vater mir damit eigentlich sagen will, ist: Mach deinen Job gut und zeig mir, dass du nicht nur ein einfacher Lückenbüßer bist.
Cleo
Es ist später Nachmittag, als ich zu Hause ankomme. Mit Harold, meinem orange-roten Pick-up, rausche ich an dem tristen kleinen Ortsschild vorbei, das für mich jedes Mal wie ein Portal in eine andere Welt ist. Wie in Narnia, wenn Lucy durch den Kleiderschrank spaziert. Manchmal kommt es mir vor, als würde die Zeit in Lorain stillstehen. Viele der Läden, wie den Shop für Anglerbedarf von Alfred Grandham oder den Kiosk von Minerva Mulroney, gibt es bereits seit meiner Geburt. Und meistens, wenn ich abends von der Uni oder den Besorgungen für die Farm heimkehre, hängen sie gerade ihre »Geschlossen«-Schilder von innen an die Türen und winken mir aus dem Laden heraus zu – so auch heute.
Die Sonne lässt sich langsam am Horizont nieder wie ein Schmetterling auf einer Blume, und das warme Licht des Abendhimmels scheint in die kleine Fahrerkabine meines Wagens. Ich kann die winzigen Staubflusen erkennen, die vor mir hin und her tanzen, und spüre innerlich den Drang, Harold endlich mal wieder sauber zu machen. Doch irgendwie komme ich einfach nie dazu, weil für die Farm oder die Uni so viel anderes zu tun ist. Mom hätte – wäre sie noch am Leben – bestimmt aus Spaß eine Botschaft in der Staubschicht auf den Armaturen des Autos hinterlassen. Zumindest hat sie das früher getan, wenn Harold für jeden Allergiker mal wieder die absolute Gefahrenquelle gewesen ist. »Mach mich sauber« oder »Mom war hier« waren nur ein paar der Nachrichten, die sie ab und zu für mich schrieb. Mir wird warm und kalt zugleich ums Herz. In Momenten wie diesen schmerzt ihre Abwesenheit am meisten.
Ich fahre am schmalen Sandstrand vorbei, der in diesem März trotz des schönen Wetters nur spärlich besucht ist. Direkt an der Stelle, wo die sanften Wellen des Eriesees den Sand mit ihrer Nässe benetzen, steht eine junge Mutter mit ihrem kleinen Sohn. Sofort erinnere ich mich schemenhaft daran, wie ich mit Mom früher dort auf Handtüchern lag, während wir die Zehen im kühlen Sand vergraben und auf das berühmte Lorainer Lighthouse geblickt haben, dessen Lichter den Hafen bei Dunkelheit erhellten. Ich werde niemals mehr mit ihr eine Sandburg bauen können. Doch dafür werde ich mich um die Schmetterlinge kümmern, die Mom so vergötterte.
Das rote Spitzdach des weiß gestrichenen Leuchtturms weist mir wie immer den Weg nach Hause. Nur noch drei Kreuzungen, ehe ich einen kleinen schmalen Feldweg erreiche. Umgeben von etlichen blühenden Kastanienbäumen, für die Lorain bekannt ist, liegt am Eriesee unsere Farm Butterfly Dreams. Abgeschirmt durch eine große Hecke, befindet sich dahinter unser kleines Paradies. Als Mom und Dad die Farm damals erbauen ließen, wollten sie, dass dieser Ort nicht nur zu einem Zuhause für die Tiere, sondern auch für uns wird. Beim Aufwachen auf bunte Blumenwiesen schauen, beim abendlichen Grillen im Garten die Schmetterlinge von der Terrasse beobachten, was gibt es Schöneres?
Dads Pick-up, dessen Reifen und Türen zur Hälfte von krustigem Schlamm bedeckt sind, steht bereits vor dem Tor, das auf unser autofreies Gelände führt, auf dem auch unser Haus steht. Kaum habe ich daneben gehalten, strömt mir auch schon die blumige Luft durch das geöffnete Fenster entgegen.
»Bis morgen, Harold«, sage ich und tätschele leicht das Lenkrad. Ich lasse die rostfarbene Autotür hinter mir zufallen und stapfe über die frisch gemähte Wiese auf mein Zuhause zu. Das Eingangstor zur Schmetterlingsfarm ist ein Kunstwerk, von dem ich immer noch nicht glauben kann, dass ich als Kind selbst dabei war, als Dad es erschaffen hat. Es ist ein schwarzer Torbogen, in dessen Rahmen die ausgebreiteten Flügel eines Schmetterlings eingefasst sind. Feinste Glasplatten in Regenbogenfarben wurden in die Zwischenräume der schmiedeeisernen Kunst eingesetzt. Wärme hüllt sich um mein Herz und lässt die einzelnen Erinnerungen an Dads und mein gemeinsames Projekt in meinen Gedanken aufflackern wie die Sonnenstrahlen der einzelnen bunten Gläser. Fein säuberlich habe ich damals all die kleinen Glasplatten herausgesucht, und noch immer sind sie ohne einen einzigen Riss. »Butterfly Dreams in Lorain« prangt darüber in gusseisernen Lettern und in kleineren Buchstaben darunter: »Schmetterlingsparadies der Familie Winston«. Dad wollte Mom damals eine Freude machen und ihren gemeinsamen Ort noch persönlicher gestalten. Wenn man bedenkt, wie herzlich Mom lachte, als sie das Tor zum ersten Mal sah, ist Dads Plan wohl aufgegangen. Noch heute sagt er, dass es die schönste und sinnvollste Sache war, für die er je Geld ausgegeben hat.
Ich drücke gegen die robusten Metallstreben, woraufhin sich das Tor mit einem heimisch klingenden Knarzen öffnet und den Blick auf unser kleines Paradies freigibt. Ich bleibe einen Moment stehen, so wie ich es jeden Nachmittag tue, wenn die wichtigsten Aufgaben erledigt sind und ich mal kurz zur Ruhe kommen kann.
Der Frühling hat Einzug gehalten, und das sieht man an jeder Ecke. Von der linken Seite, hinter unserem schmalen Kassenhäuschen, in dem Ewelyn gerade Zeitung liest, strahlen mir feine Blaukissen in weiß angestrichenen Steintöpfen entgegen. Ihre winzigen Blütenblätter sind herzförmig und bieten als eine der bekanntesten Pflanzenarten viel Nektar für Schmetterlinge. Sie säumen nicht nur den Weg zu unserem Wohnhaus, sondern auch die, die zu all den Schmetterlingshäusern auf dem Gelände führen. Beschwingt laufe ich an Ewelyn vorbei. Sie ist eine resolute Frau, die eigentlich schon im Ruhestand ist, aber seit Jahren ehrenamtlich für uns Tickets verkauft, da sie die Farm genauso liebt wie alle anderen Mitarbeitenden hier. Ein wenig mürrisch liest sie das Lorain’sche Tagesblatt, während sie auf ihrem Kaugummi herumkaut. Als sie mich bemerkt, lächelt sie und zwinkert mir auf ihre mütterliche Art zu, die ich an ihr so mag.
»Na, Kleines, wie war die Uni?«, ruft sie mir zu und senkt dabei die Zeitung in ihren Händen. Entspannt winke ich ab.
»Ein absoluter Graus, wie immer, Ewe«, scherze ich.
Sie schenkt mir ein rauchiges Lachen und deutet mit dem Arm nach hinten. »Dein Dad ist im Haus der Monarchen.«
Ganze sechs Schmetterlingshäuser sind auf dem Gelände der Farm verteilt. Das Haus der Monarchen, das Regenbogenhaus, das Haus der Nacht, das Haus der Wunder, der Blumenpalast und die Raupenwiese. Das Haus der Monarchen war das erste, das Mom und Dad errichtet haben, und so sieht es heute auch aus. Es ist etwas baufälliger als die anderen und gleicht einer übergroßen Scheune mit bodentiefen Glasfenstern. Im Regenbogenhaus sind unsere außergewöhnlichsten Falter untergebracht, die in besonders bunten Farbvarianten schimmern und teils aus tropischen Gebieten stammen. Unsere Nachtfalter beherbergt das Haus der Nacht, und im Blumenpalast sind die Schmetterlinge untergebracht, die den Nektar besonderer Blumen benötigen. Die Raupenwiese, wie das Wort schon andeutet, ist das Zuhause der Tiere, die erst noch zu Schmetterlingen werden wollen, während sich im Haus der Wunder unsere verpuppten Raupen befinden, die bald aus ihrem Kokon schlüpfen.
Ich stapfe den Kiesweg entlang zu dem Haus der Monarchen, in dem Dad sich aufhält. Es ist das einzige unserer Häuser, das noch vollständig aus weiß lackiertem Holz gefertigt ist. All die anderen Unterschlüpfe ähneln eher lichtdurchfluteten Gewächshäusern in Übergröße.
Ein kleines, schiefes Holzschild hängt über dem offenen Torbogen und trägt die filigrane, von mir damals eigenhändig in bunter Farbe daraufgepinselte Aufschrift: »Haus der Monarchen«. Durch eines der Fenster erkenne ich Dad, der unsere kniehohe gelbe Gießkanne in den Händen hält. Selbst im Licht der Abendsonne sticht er damit aus dem Schmetterlingshaus hervor, in welchem gängige Arten wie Monarchfalter und Schwalbenschwänze zu finden sind. In den warmen Monaten schwirren sie dann über die gesamte Farm.
Durch den Torbogen trete ich ins Innere und laufe über den einfachen Dielenboden auf die feine Gitternetztür zu. Jedes Knarzen des Holzes unter meinen Füßen erinnert mich daran, dass ich den heutigen Tag geschafft habe und endlich wieder zu Hause bin. Hier ist mein Safe Space. Hier bin ich ich.
»Hallo, Cleo! Magst du mir von draußen den Sack Blumenerde mitbringen? Dann können wir direkt die Pflanzen umtopfen, die du vorgestern aus Columbus mitgebracht hast.« Die Stimme meines Vaters, mit dem leicht bebenden Unterton, lässt durchscheinen, dass irgendwas anders ist.
Hastig greife ich nach dem Henkel an der oberen Lasche des Papiersacks und trage ihn in seine Richtung. Kaum bin ich durch die dünne Gitternetztür, atme ich den Duft von frischen Blumen und feuchter Erde ein, der sich durch den ganzen Raum erstreckt. Links und rechts vom Eingang ziehen sich zwei mit Sägespänen ausgelegte Wege durch das Häuschen. In der Mitte ist ein kreisförmiges Blumenbeet angelegt, in welchem Flieder und rot leuchtende Flammenblumen blühen. An den äußeren Seiten des Monarchen-Schmetterlingshauses haben Dad und ich in mühevoller Kleinstarbeit einige Kräuter wie Thymian und Salbei eingepflanzt. Eine angenehm würzige Mischung der Gerüche durchströmt mich und pustet meine Atemwege frei. Am Ende des Häuschens entdecke ich meinen Dad an einem langen Holztisch stehend. Auf ihm lagern die einzelnen Blumentöpfe sowie kleine Schälchen mit Regenwasser und geschnittenem Obst, das wir den Schmetterlingen neben dem Nektar der hier blühenden Pflanzen als zusätzliche Nährstoffquelle anbieten.
Je näher ich Dad komme, desto deutlicher fällt mir auf, wie eingefallen er vor Müdigkeit wirkt, und die ersten Stoppeln an seinem Kinn zeigen, dass er länger keine Zeit mehr für eine Rasur hatte. Mit seinem schütteren, leicht ergrauten, dunkelbraunen Haar und der hageren Figur könnte er beinahe als ein jung gebliebener Opa durchgehen.
Er macht einen Schritt auf mich zu und drückt mir einen leicht kratzigen Kuss auf die Wange. »Puh, Dad, du könntest dich mal wieder rasieren«, entgegne ich scherzhaft.
Doch da ist etwas anderes, das mich stutzig innehalten lässt. Es ist das nervöse Zucken seiner Mundwinkel.
Eine sanfte Berührung an meinem Arm unterbricht meine Gedanken. Auf meinem linken Oberarm streifen die feinen Flügel eines Monarchfalters meine Haut. »Hey, Viola, dir auch einen guten Abend.« Augenblicklich legt sich eine Wärme über meine Brust. All unsere Schmetterlinge, auch wenn ihre Lebenszeit immer nur wenige Wochen bis Monate andauert, werden von mir benannt. Ich liebe es, mir zu überlegen, welcher Name am besten zu ihnen passen könnte. Und Viola ist definitiv unverkennbar. Denn obwohl sie genau wie viele andere unserer Monarchfalter die typische Musterung aus schwarz gefärbtem Rand mit weißen Punkten und orangen sowie braunen Verfärbungen in der Mitte ihrer Flügel hat, würde ich sie problemlos wiedererkennen. Sie hat nicht nur ein paar zusätzliche violette Schattierungen, sondern auch die Angewohnheit, sich stets in meiner Nähe aufzuhalten, sobald ich das Haus betrete. »Viola« war Moms zweiter Vorname, und wann auch immer ich sie hier im Haus herumflattern sehe, habe ich das Gefühl, in Moms Nähe zu sein. Als wäre sie noch da. Als wäre sie noch bei mir.
»Du bist ihr Mutter-Ersatz geworden, Cleo.« Mein Vater betrachtet, wie der Schmetterling davonfliegt, und folgt ihm mit dem Blick bis zu einer der Fliederpflanzen.
»Irgendwie schon. Dabei ist sie erst vor Kurzem hier angekommen. Aber es geht schnell, sich an die Neuankömmlinge zu gewöhnen. Und vielleicht geht es ihnen mit uns Menschen genauso.«
Jedes Jahr machen sich die Monarchfalter im Herbst auf eine lange Reise in die Wärme bis nach Mexiko. Gerade deshalb sind die Türen des Hauses der Monarchen immer geöffnet. Die Falter dürfen sich, wann auch immer sie möchten, auf ihre Reise machen. Da sich die Monarchfalter am Magnetfeld der Erde orientieren, können sie nach Belieben losfliegen. Es ist immer ein Highlight, wenn sie ab März in Ohio auf Wanderschaft gehen, denn dann sieht man diese Tiere hier in Scharen über das Land fliegen. Es ist ein Abschied auf ewig, denn diese Monarchfalter leben meist nur ungefähr einen Monat. Jeder Schmetterling, der also aus umliegenden Gebieten in Ohio und anderen Bundesstaaten seinen Weg zu unserer Farm findet, war vorher noch nicht hier.
Ich freue mich jedes Mal aufs Neue, wenn Monarchfalter auf ihrer Reise zu uns kommen, weil es sich anfühlt, als würde man in eine riesige Wundertüte greifen oder Lotto spielen, wenn man darauf tippt, wie viele es bis zu uns schaffen. Zwar sehe ich Falter wie Viola nicht wieder, doch ich bin dennoch nicht alleine. Es gesellen sich andere Falter zu uns, die hier vorübergehend ein Zuhause finden.
Die Schmetterlingsarten in den klimatisierten Häusern bleiben allerdings darin. Sie übernehmen wir als Raupen von anderen Tierparks und Naturschutzorganisationen und kümmern uns darum, dass sie hier genügend Nahrung finden, sich dann verpuppen und schließlich zu Schmetterlingen werden. Für sie sind wir also wirklich ihr Zuhause – von Anfang bis zum Ende.
Ich beobachte meinen Dad dabei, wie er die Schale mit dem aufgeschnittenen Obst an der Spitze einer Blumenspirale platziert, die von der Decke hängt.
»Wir müssen die anderen Häuser auch noch fertigmachen, zumindest was das Blumenpflanzen anbelangt. Ein paar der Beete müssen gejätet und mit neuen Pflanzen bestückt werden. Gerade das Haus der Wunder müssen wir ein wenig vorbereiten. Wenn die Schmetterlinge erst mal aus den Kokons geschlüpft sind, werden sie gewaltigen Hunger haben, bevor wir sie von dort in den Insektenkästen in die anderen Häuser transportieren.«
Kaum hat er fertig gesprochen, beginnt mein Magen zu knurren, was Dad ein lautes Lachen entlockt, und die Heiterkeit erfüllt mich von Kopf bis Fuß. Erst im zweiten Augenblick ertappe ich mich dabei, wie ich mir innerlich eingestehen muss, dass dieses Lachen nicht ganz seine Augen erreicht. Es ist keins, bei dem seine Grübchen an den Wangen hervortreten. Irritiert mache ich einen Schritt auf ihn zu, um ihn besser anschauen zu können, doch er meidet den Blickkontakt – etwas, das er nur dann tut, wenn er ein schlechtes Gewissen hat.
»Was ist los, Dad? Ist etwas mit den Schmetterlingen? Oder den Raupen? Fressen sie nicht richtig? Sonst muss ich noch mal mit Gwen sprechen, damit sie darauf achtet, dass wir immer genügend Brennnesseln haben. Gerade die Nesselfalter sind darauf angewiesen, sonst verpuppen sie sich ja nicht, und …«
Mit einem schnellen Kopfschütteln bedeutet er mir, dass es darum nicht geht.
»Was ist denn dann? Schon als ich hier reingekommen bin, konnte ich förmlich spüren, dass irgendwas nicht okay ist. Sag es mir.« Meine Stimme klingt schroffer als beabsichtigt, doch normalerweise erzählen Dad und ich uns alles. Wir haben seit Moms Tod schließlich nur noch einander.
»Okay, setz dich«, fordert er mich auf und deutet auf einen der braunen Holzhocker, die überall im Raum verteilt stehen.
Widerwillig komme ich seiner Aufforderung nach, während er sich gegen den Rahmen der Gitternetztür lehnt und die Arme vor der Brust verschränkt.
»Es gibt da etwas, das ich dir sagen muss. Und bevor du Widerworte gibst, bitte lass mich erst ausreden.«
Mein Magen zieht sich schmerzhaft zusammen, denn wenn er solche Ansagen macht, haben wir wirklich ein Problem.
»Ich habe vorhin einen Brief von der Bank erhalten. Wir stecken in Schwierigkeiten. Die Besucher werden immer weniger. Wer kann es ihnen verübeln? Wir mussten die Eintrittspreise erhöhen, damit alles finanziert werden kann. Es bleibt kein Geld für Marketing. Alles, was wir einnehmen, stecken wir wieder zurück in die Farm. Du hast es eben wieder gesehen: Ewelyn sitzt sich den Hintern wund im Kassenhaus. Ja, wir haben Besucher, aber die Anzahl reicht einfach nicht aus. So langsam sieht es wirklich schlecht aus, und deshalb …«, er nimmt einen tiefen Atemzug, »werde ich die Farm verkaufen.«
Mein Verstand zerschellt, als ich versuche, die Worte zu begreifen, die mein Vater wie einen Stein gegen mein Gedankenglashaus wirft. Die Farm ist mein Zuhause. Hier bin ich aufgewachsen und groß geworden. Und jetzt soll all das vorbei sein?
»Das kannst du doch nicht machen, Dad! Du willst einfach so die Farm verkaufen, für die Mom und du so lange geschuftet habt? Was würde sie denn denken, wenn du das Einzige hergibst, das wir haben? Das Einzige, das uns an sie erinnert.«
Ich sage nicht, dass keiner ihrer Pullover mehr nach ihr riecht. Dass ihre Stimme schon lange nicht mehr klar in meinen Ohren klingt. Dass ich sie vergesse – mit jedem Tag ein Stückchen mehr. Denn es würde ihm genauso wehtun wie mir.
Tränen schießen mir in die Augen, und ich muss mich selbst ermahnen, mich zu beruhigen. Dad kann nichts dafür, dass es uns finanziell so schlecht geht. Er hat seit Moms Tod mindestens genauso sehr versucht, alles aufrechtzuerhalten, wie ich.
»Aber Mom ist nicht mehr da, Cleo. Ich habe mehr als fünf Jahre gekämpft, um die Erinnerung an sie wachzuhalten. So viele Jahre, in denen mich die Trauer um sie beinahe aufgefressen hat. Aber ich kann nicht zaubern. Ich habe alles gegeben, und ich kann nicht mehr.«
Langsam streiche ich mir mit dem Handrücken über die Wangen und spüre immer mehr, wie die warme Nässe meiner Tränen über mein Gesicht rinnt. »Ich habe genauso gekämpft, bin genauso erschöpft, aber das heißt nicht, dass wir einfach aufgeben sollten! Hast du mal an Gary, Gwen, Ewelyn und die anderen gedacht? Wir haben Mitarbeiter. Menschen, die ihre Miete zahlen müssen und für die wir nicht einfach so die Flinte ins Korn werfen können! Ich suche mir einen Nebenjob und helfe dir mit dem Geld. Denk doch mal an Abigail, Violet und die anderen Schmetterlinge! Wo sollen sie hin?«
»Cleo, Blumenwiesen gibt es in Ohio wie Sand am Meer. Die Tiere kommen klar. Das weißt du genauso gut wie ich.« Mein Vater winkt ab und schüttelt den Kopf, was Wut in mir aufsteigen lässt.
»Ist es das, was du dir einredest, wenn du unser Zuhause an die Bank verhökerst? Dass wir alle schon damit klarkommen werden? Mir scheint, der Einzige, der kein Problem damit hat, diese Farm aufzugeben, bist du. Ich werde nicht einfach zusehen, wie du alles, was ich habe, an irgendjemanden verkaufst, der damit wer weiß was anstellt! Wir schützen die Natur mit diesem Ort. Wir helfen den Tieren und sichern Arbeitsplätze – Wir. Haben. Eine. Verantwortung!«, schreie ich ihm schon fast entgegen und stürme aus der Tür. Tränen der Verzweiflung laufen unaufhörlich, und dennoch kann ich nichts anderes empfinden als sture Entschlossenheit.
Draußen in der Abendsonne, die beinahe hinter den grün leuchtenden Baumkronen am Rande der Farm verschwunden ist, haben ihre wärmenden Strahlen angesichts der frostigen Kälte in meinem Inneren längst ihre Wirkung verloren.
Gwen, unsere Lepidopterologin, starrt mich mit großen Augen an, als ich Richtung Ausgang laufen will und sie dabei unsanft an der Schulter streife. »Hey, Cleo, ist alles in Ordnung?«, höre ich sie noch rufen
»Tut mir leid«, ist das Einzige, das ich hervorbringen kann, ehe ich davonrenne.
Der gepflasterte Weg führt mich vorbei an einer Reihe gepflegter Hecken, zu dem Ort, den ich seit meiner Kindheit mein Heim nenne: ein schlichtes, mit hellblau gestrichenem Holz verkleidetes Einfamilienhaus, dessen schwarzes Dach in der Abendsonne regelrecht leuchtet. Hier und da blättert die Farbe der Hausfassade bereits ab, und auch der Aufgang zu unserer Tür – drei leicht morsche Treppenstufen – ist nur noch ein mäßig gut aussehendes Überbleibsel, das die Zeit nach Moms Tod ebenso wenig gut verkraftet hat wie wir. Vermutlich könnte man das Haus auch als eine Art Spiegel unserer selbst betrachten: außen kaputt und brüchig, aber innen voller Erinnerungen.
Als ich die Stufen hinaufstapfe, knarzt es unter meinen Füßen. Unsanft stoße ich das weiße hölzerne Türblatt auf und renne hinauf in mein Zimmer. Ich schmeiße mich auf mein Bett und lasse meinen Tränen endgültig freien Lauf, auch wenn ich darin zu ertrinken drohe.
Es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis ich mich wieder beruhigt habe, doch was bleibt, ist das Gefühl von Leere, in der eine Frage widerhallt: Wie naiv bin ich in all den Jahren gewesen? Dad hat alle Finanzen immer von mir ferngehalten, meinte, dass ich mir darum nicht auch noch Sorgen machen solle.
Aber dass wir unser ganzes Leben nicht mehr finanzieren können? Ich hätte doch irgendwas merken müssen … Woher kommt dann das Geld für das Saatgut und all die Pflanzen, die ich immer kaufe, um unser Grundstück zu bewirtschaften? Von den Kosten für Dünger und Co. ganz abgesehen.
Müde und kaputt betrachte ich mein eigenes Reich, das mir in schweren Zeiten bisher das Gefühl von Sicherheit gegeben hat. Das zarte Hellgelb an den Wänden habe ich geliebt, weil es meine dunklen Tage erhellt hat. Und auch die Bildergirlanden an der Wand sind ein Überbleibsel aus meiner längst vergangenen Kindheit. Was sonst immer mein Sicherheitsnetz war, erinnert mich nurmehr daran, dass ich all das verlieren könnte. Ich schaue hinauf zu den Fotos von Mom, Dad und mir. Der Erhalt von kostbaren Augenblicken der Vergangenheit war mir immer so wichtig, weil ich damit Erinnerungen an unsere Farm verbinde. Und dies wird nun alles in Vergessenheit geraten, wenn mein Zuhause nicht mehr da ist.
Missmutig lasse ich meinen Blick zum Fenster links von mir gleiten. Die unzähligen Ordner auf meinem Schreibtisch sind ein Indiz für mein Studium, das mir so unwichtig erscheint wie noch nie. Wofür Kurse wie Statistik, Wirtschaftsrecht oder Wirtschaftsgeschichte, wenn ich all das nur für die Farm getan habe? Wozu für die Prüfungen in ein paar Wochen lernen, wenn der Sinn des Ganzen geradewegs vor meiner Nase verkauft wird?
Ein leises Klopfen an der Tür ertönt, welches ich ignoriere. Stattdessen stülpe ich mir die Decke über meinen Kopf.
»Cleo, bitte. Lass uns nicht streiten«, höre ich meinen Vater murmeln. Ich will ihm nicht böse sein, schließlich habe ich nur noch ihn. Und sosehr ich ihm gerade die Schuld an allem geben möchte, ein Teil in mir weiß, dass er keine andere Wahl hat. Was ich allerdings nicht verstehe, ist, wieso er all diesen Aufwand noch betreibt, wenn er schon so lange weiß, dass unsere Farm keine Zukunft hat.
»Komm rein«, flüstere ich, schäle mich wieder aus der Decke und verschränke die Arme vor der Brust.
»Hey, mein Schatz, es tut mir leid«, sagt Dad kaum hörbar, während er eintritt und sich dann neben mir auf mein schmales Bett gleiten lässt. Er lehnt sich an das Fußteil und begutachtet mich mit einem müden Blick. Ich sehe ihm an, dass er nach den richtigen Worten ringt, die er aber kaum zu finden scheint. Kurz nach Moms Tod lag eine Stille über der Farm, die sich nach einigen Wochen wieder verflüchtigt hat. Doch jetzt ist sie wieder da – mitten in meinem Zimmer, und ich spüre tief im Herzen das Verlangen, sie sofort zu durchbrechen.
»Verrate mir eins: Wieso hast du mich Management studieren lassen, wenn absehbar war, dass wir es nicht lange packen können? Wie konntest du mich derart im Dunkeln lassen?«
Mit einem in letzter Zeit für ihn so typischen Stirnrunzeln legt er seine Hand dorthin, wo sich mein Knie als leichte Erhöhung unter dem Bezug abzeichnet. »Du hättest niemals studiert, wenn es nicht im Sinne der Farm gewesen wäre, oder?«
Er hat recht. Vermutlich hätte ich all meine Zeit in diesen Ort gesteckt. »Das mag ja sein, aber war es das wert? Mich im Glauben zu lassen, ich würde diesen Ort irgendwann übernehmen können? Die Vorstellung aufrechtzuerhalten, dass ich mich um alles kümmere, während du in der Hängeschaukel sitzt und mir beim Arbeiten zuschaust?« Mein Dad schluckt schwer, als ich diese Worte ausspreche, und ich kann nur erahnen, wie sehr ihn all das mitten ins Herz trifft.
»So darfst du das nicht sehen, Cleo. Natürlich wäre das schön gewesen, und ich wollte dir das nicht nehmen. Ich habe nur geglaubt, dass du deinen Frieden damit machen würdest. Meinst du nicht, dass wir auch woanders ein neues Plätzchen für uns finden könnten?«
Seine Worte durchdringen mich, als wäre ich nur eine leere Hülle. So wie er die Frage stellt, bedeutet es, dass ihm die Farm augenscheinlich egal ist.
»Auf keinen Fall! Das hier ist schließlich mein Zuhause, der Ort, der Mom alles bedeutet hat.«
Dad schüttelt den Kopf. »Nein, das Einzige, was ihr alles bedeutet hat, warst du. Sie hätte gewollt, dass du auf etwas aufbauen kannst, eine gesicherte Zukunft hast und dich nicht mit Geldproblemen herumschlagen musst. Wir haben uns etwas Besseres für dich gewünscht.«
»Aber das hier ist doch schon das Beste, das ich habe. Diese Schmetterlingsfarm, zusammen mit dir: Das ist alles, was ich will und brauche.«
»Ich fürchte, von diesem Gedanken müssen wir uns jetzt verabschieden«, erwidert er mit gesenkter Stimme.
Je ruhiger er wird, desto deutlicher spüre ich das Adrenalin durch mich hindurchfließen. Ich setze mich auf.
»Woher kam das Geld, mit dem wir uns die letzten Jahre über Wasser gehalten haben? Für all die Samen, das Haus und unsere Autos?«
»Du weißt, dass ich, lange bevor ich deine Mutter getroffen und sie mich mit ihrem Freigeist in diese bunte und außergewöhnliche Welt entführt hat, in einer großen Bank gearbeitet habe. Damals konnte ich einiges an Geld beiseitelegen. Das hat uns eine ganze Weile über Wasser gehalten. Aber nun ist fast alles weg.«
Meine Gedanken wandern zu unseren gängigen Pizza-Abenden in Rosies Pizza Palace und meine teuren Studienfahrten. Am liebsten würde ich ihm an den Kopf werfen, dass wir das Geld besser hätten sparen können, wenn er offen und ehrlich zu mir gewesen wäre. Doch dann fällt mein Blick auf seine grüne Latzhose, die mittlerweile mehr aus Flicken als ihrem ursprünglichen Stoff besteht. Auch wenn ich noch immer innerlich vor Wut koche, bricht es mir in diesem Augenblick tausendfach das Herz, weil ich mich automatisch frage, auf was er mir zuliebe noch alles verzichtet hat.