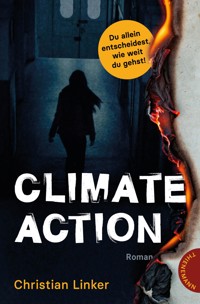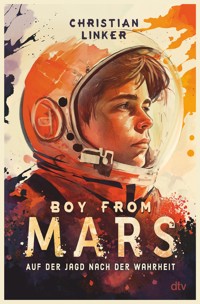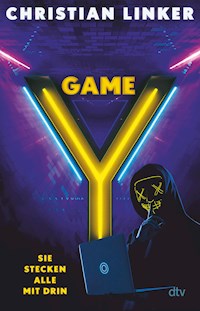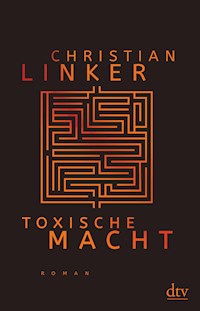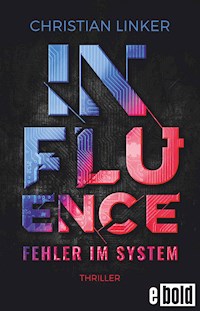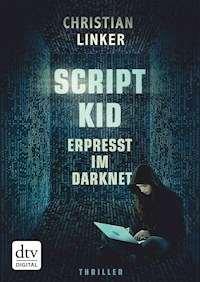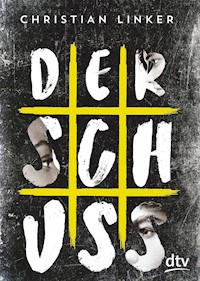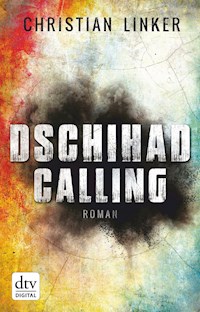12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Drei Jugendliche. Drei Stimmen, die sich nicht zum Schweigen bringen lassen. Drei Jugendliche ringen um ihre Freiheit: Harry kämpft sich durch die Ruinen der Nachkriegszeit, Jennifer landet wegen ihrer Regimekritik im brutalsten Jugendknast der DDR und in der heutigen Zeit sieht sich der Slam-Poet Nadiem bei seinem ersten großen Auftritt einem rechten Mob gegenüber. Jahrzehnte trennen diese Geschichten voneinander und doch verbindet sie neben einem familiären Geflecht der Wunsch nach Freiheit und Selbstbestimmung, mit dem die drei Jugendlichen schnell an Grenzen stoßen – und der Mut, diese zu überwinden. - Eine bewegende, aufrüttelnde Auseinandersetzung damit, was es heißt, für Freiheit zu kämpfen - Emotional eindringlich und dabei hoch spannend
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
Sie glaubten an eine Lüge …
Drei Jugendliche ringen um ihre Freiheit: Harry kämpft sich durch die Ruinen der Nachkriegszeit, Jennifer landet wegen ihrer Regimekritik im brutalsten Jugendwerkhof der DDR und in der heutigen Zeit sieht sich der Slam-Poet Nadiem bei seinem ersten großen Auftritt einem rechten Mob gegenüber. Alle Hoffnung scheint verloren – doch aufgeben ist für die drei keine Option. Jahrzehnte trennen ihre Geschichten voneinander und doch verbindet die Jugendlichen neben einem familiären Geflecht der Wunsch nach Freiheit und Selbstbestimmung, mit dem sie in totalitären Strukturen schnell an ihre Grenzen stoßen – und der Mut diese zu überwinden!
Harry: 1945 bis 1947
Das begeisterte HJ-Mitglied Harry landet kurz vor Kriegsende in einem britischen Lazarett. Dort begreift er, an was für eine Ideologie er geglaubt hat. Zurück daheim gründet er daher einen umstrittenen Musik- und Debattier-Club für Jugendliche …
Jennifer: 1988 bis 1992
Die überzeugte Sozialistin Jennifer spitzelt für die Stasi. Doch die Menschen in der kirchlichen Friedensgruppe, die sie infiltriert, bringen sie zum Nachdenken – allen voran Pfarrerstochter Nicole, die noch dazu ganz unerwartete Gefühle in ihr weckt …
Nadiem: Gegenwart
Als »Vorzeige-Flüchtling« Nadiem in eine Schlägerei verwickelt wird und ein Video davon viral geht, werden plötzlich online Aufrufe verbreitet, seinen geplanten Slam-Auftritt zu crashen. Soll er dieses Risiko wirklich eingehen?
Von Christian Linker ist bei dtv außerdem lieferbar:
Y-Game – Sie stecken alle mit drin
Toxische Macht
Der Schuss
Influence – Fehler im System
Und dann weiß jeder, was ihr getan habt
Dschihad Calling
Blitzlichtgewitter
RaumZeit (als E-Book)
Scriptkid – Erpresst im Darknet (als E-Book)
Boy from Mars
Back to Mars
Stadt der Wölfe
Christian Linker
Wenn die Welt unsere wäre
Roman
Für uns. Alle.
1
1945. Harald
Er rannte über das Kopfsteinpflaster. Vielleicht kannte er die Straße, vielleicht auch nicht, er konnte sich kaum orientieren, weil die meisten Gebäude nur noch Ruinen waren. Dazwischen gab es ein paar Ladenzeilen, alle Fenster mit Brettern vernagelt. Das Dröhnen in der Luft kam näher.
Er rannte schneller. Die Straße war von Bombenkratern übersät, er musste ausweichen oder springen. Neben ihm rannte Fritz und vor ihnen beiden lief Erich, der Leitwolf. Hinter sich hörte Harry das Keuchen von Jupp, bis es vom Donnern des Kampfbombers verschluckt wurde, der jetzt über ihren Köpfen auftauchte. Harry rannte weiter, machte sich auf das Pfeifen der Bomben gefasst, er war bereit, in den nächsten Krater zu springen, um sich vor der Explosion zu schützen, aber da pfiff nichts. Stattdessen orgelte ein MG los. Kurzer Blick nach oben. Thunderbolt, erkannte Harry sofort, amerikanischer Jagdflieger. Mit dem Kopf im Nacken kam er fast ins Taumeln, fing sich wieder, rannte weiter, das Gewehr in seiner Hand wog plötzlich Zentner. Er spürte Nadelstiche im Rücken und glaubte sich getroffen, aber das waren nur Steinchen, von den Geschossen aufgepeitscht, dann war der Flieger über sie hinweggerauscht und verschwand hinter den verkohlten Hausdächern der nächsten Querstraße.
Harry hielt inne, rang nach Luft. Junge, wir leben noch! Vor Erleichterung wollte er dem Fritz neben sich auf die Schulter klopfen. Aber der Fritz war nicht mehr neben ihm. Harry drehte sich um und sah ihn auf dem Rücken liegen, die Augen starr, sein Blut rann über das Kopfsteinpflaster. Noch weiter hinten stand Jupp wie angewurzelt mitten auf der Straße und glotzte ins Nichts, aus seiner kurzen schwarzen Hitlerjungenhose lief ihm Pisse an den Beinen runter.
Harry hörte ein Krachen und drehte sich wieder zu Erich um. Der warf sich noch mal und noch mal gegen die Tür eines Ladens, bis sie endlich aus den Angeln flog.
Er winkte. »Harald! Rein hier. Schnell! Der kommt zurück!«
Harry machte einen Satz in Erichs Richtung, hielt inne, wandte sich wieder zu Jupp um.
»Los, komm!«
Jupp reagierte nicht.
Harry wollte loslaufen, ihn holen, aber Erich rief: »Lass den Lump, der nützt uns nichts. Komm endlich!«
Es erschien ihm falsch, den Jupp zurückzulassen, aber Erich war nun mal der Leitwolf, Befehl ist Befehl. Harry gab sich einen Ruck und hechtete in den Laden. Erich drückte von innen die lose Tür zwischen die Balken, sie hielt.
Drinnen herrschte Dämmerung. Etwas Licht kam durch die Ritzen zwischen den Brettern hindurch, mit denen die Fenster vernagelt waren. Nach und nach erkannte Harry leere Regale und eine Ladentheke. Darauf standen die Registrierkasse sowie leere Körbe für das ganze Obst und Gemüse, was es nirgends mehr gab.
Erich öffnete ein Fenster, zückte sein Messer und begann, ein Guckloch ins Holz zu bohren. Harry ließ sich, an die Theke gelehnt, auf dem Boden nieder und wiegte sein Gewehr im Schoß wie ein Kleinkind. Die Magazinkapazität des VG-2 betrug zehn Schuss, aber Erich hatte nur zwölf Patronen auftreiben können und unter den Jungs aufgeteilt, Harry hatte drei abgekriegt. Drei Schüsse für die Ewigkeit.
Der Fritz, der brauchte seine jetzt nicht mehr … Scheiße, Junge. Wie sollte Harry das der Mutter vom Fritz erklären?
Sie waren seit zwei Tagen unterwegs. Streiften durch die zerbombte Stadt, vor allem die westlichen Stadtviertel von Wuppermünde, die an den Rhein grenzten, denn von dort mussten die Amis anrücken. Eigentlich war das spannender, als bei der Flak zu sein. Da hatten sie Harry nämlich nicht haben wollen, angeblich zu jung, mit fünfzehneinhalb. Die nächsthöhere Klasse war komplett zur Flugabwehr-Batterie eingezogen worden. Aber was immer die Kameraden da an der Flak trieben – den Thunderbolt von vorhin hatten die entkommen lassen. Die hatten den Fritz auf dem Gewissen!
Na gut, also Werwolf statt Flak. Eine echte Untergrundbewegung. Harry hatte keinen Schimmer, von wo und wem Erich seine Befehle bekam, der war ja auch erst zweiundzwanzig, vom Volksschullehrer-Studium direkt zur SS, er hatte also Ahnung. Ahnung und Befehle hatte der. Verstecken, aufklären, zuschlagen. Konnte Harry alles. Hatte er jahrelang im Zeltlager geübt. Und von genau dieser Situation hier geträumt.
»Scheiße, der Fritz ist tot!«, brach es plötzlich aus ihm heraus.
»Ja, der ist jetzt ein Held«, meinte Erich gelassen, ohne sich umzudrehen. Er hatte mit seinem Messer eine Öffnung ins Holz gebohrt, drückte sein Gesicht gegen das Brett und spähte hindurch auf die Straße. »Der Führer ist stolz auf ihn.«
Der Führer hat den Fritz ja gar nicht gekannt, dachte Harry kurz. Andererseits waren sie alle die Kinder des Führers. Der Führer war immer da, wie der liebe Gott, sein Bild hatte daheim über Harrys Bett gehangen – in dem Haus, das es nicht mehr gab. Jetzt steckte das Bild mit dem gezackten weißen Rand zweimal gefaltet in Harrys Brusttasche. Das Bild, auf dem der Führer seine Hand ausstreckt, als wollte er alle deutschen Kinder auf einmal umarmen. Alles wird gut, sagte das Bild. Auch wenn Vater in Gefangenschaft war und das Haus einfach futsch, peng, Phosphorbombe, die ganze Straße nur noch verkohlte Mauerstümpfe; Onkel Kurt in Russland gefallen, Herrmann von gegenüber in Afrika gefallen … Solange der Führer an uns glaubt und wir an ihn, solange kann nichts …
»Sitz hier nicht die ganze Zeit rum«, knurrte Erich. »Guck mal nach, ob’s hier noch irgendwas zum Fressen gibt.«
»Jawoll!« Harry zog sich auf die Füße, legte das VG-2 auf die Theke und begann, die Regale zu inspizieren. Da standen Dosen aus Emaille, beschriftet mit Zucker, Salz, Zwieback, er hob sie an und schüttelte sie, aber kein Rascheln antwortete ihm, sie waren alle leer. Er stellte die letzte zurück ins Regal und merkte, dass sie zu zittern begannen. Alle! Kein Zweifel, die Dosen vibrierten und ein dumpfes Brummen näherte sich wie ein Erdbeben.
»Was ist das?« Er ließ von den Regalen ab und ging um die Theke herum zu Erich. »Das ist doch kein Flugzeug.«
In das Brummen mischte sich das Rasseln schwerer Ketten.
»Was siehst du, Erich? Sag schon!«
»Sherman-Panzer. Nur einer. Und Infanterie.«
»Lass mich auch mal sehen.«
»Nein, du gehst raus.« Erich sah ihn scharf an. Um sein linkes Auge zog sich der Abdruck vom Loch im Holz, gegen das er sein Gesicht gepresst hatte, als würde er ein Monokel tragen. Seine spitze Nase stach beinahe auf Harry ein. »Du gehst raus und stiftest Verwirrung. Und ich nehm die Amis von hier drinnen aufs Korn.«
»Rausgehen …«, wiederholte Harry und zerkaute das Wort im Mund, weil er einen plötzlichen Würgereiz unterdrücken musste. Sein Magen lehnte sich auf. »Wie – Verwirrung? Wie stiftet man denn …?«
»Raus jetzt!«, herrschte Erich ihn an. »Ich hab dir einen Befehl gegeben, du Pimpf!«
»Das ist doch Selbstmord!« Das Zittern in Harrys Stimme mischte sich in das Beben der Wände, in das Scheppern der Fensterscheiben. Natürlich wusste Erich selber, dass das Selbstmord war. Darum schickte er ihn ja.
»Das ist doch sinnlos. Sollen wir nicht lieber …«
»Du verjudetes Stück Scheiße!« Erich zog seine Pistole und richtete sie direkt auf Harrys Kopf. Harry starrte in die Mündung. Eine Luger, er kannte alle Waffen. Von den Sammelbildern seines Wehrmachtsalbums. Verrückt, dass er jetzt an dieses Album denken musste, während er bis an die Theke zurückwich. Erich kam auf ihn zu. »Stirb als Held oder als Verräter. Du hast die Wahl.« Er grinste über seine eigenen Worte, als würde ihm das Ganze sogar Spaß machen.
Harry wollte die Hände heben, aber selbst das kam ihm sinnlos vor. Er starb jetzt. Der Gedanke war klar wie ein eisiger Wintermorgen, klar und ganz simpel. Er musste sich nur entscheiden, ob Erich ihn erschießen sollte oder einer von den Amis. Er starb jetzt, obwohl er noch gar nicht alle Bilder hatte, um sein Album vollzumachen.
Am liebsten hätte er dem Erich genau jetzt auf die Füße gekotzt, aber wer seit zwei Tagen nichts zum Fressen hatte, hat auch nichts zum Kotzen.
Er griff nach dem VG-2 und musste zweimal zupacken, so klamm waren seine Hände auf einmal. Aber das Gewehr gab ihm Sicherheit.
Er schob die demolierte Ladentür ein Stück zur Seite und machte einen entschlossenen Schritt auf die zerlöcherte Straße hinaus. Mit Höllengetöse kam der Panzer um die Ecke gebogen. M4 Sherman, ein großer fünfzackiger Stern prangte auf der Vorderseite. Hinter dem Panzer gingen zwei Reihen Soldaten im Gänsemarsch, immer genau hinter den Ketten des Sherman, sie hatten sicher Angst, auf Minen zu treten. Fast ganz hinten ging der Jupp, Hände gefesselt. Die hatten den tatsächlich gefangen genommen, anstatt ihn einfach abzuknallen, wie er es verdient hätte. Der Schwächling war doch nur eine Last für die. Sah man mal, wie dumm die Amis eigentlich waren.
Harry tat noch einen Schritt und noch einen, bis zur Mitte der Straße, nahm das Gewehr in Anschlag. Drei Kugeln. Das Rasseln stoppte abrupt. Die Amis hoben ebenfalls ihre Gewehre und die vordersten Männer pirschten sich rechts und links am Panzer entlang vorwärts. Das Rohr schwenkte in Harrys Richtung, bis er direkt in die tiefe schwarze Mündung blickte.
Ein paar Schritte vor dem Panzer lag Fritz mit seinen toten Augen.
Er starb jetzt. Seltsam, das zu denken, denn er konnte gar nichts dabei fühlen, er musste nur wählen, welchen Ami er mitnehmen wollte, rechts oder links. Einen von denen würde er auf jeden Fall erwischen.
Der Ami links rief: »Stopp!« Er löste sich aus dem Trupp, nahm sein Gewehr ein Stück runter und kam langsam auf Harry zu.
So einen hatte Harry noch nie gesehen. Drei Streifen auf dem Ärmel, Sergeant hieß das bei den Amis, eine Art Unteroffizier, wusste Harry, er hatte sich ja vorbereitet. Aber nicht auf so einen. Der Mann war schwarz! Nicht wie die Schwarzen im Kino, die ja nur mit Kohle angemalte Weiße waren, sondern ein echter Mensch. Harry hatte nicht gewusst, dass die auch Soldaten werden durften, es irritierte ihn auf seltsame Art.
Der Sergeant stand jetzt direkt vor dem toten Fritz, ließ die rechte Hand mit dem Gewehr sinken und hob die linke zu einer beruhigenden Geste.
Er sagte was, das klang wie: »Pudditdaun beu, leidaun juhr gann.« Er betrachtete den toten Fritz mit einer Spur von Mitleid. Dann hob er den Blick wieder und schaute Harry direkt in die Augen. Harry glotzte unverwandt zurück. Am Rande nahm er wahr, dass die anderen Soldaten sich von dem Panzer gelöst und verteilt hatten, sie drückten sich rechts und links an die Hauswände, an die vernagelten Läden auf der einen und die verkohlten Ruinen auf der anderen Seite.
»Pudditdaun«, wiederholte der Sergeant beinah sanft und machte eine Bewegung mit der freien Hand, die Harry verstand. Leg die Waffe nieder, sollte das heißen. Er visierte den Mann an. Über Kimme und Korn, direkt zwischen die Augen, die so hell aus dem Gesicht leuchteten. Er hatte das geübt, tausendmal auf Pappkameraden geballert, er konnte das. Aber seine Hand zitterte, Kimme und Korn führten einen Tanz auf, so würde er nicht mal den Panzer treffen, geschweige denn den Sergeant.
»Harry, gib auf!« Das war Jupp. Eher ein Schluchzen. Oder ein Flehen. »Es ist vorbei, Harry. Die tun uns nichts, ergib dich einfach!«
Die freie Hand des Sergeants bewegte sich langsam in die Jackentasche, kam genauso langsam wieder heraus und hielt ihm etwas hin, das in glitzerndes Stanniolpapier gewickelt war.
Schokolade.
Harry dachte das Wort, zerkaute es im Mund, er schmeckte es fast.
Ganz langsam nahm er das VG-2 herunter.
Da krachte ein Schuss!
Der Sergeant brach zusammen. Aber die Kugel war nicht aus Harrys Gewehr gekommen. Erich! Er musste aus dem Hinterhalt geschossen haben. Für den Bruchteil einer Sekunde herrschte Totenstille, nur der Schuss echote durch Harrys Kopf.
Und dann knallte es von allen Seiten. Harrys Beine knickten weg, er stürzte an Ort und Stelle zu Boden. Der Turm des Panzers drehte sich in die Richtung, aus der der erste Schuss gekommen war. Dann feuerte der Sherman auf den Laden, wo Erich sich versteckt hielt. Mauerstücke, Glasscherben, Holzsplitter wirbelten durch die Luft, der Geschmack von Schießpulver füllte Harrys Mund. Jetzt erst setzte der höllenmäßige Schmerz ein. Im Liegen griff er an seine Beine und tastete sehr viel Blut.
Er starb jetzt nicht, wusste er seltsamerweise. Vorhin war er zum Sterben bereit gewesen, aber jetzt fühlte er den brennenden Schmerz, als würden seine Knochen durch eine Mühle gedreht, und er klammerte sich an diesen Schmerz, denn Schmerz ist Leben. Er starb jetzt nicht, wusste er, während er spürte, dass er ohnmächtig wurde. Er wollte an die ausgestreckte Hand des Führers denken, aber das klappte nicht mehr, er sah nur die Hand des sterbenden Sergeants, der halb auf dem toten Körper von Fritz lag und verblutete. Seine Hand war in Harrys Richtung ausgestreckt und darin lag die Schokoladentafel.
1988. Jennifer
Sie rannte die Treppe rauf. Auf der Straße hatte sie Onkel Achims Auto gesehen, den breiten Lada zwischen all den Trabis, kaum zu übersehen. Irgendwas war passiert, denn Achim kam nie einfach nur so zu Besuch.
Sie rannte aber nicht deswegen; sie rannte jeden Tag die Treppe hoch. Es gab zwar einen Fahrstuhl, aber Treppenlaufen gehörte zum Trainingsplan. Bis in den siebten Stock in weniger als einer Minute. Sie zog die Riemen der Schultasche fester.
Wir wer-den flei-ßig und re-gel-mä-ßig trai-nier-en.
Sie lief die Stufen hoch und sagte sich im Rhythmus der Schritte den Eid vor. Erster Stock.
Wir wer-den Freund-schaft hal-ten und Fair-ness ü-ben.
Sie sprintete Stufe um Stufe empor und versuchte, die Atmung zu kontrollieren.
Wir wer-den die so-zi-a-lis-ti-sche D-D-R schüt-zen und stär-ken.
Sie würde irgendwann schneller sein als Kerstin Pankuweit. Und wenn es nur dieses eine Mal wäre. Bei dieser einen verdammten Spartakiade würde sie als Erste durchs Ziel gehen. Sie musste einfach. Vierter Stock.
Wir lie-ben den Frie-den und die Zu-kunft des so-zi-a-lis-ti-schen Deutsch-lands. Puh!
Sie war zu langsam. Scheiße.
Kerstin ging seit drei Jahren auf die KJS, die kriegte Pillen, um noch besser zu werden. Die würde es in den Leistungssport schaffen. Jubel, Medaillen, Hymne, Ausland, die würde ein Reisekader sein und die Welt sehen – und Jenny hing weiter auf der EOS fest.
Sechster Stock … nicht krampfen … siebter … Stock.
In der offenen Wohnungstür stand ihre Mutter, seltsam lächelnd. Jenny musste durchatmen, stützte sich am Türrahmen ab.
»Jenny, wir haben Besuch. Komm.«
Sie richtete sich auf, drückte den Rücken durch und löste das Haargummi, schüttelte die blonde Mähne auf. Dann folgte sie Mutti durch den dunklen Flur ins Wohnzimmer, wo Onkel Achim auf dem Sofa saß.
»Jenny, mein Schatz. Ich hab dir was mitgebracht.«
Auf dem Fliesentisch lag eine Tüte Zetti Knusperflocken.
Das konnte nur ein Test sein.
»Und mein Diätplan?«
Mutti winkte ab. »Den vergessen wir jetzt einfach mal.« Sie klang beinah fröhlich.
War das gespielt oder nicht? Jenny konnte es nicht einschätzen. Auch nicht Achims Anwesenheit, denn der Onkel aus der Hauptstadt ließ sich sonst nur zu besonderen Anlässen in Schafheutlin blicken. Hatte sie etwa einen Feiertag vergessen? Sie sprach nie darüber, dass Achim bei derFirma arbeitete. Er war Major des MfS, Ministerium für Staatssicherheit, ein wirklich wichtiger Posten, aber das brauchte niemand zu wissen. Darum trug er auch keine Uniform, sondern diesen Mantel mit hochgeschlagenem Kragen, den er sogar hier im Wohnzimmer nicht ablegte. Und immer, wirklich immer, trug er diesen ledernen Aktenkoffer bei sich, den Jenny noch nie offen gesehen hatte.
Mutti setzte sich in den Sessel. Jenny hockte sich neben Onkel Achim aufs Sofa und schielte auf die Tüte mit den Knusperflocken.
Als Kind hatte sie sich fast mal verplappert. Heute, mit sechzehn, passierte ihr das nicht mehr. Aber was sie genauso schwierig fand wie als Kind, waren die ganzen Andeutungen und offenen Halbsätze. Achim redete andauernd nebulös, Mutti manchmal auch, und Jenny hatte sich daran gewöhnt, dass der wichtigste Punkt meistens genau in dem Teil eines Satzes lag, der gar nicht ausgesprochen wurde.
Obwohl Mutti und Achim dermaßen entspannt wirkten, machte sie lieber ein bisschen auf zerknirscht und sagte leise: »Ich glaub, das wird nicht reichen, bei der Spartakiade. So komm ich nie auf die KJS.«
»Die Kinder- und Jugendsportschule vergessen wir jetzt mal«, antwortete Achim gönnerhaft und legte seine große Hand auf Jennys sehnigen Unterarm. »Ich weiß ja, wie sehr du dir wünschst, deinem sozialistischen Vaterland zu dienen.«
»Kerstin ist urst gut. Vielleicht bin ich für den Leistungssport einfach nicht geschaffen.«
»Wir sagen dir schon, wozu du geschaffen bist«, erwiderte Mutti und lächelte wieder, was kein bisschen zum Inhalt ihres Satzes passte. »Es gibt im Leben mehr als Sport.«
»Aber Sport ist mein Leben!«, rief Jenny. Da kam ihr ein schockierender Gedanke. »Ist es wegen Tante Frieda?«
Na klar, Westverwandtschaft. Da kannst du deine Träume gleich begraben. Mit Westverwandtschaft lassen sie dich nicht reisen – viel zu riskant. Selbst wenn du diese ominöse Tante nie im Leben gesehen hast und sicher auch niemals sehen wirst. Frieda war nur ein Name, mehr ein Phantom als ein Mensch, aber er hallte in dem kleinen Wohnzimmer seltsam wider.
»Frieda interessiert uns nicht.« Muttis Lächeln wirkte auf einmal wie einbetoniert.
»Nein, mit unserer unseligen Schwester hat das nichts zu tun«, bestätigte Achim und tätschelte Jennys Arm. »Aber es gibt noch viel mehr Wege, unserer Republik zu dienen.« Er nahm seine Hand von ihrem Arm und tippte stattdessen gegen ihre Stirn. »Vor allem welche, wo du hier oben … nicht wahr?«
Mutti nickte dazu.
Achim neigte sich ein wenig zu Jenny und senkte die Stimme. »Du willst doch, dass wir alles tun, um unser Land zu schützen, nicht wahr? Auch wenn es manchmal schwierige Entscheidungen … so ist das eben.«
Jenny nickte.
»Und du willst doch bestimmt Schulkameraden helfen, die vielleicht an falsche Freunde geraten sind?« Er neigte sich noch weiter zu ihr, seine Stimme wurde noch leiser. »Schulkameraden, die Gefahr laufen, den betrügerischen Verführungen des Klassenfeindes auf den Leim … nicht wahr?«
»Natürlich, Onkel Achim, das weißt du doch. Wie damals, als die Eltern von Claudia …«
Mit einer knappen Geste schnitt er ihr das Wort ab. Sie schluckte den Rest des Satzes runter.
Achim legte den Kopf schräg, sah Jenny ernst an und sagte: »Wir möchten, dass du für uns arbeitest.«
Am liebsten hätte sie nachgefragt: Wer ist wir, wer ist uns – doch Achim würde es nicht aussprechen und sie wusste es ja eh. Er sprach vom MfS, Ministerium für Staatssicherheit, von der Stasi, der Firma, natürlich. Ein Teil von Jenny wünschte sich, dass er es einfach mal geraderaus sagte. Tat er aber nicht.
Und sie brauchte nicht darüber nachzudenken.
»Allzeit bereit.« Nie hatte sich dieser Gruß der Jungen Pioniere richtiger angefühlt als in diesem Augenblick. Sie räusperte sich. »Was soll ich denn tun?«
Achim lehnte sich zurück und schaute kurz zu seiner Schwester. Die beugte sich vor.
»Bevor du freudig zustimmst, musst du gut überlegen«, sagte Mutti. »Denn diesmal geht es nicht um eine einmalige Geschichte wie damals mit … du weißt schon. Das wird was Längeres.«
»Gut.« Jenny zuckte mit den Schultern und verstand nicht, ob das jetzt eigentlich hieß, dass sie mit dem Sport aufhören sollte. Einfach so. Sie liebte die Leichtathletik, sie hatte für nichts anderes existiert als dafür. Und für den Sozialismus natürlich. Aber das war ja dasselbe. Durch Erfolg im Sport die Überlegenheit der DDR demonstrieren, das gehörte zusammen.
Achim bückte sich zu seinem Aktenkoffer und entnahm ihm eine Postmappe und dieser Mappe ein mit Schreibmaschine beschriebenes Blatt Papier, das er vor Jenny auf den Fliesentisch legte.
IM Hagar
stand da und darunter, fett unterstrichen:
Einsatz- und Entwicklungskonzeption 1988–1994.
Sie überflog das Papier, schnappte Wortfetzen auf: Friedensgruppe, Seminar, Kirche, Studium, Theologie … Bevor sie es richtig lesen konnte, zog Achim das Blatt zurück und ließ es wieder in der Postmappe verschwinden und diese in der Aktentasche.
»Wir haben eine langfristige EEK für dich aufgestellt«, sagte er. »Einen Sechsjahresplan. Als unsere inoffizielle Mitarbeiterin wirst du dich einer sogenannten Friedensgruppe anschließen. Du wirst die Kirchengemeinde infiltrieren, du wirst nach deinem Schulabschluss Theologie studieren, du wirst in die innersten Kreise dieses Kirchensumpfes eindringen und dann wirst du als unser Auge und Ohr mitten unter diesen Leuten … du verstehst. Willst du nicht mal die Knusperflocken probieren?«
Jenny verstand absolut kein Wort und nickte. Davon wurde ihr fast schwindlig. Mechanisch öffnete sie die Tüte, pflückte eins von den kleinen tropfenförmigen Dingern heraus und steckte es in den Mund. Es knisterte und knusperte zwischen ihren Zähnen und der Schokoladengeschmack wogte warm durch den ganzen Körper.
Sie nahm noch eins und noch eins und hielt plötzlich im Kauen inne, als ihr klar wurde, was ihr Onkel von ihr wollte. Er hatte die nächsten sechs Jahre ihres Lebens komplett durchgeplant!
Was für ein …
Ähm … Vertrauensbeweis?
Plötzlich hatte sie den Drang, allein zu sein.
»Ich muss mal kurz.« Sie sprang auf und lief ins Bad, vielleicht ein wenig zu schnell.
Sie schloss die Tür hinter sich und hockte sich auf den geschlossenen Klodeckel. Im Bad der Wohnung unter ihr brannte Licht. Es schimmerte durch die Ritze, die dort verlief, wo das Heizungsrohr im Boden verschwand. Die Leute da unten können deine Gedanken nicht hören, Jenny. Niemand kann das.
Auf dem Rand der Badewanne lag ein zerlesenes Buch, in dem sie erst gestern Abend wieder geschmökert hatte: Der Weg zum Rio Grande. Über die sagenhafte Agentin Tamara Bunke aus Eisenhüttenstadt, Kampfname Tania, sie hatte in Südamerika an der Seite des Revolutionshelden Che Guevara gekämpft. Bisher waren Grit Breuer und Katrin Krabbe Jennys Vorbilder gewesen, die zwei waren kaum älter als sie selbst und würden in wenigen Wochen bei den Olympischen Spielen in Südkorea für die DDR laufen. Aber, musste Jenny sich eingestehen, Grit und Katrin würden nie am Rio Grande kämpfen, sie würden keine Agentinnen sein, keine Geheimnisse bewahren, nicht das Vaterland vor negativen Elementen beschützen.
Sie stand auf und schaute in den Spiegel. Infiltrieren. Niemand wird was anderes in dir sehen als ein hübsches blondes Mädchen. Niemand wird ahnen, dass du zum Schwert und Schild der Partei gehörst. Du wirst eine echte Agentin sein, eine Tschekistin. So eine wie Kerstin kann das gar nicht, die würde sich sofort verplappern. Oder sich aus Schiss in die Hose machen. Die kann halt rennen, aber die hat nichts in der Birne. Du aber, Jenny, du hast das Zeug dazu.
Pfeif auf den Sport. Das hier ist viel wichtiger.
Sie hob die flache Hand senkrecht über den Kopf und grüßte sich selbst im Spiegel. Als sie zurück ins Wohnzimmer kam, lagen ein weißes Blatt Papier und ein Stift auf dem Tisch.
»Was ist das?«
»Du schreibst jetzt deine Verpflichtungserklärung.« Achim klang feierlich.
»Gut … ähm, was schreibt man denn da?«
»Keine Sorge, ich diktiere es dir. Bereit? Ich, Jennifer Kaluza, verpflichte mich freiwillig, das MfS in seiner Arbeit zu unterstützen … Ich möchte Feinde unschädlich machen und Menschen helfen, die auf den falschen Weg geraten sind … Zur Wahrung der Konspiration wähle ich das Pseudonym Hagar.«
heute. Nadiem
Er rannte ohne Grund, einfach aus Spaß. Er lief im Zickzack zwischen den Menschentrauben auf der Freibadwiese hindurch. Spielende Kinder, Leute auf Decken, die lasen oder Musik hörten oder Karten spielten, ein paar Jungs, die sich gegenseitig schubsten – schwer zu sagen, ob sie nur Spaß machten. War das hier jemals so voll gewesen? Und jemals so drückend heiß? Die ganzen Ferien über hatte es gefühlt nur geregnet, aber seit Schulbeginn vor ein paar Tagen war plötzlich der Hochsommer ausgebrochen. Endlich erreichte er das Schwimmbecken, hob ab und tauchte kopfüber ins kalte Wasser ein, genau in die Lücke zwischen den vielen anderen, die hier schwammen oder plantschten oder einfach im Wasser trieben und redeten. Er stieß sich vom Boden ab und tauchte wieder auf, strich sich die schwarzen Locken aus der Stirn und blinzelte in die Sonne.
Eigentlich waren es tausend Sonnen, sie tanzten auf dem türkisblauen Wasser und dazwischen tanzten Hunderte Gesichter. Eines davon lächelte ihm zu.
»Nadiem Abi!« Die Hand winkte, der silberne Armreif glitzerte im Licht und das Licht glitzerte in ihrem Haar, er kniff die Augen zusammen. Ayla.
»Hey, Schwester!« Er tauchte unter, schwamm mit kräftigen Zügen zu ihr, tauchte wieder auf, doch bevor er sie begrüßen konnte, beugte sich am Beckenrand ein Muskelotto im Security-Shirt zu ihm runter. »Vom Beckenrand springen verboten, Kollege, klar?«
»Klar«, brummte Nadiem, »sorry.«
Der Mann schlenderte weiter und Nadiem drehte sich paddelnd zu Ayla um. »Seit wann laufen hier so Typen rum?«, fragte er. »Wo ist der gemütliche Bademeister vom letzten Sommer?«
»Dahinten sind noch zwei«, meinte Ayla und nickte zu dem Sprungturm, um den sich eine dichte Traube von Jugendlichen drängte. Die Menge wogte hin und her, als wäre sie ein einziger lebender Organismus. »Letztes Jahr gab’s hier Randale. Deswegen.«
Ein breitschultriger Junge machte einen Salto vom Dreier, der große lange hinter ihm sogar einen doppelten.
Ayla hielt sich mit gleichmäßigen Schwimmbewegungen auf der Stelle und fragte: »Sag mal, stimmt das, was ich gehört habe? Du willst als Schulsprecher kandidieren?«
»Ja, ich glaub, ich mach das. Laura und Erkan vom GSV-Team haben mich gefragt und – erst mal dachte ich so, krass, die fragen mich echt. Und dann dachte ich so: Alter, soll ich wieder mal der Vorzeigeflüchtling sein? Aber dann meinten sie: Nein, echt, du würdest das voll gut machen und so.«
»Wirst du auch«, sagte Ayla, dann warf sie ihm eine Handvoll Wasser ins Gesicht und sah ihn fast tadelnd an. »Vielleicht hörst du ja dann endlich mal mit diesem Gerede vom Vorzeigeflüchtling auf. Das klingt immer so, als hättest du Angst, die Leute wollten sich nur mit dir schmücken. Kann ja schon sein, dass es so was gibt, aber Laura und Erkan finden dich wirklich gut. Alle finden dich gut, Mann. So, wie du bist. Ich finde dich gut.«
Da musste er ihrem Blick ausweichen. Es fühlte sich schön an, so was zu hören. Natürlich! Aber Ayla verstand ihn gar nicht. Es ging ihm nicht darum, was die anderen in ihm sahen. Sondern darum, dass er manchmal in den Spiegel blickte und bloß die Fassade eines perfekt integrierten jungen Mannes erkannte. Einer mit zwei tollen Pflegemüttern, der in die Oberstufe ging, der an Poetry Slams teilnahm. Sich in seiner Schule engagierte. Eine wirklich prächtige Fassade. Und dahinter nichts als ein paar durchgerissene Dokumente, zurückgelassene Orte, ein gepackter Rucksack. Vielleicht war diese Kandidatur ja nur ein weiterer verzweifelter Versuch, sein neues Leben auf ein stabiles Fundament zu stellen, das … Verdammt, er hasste diese Gedanken und versuchte, sie zu verscheuchen.
»Hey, warum schüttelst du den Kopf?«, fragte Ayla.
»Weil du einfach ’ne zu hohe Meinung von mir hast«, antwortete Nadiem.
»Ähm – ja, vielleicht. Aber ich wette, das da kannst du nicht.« Sie deutete auf einen Jungen, der gerade mit einem Freudenschrei im dreifachen Salto vom Dreimeterbrett sprang.
»So’n Triple Flip? Nee. Du?«
»Vorwärts und rückwärts.«
»Ich glaub dir kein Wort.«
»Komm«, sagte sie. »Ich mach es dir vor, du machst es nach.«
Sie zog sich aus dem Wasser hoch. Er folgte ihr. Irgendwie war er ein bisschen erleichtert, dass das Gespräch erst mal nicht weiterging, weil … wusste er jetzt auch nicht. Sie schoben sich in die Menschentraube. Eine richtige Warteschlange war das nicht, es gab keine Reihenfolge, alle drängelten zur Leiter, die Stärkeren setzten sich durch.
Die beiden Security-Typen standen abseits und diskutierten miteinander. Vielleicht überlegten sie, ob sie eingreifen sollten. Beziehungsweise – ob sie gegen all die Leute überhaupt eine Chance hätten.
Die Enge des Gedränges erinnerte Nadiem an Orte, die er eigentlich gern vergessen hätte. Und plötzlich fiel ihm auf, dass hier nur junge Männer waren. Ayla war die einzige Frau in dem Pulk. Doch als Nadiem sich nach ihr umdrehte, sah er bloß etliche weitere Männergesichter. Er reckte den Hals und erkannte, dass Ayla abgedrängt worden war. Er selbst wurde vorwärtsgeschoben. Er blicke sich nervös um. Es schien, als würde die allgegenwärtige Hitze die Gesichter um ihn herum schmelzen lassen, als würden sie alle zerlaufen, sich zu Fratzen verzerren. Die Menge siedete. Begann hochzukochen.
»Doch, du hast die angeglotzt, Spacko!«, zischte jemand neben ihnen.
»Halt’s Maul«, gab ein anderer zurück – und erntete ohne Vorwarnung einen Kopfstoß von seinem Gegenüber. Er taumelte, aber zum Hinfallen war kein Platz.
Bewegung kam auf, alles wogte hin und her, plötzlich flogen Fäuste.
Nadiem versuchte, irgendwie aus dem Pulk herauszukommen. Sein Blick suchte wieder nach Ayla. Aber er sah sie nicht mehr. Und er wusste auch gar nicht mehr, in welche Richtung er sich überhaupt würde durchkämpfen müssen, um von hier wegzukommen. Stattdessen wurde er von einem Sog erfasst und immer weiter in den Strudel aus Beschimpfungen, Geschubse, Geboxe reingezogen. Irgendein Typ kriegte einen Ellbogen voll auf die Nase, kippte ins Becken, die rote Suppe verdünnte sich im Wasser.
Nadiem rief irgendwas, hörte sich selbst nicht, weil der Lärm anschwoll, er hob die Hände, als könne er das hier irgendwie schlichten, aber das war zwecklos.
Hass blubberte hoch, auf keinen konkret, einfach alle auf alle und alles einfach so. Plötzlich griffen zwei Hände an seinen Hals.
Nadiem fixierte den Angreifer, sein rechter Arm fuhr zwischen die Arme des anderen, wie um einen Hebel anzusetzen, er drückte die linke Armbeuge des Typen nach unten, brachte ihn so aus dem Gleichgewicht, dann schnellte Nadiems Linke nach vorn und traf die Nase. Der Typ schrie auf und ließ ihn los.
Für eine Millisekunde tat das richtig gut. Nadiem sah wie in Zeitlupe zu, wie der Getroffene nach hinten taumelte. Erst dann bemerkte er, dass sich der Pulk ausgedünnt hatte. Ein Kreis bildete sich um ihn, wie in einer Arena, als wäre ein Scheinwerfer auf ihn gerichtet. Jetzt sah er die beiden Security-Männer auf sich zukommen.
Da spürte Nadiem, wie seine Fassade kippte. Mit einem großen Knall schlug sie in ihm auf den Boden und zerschellte. Als wäre plötzlich alles wieder auf null gestellt, seine ganze Existenz. Er rannte los.
Rannte wie in Kabul. Wie in Teheran. Wie in Skopje. Er rannte einfach Richtung Ausgang, nur in Badehose, dachte nicht an seine Klamotten, sein Handy oder sein Handtuch, seinen Rucksack, er rannte.
Ein Teil von ihm wusste, dass die beiden Männer ihn nicht verhaften und auspeitschen würden, aber der Teil, der das wusste, war in seinem Kopf gerade nicht der Boss; der Boss war die Erfahrung.
Und die hatte ihn gelehrt, im Zweifel zu rennen.
Er lief um das Becken herum und Richtung Ausgang, lief an den Umkleidekabinen vorbei und prallte wie aus dem Nichts gegen einen Polizisten. Es tat richtig weh, der Mann trug eine stahlharte Sicherheitsweste.
Nadiem wollte ausweichen und um ihn herumlaufen, doch der Beamte hielt ihn fest.
»Nicht so schnell, Freundchen. Bleib mal schön hier. Ausweis dabei?«
Kurzatmig hielt Nadiem inne und sah ihn ungläubig an.
»Ausweis? In der Badehose?«
Er fühlte sich nackt. Und war es ja auch fast.
Als hätte sich die Staubwolke aus seiner zerschellten Fassade gelegt und den Blick auf ihn freigegeben, so, wie er wirklich war.
»Werd jetzt nicht frech!« Die Stimme gehörte einer Polizistin, die ebenso unvermittelt aufgetaucht war. »Mach mal ’n Adler!«
Und bevor Nadiem sich noch fragen konnte, was die Frau damit meinte, drückten sie ihn zu zweit mit dem Bauch gegen die hölzerne Tür einer der Kabinen.
»Arme nach oben«, befahl die Frau, der Mann presste sich gegen Nadiems Rücken und trat mit seinem Stiefel leicht gegen die Innenseite von Nadiems Knöchel, um seine langen dünnen Beine zu spreizen.
»Wenn du cool bleibst«, ließ ihn der Beamte wissen, »können wir über alles reden.«
Dann tastete er tatsächlich Nadiems Badehose ab. Wenn der jetzt seine Finger an meine Eier …
Er merkte, wie schnell sein Atem ging, wie hart sein Herz hämmerte. Panik oder Wut oder beides, er kannte das und hasste es. Hände ruhig halten, Mann, jetzt nur nicht zuschlagen, verdammt, er würde sich alles versauen, alles, das wusste er doch. Er versuchte krampfhaft, sich an die vielen Sitzungen mit Herrn Mailänder zu erinnern. An irgendeinen Satzfetzen aus dem Mund seines Therapeuten, der ihm jetzt weiterhelfen könnte.
»Lass gut sein«, sagte die Polizistin.
Der Mann trat einen Schritt zurück. Nadiem nahm die Arme runter und drehte sich um. Er stand auf einer Bühne, Hunderte Augenpaare starrten ihn an. Augenpaare und Handykameras. Paradoxerweise war es eine vertraute Situation, er kam sich kurz vor wie beim Poetry Slam, aber hier wollte niemand seine Worte hören. Sein Blick glitt rasch über die Menge, aber er konnte Ayla nirgendwo sehen, auch nicht mehr den Typen, dem er auf die Nase geboxt hatte. Dafür erkannte er Arthur, der war kaum zu übersehen, weil er als Einziger unter all den Leuten hier einen schwarzen Hoodie trug, als wäre es Herbst. Außerdem war Arthur der Einzige, der nicht zu ihm rüberstarrte, denn er rangelte mit Sven Schröder, soweit Nadiem das erkennen konnte, Sven Schröder hatte anscheinend Arthurs Handy weggeschnappt.
»Hey!« Die Polizistin schnipste mit den Fingern vor Nadiems Gesicht. »Hier spielt die Musik. Können Sie sich irgendwie ausweisen?«
Atmen Sie, Nadiem, sagte sein innerer Herr Mailänder. Nadiem hatte gelernt, dass das gegen Flashbacks half. Theoretisch.
Er atmete. Ein, aus. Dann antwortete er: »Nee. Ich hab keinen Ausweis dabei, nicht mal ’ne Busfahrkarte, ich bin mit dem Fahrrad hier.«
»Dann müssen wir Sie leider mitnehmen, um Ihre Personalien festzustellen«, sagte sie.
»Was – so?«
»Nein, Sie ziehen sich bitte an. Wo haben Sie Ihre Sachen?«
»Da drüben auf der Wiese.«
»Mein Kollege begleitet sie.«
Kopfschüttelnd setzte sich Nadiem in Bewegung, der Polizist folgte ihm. Während sie sich einen Weg durch die feixende Menge bahnten, knarrten die Lautsprecher, die in den Bäumen verteilt hingen, eine Durchsage folgte: »Aus betrieblichen Gründen muss das Bad leider außerplanmäßig schließen. Bitte verlassen Sie geordnet und ruhig das Bad.«
Es gab Pfiffe und Buhrufe, einer zischte Nadiem zu: »Toll, wegen dir, du Arsch.« Der Polizist schob den Typen rigoros zur Seite.
Nadiem zog Hose und T-Shirt an, schlüpfte in seine Crocs und stopfte das Handtuch in den Rucksack.
»Nadiem Abi!« Auf einmal war Ayla da. »Du hast nichts falsch gemacht!«
»Bitte gehen Sie zur Seite«, forderte der Polizist sie auf.
»Ruf mich an, Nadiem«, rief sie hinter ihm her.
Er nickte bloß. Inmitten der motzenden, maulenden Menschenmenge, die zum Ausgang strebte, bahnte ihm der Polizist einen Weg. Sie kamen an Arthur vorbei, der Nadiem anstarrte, als wolle er ihm dringend was sagen, aber er klappte nur den Mund auf und zu wie ein Fisch auf dem Trockenen. Seine riesige Brille passte dazu.
Vor dem Tor parkte der Polizeiwagen, die Beamtin saß schon am Steuer. Im selben Moment, als Nadiem und der Polizist hinten einstiegen, fuhr ein weiterer Streifenwagen vor. Oh Mann, alles seinetwegen? War er jetzt ein Schwerverbrecher? Aber die anderen Uniformierten waren anscheinend bloß dazu da, die reibungslose Räumung des Freibads zu überwachen.
Die Polizistin gab Gas. Leute starrten ihnen hinterher, einige filmten immer noch mit ihren Handys. Er musste es sich immer wieder sagen: Nein, diese Beamten würden ihn nicht auspeitschen. Trotzdem lief ihm dieses Gefühl wie eiskaltes Blut den Rücken runter.
Nein, nein, nein, beschwor er sich selbst, das tut die deutsche Polizei nicht.
Er musste ganz dringend an seinen inneren sicheren Ort; das hatte er mit Herrn Mailänder hundertfach geübt. Da war es warm und freundlich, es duftete nach Tee und Kebab und nach dem Parfüm von Ayla. Sie öffnete ihm stets die Tür zu diesem Ort – natürlich nur in Gedanken, nie würde er ihr davon erzählen – und ließ ihn ein und er konnte reinkommen, runterkommen, sich beruhigen, durchatmen.
Alles gut, Mann, alles gut. Er merkte, wie sein Atem gleichmäßiger wurde. Herr Mailänder wäre stolz. Er holte sein Handy aus dem Rucksack.
»Kann ich telefonieren?«
»Ja«, sagte der Beamte. »Rufen Sie bitte jemanden an, der zu uns aufs Revier kommen und Ihre Identität nachweisen kann. Sie sind doch sicher schon achtzehn, oder?«
»Ähm – nein?« Nadiem wunderte sich selbst, dass es eher nach einer Frage als nach einer Antwort klang.
»Dann rufen Sie bitte einen Erziehungsberechtigten an. Vater oder Mutter oder Ihren Vormund oder … wer sonst für Sie zuständig ist.«
Das machte er. Bei Nicole erreichte er nur die Mailbox, aber Jenny ging sofort dran. Er erzählte ihr in knappen Worten, was passiert war, und ließ sich von dem Polizisten durchgeben, zu welcher Wache sie fuhren.
»Oje. Okay, ich komme.«
Jenny saß schon in einem Wartebereich im Vorraum der Polizeiwache, als Nadiem hereingebracht wurde. Er wäre ihr am liebsten um den Hals gefallen, so erleichtert war er, sie hier zu sehen. Doch etwas an ihrem Blick verunsicherte ihn auch, er konnte es nicht deuten. Sie reichte ihm seine BüMA, eine Art Ausweis für Geflüchtete, und er gab das Papier dem Polizisten, dann folgten sie den beiden Uniformierten durch eine Sicherheitstür in einen Raum mit Schreibtischen, wo sie alle Platz nahmen.
Die Polizistin sah Jenny an. »Sie sind die …«, sie legte den Kopf schräg und sah Jenny zweifelnd an, »ähm … Mutter?«
»Ja. Also Pflegemutter, um genau zu sein. Meine Frau und ich haben Nadiem als Pflegesohn aufgenommen.«
»Kann ich bitte auch Ihren Ausweis sehen?« Jenny holte ihren Perso raus, schob ihn rüber. Ihre Hand zitterte dabei. Sie bemerkte Nadiems Blick, zog die Hand schnell zurück und klemmte sie in die linke Achselhöhle. Beide Ausweise wurden auf einem Scanner eingelesen, dann wandte sich die Frau wieder an Nadiem.
»Gut, Herr Khan. Dann erzählen Sie mal bitte, wie es aus Ihrer Sicht zu dem Tumult gekommen ist.«
Nadiem atmete tief ein und aus und versuchte, sich zu konzentrieren. Er sah Fetzen von Bildern vor sich, deren Reihenfolge ihm schon nicht mehr ganz klar war. »Das ging alles verdammt schnell, wissen Sie? Also, ich wollte mit einer Freundin zum Sprungturm, aber da war so ein Gedränge und auf einmal hat mich … nee. Erst meinte einer zu irgendeinem anderen, der hätte seine Freundin angeglotzt. Ja, ich glaub, so fing es an. Und dann …« Nadiem sortierte seine Gedanken und kam schließlich an die Stelle, wie ihm einer an den Hals packte. »Und dann hab ich ihm den Arm verdreht und eins auf die Nase gegeben, das war Notwehr.«
Kurzer Seitenblick zu Jenny, aber die starrte bloß auf die Tischplatte.
»Kannten Sie sich?«, wollte die Polizistin wissen.
»Hä?«, machte Nadiem.
»Na, der, dem sie eins auf die Nase gegeben haben.«
»Nee.«
»Hat denn«, meldete sich Jenny, »irgendjemand Anzeige gegen Nadiem erstattet?«
Die Polizistin sah ihren Kollegen an, der guckte nur zurück und sagte: »Liegt bis jetzt nicht vor.«
»Können wir dann bitte gehen?«, fragte Jenny und erhob sich.
»Wenn Sie Ihrer Aussage nichts hinzuzufügen haben«, antwortete die Beamtin. Der Polizist klickte auf seine Computermaus und der Drucker spuckte ein Dokument aus. »Bitte unterschreiben Sie beide, wenn das so korrekt wiedergegeben ist.«
Wenig später saßen sie zusammen in der Bahn.
»Was denkst du, was jetzt passiert?«, fragte er seine Pflegemutter leise.
»Ich weiß nicht«, sagte Jenny, »echt nicht. Aber du musst keine Angst haben.« Sie drückte seine Hand. »Wirklich, du musst keine Angst haben. Eine Freundin von mir ist Anwältin, die rufe ich nachher an. Alles wird gut.« Es klang ein bisschen, als müsse sie das vor allem zu sich selbst sagen.
Wie ihre Hand vorhin gezittert hatte! Nadiem konnte sich keinen Reim darauf machen. Er würde sie irgendwann mal danach fragen. Jetzt vielleicht besser nicht.
Er zog seine Hand vorsichtig aus ihrer, dann holte er das Handy raus. Es explodierte fast vor Nachrichten. Fuck, es gingen schon Videos rum. Videos von ihm, wie er von dem Polizisten gegen die Wand gedrückt wurde. Wie er über die Wiese zurückging und sich anzog. Wie er im Polizeiwagen verschwand. Fuck.
Und eines gab es, nur ein einziges, das genau zeigte, wie seine Faust in das unbekannte Gesicht traf. Das stammte von Arthur. Und es hatte schon Hunderte Aufrufe.
Nachrichten kamen rein. Über WhatsApp, über Insta, über Signal, über Telegram. Alter, was ist da los? Bist du okay? Hey, schreib mal, wenn du aus dem Knast wieder raus bist. Bro, du hast nichts falsch gemacht. Typisch Islam, alle abschieben, Remigration sofort.Wichser. Hey, Nadiem, ignorier das Rassistengelaber.
Ja, ignorieren. Toller Ratschlag.
In Gedanken bückte er sich zu den Trümmern seiner Fassade und begann, Stein um Stein wieder aufzuschichten. Vielleicht würde er sie wieder hinstellen können. Aber sie wäre noch wackliger als zuvor.
2
1945. Harald
Schmerzen.
Licht, Dunkel. Hitze. Kälte. Schmerzen.
Stimmen, aber nicht aus seinem Mund. Sein Mund – wie verklebt, Zunge am Gaumen festgewachsen. Durst.
Kälte, Wimmern, unbeweglich. Schmerzen.
Transport. Wer, wohin?
Stunden oder Jahre? Tage? Licht und Dunkel. Schmerzen.
Jim. Seine Hand, ausgestreckt. Schokolade.
Schmerzen.
Dann irgendwann war es wie ein allmähliches Erwachen.
Da tönte ein Jauchzen. Konnte auch ein Schimpfen sein. Eine Männerstimme, die kieksend in die Höhe sprang. Signalhörner, die zum Angriff bliesen oder auch zum Rückzug. War er tot? In der Hölle? Diese schrägen Töne. Schräg waren sie, aber seltsam schön, viel zu schön für die Hölle. Verboten schön. Also im Himmel? Unter all dem lag ein Rhythmus. Ein Klavier. Ein Kontrabass? Ein Schlagzeug? Gab es verbotene Musik im Himmel?
Hatte der Himmel eine Betondecke? Und vergitterte Fenster?
»Ah, da kommt jemand zu sich.« Eine Hand auf Harrys Stirn. »Das Fieber scheint endlich zu weichen.«
Ein Gesicht unter einer Schirmmütze. Die Mütze war braun mit einem roten Band und das Gesicht voller Sommersprossen und Bartstoppeln. Es drehte sich kurz weg und der Mund sagte Worte auf Englisch. Dann wandte es sich ihm wieder zu. Irgendwo im Hintergrund kiekste die Männerstimme.
»Willkommen, junger Mann«, sagte das Gesicht. Der Soldat, dem es gehörte, richtete sich auf. Seine Uniform war britisch und die Abzeichen die eines Leutnants, wenn Harry sich nicht irrte.
Er wollte seine Zunge bewegen. Überraschenderweise funktionierte es. Aber er musste die Worte mühsam zusammensetzen. »Was ist … das?«
»Das ist die Krankenstation«, antwortete der sommersprossige Leutnant.
»Nein, nein, die … Musik.«
Der Mann lächelte. »Jazz. Das Lied heißt Caldonia. Ein Hit von Louis Jordan.«
»Was ist ein Hit?«
Wieder lächelte der Mann. »Du bist übrigens hier in einem Verhörzentrum der British Army, falls dich das interessiert.«
Harrys Beine zuckten. Das tat weh. Aber sie zuckten, also waren sie wohl noch da. Sie zuckten im Takt der Musik. Caldonia. Er tastete nach seinen Beinen und spürte zwei schwere Gipsverbände.
»Du hast Glück, dass du hier bist«, sagte der Leutnant. »Unsere amerikanischen Freunde wollten dich aus dem Lager entlassen, weil du einfach nur ein Hitlerjunge bist. Aber irgendwem ist der Aufnäher auf dem Ärmel aufgefallen.«
Aufnäher. Das Symbol mit dem Wolfshaken. Das Abzeichen, das Harry als Werwolf kennzeichnete.
»Darum haben sie dich hierher zu uns geschickt«, fuhr der Mann fort, »und vermutlich hat dir das das Leben gerettet. Oder zumindest deine Beine. Draußen gibt es keine funktionierenden Krankenhäuser mehr.« Er machte eine Pause und betrachtete Harry. »Du warst ziemlich lange im Delirium. Hast du überhaupt eine Ahnung, was passiert ist?«
Harry richtete den Oberkörper ein Stück auf. Der Raum war viel größer, als er zunächst gedacht hatte. Eine Lagerhalle vielleicht, zu einem Lazarett umfunktioniert. Krankenbetten mit Verwundeten in Reih und Glied, neben der Tür ein kleiner Tisch und darauf ein Grammofon, auf dem sich eine Schallplatte drehte.
»Caldonia!«, kiekste Louis Jordan – das war doch der Name? – im Hintergrund. Harrys Beine zuckten dazu.
»Wie heißt du überhaupt?«, fragte der Leutnant.
»Harry.« Er ließ sich wieder zurück aufs Kissen sinken. »Also Harald. Harald Baumberg.«
»Angenehm.« Der Mann deutete eine Verbeugung an, die vielleicht spöttisch gemeint war. »Bill Almond. Ich bin hier vor allem zuständig für die Verhöre von Jugendlichen wie dir.«
»Wie mir?«
»Werwölfe.«
»Caldonia!«, rief Louis Jordan. Seltsamerweise musste Harry an Jim denken.
»Ich sage Ihnen nichts«, gab er zurück. »Ich werde meine Kameraden nicht verraten. Ich habe dem Führer einen Eid geschworen, dass …«
»Ach so, das hast du noch nicht mitbekommen.« Diesmal war Almonds Lächeln wirklich spöttisch. »Hitler ist tot. Die Wehrmacht hat kapituliert. Der Krieg ist vorbei.«
Die Worte gingen in Harrys Ohr und von dort in sein Hirn und verharrten, ohne ein Gefühl auszulösen. Vermutlich würde sein Sammelalbum nicht mehr voll werden.
»Was ist aus Jim geworden?«, fragte er und merkte erst einen Augenblick später, wie vollkommen sinnlos das war.
Jim, so hatte Harry ihn still für sich genannt. In den halbklaren Momenten seines Deliriums hatte er ihn vor sich gesehen, den amerikanischen Sergeant, seine ausgestreckte Hand. Er hätte Harry töten können. Hatte es aber nicht getan, er hatte ihm die Hand reichen wollen. Ja, noch mehr – er hatte dafür gesorgt, dass die anderen nicht schossen. Jim hatte Harrys Leben gerettet und sein eigenes dadurch verloren. Den Namen Jim hatte Harry aus diesem verbotenen Buch, Die Abenteuer des Huckleberry Finn. Jim war der Freund von Huckleberry Finn. Huck und Jim. Eine kleine Heimlichkeit, die er sich als Kind erlaubt hatte. Wobei – vielleicht war das Buch ja jetzt gar nicht mehr verboten, denn wenn schon solche Musik erlaubt war, dann doch auch Abenteuerbücher vom Mississippi?
»Wer ist Jim?«, fragte Almond.
»Schon gut, ein Irrtum.« Harry schüttelte nur leicht den Kopf. Erich hatte Jim erschossen. Ja, so war es gewesen. Hoffentlich war Erich dabei selber draufgegangen, das Schwein.
Die Musik endete, Harry hörte nur noch das Knistern des Grammofons.
»Komm erst mal zu dir«, sagte Almond. »Wir unterhalten uns später.«
Er wollte sich entfernen, doch Harry rief: »Können Sie die Musik wieder anmachen?«
Da kam eine heisere Stimme aus dem Bett nebenan. »Nein! Bitte nicht! Wir verlieren hier noch alle den Verstand von dieser Affenmusik!«
»Aber gern«, sagte Almond, lächelte Harry noch einmal zu und setzte, bevor er den Raum verließ, die Nadel des Plattenspielers wieder auf den Beginn des Liedes.
Der Führer war tot. Der Krieg war aus.
Caldonia!
Seine Beine zucken, als wollten sie tanzen.
Irgendwann war das Lied abermals zu Ende. In das leise Knistern hinein sagte Harry in Richtung der Betondecke über sich: »Der Führer ist tot.«
»Ja, der hat’s gut«, kam es heiser aus dem Nebenbett. »Der hat es hinter sich.«
Harry drehte sich zu dem Mann, der neben ihm lag. Sein Gesicht war zur Hälfte unter einem blutigen Verband verborgen. Das freie Auge fixierte ihn, dann zischte der Mann: »Wenn wir Glück haben, werden uns die Engländer einfach totschießen. Aber ich glaub’s nicht. Die werden uns vorher foltern.«
»Warum? Was für Informationen brauchen die denn noch? Wenn der Krieg doch aus ist?«
»Allein schon als Strafe.«
»Für was?«
»Für das, was wir im Osten gemacht haben«, antwortete der Mann und senkte die Stimme zu einem Flüstern. »Mit den Juden.«
Spontan wollte Harry fragen: Was habt ihr denn mit den Juden gemacht? Aber er schluckte es runter. Eigentlich wusste er es ja. Eigentlich hatte es jeder wissen können, wenn er es wissen wollte.
Harry erinnerte sich an den Tag, wo sie den Alfred abgeholt hatten und seine ganze Familie. Zufällig war Vater gerade auf Fronturlaub gewesen. Harry hatte das Gespräch zwischen seinen Eltern belauscht. Mutter hatte gesagt: Die können doch froh sein, die Juden, die kommen in den Osten, da fallen wenigstens keine Bomben. Und Vater hatte höhnisch gelacht und gesagt: Nein, da gibt’s keine Bomben, im Osten. Da gibt’s nur Schornsteine.
Dieser Almond hatte angekündigt, er wolle später mit Harry reden. Doch in den nächsten Tagen sah er ihn nicht. Und das war gut so, denn Harry wusste nicht, ob der Kerl im Bett neben ihm nicht vielleicht doch recht hatte – dass sie gefoltert würden. Die Engländer hatten hier vor allem SS-Leute interniert. Solche, die bis vor Kurzem als Wachen in Konzentrationslagern gearbeitet, die selbst Leute bewacht und gefoltert und getötet hatten und nun plötzlich die Bewachten waren, die vielleicht, wer weiß, gefoltert und getötet werden würden. Außerdem saßen hier ein paar Verwaltungsbeamte, die man verdächtigte, dass sie bei Kriegsverbrechen mitgemacht hatten. Und dazu eine Handvoll Jugendlicher, die beim Werwolf gewesen waren, genau wie Harry. Und die man wieder und wieder verhörte, weil sie vielleicht was über geplante Attentate gegen die neuen Besatzer wussten.
Nichts erschien Harry absurder, als ein Attentat zu planen.
Er lag in seinem Bett, bekam ab und an eine dünne Suppe und eine Krankenschwester wechselte seine Bettpfanne. Die Schwestern sprachen nur Englisch.
Nachts schreckte er hoch und griff aus Reflex unter sein Bett, aber die Hand fuhr ins Leere. Es war ja kein Krieg mehr und es war ja nicht sein Bett im alten Kinderzimmer und darunter lag nicht der Koffer mit den wichtigsten Habseligkeiten, den er beim Bombenalarm immer hatte schnappen und die Treppe runtertragen müssen. Er den Koffer in der Hand und Mutter den kleinen Norbert auf dem Arm, so rannten sie zum Luftschutzbunker zwei Straßen weiter. Zuletzt war das fast jede Nacht gewesen, in manchen Nächten sogar zweimal. Da hockten sie dann eng gedrängt mit all den anderen Müttern und Kindern und Alten in dem stickigen Betonloch, während die Erde unter den Explosionen erzitterte und der Staub von der Decke rieselte, die hoffentlich, bitte, bitte, lieber Gott, halten würde. Und wenn dann Entwarnung gegeben wurde und sie rauskonnten und zurück nach Hause, wussten sie nie, ob das überhaupt noch existierte, dieses Zuhause. Jedes Mal dann erleichtertes Ausatmen, weil das Haus immer noch stand und nicht mal brannte.
Aber eines Nachts – drei Wochen bevor Harry sich mit Fritz und Jupp diesem Erich angeschlossen hatte – war es einfach weg. Erst dachte Harry, sie hätten sich in der Straße vertan, wären im allgemeinen Gewühl der Menschen und der durcheinanderrennenden Rettungskräfte und der Rauschwaden falsch abgebogen, aber nein. Das hier war ihre Straße. Gewesen. Und wo das Haus gestanden hatte, war ein Loch. Darin war alles verdampft, was Harry je besessen hatte – sein Lieblingssessel und seine Gitarre, die Karl-May-Bücher und das Modellauto, BMW 335. Sie zogen in ein anderes Mietshaus, wo Oma Gertrude lebte. Deren Wohnung war bereits überfüllt mit ihrer anderen ausgebombten Tochter und deren vier Kindern, also wohnten sie ab jetzt im Keller, einem stickigen Verschlag, und Harry war mehr als froh gewesen, als Erich aufkreuzte und Leute für seinen Werwolf-Trupp suchte. Harry hatte seiner Mutter nur einen Zettel hinterlassen, eine schnell hingekritzelte Nachricht. Während sie irgendwo für Brot angestanden hatte oder für Eier oder so was, war er rasch abgehauen, um ihr nicht ins Gesicht sehen zu müssen. Inzwischen hielt sie ihn wahrscheinlich für tot, und das machte ihm ein schlechtes Gewissen. Er müsste jemanden fragen, ob er nicht vielleicht nach Hause schreiben dürfe. Aber er konnte ja kein Englisch.
Solche Gedanken ließen Harry nachts oft wach liegen und in die Stille lauschen, während die anderen um ihn herum schnarchten.
Aber eines Nachts wurde er davon wach, wie der Einäugige im Nachbarbett, Kruppke war sein Name, mit seinem anderen Nebenmann flüsterte.
Harry schnappte halbe Sätze auf: »… und die ganzen Kinder. Bäm, Bäm, Bäm, da lagen sie im Graben wie Püppchen«, sagte Kruppke. »Einer musste es ja machen. Gab immerhin zwölf Mark Zulage.«
Da sagte der andere: »Sei mal leise, der Kleine neben dir spitzt die Ohren.«
»Na und?«, meinte Kruppke, jetzt weniger leise. »Für den haben wir das doch gemacht. Oder?« Er drehte sich um und fixierte Harry mit seinem einen Auge. Es blitzte im schwachen Schein einer Gaslampe. »Für euch haben wir das doch getan, Junge, für eine reinrassige deutsche Jugend. Guck dich doch an, Junge. Flink und zäh und hart, ihr seid eine Auslese. Damit das Judenpack nicht länger unsere Rasse vergiftet.« Er lachte leise. »Der Führer ist tot und das Reich vielleicht für immer untergegangen, aber unser Blut, das haben wir rein gehalten.«
Harry drehte den Kopf weg und starrte zur Wand. Was der Fritz wohl dazu sagen würde, wenn er ihm das erzählen … ach so, nee. Der Fritz war ja immer noch tot.