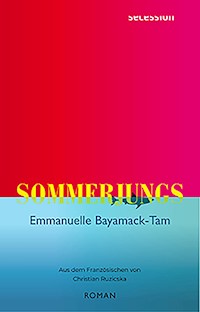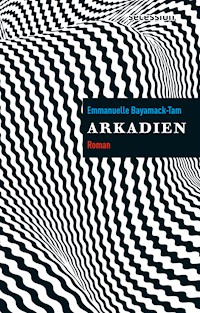Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Secession Verlag für Literatur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Erster Akt der Revolte: sich den Anfang aneignen, die eigene Geburt. Wie? Lassen Sie sich überraschen! Zweiter Akt der Revolte: sich die Sprache aneignen, als was? Als Waffe gegen eine Welt von Egozentrikern, die ihre Kinder verwahrlosen lassen und die Bande der ach so heilen Familie nur umso enger um die Kehlen ihrer Sprösslinge knüpfen, als dass, "unter uns", nichts, aber nun auch wirklich nichts, "weiter schlimm" ist. Und so darf es quellen und gären und aufkeimen im Morast einer monströs normalen Familie: das uralte Grauen, das Ovid schon besang, als er in seinen "Metamorphosen" Philomena gegen ihren Peiniger ausschreien ließ: "wenn nicht mit meiner Unschuld alles vor die Hunde ging!", bevor dieser sie ihrer Zunge entledigt - Kimberley, einst Titelheldin eines Songs von Patti Smith, hier nun wutentbrannte Stimme einer Heranwachsenden, die einen Spiegel vor unsere Augen schleudert, dessen Kristallsplitter Baudelaire, Hugo, Rimbaud, Verlaine aufblitzen lassen, diese Kimberley, sie wird zur Kronzeugin einer Kraft, die gegen alle Wucht des Schicksals mit der Sprache in der Hand sich ihre eigene Identität schöpfen wird: Und wenn die fragilste Stelle des Menschen seine sexuelle Identität ist, so ist dieser grandios zornige Roman ein überwältigender Aufschrei des Lebens, der auch dort widerhallt, wo der Abgrund der "unerträglichen Grausamkeit des Seins" aufklafft. Zum Beispiel: im von Geburt an gespaltenen Gesicht der Mutter, Vorsicht, die Oberfläche der Körper! All ihre Narben!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 478
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
WENN
MIT MEINER
UNSCHULD
NICHT ALLES
VOR DIE
HUNDE
GING
EMMANUELLE
BAYAMACK-TAM
WENN
MIT MEINER
UNSCHULD
NICHT ALLES
VOR DIE
HUNDE
GING
EMMANUELLE
BAYAMACK-TAM
ROMAN
Aus dem Französischen von Christian Ruzicska und Paul Sourzac
Dieses Buch erscheint im Rahmen des
Förderprogramms des Institut français.
Dieses Buch erscheint im Rahmen des
Förderprogramms des französischen
Außenministeriums, vertreten durch die
Kulturabteilung der französischen
Botschaft in Berlin.
Titel des französischen Originals: Si tout n’a pas péri avec mon innocence
© 2013 P.O.L éditeur, Paris
Erste Auflage
© 2014 by Secession Verlag für Literatur, Zürich
Alle Rechte vorbehalten
Übersetzung: Christian Ruzicska und Paul Sourzac
Lektorat: Alexander Weidel
Korrektorat: Peter Natter
www.secession-verlag.com
Gestaltung, Typographie, Satz und Litho:
KOCHAN & PARTNER, München
eISBN 978-3-905951-34-9
ISBN 978-3-905951-29-5
»Aber kein dem Menschen geschuldeter Respekt, keine falsche Scham, kein Bündnis, kein allgemeines Wahlrecht werden mich zwingen, das beispiellose Kauderwelsch dieses Jahrhunderts zu sprechen, noch je die Tinte mit der Tugend zu verwechseln.«
C. B.
INHALT
1. BANG BANG
2. WAS NÜTZT ES, DABEI ZU SEIN
3. WIE MAN ES TÄNZELN SIEHT
4. ALLES ÜBER CHARLIE
5. NICHT WEITER SCHLIMM
6. UNTER UNS
7. DIE VERZWEIFELTEN LEBEN SIND DIE WÜRDEVOLLSTEN
8. DAS ENDE DES SPIELS
9. DER RUHM MEINER MUTTER
10. DER GERUCH DES BLUTES (I)
11. IN DER NIEDERTRÄCHTIGEN MENAGERIE UNSERER LASTER
12. DAS HOHEITSVOLLE KIND
13. DER GERUCH DES BLUTES (II)
14. DAS ENDE ALLER SPIELE
15. ERLAUBET GOTT DENN SOLCH UNSÄGLICH TIEFES LEID
16. OH BABY, I REMEMBER WHEN YOU WERE BORN
17. HEUTE HABE ICH GEBURTSTAG
18. FREED FROM DESIRE
19. LIEBE IST DER GESCHMACK VON PROSTITUTION
20. RAKETEN
21. DIE SPRACHE DER VÖGEL
22. DES LEBENS RICHTIGE RICHTUNG
23. DER GERUCH DES BLUTES (III)
24. WIE WIMMELNDE WÜRMER
25. EINE SCHWALBE MACHT MEINEN SOMMER
26. OH DU MEIN KIEL, ZERSPLITTRE! UND ÜBER MIR SEI, MEER!
ANMERKUNGEN ZUR ÜBERSETZUNG UND ERLÄUTERUNGEN
1. BANG BANG
Als meine Großmutter versucht, die Schenkel wieder zu schließen, hindert die Hebamme sie daran und beginnt unverzüglich, ihren schmerzenden Damm abzureiben. Meine Großmutter täte gut daran, den Grund dieser Brutalität zu hinterfragen, aber da sie stets ein Händchen dafür hatte, die Gunst des Augenblicks zu nutzen, gönnt sie sich die Entspannung, die ihr die wiedergewonnene Ruhe ihrer Eingeweide und das rasche Entschwinden ihres Neugeborenen gewähren. Sie lässt gedankenverloren die Hand über ihren eingesunkenen Bauch fahren und kommt gerade noch dazu, die letzten Wehen, die absterbende Replik des großen Tohuwabohu zu spüren, bevor sie von einer Plazenta erlöst wird, deren Existenz ihr unbekannt war und die sich in drei wollüstigen Zuckungen aus ihr herausdrückt.
Allein gelassen, die Beine noch immer in archaischen Bügeln hängend, wird meine Großmutter von einem nervösen Lachen erfasst. Sie täte gut daran, den Sinn auch dieser Einsamkeit zu hinterfragen, aber mit ihren sechsundzwanzig Jahren weiß sie bereits genug vom Leben, um sich über nichts mehr zu wundern und hinzunehmen, dass Einsamkeit unser Daseinsgrund ist. Alles, was ihr in den Sinn kommt, sind die Fetzen eines Liedes von Nancy Sinatra, »Bang Bang«, sowie die leuchtende und erstarrte, gleichsam in der schimmernden Falle ihres Gedächtnisses gefangene Erinnerung an den Strand von Sidi Fredj.
Schwebend, glückselig, möchte sie beinahe schon vor sich hin summen, als ihr endlich die Frucht ihres Leibes hingehalten wird, eingepackt in einen smaragdgrünen Samtstrampler mit appliziertem Bienenwabenmusterlatz, ein Kleidungsstück, das ihr merkwürdig bekannt vorkommt, bis sie sich schließlich daran erinnert, es selbst in der Babyabteilung bei Dames de France gekauft zu haben.
Bang bang, meine Großmutter kann das Leben noch so gut kennen, eine Vorbereitung für das, was jetzt folgt, gibt es nicht. Sie schließt die Augen, kreuzt die Finger, sucht nach der rechten Geste, dem magischen Schlüssel, aber nichts zu machen, keine Taube flattert da mühsam aus irgendeinem Hut, kein Hase quält sich da aus ihm hervor, keine ellenlange Folge von Halstüchern entwindet sich der gestärkten Tasche der Hebamme, die nicht davon ablässt, ihr ein Baby hinzuhalten, dessen ergreifend hässliches Gesicht einen erbärmlichen Kontrast darstellt zu dem prunkvollen Kleidungsstück, das ihm seine Eltern ausgesucht hatten, als es höchste Zeit war, auch an Kleidung zu denken.
Meine Großmutter streckt, da die Umstände es erfordern, jedoch ohne jeglichen Elan, die Arme in Richtung ihres Sprösslings, dessen sich die Hebamme mit ebenso deutlicher wie demütigender Erleichterung entledigt. Bang bang, ein Gefühl der Ungerechtigkeit brandet in meiner Großmutter auf, die eine Kränkung auf den ersten Blick zu erkennen vermag. Wir befinden uns Ende der sechziger Jahre, noch hätte keine Ultraschallaufnahme die finsteren Tiefen ihrer Schwangerschaft ergründen können; noch hätte keine pränatale Untersuchung ihr eröffnen können, dass ihr erstes Kind ein Mädchen und dass dieses Mädchen an etwas erkrankt war, das landläufig noch immer als Hasenscharte bezeichnet wird. Heute spräche man eher von einer Lippen-Kieferspalte, die, im Falle meiner Mutter, da ja von meiner Mutter die Rede ist, in eine Gaumenspalte übergeht, ganz abgesehen von einem gespaltenen Zäpfchen, dessen Existenz sich hinsichtlich der anderen erfassten Fehlbildungen letzten Endes aber als belanglos erweisen wird.
Meine Großmutter drückt ihren Säugling fester an sich. Der kleine Kopf beginnt sich umgehend mit animalischer und blinder Entschlossenheit zu bewegen, bis es ihm gelingt, an einer von neun Monaten Schwangerschaft überdehnten und grünadrigen Brustwarze anzudocken. Wachsam hinunterschielend auf die klaffenden Nasenlöcher und die rätselhaft dreiblättrige Lippe ihres Neugeborenen, wendet sich meine Großmutter an die Hebamme:
– Wird es saugen können?
– Das wird schwierig.
Meine Großmutter verspürt nur allzu deutlich die perverse Genugtuung, die die Hebamme bei der Formulierung ihrer Diagnose empfindet, aber ohne besondere Gefühlsregungen preiszugeben, begnügt sie sich damit, den gierigen Mund ihres Kindes passender an ihre schmerzende Brust zu legen. Aller Erwartung zum Trotz gelingt es derjenigen, die nur dreiundzwanzig Jahre später meine Mutter werden wird, einen Rachen voll Kolostrum hinunterzuschlucken, dann einen zweiten, woraufhin sie sich unter Protestgeschrei nach hinten wirft – denn auf meine Mutter ist Verlass in Sachen Wut und Lärm.
– Wie werden Sie es nennen?
Kalt erwischt, versucht meine Großmutter Zeit zu gewinnen und die Panik zu unterdrücken, die sie überfällt zwischen dem Baby, das schreit, und der Hebamme, die sie mustert. Nicht etwa, dass sie vergessen hätte, für welche Vornamen sie sich entschieden hatte, und zwar gemeinsam mit dem Vater dieses Neugeborenen, das da zwischen ihren Armen schäumt und krampft, bei dem sie aber noch immer nicht weiß, ob es ein Junge oder Mädchen ist.
Ohne ihre Feindin zu konsultieren, lässt sie zwei Ton in Ton unisexgrün lackierte Druckknöpfe aufspringen. Wir befinden uns Ende der sechziger Jahre, Wegwerfwindeln gibt es noch keine, und so hat meine Großmutter mit den Sicherheitsnadeln zu kämpfen, bevor es ihr endlich gelingt, aus den Windeln zu schälen, was sich als ein kleines, im Genitalbereich vollkommen wohlgeformtes Mädchen erweist. Überschwemmt von viel zu vielen absurden Gedanken, verkrampft sich meine Großmutter, sieht sich aber vom gleichen wilden Lachen eingeholt wie kurz zuvor auch schon. Bang bang: Es wäre besser gewesen, sagt sie zu sich selbst, die Fehlbildungen hätten die Vulva meiner Tochter betroffen anstatt Mund und Nase; bang bang, es wäre besser gewesen, ihr dieses Wams aus unnötig glänzendem Samt nicht gekauft und sie auch nicht im Vorfeld schon mit unnötig fürstlichen Namen getauft zu haben, die für ein normales Baby ihren Zweck erfüllt hätten, für das Monster jedoch, das ich gerade in die Welt gesetzt habe, eine Verschwendung darstellen, ja sogar eine weitere Schmach.
Während jener Zeit, da das noch zu gebärende Kind nichts anderes tat, als ab und an die Seiten meiner Großmutter zu zerbeulen, hatten die Eltern in spe ihre Entscheidung zugunsten von Léopold und Fabiola gefällt, eine Wahl, die unter dem Deckmantel der Würdigung der wallonischen Herkunft meines Großvaters wohl eher ihrer beider Traum von Größe verriet. Wie dem auch sei, meine Großmutter zieht dieses Baby, das sie dazu zwingt, ihre dynastischen Ambitionen zurückzustellen, wieder an und wiegt es nachdenklich, während sich die Hebamme um sie herum zu schaffen macht.
– Ich werde Ihnen einen kleinen Plastikgaumen bringen: den wird es brauchen. Und dann werde ich ihm ein Fläschchen bereiten. Es würde mich wundern, wenn Sie gute Milch hätten, Sie sind zu mager.
– Ich glaube, ich will weiterhin stillen. Wir werden ja sehen.
– Ich kenne mein Metier, wissen Sie. Solche wie Sie habe ich haufenweise gesehen, die wollen stillen, halten aber keine achtundvierzig Stunden durch. Also warum Ihnen nicht gleich unnötige Leiden ersparen?
Meine Großmutter ist der festen Überzeugung, ihr die Leiden ersparen zu wollen, stelle nicht die lobenswerte Sorge dar, die ihre Beißerin antreibt. Allein schon die kleinen, geheuchelt mitleidsvollen Zungenschnalzer, die sie mit jedem weiteren Blick auf das Neugeborene von sich gibt, allein schon das scheinheilige Beharren, mit dem sie wieder und wieder auf die Frage nach dem Vornamen zurückkommt, als wäre es nicht das Gebot der Stunde, die Gebärende über den Schock und die Enttäuschung hinwegzutrösten, von denen sie sich mehr schlecht als recht zu erholen und deren Ausmaß sie zu kaschieren sucht.
– Der Standesbeamte wird nicht lange auf sich warten lassen, wissen Sie.
– Um was zu tun?
– Sie müssen es ihm dann mitteilen. Was den Vornamen anbelangt. Oder die Vornamen. Sie können bis zu vier geben.
Den Blick ostentativ auf das viereckige, von der Hebamme auf Höhe des Herzens getragene Namensschild gerichtet, raunt meine Großmutter voller Perfidie:
– Im Falle eines Mädchens hatten wir an Gladys gedacht.
Totenstille knallt nieder auf diesen Saal, der den Geburten zugedacht ist. Aber es muss angenommen werden, dass nicht alle Geburten den gleichen Wert besitzen und weder zur gleichen Aufmerksamkeit noch zur gleichen Freude Grund geben. Unter dem unerbittlichen und erschöpften Blick meiner Großmutter errötet die Hebamme und sucht nach einer Retourkutsche, die sie niemals finden wird – und das aus gutem Grunde: Wie ablehnen, dass ein Kind heißen soll wie sie und dies zweifelsohne auch noch ihr zu Ehren? Zuzugeben jedoch, dass diese Ehre zugleich eine Beleidigung sei, dies genau ist für beide Seiten schlechterdings unmöglich. Meine Mutter wird Gladys heißen und die fürstlichen Vornamen werden den anderen Kindern dienen – meinem Onkel Léopold und meiner Tante Fabiola, er wie sie glücklicherweise bar sichtlicher Makel.
Das Leben ist ungerecht, denn meine Mutter ist eine Prinzessin und hätte Ehrentitel nötiger als jede andere, in erster Linie einen Vornamen, der ihre Würde bezeugte anstelle dieses »Gladys«, das als Rache einer Frau entgegen geschleudert wurde, die meine Großmutter bis hin zu deren bloßer Existenz umgehend nach dem Verlassen der Klinik vergessen haben wird.
Das Leben ist ungerecht, aber meine Mutter ist für das Leben geschaffen. Während meine Großmutter ihren Triumph und die Enttäuschung ihrer Feindin auskostet, saugt ihre Tochter wie wahnsinnig an der nährenden Brust, und was soll’s, wenn sie sich verschluckt und hustet, was soll’s, wenn ein guter Teil der Flüssigkeit droht, direkt in die Lungenbläschen zu schießen, ein Rest wird seinen Weg schon nehmen. Auf meine Mutter ist Verlass, wenn es anzugehen gilt gegen Widrigkeiten, auf meine Mutter ist Verlass, wenn es zu überleben gilt in feindlicher Umgebung.
2. WAS NÜTZT ES, DABEI ZU SEIN?
Möge sie mir gehören, diese Erzählung eines Beginns, der nicht der meine ist. So oder so, es muss ohnehin begonnen werden.
Mir diese Erinnerung, die nicht die meine ist. Es gehören ohnehin die Erinnerungen niemandem. Zu ungewiss ist ihre Natur, als dass wir uns ihres Besitzes brüsten dürften: zu fein die Unterscheidung zwischen ihnen und den Träumen, als dass wir auf das Gedächtnis auch nur irgendeine Art von Gewissheit gründen dürften, so auch jene, überhaupt etwas erlebt zu haben. Gut möglich sogar, dass wir gar nicht dafür geschaffen sind, uns zu erinnern, wenn ich einmal bezüglich des winzigen Anteils dessen urteile, was dem Vergessen entrinnt von all diesen zahlreichen Stunden, Stunden, die Sekunde für Sekunde uns durchzogen haben; Blutstrom, Pulsieren des Herzens, Ausatmen, Einatmen – und zum Schluss dann: nichts, so gut wie nichts, aufgelöst in Luft die zahlreichen Stunden, zwanzig Jahre Leben in einem Taschentuch.
Mir diese Erinnerung, die den gleichen Wert besitzt wie jede beliebige andere. Ich war nicht dabei? Stimmt, aber was nützt es, dabei zu sein? Meine Mutter, die dabei war, erinnert ihre Geburt und improvisierte Taufe auch nicht besser als ich.
Mir diese Erinnerung einer Erinnerung. Meine Großmutter ist eine ausreichend gute Erzählerin, um aller Welt das trügerische Gefühl zu vermitteln, dem Schauspiel beigewohnt zu haben.
Mir diese Erzählung, die sich meine Mutter immer ohne mit der Wimper zu zucken angehört hat, sie, die sonst so leicht aus der Reserve zu locken ist, sie, die immer so schnell ausrastet, wenn es gilt, seine Meinung kundzutun. Schon der geringste Sporn, und zack, da schlägt sie aus, zack, da tänzelt sie, und hopp, los geht’s – und stundenlang geht’s rund mit meiner Mutter, wo sie doch nichts auslässt, nicht eine Auswalzung ihres konfusen Denkens, keine hirnrissige Idee, keine müßige Erwägung.
Um ihr das Wort abzuschneiden, blieb allein dieses Schauermärchen, in dem man sie ihre ebenso turbulenten wie enttäuschenden ersten Schritte in die Welt machen sieht. Sie hat es sich stets aufmerksam angehört, aber mit einem Ausdruck von Abwesenheit, der ihr sonst nicht eigen ist, sie, die auch nur den geringsten Abstand zu wem auch immer weder kennt noch respektiert.
Mir die Geschichte, die allein geeignet, dieses Mundwerk zu stopfen, das mit einem Hasen nie etwas anderes gemein hatte als den Namen – denn wenn man Wert legt auf Metaphern und Genauigkeit zugleich, dann lasst uns darin übereinkommen, dass Mund wie Nase meiner Mutter eher dem System einer Knolle entstammen, eines fleischigen Blütenstempels oder einer üppigen Beere. Heute hat ihre Oberlippe dank der plastischen Chirurgie eine zaghafte Linie wiedererhalten: Sie schmiegt sich eng an die Zahnreihe, doch scheinbar ohne Fruchtfleisch, und verzweigt sich nach oben hin zu einer doch recht plumpen, rosawulstigen Narbe. Die Nasenlöcher haben ihre furchteinflößende Asymmetrie verloren zugunsten akzeptabler Züge, doch die Nase bleibt platt und wie geweitet, was ihr einen schemenhaft aztekischen Ausdruck verleiht und ihr mit »Indianerin« den wohlwollendsten unter all ihren Spottnamen eingetragen hat.
Das Leben ist ungerecht, denn meine Mutter, deren Vorname für sich genommen schon eine Demütigung darstellt, schleppt noch dazu fünfundvierzig Jahre schmachvoller Spitznamen hinter sich her, die unweigerlich und in der Reihenfolge ihrer Prävalenz den Affen, die Sau, die Hündin zur Sprache bringen – und schließlich, und zwar erst am Ende der Liste, den Hasen, dem sie so wenig ähnelt.
Mit Vornamen kenne ich mich aus. Das Leben meiner Mutter ist dafür verantwortlich. Weil sich die Kränkung nicht auf die schändliche Wahl von Gladys beschränkt hat; die Kränkung rührt auch daher, dass Léopold und Fabiola Anrecht auf weitere Vornamen hatten: Louis, Alexandre und Maximilien für den einen, Astrid, Élisabeth und Théodora für die andere, eine Abfolge von Köpfen, der eine adeliger als der andere, was mit Fug und Recht darauf schließen lässt, dass meine Großeltern von sozialer Revanche träumten, nicht aber auf ihre älteste Tochter zählten, um diesen Traum durchs Leben zu tragen.
Mit Vornamen kenne ich mich aus, aber auch mit elterlichen Projektionen, die mit ihnen einhergehen, selbst wenn ebendiese elterlichen Projektionen auf die Schnauze fallen. Und so haben Onkel Léo und Tante Faby sich ihre fürstlichen Vornamen sehr früh amputiert und ebenso früh auf ein ruhmreiches Schicksal verzichtet. Diejenige, die sich dem Ruhm am meisten nähern sollte, und auch hier wird man noch sehen, wie, ist meine Mutter, jene Gladys, auf die man so wenig setzte, dass sie nur Anrecht hatte auf einen Ersatznamen, eine erzwungene Wahl, eine aus Verbitterung und Vergeltung getroffene Wahl, während alle übrigen Kinder sahen, wie ihre Patentanten voller Wohlwollen und traumestrunken nach Größe sich über ihre Wiege beugten.
Mit Vornamen kenne ich mich aus, denn meine Mutter hat mich Kimberly genannt und ihre Projektionen waren schon immer schwieriger umzusetzen und zu verstehen als jene der anderen Eltern, selbst für mich, die ich Spezialistin bin für verdrehte Hirne. Da meine älteren Schwestern Svetlana und Ludmilla heißen, schien es tatsächlich unabwendbar, dass ich einen slawischen Vornamen abbekommen sollte, aber auf meine Mutter ist Verlass in Sachen Kontinuität: Kaum hatte sie ihrer Sammlung russischer Püppchen abgeschworen, kaum hatte sie mich Kimberly genannt, da hatten Lorenzo und Esteban auch schon die Familie vergrößert, bang bang, zwei im Abstand von neun Monaten geborene Jungen, was Bände spricht über die Laxheit meiner Mutter auf dem Gebiet der Empfängnisverhütung und zugleich erklärt, weshalb ich die letzten sechzehn Jahre in der Befürchtung verbrachte, sie würde damit wieder anfangen, zumal schwanger zu sein für sie beinahe ebenso grandios ist wie zu gebären.
Svetlana, Ludmilla, Kimberly, Lorenzo, Esteban: Solch folkloristische Farbenpracht könnte vermuten lassen, wir hätten nicht denselben Vater, aber auch dies hieße, Gladys schlecht zu kennen, und so heißt unser gemeinsamer Erzeuger Patrick, wie alle Jungen seiner Generation. Ich muss betonen, dass er mit der Wahl unserer Namen nichts zu tun hat. Man kann sogar sagen, dass er mit rein gar nichts etwas zu tun hat, was ihn aber nicht daran hindert, sich für unabdingbar zu halten und eine irre Energie darauf zu verwenden, das Oberhaupt der Familie zu spielen. Egal, zu welcher Stunde man ihn antrifft, mein Vater scheint stets überanstrengt und besorgt zu sein. Unsere Erziehung ist seine große Sache, auch wenn es ihm nur ab und an in den Sinn kommt, in immer wiederkehrenden Anwandlungen, im Zuge derer er uns zur Seite nimmt zwecks feierlicher Warnungen, mit zitternder Stimme Auge in Auge vorgetragene Predigten, die mich stets sehr kalt gelassen haben und von denen meine Geschwister wohl ebenso unbeeindruckt blieben wie ich, selbst wenn wir nie darüber sprachen, da mein Vater nun wirklich kein Gesprächsthema ist. Es scheint ganz in seiner Natur zu liegen, keinen Eindruck zu hinterlassen und niemanden zu interessieren. Es gibt solche Leute, deren Leben vollkommen im Dunkeln bleibt, unabhängig von der Kraft, die sie aufbringen, um zu existieren.
Alle vergessen meinen Vater, selbst seine eigenen Kinder, was ausgesprochen ungerecht ist, denn er ist ein charmanter und fröhlicher Mensch, unfähig, Böses zu denken oder schäbig zu handeln, stets ergeben und hilfsbereit. Und noch dazu ist er von strahlender Schönheit mit seinen goldbraunen Locken, seinen klaren Augen, seinem großzügigen Mund und vor allem seiner majestätischen, spitz zulaufenden, Neid erregenden Nase, die ich geerbt.
Denjenigen, die sich nun fragen, warum er, gesegnet mit solch vorteilhafter Körperlichkeit, unter allen Frauen eine derart benachteiligte erwählte, würde ich gerne antworten, dass die Schönen, die sich nichts zu beweisen haben auf dem Gebiete der Schönheit, die Hässlichen zu lieben und zu heiraten sich leisten können. Aber jedermann weiß ja, dass dieser vernünftig klingende Grundsatz eine Lüge ist, und dass Schönheit Schönheit anzieht, da das Leben ja ungerecht, und um dies zu beweisen, reicht mir mein eigenes Leben doch wirklich mehr als genug. Da es hier nun aber um Wahrheit und Wahrscheinlichkeit geht, zwingen mich diese einzuräumen, dass mein Vater sich aufgrund seiner geringen Körpergröße auf dem Markt der Liebenden nie besonders laut aufgespielt hat. Sehr gut möglich sogar, dass er im Vergleich zu meiner Mutter mehr Komplexe, ja, sogar als einziger der beiden überhaupt welche hat. Denn das Leben kann noch so ungerecht sein, manchmal fängt es sich dann doch wieder mit merkwürdigen Kompensationsmechanismen, so zum Beispiel jenem, der es einer durch eine Hasenscharte entstellten jungen Frau erlaubt, sich im Spiegel voller Genugtuung zu betrachten, voller Entzücken sogar im Falle meiner Mutter.
Tatsächlich kenne ich niemanden, dessen Narzissmus derart unanfechtbar ist wie der ihre, und wo wir schon einmal Erklärungen für ihre Heirat suchen, bezweifle ich mitnichten, dass sie meinen Vater und vor ihm andere hübsche Kerle in den Bann gezogen hat mit ihrer seelenruhigen Überzeugung, unwiderstehlich zu sein, trotz vernähter Lippe und deformierter Nase. Verhaltet euch wie ein Vamp, und die Leute werden zögern, euch einen Nasenaffen zu schimpfen, eine Kröte oder Sau, wie es meiner Mutter, bevor sie sich entschlossen hatte, der ganzen Welt eine in Selbstbehandlung überschminkte Sicht ihrer selbst aufzuzwingen, wieder und wieder passiert war.
Da Grausamkeit der Kinder zweite Natur, bin ich mir vollkommen darüber im Klaren, was sie alles an Spott, Demütigung, und Misshandlungen über sich ergehen lassen musste. Ich war nicht dabei, aber was nützt es auch, dabei zu sein, wo man ja weiß, wie eifrig die Pausenhöfe das Gesetz des Dschungels fortleben lassen und die Besiegten dem Verderben preisgeben. Nur, dass meine Mutter, weit davon entfernt, sich von Schikanen erniedrigen, von Spötteleien kleinkriegen zu lassen, es vorgezogen hatte, sich die Persönlichkeit eines hübschen Mädchens zuzulegen, das zwar verbeult, aber sexy war, was für sie eine recht heikle Positionierung darstellte angesichts des Risikos, das für sie bestand, als Flittchen durchzugehen, aber auf meine Mutter ist Verlass, wenn es gilt, sich widerspenstig zu verrenken, und so konnte Gladys rasend schnell ungeheuren Erfolg verbuchen.
Mit Vornamen kenne ich mich aus, hat meine Mutter den ihren doch stets wie eine Standarte vor sich hergetragen. Immerhin war sie all jenen Corinnes, Valéries und Nathalies entkommen, mit denen die Hälfte der Mädchen ihrer Klasse gegeißelt waren.
Mit Vornamen kenne ich mich aus, habe ich den meinigen doch stets für vulgär und feierlich zugleich befunden – abgesehen davon, dass meine Mutter nie ihre unerklärliche Reserviertheit in Bezug auf die Wahl von Kimberly abgelegt hat, sie, die aus nichts einen Hehl macht, sie, die in der Lage ist, Svetlana wie Ludmilla, Lorenzo wie Esteban wortgewaltig zu rechtfertigen.
Aus nichts einen Hehl machen. Da haben wir eine weitere Eigenschaft meiner Mutter, weder Scham zu besitzen noch Sinn für die Scham der anderen – und Sinn für deren Empfindsamkeit ebenso wenig. Denn meiner Mutter zuzuhören, besser gesagt, sie sprechen zu sehen, ihren verzweifelten Artikulationsversuchen beizuwohnen, heißt, sich etwas zuzumuten, ja, einiges einstecken zu können – oder aber es seit geraumer Zeit gewohnt zu sein. Die Chirurgie hat ihr noch so sehr die Lippe und den Gaumen wieder vernähen, ihr die Nase neu modellieren und die Zahnreihe begradigen können, ihre Schwierigkeiten bei der Aussprache bleiben doch bestehen, gleichen einer Art Stottern, als wären die Worte irgendwo zwischen Zwerchfell und Schneidezähnen gefangen gehalten, und beinahe meint man zu sehen, wie sie sich winden, drohen, grollen, bevor sie in sintflutartigen Regengüssen oder prasselnden Hagelstürmen auf ihr Publikum niedergehen.
Will man der Ärzteschaft Glauben schenken, so ist die Spaltung ihres Gaumens mitnichten verantwortlich zu machen für das Stottern meiner Mutter. Davon ausgehend meinen zu wollen, sie habe zunächst simuliert, bevor sie sich in der Komplexität der Phonationsmechanismen verfing, dies ist ein Schritt, den zu gehen ich sofort bereit bin, kenne ich doch meine Mutter und ihren unbändigen Willen, Aufmerksamkeit zu erregen. In noch zartem Alter und erfolgreich in drei Etappen operiert, ordnungsgemäß zusammengeflickt, fast schon normal, hat sie sich wahrscheinlich ein Symptom erfinden wollen, um den Ärzten eine Nuss zu knacken zu geben und ein Feld zu beackern. Was sie jedoch nicht simulieren musste und was auch heute noch geradewegs herausdringt aus ihrer Hasenscharte, das ist ihre Stimme, diese Zeichentrickfilmstimme, die zugleich näselnd und spöttisch klingt, dieses unerträgliche Gehupe, das niemals aufhören wird, in meinen Ohren zu hallen, während meine Mutter Fratzen schneidet, ihre Fäuste ballt und wieder lockert, den Hals nach vorn reckt, einfach nur, um einen Ton zu erzeugen, dann einen weiteren, dann einen ganzen Satz, und da haben wir’s, los geht’s, aufzuhalten ist sie jetzt nicht mehr, zu meinem Leidwesen und dem meiner Geschwister, alle ebenso sprachlos wie ich, alle ebenso ins Netz gegangen und ebenso unfähig, sich zu befreien: Svetlana, Ludmilla, Lorenzo, Esteban, für euch ergreife ich das Wort, aber seid unbesorgt, ich erwarte nichts, wo ihr doch durch die Bank weder fähig seid zu Geistesblitzen noch zur leisesten Regung der Dankbarkeit.
3. WIE MAN ES TÄNZELN SIEHT
Man kann neunjährig zur Welt kommen: der Beweis dafür bin ich. Mögen sie mir gehören, all diese Erinnerungen, die keine sind, bang bang, wieder und wieder. Mir all diese Anfänge. Nach demjenigen meiner Mutter, hier nun der meine, dieses verspätete Zur-Welt-Kommen, das mich nackter zurückgelassen hat als ein Neugeborenes, glücklicherweise aber herausgelöst aus den mütterlichen Eingeweiden und gebadet im reinigenden Schaum und in den Wellen des Meeres – denn auf das Meer ist Verlass, wenn es gilt, Geburten zu begleiten, zumindest jedoch die meine, damals im Sommer Zweitausendzwei.
Das Meer tänzelt keine zwei Schritte entfernt. Meine Zunge dringt zaghaft vor, bis hin zur Berührung mit den kreideartigen Spuren, die das Salz auf meinen Schultern gezogen hat. Ich lecke. Einmal, zweimal, dreimal, bis meine Haut ihre ursprüngliche Fadheit wiedererlangt hat. Unweit von mir haben meine Mutter und meine Schwestern ihre Bastmatten aneinander gerückt, um sich gegenseitig mit Sonnencreme einzureiben. Bald dreizehnjährig, trägt meine Schwester Svetlana bereits die Formen einer reifen Frau zur Schau, die ihr roter Zweiteiler vom letzten Jahr nur mit Mühe zusammenhält. Selbst ihre Blondinenhaut, ihre bislang weißblaue Haut, hat um Gnade gefleht unter dem zu raschen Wachstum all dieser Attribute. Sie gab nach, riss vor Spannung, bildete scharlachrote Striemen, die meine Mutter »Schwangerschaftsstreifen« nennt und über die sie ebenso stolz zu sein scheint wie über das vollbusige Dekolleté ihrer ältesten Tochter – vom fetten Hintern ganz zu schweigen, auf den ihre Lobeshymnen nicht versiegen:
– Bei einem solchen Prachtarsch, meine Tochter …
Der Satz verliert sich, es liegt an uns, gemeinsam mit meiner Mutter von den Welten zu träumen, die sich Svetlana bei dieser ausufernden Weiblichkeit zweifellos erschließen werden. Von Svetlana gehen wir über zu Ludmilla, die mit ihren elf Jahren nur ihre zarte und feurige Schönheit in die Waagschale werfen kann, ihre kaum ausgeprägte Taille, ihre kaum knospenden Brüste – was sie aber nicht davon abhält, die gleiche Bademode zu tragen wie ihre Schwester, einen Bikini, feingestreift in roten bis rosaroten Tönen. Mit gewitztem Finger lüftet meine Mutter das Band des Oberteils ihrer Jüngeren und lacht auf ob der Bescheidenheit ihrer Brust. Ludmilla protestiert lauthals und lässt einen zusätzlichen Spritzer Sonnencreme auf dem Bauch landen, dem sie entstammt, ein Bauch, von dem alle außer mir meinen, dass er nach fünf regelgerecht ausgetragenen Schwangerschaften immer noch gut in Form sei. Meine Mutter stellt ihn bei jeder Gelegenheit zur Schau, und geht, sobald das Wetter es erlaubt, im Bikini vor die Türe, hat sie sich doch nie zu einem Badeanzug durchringen können, für den sich Frauen ihres Alters vernünftigerweise entscheiden. Auf Gladys ist Verlass, wenn es gilt, unvernünftige Entscheidungen zu treffen.
Angetrieben von kindlichem Eifer, den meine Mutter bei all ihren Sprösslingen einfordert, macht sich Ludmilla daran, ihr die Schenkel durchzuwalken, dann die Waden, die Fersen, den Rist, verteilt dabei großzügig Creme und vergisst keinen einzigen Quadratzentimeter dieser empfindlichen und zähen Haut, die es vor Sonne zu schützen gilt.
Mit Schüppe und Rechen unter dem familiären Sonnenschirm hockend, der unter jeder Mistral-Böe mit all seinem ausgefransten Stoff erzittert, sind Lorenzo und Esteban ausgestattet wie zwei Mondscheinkinder: T-Shirt, Sonnenhütchen, schwarze Sonnenbrillen und ein gelblicher Ölfilm mit höchstem Lichtschutzfaktor. Es sei erwähnt, dass Esteban eher blondhaarig, der arme Lorenzo hingegen knallrot ist. Das hat er von Großmutter Claudette, Claudette, die das Leben kennt, Claudette, die weiß, dass Einsamkeit unser Daseinsgrund ist, Claudette, die in einem Anflug von Rachegelüsten ihrer ältesten Tochter den Vornamen einer Hebamme verpasste. Auch sie ist da, Claudette, im zitternden Schatten des Sonnenschirms. Mit einem Auge wacht sie über meine kleinen Brüder, die ebenso vom Ertrinken wie vom Sonnenstich bedroht sind; mit dem anderen schielt sie auf Charlie, unseren lebhaften Patriarchen, der gerade auf seinem Strandtuch schläft – denn zum Strand gehen wir als Familie, und die Familie, das sind bei uns nicht weniger als drei Generationen.
Mit seinen fünf Jahren lebt Lorenzo noch in der glücklichen Einfalt seiner Rothaarigkeit. Sie hat ihm bislang weder den Spott noch die Nachstellungen eingetragen, die bald schon den wesentlichen Anteil seiner sozialen Existenz ausmachen werden. Unschuldig spielt er unter der Aufsicht seiner Großmutter, deren Haarpracht übrigens bedeutend weniger leuchtend ist als die seine, das Leben ist ungerecht, was zu beweisen mir bis zu meinem letzten Atemzug wichtig sein wird. Denn verzeiht man es den Mädchen, rothaarig zu sein, den von Sommersprossen übersäten Irinnen, den venezianischen Schönheiten oder den giftigen Gildas, so profitieren die Jungs weder von der gleichen Nachsichtigkeit noch vom gleichen Ermessensspielraum. Meiner Großmutter aber muss dieses Verdienst angerechnet werden: den erwarteten Rollen hat sie stets die Eigenkreation vorgezogen, und so war sie auf ihre eigene Art und Weise rothaarig, wobei ihr wahrscheinlich eine ungewöhnliche Haarpracht geholfen hatte, die eher mahagonirot als orange und vor allem unwahrscheinlich gelockt ist, fast schon kraus, unkämmbar.
Doch entferne ich mich zu sehr von meinem Anfang, was schade, da doch mein Anfang würdig ist, in aller Fülle erzählt zu werden. Im Gegensatz zu den meisten Menschen bin ich nicht unter Schmerzen und Ausflüssen geboren, ebenso wenig unter dem klinischen Licht eines Kreissaals. Nein, meine Geburt konnte der Ärzteschaft, den blasierten Geburtshelfern sowie den leicht perversen und für eben ihre Perversion bestraften Hebammen entkommen.
Ich bin nicht befähigt, die Unbeflecktheit meiner Zeugung in Anspruch zu nehmen, aber ich beteure bei meiner Ehre, dass kein einziges Reproduktionsorgan in meine Geburt verstrickt war: Ich bin wellen- und schaumgeboren, wie Aphrodite, ohne jedoch, dass die Eier meines Vaters dabei auch nur irgendwie im Spiel gewesen wären – ebenso wenig wie der Uterus meiner Mutter und noch weniger ihre ausgeleierte Vagina oder ihr auf zehn Zentimeter geweiteter Gebärmutterhals.
Ich beteure bei meiner Ehre, meine Geburt, die bin allein ich. Ich allein nach neun Jahren stumpfer Kindheit, schwachen Wimmerns und kindischem Gehorsam Eltern gegenüber, die es nicht verdienten, dass man ihnen gehorchte. Aber vor dieser zweiten Geburt, die die erste aufhebt, bleibt mir ein letzter Kraftakt, eine letzte Überschreitung.
Unweit von mir necken meine Mutter und Schwestern einander wie gehabt voller Begeisterung. Mit einem sonnencremebeschmierten Zeigefinger zerdrückt meine Mutter Svetlanas Nase und unterstreicht damit die ohnehin beängstigende Ähnlichkeit zwischen den beiden. Ludmilla, die unter keinen Umständen zurückstehen möchte, drückt ihre eigene Nase platt und stülpt ihre Oberlippe hoch. Über wen man sich da lustig macht, kann ich nicht wirklich sagen, das Gekreische aber steigt an, die Körper nähern sich einander und werden zu einem Gemenge öligen Fleisches, was meine Mutter aber nicht daran hindert, unter den ekstatischen Blicken ihrer Töchter in ihrer unangenehm stockenden Manier Reden zu schwingen.
Klammheimlich entledige ich mich meines Bikinioberteils, ein marineblauer Büstenhalter, der auf der linken Brust mit einer fürstlichen Krone bestickt ist – Brüste aber eben habe ich keine, und ginge es nach mir, ich würde nie welche bekommen; bräuchte sie dann auch nie vor mir herzuschieben, diese wackelnde und Platz greifende Masse, die mich beim Laufen doch nur störte, beim Springen, bei allem. Ebenso wenig wie ich je Körperhaar bekommen würde, könnte ich es nur vermeiden. Und auch hier, wie nur soll man die Schreie des Entzückens verstehen, die von meiner Mutter ausgestoßen wurden, als sie bei Svetlana, später auch bei Ludmilla, die vielversprechende Saat einer Schambehaarung entdeckte.
Ich lege mich auf den Bauch, um den zärtlichen Avancen meiner Mutter auszuweichen. Im Dreieck meiner verschränkten Arme, im Winkel des vertraulichen und gedämpften Schattens, den ich soeben für mich allein geschaffen habe, steigt mir der Geruch der Bastmatte in die Nase, trockenes Stroh, ländliche Binsen, in mir ein wollüstiges Empfinden von Einsamkeit und Sicherheit verstärkend. Um mich herum schwillt das Rumoren des Strandes an, durchzuckt von spitzen Schreien, fällt dann wieder ab auf einen dumpferen und undeutlicheren Pegel. Ich spreize ein wenig die Beine und der Pfeil der Sonne trifft augenblicklich auf meine noch kalte Vulva, ihre unter dem nassen Lycra noch blassen Falten. Indem ich mein Becken noch heftiger gegen die Bastmatte drücke, verstärke ich das Reiben meiner Crista iliaca und meiner Brüste, die noch keine sind, gegen das raue Gewebe. Gedankenverloren, von aufkommender Lust geleitet, berauscht von der Hitze, den Windstößen, dem offenen Raum um mich herum, wende ich das Gesicht dem Meer zu, ich schließe die Augen, ich schlängle mich, meine Hände durchfahren krampfartig den brennenden Sand. In genau diesem Augenblick stößt meine Mutter, der meine heimlichen Kriechbewegungen nicht entgangen sind, ein Kreischen aus, laut genug, den ganzen Strand zu alarmieren:
– Schaut mal, was Kim da macht!
Ich schnelle auf meiner Bastmatte hoch, aber es ist zu spät. Das Geschrei und die Kommentare schwellen an:
– Kim, alles in Ordnung? Stören wir dich etwa? Macht’s denn wenigstens Spaß? Falls du Hilfe brauchst, sag uns Bescheid, ja!
Mein jetzt hellwacher Großvater mustert mich spöttischen Blicks. Svetlana und Ludmilla schlagen sich vor Lachen die Schenkel, während meine Mutter mir mit fälschlich rügendem Finger droht. Lorenzo und Esteban, Schüppe und Rechen in der Luft über ihrem Sandkuchen, beobachten offenen Mundes diese Entfesselung an Boshaftigkeit. Allein meine Großmutter starrt auf den Horizont – mit einem Ausdruck klarer Missbilligung, ohne dass jedoch gedeutet werden könnte, auf wen diese offensichtliche Missbilligung nun zielt, ob auf ihre schlüpfrige Enkelin oder ihre lautstarke Nachkommenschaft.
Man kann neunjährig zur Welt kommen: Der Beweis dafür bin ich. Man kann in der Demütigung und durch die Demütigung geboren werden, im Gefühl entweihter Intimität und verhöhnter Unschuld. In genau diesem Augenblick könnte ich zur Welt kommen. Die Pein ist stark genug, um die Loslösung von dieser physischen Linie zu beschleunigen, die zwischen das Meer und mich tritt: Svetlanas fette Hüften, Ludmillas gebräunte Wirbelsäule, und vor allem Gladys Bauch, ein noch immer erstklassiger Bauch, von mir aus, ein Bauch, dem wir alle fünf entstammen, o. k., und doch, unter dem erbarmungslosen Augustlicht erscheint er mir lasch, fahl und vor allem unerträglich nah, als stünde er noch immer offen, allzeit bereit, mich wieder aufzunehmen, bang bang, Kimberly ist auf dem Rückweg zur Einnistung zwischen Brustkorb und dürrem Gedärm ihrer Mutter, Kimberly im Aufbruch begriffen, zu neun nicht enden wollenden Monaten intraorganischen Lebens, nein!, mir zu Hilfe die Welle, die Gischt, das Azurblau, die frische Luft!
Ich erhebe mich, greife wie im Flug nach meiner Taucherbrille, ein Geschenk von Großvater Charlie, diesem Verräter, und ich renne aufs Meer zu, das man tänzeln sieht und unaufhörlich ans Ufer schlagen hört. Ich bin noch nicht geboren, nein, noch nicht, aber bald schon, bald, denn auf das Meer ist Verlass, wenn es gilt, Geburten zu begleiten, Übertretungen und heimliche Überschreitungen. Ich laufe, als hinge mein Leben davon ab, und vielleicht hängt es davon ab; ich laufe hinein in die Schaumkronen, die sich mir einem Ehrenspalier gleich auftun, einer Begrüßung gleich für diesen neuen Moment. Als mir das Wasser bis zum Nabel reicht, bleibe ich ruckartig stehen, richte den türkisfarbenen Gummiriemen, bringe die Brille in Position und springe in die Zusammenkunft mit der Welle. Sie nimmt mich auf, hält mich eine Weile lang zwischen zwei Wassern, schwebend, nirgendwo, glücklich, dann zieht sie davon, um weiter weg zu branden. Ich halte meine Tränen zurück, um meine Sicht nicht zu trüben, und schwimme kraftvoll ins Weite. Die abenteuerlustigsten unter den Schwimmern einmal hinter mir gelassen, drehe ich mich um und spiele toter Mann, starre in den Himmel durch das leicht beschlagene Glas – man möchte glauben, ich hätte mich nicht zurückhalten können zu weinen. Ich bin allein. Es ist nicht mehr das trügerische Gefühl von eben, als ich auf meiner Bastmatte lag, genussvoll vergessend die äußere Welt und nicht mehr gewahr der finsteren Wachsamkeit der Mutter. Jetzt, da gibt es nur mich, hin und her gewogen vom Seegang und geblendet von der im Zenit stehenden Sonne.
Das Wasser mit Füßen und Händen durchziehend, doch ohne die Sonne aus den Augen zu lassen oder meine ausgestreckte Haltung aufzugeben, beginne ich in die Tiefe vorzudringen, zum Sand, der sich einige Meter unter mir weich wellt. Und ganz egal, ob meine Trommelfelle platzen, ganz egal, ob meine Lungen explodieren. Auf das Meer ist Verlass, wenn es gilt, Schiffbrüche zu begleiten, das Verstreuen von Asche und die Zersetzung von Leichen. Egal, ob ich sterbe: zu leben interessiert mich ohnehin nicht.
Aufgewirbelt durch mein Eintauchen, entflieht ein Schwarm großer Blasen hin zur freien Luft, um an ihr ebenso eilig zu zerplatzen, wie ich den Grund erreichen will. Ist es das leichte Strudeln der Blasen, diese so wundersame, da kaum wahrnehmbare Berührung? Ist es das Meer, wie es sich mir darbietet, das Meer, erstmals von unten gesehen, die andere Seite des Spiegels, dieses silbrig wogende Verschlussorgan, hier und da von Falten durchzogen wie die mächtige Haut eines Fabelwesens? Zu sterben habe ich jetzt keine Lust mehr und ich, auch ich, steige wieder hinauf, die Oberfläche zu durchstoßen, ich öffne den Mund, weit, damit Wind einfahre, salziges Wasser, das Leben, so wie ich es mir von nun an ausmalen kann. Schluss mit der Fügsamkeit gegenüber den von Dritten erlassenen Gesetzen. Schluss mit der programmierten und unausweichlichen Weiblichkeit. Schluss mit der Liebe, die zum Schlimmsten führt.
Das Ufer erreiche ich sorgsam kraulend, Bewegungsabläufe wie im Schwimmbad, die Atmung erst auf der einen Seite, dann auf der anderen. Als ich wieder Boden unter den Füßen habe, ziehe ich die Taucherbrille über die Stirn und werfe einen Blick hin zu jener Stelle des Strandes, die meine vielköpfige Familie besetzt. Gladys ist noch immer damit beschäftigt, verliebt mit ihren Töchtern zu schäkern, während sie Großmutter Claudette die Aufgabe überlässt, den Inhalt unserer Kühlboxen auszupacken – niemals weniger als zwei, um diese hübsche Menge Menschen zu ernähren. Tupperware voller Salade niçoise, Sandwiches mit Omelette, Pissaladières, Flaschen gut gekühlten Rosés, schon geschnittene Wassermelone und Ananaskuchen, saftig und sättigend: nichts von dem fehlt, was für gewöhnlich unser Picknick auszeichnet.
Noch reicht mir das Wasser bis zur halben Höhe der Waden, was mich aber nicht daran hindert, kraftvoll auf den Sand zu treten und an den Sohlen meiner Füße seine Zartheit zu spüren, während meine Schienbeine die Welle in einer Weise spalten, von der ich hoffe, dass sie männlich wirkt. Anstatt mich sofort zu den Meinen zu gesellen, ziehe ich den Strand entlang und sinniere über meine Rückkehr auf die Bühne nach dem sensationellen Abgang von vorhin, und Pech, ich stoße gegen den Bauch von Großvater Charlie, der, auch er, die Nase im Wind, die Arme hinterm Rücken verschränkt, das Ufer abschreitet.
– Sieh an, sieh an, wen haben wir denn da?
Er lässt liebevoll seine große Pranke auf meiner Schulter landen, zu vergessen aber, dass auch er sich lustig gemacht hat über mich, dass auch er ins Lachen der anderen mit eingestimmt hat, kommt gar nicht infrage. Ich drehe eine Pirouette, klar entschlossen, ihm zu entwischen, ihm wie allen anderen auch. Schluss mit der Liebe. Hopp, und wieder laufe ich, in großen Sprüngen, denen die Federkraft des Sandes eine märchenhafte Weite verleiht, als trüge ich Siebenmeilenstiefel – nur, dass ich barfüßig bin, und so ist es noch viel besser. Zunächst verblüfft, fängt sich Großvater Charlie, um ein schrill tönendes und befehlendes Pfeifen auszustoßen. Kommt jedoch nicht infrage, dass ich gehorche: Schluss mit der Fügsamkeit. Ich renne mit Karacho auf ein noch unbestimmtes Ziel zu, die Felsenreihe, die den Strand säumt, vielleicht, oder die kleinen Steinstufen, die den Zugang zur Straße ermöglichen. Man wird mich nicht einfangen. Zumal ein erneuter Seitenblick auf meine vielköpfige Familie mir erlaubt hat festzustellen, dass mein Vater seine Mittagspause dazu genutzt hat, zu uns zu stoßen. Kein Zweifel, dass der kleine Zwischenfall von eben ihm gepetzt werden wird in episch breiten Schilderungen, die es ihm ermöglichen, Teil der Legende zu werden, mir jedoch einbrocken, dass ich ihn mir bei jeder sich bietenden Gelegenheit wieder anhören muss, und zwar Mal um Mal für mich erniedrigender, je älter ich sein werde.
Ich erreiche die Felsen, eine faszinierende Verflechtung von Gestein in geglätteten Formen mit lauwarmen Lachen. Das ist mein Königreich. Jede einzelne mit Algen überwucherte Vertiefung darin kenne ich, jeden noch so kleinen Bewohner: die dicken scharlachroten Kirschen der Seeanemonen, die flinken Krebse, die jadegrünen Seeigel und die Grundeln, denen ich auf die Gefahr hin, mir den Rücken zu verbrennen, stundenlang mit meinem Eimer nachstelle. Nur, dass ich eben anders als der arme Lorenzo und trotz meiner Blondheit in Hülle und Fülle Melanin besitze.
Ich lasse den geschützten Teil meines Reviers hinter mir und mich am Bug nieder, wo die Wellen, während sie zerbersten, mir schaufelweise Schaum ins Gesicht schleudern. Oberhalb von mir schwebt eine Möwe, schlägt mit den Flügeln und nutzt die Luftströme, um sich an selber Stelle zu halten, spähend vielleicht nach einem kleinen, zwischen den Felsen gefangenen Fisch. Ich selbst bin ein Fisch, der darum fleht, dass er ausgenommen werde, und der zugleich weiß, dass das Messer, das ihn seiner stinkenden Eingeweide entledigen wird, mit nämlichem Stich auch tötet. Egal. Falls sich eine Chance zu laufen auftut, bin ich bereit; falls sich eine Möglichkeit eröffnet, dass ich den Lauf meines Lebens wiederaufnehmen kann, wenn auch ein für alle Mal ausgeweidet und meiner lebenswichtigen Organe beraubt, dann meinetwegen. Man kann neunjährig zur Welt kommen – ich tue es. Und ist erst diese zweite Geburt, die die erste aufhebt, vollbracht, kehre ich seelenruhig zu den Meinen zurück, die nicht mehr die Meinen sind. Ich kassiere ihre Sarkasmen ohne mit der Wimper zu zucken, wohl wissend, dass ich nicht mehr ihr Mädchen bin, dass ich überhaupt kein Mädchen mehr bin. Dies ist mein erster Vorsatz und ich spute mich, ihn einzuhalten. Ich plustere die Brust, setze eine harte Miene auf, überzeugt davon, den gesamten Strand mit meinem kurzen Haar und meinen marineblauen Lycrashorts hinsichtlich meiner sexuellen Identität hinters Licht führen zu können.
Meine Mutter spürt genau, dass ihrem Verstand sowie ihrer Kontrolle gerade etwas entgleitet, und so schimpft sie mich während des gesamten Picknicks aus, mal liebevoll, mal streitsüchtig. Charlie, sonst immer so impulsiv, grummelt bezüglich meiner Person unverständliche Sätze – seine Antennen, wie auch die seiner Tochter, müssen ihn wohl über meine emanzipatorischen Anwandlungen in Kenntnis gesetzt haben. Mein Vater bringt kein Wort hervor und begnügt sich damit, im Angesicht des Meeres verträumt seinen Wein zu schlürfen. Claudette trinkt ihrerseits, ihr Blick ist bitter und fest, doch wird sie ebenso wenig wie ihr Schwiegersohn den Mund öffnen.
Den Mund, den öffnet meine Mutter für zwei, für drei, für alle Welt im Grunde genommen; verdrehter und schwarzer Mund unter der Sonne, Mund einer von sich selbst berauschten Prophetin, während alle anderen zur Trunkenheit Alkohol benötigen: Rosé de Bandol für Claudette und Patrick, Ricard für Charlie, der sich nach einer bewegten belgischen Jugend rasch an die südfranzösischen Sitten gewöhnt hat.
4. ALLES ÜBER CHARLIE
Ich konnte neunjährig noch so sehr das Ende der Liebe ausrufen, Charlie habe ich bis vor Kurzem weiterhin geliebt. Gut möglich, dass ich ihn sogar heute noch liebe, jetzt, da ich zwanzig bin, und mir, was ihn betrifft, definitiv die Augen geöffnet sind, doch ziehe ich es vor, dieser erschreckenden Vorstellung nicht allzu sehr nachzugehen, die Bände spricht über die Logik meines Fühlens.
Ich habe ihn umso mehr geliebt, als ich ihm persönlich zugedacht war, schon von frühester Kindheit an kraft eines dunklen Zuordnungsmechanismus, wie man ihn aus den besten Familien kennt, und die meine zählte eher zu den schlimmsten. So hatte meine Mutter eher Svetlana, während Claudette sich um die Jungs kümmerte und mein Vater sich auf Ludmilla stürzte. Im Gegensatz zu vielen Müttern, die eine schamlose Vorliebe für ihre Söhne zeigen, hat sich die meine nie um Lorenzo und Esteban gesorgt, als hätte sie diese versehentlich ausgebrütet und würde sich nun ab und an nach ihnen umdrehen, um sie überrascht anzustarren: »Ei, ei, zu wem gehören denn diese kleinen Buben?« Ich habe die Gleichgültigkeit, in der die beiden aufwuchsen, stets voller Neid wahrgenommen, und diese Wahrnehmung war meinen Ideen einer Geschlechtsumwandlung niemals wirklich fremd. Ein Junge zu sein barg ganz klar weniger Risiken.
Wäre ihre Großmutter nicht gewesen, Lorenzo und Esteban wären wohl an Liebesmangel gestorben, es sei denn, Hungertod und Fenstersturz hätten sich zuvor schon ihre Haut geholt. Meine Mutter stand immer in vorderster Reihe, wenn es galt, ihre Schönheit und Intelligenz zu rühmen, aber nachts stand sie für die beiden nicht auf, und überließ ihrer eigenen Mutter die Aufgabe, ihnen die Flasche zu geben, ihnen die Windeln zu wechseln. Unglücklicherweise war Großmutter Claudette immer wieder plötzlichen Wachsamkeitsausfällen unterworfen, die sie in einen beinahe katatonischen Zustand versetzten, ein verstörter Zombie im Reich der Lebenden, was zur Folge hatte, dass es kein seltener Anblick war, meine kleinen Brüder in ihren von Pisse beschwerten Windeln hinter ihr her taumeln zu sehen, wimmernd und mit ausgestreckten Ärmchen, bis sich schließlich jemand ihrer erbarmte. Ich beteure bei meiner Ehre, dass ich schon mit neun, kraft meiner kurz zuvor erst und grausam erworbenen Weisheit, für meine Brüder eine beispielhafte Mutter war, aber klar, es war zu spät, die beiden hatten sich bereits angewöhnt, nichts zu sein.
Von der Tragödie, nichts zu sein, werde ich sprechen, sobald ich mit Charlie durch bin, meinem wallonischen Großvater, der für uns, die wir zwischen den Departements Var und Bouches-du-Rhône aufgewachsenen sind, so exotisch war, so sprühend an der Seite seiner kleinen, stummen Gattin, die ihrerseits viel zu häufig verloren war in ihren düsteren Wäldern – wenn sie nicht gerade damit beschäftigt war, zu kochen, aufzuräumen, zu fegen, zu schrubben, aber auch die Wäsche von neun Personen zu waschen, zu bügeln und einzusortieren.
Meine Mutter hatte ihre Eltern nie verlassen wollen. Weder ihre Hochzeit noch die Geburt ihrer eigenen Kinder haben rütteln können an ihrem festen Entschluss, bei Claudette und Charlie zu leben, in einem Familienhaus, das tatsächlich groß genug war und von einem Garten gesäumt, der in allem einer wilden Müllkippe glich, mit seinen unebenen Trockenmauern, seinen verlassenen Kaninchenställen, seinen Sandhaufen und dem Bauschutt, seinen Büschen grauen Lavendels, seinem schlecht gepflegten Gemüsegarten, seinen Mandelbäumen, seiner Kiefer, seinem Aprikosenbaum, seinem wuchernden Feigenbaum, seinen zerbrochenen Steinplatten und seinen wilden Gräsern. Ich spreche von ihm in der Vergangenheit, doch gibt es den Garten noch immer und er hat als solcher unsere unzähligen Landschaftsplanungsprojekte überdauert, von Blumenbeeten über geradlinige Pflanzungen bis hin zu Zierteichen. Mit aufgegebenen Familienprojekten kenne ich mich ebenfalls aus.
Mein Vater hat sich der Vorstellung eines dauerhaften Zusammenlebens mit seinen Schwiegereltern nie widersetzt; dazu aber muss man wissen, dass er nie irgendwelche Einwände hat, und wenn, dann selten. Es kommt ihm sehr zupass, dass jemand für ihn entscheidet, vor allem, wenn die Entscheidungen von Gladys oder Charlie getroffen werden, deren Wünsche bei uns stets Gesetzeskraft besessen haben. Und wenn ich es genau bedenke, dann sind sie vielleicht die einzigen, die welche haben, Wünsche meine ich – und dann geschieht es den anderen nur recht, den Entschlussunfähigen, den Passiven, hier eben Patrick und Claudette.
Ich war also der kleine Liebling von Großvater Charlie. Ganz früh schon. Sobald klar war, dass ich ihm glich, dass ich seine hellen Augen habe, seine septentrionale Blondheit, ganz zu schweigen von der Körpergröße, von der ich zugeben muss, dass sie uns von allen anderen Familienmitgliedern klar abhebt, Esteban ausgenommen, der seinerseits die besten Voraussetzungen hat, eher als Meuriant durchzugehen, der belgische Zweig, denn als ein Vidal oder Chastaing. Merkwürdigerweise kam nie jemand meiner Angehörigen auf die Idee, dass ich vor allem nach meinem Vater komme, auch er blond und blauäugig. Vielleicht, weil mein Vater ein Winzling, ich aber eine Bohnenstange.
Kurzum, Charlie hat das Verdienst meiner Schönheit, oder was als solche für die nicht gerade aufmerksam schauenden Leute durchgeht, stets für sich reklamiert – und umso besser für mich, wenn niemandem auffällt, dass an mir nichts Außergewöhnliches ist, ist doch der Mangel an Geschmack die meistgeteilte Sache der Welt. In Wirklichkeit habe ich die Augen meines Vaters, offen, klar und leicht spitz auf die Schläfen zulaufend; ich habe seine Nase, deren Reize ich bereits gerühmt habe; ich habe seinen großzügigen Mund, und die Reihung seiner Zähne. Bis auf meine Statur schulde ich Charlie nichts, aber alle Welt gefällt sich darin, das Gegenteil zu behaupten.
Zu Belgien habe ich das gleiche privilegierte Verhältnis gehabt wie zu meinem Großvater. Stets stießen wir ins gleiche Horn, wenn es galt, seine Verdienste zu rühmen und die allzu spröden Reize der Provence zu verunglimpfen. Ich erinnere meine erste Reise nach Brügge, ein Geschenk von Charlie zu meinem Geburtstag, als ein immerwährendes Märchenspiel. Bei unserer Ankunft lag die Stadt unter Schnee begraben – Schnee, von dem ich siebenjährig nichts anderes kannte als die kümmerlichen, schnell zu Matsch verwässerten Flocken auf den Bürgersteigen meiner Heimatstadt. Die Atmosphäre war gedämpft, still und verzaubert. Ich schritt dahin, stumm vor Verzückung und geklammert an die Hand meines Großvaters. Die Straßen dufteten nach Pralinen und Waffeln – aber jene brennend heiße, mit luftiger Sahne überzogene zu essen, die mir Charlie gekauft hatte, dazu war ich nicht fähig, so überwältigt war ich von Glückseligkeit und dem Gefühl, etwas Einmaliges zu erleben.
Wir durchschritten den Markt und bewunderten von seinem Belfried aus die derart naiv bemalten Häuser, dass Charlie mich mühelos davon überzeugen konnte, sie seien aus Zucker und Pfefferkuchen gemacht; mein Hochgefühl jedoch kannte keine Grenzen mehr, als auf dem schlafenden Wasser des Sees zwei schwarze Schwäne ihre Schnäbel vereinten und vor unseren Augen ein Herz bildeten, das nur umso anmutiger war, als es sich prompt wieder auflöste und mir die Erinnerung an einen Traum vermachte.
Charlie, an meiner Seite, plusterte sich auf. Er konnte noch so sehr gebürtiger Lütticher sein, Brügge betrachtete er als sein persönliches Erbe, genau wie unsere Pseudo-Ähnlichkeit auch.
Eines seiner Geheimnisse zum Glück liegt bei Charlie exakt in seiner Fähigkeit, alles auf sich zu beziehen und für alles und jedes Besitzurkunden geltend zu machen, was sich einzuverleiben ihm würdig erscheint. Als Beweis dafür möchte ich das fetischistische Verhältnis vorbringen, das er mit seinem Vornamen pflegt, sein Entzücken, Charles zu heißen, und nicht etwa Gérard, Jean-Pierre oder Daniel. Meine ganze Kindheit über habe ich ihn von Karl dem Großen, Charles von England oder Charlie Chaplin sprechen hören, als handelte es sich um einen ebenso erlauchten wie selektiven Club, dessen rechtmäßiges Mitglied er allein aufgrund seiner Homonymie wäre. Höchst unfreiwillig habe ich ihm an jenem Tag eine Riesenfreude bereitet, als ich ihm mein Heft für Gedichte mit Verve auf den Schoß drückte:
– Kannst du mich abhören?
Meine Mutter hatte mit ungeduldiger Geste abgelehnt, Svetlana hatte mich ausgelacht, und Claudette hatte sich in die Zubereitung einer Schakschuka gestürzt. Er aber hat seine Brille und einen gelehrten Blick aufgesetzt, um das Gedicht von Baudelaire, das ich sorgfältig in Schönschrift abgeschrieben hatte, unter die Lupe zu nehmen:
– Schieß los. Ich bin ganz Ohr.
– »Die Katzen«, von Charles Baudelaire
Die toll Verliebten und die strengen Weisen
Verehren beide …
Das Ende des zweiten Alexandriners hat er erst gar nicht abgewartet, um sich mit begeisterter Neugierde zu erkundigen:
– Charles Baudelaire?
– Ja klar.
– Kennst Du ihn?
– Er ist sehr berühmt, hat die Lehrerin gesagt.
– Ahh … ha, das wundert mich nicht!
– Hörst du mich ab?
Mein Großvater hörte mir nicht mehr zu, ganz und gar davon erfüllt, sich buchstäblich die Hände zu reiben und sich zu beglückwünschen, dass da ein weiterer Charles aufgetaucht war, um sich in sein kleines Pantheon einzugliedern.
– Was hat er geschrieben?
– Er hat »Die Katzen« geschrieben.
– Ach so, und das ist alles?
– Hörst du mich ab?
– Charles Baudelaire … Nie gehört. Bist du dir sicher, dass man ihn kennt?
Kampfesmüde nahm ich ihm das Heft mit den Gedichten wieder weg, mein Lieblingsheft, mit seinem rosarauen Umschlag, seinen abwechselnd karierten und rein weißen Blättern, auf denen es mir eine Herzensangelegenheit war, ein ganzes Florilegium zu illustrieren, das aus der Mode gekommen, in den Schulen Frankreichs zu Beginn des Jahrtausends aber noch seine Gültigkeit besaß: Maurice Carême, Paul Fort, Rosemonde Gérard … Bei Baudelaire ahnte ich erstmals, dass Dichtung nicht unbedingt eitel und kitschig sein muss. Mein Vater war gerade nach Hause gekommen, und so war er es, dem ich das vollständige Sonett bis zum Schluss mit »feinem goldenen Sand« und »rätselvollen Auges Glühen« rezitierte, was mir einen Schauer der Erregung und Unruhe über den Rücken jagte.
Charlie durchforstete fieberhaft das Lexikon. Er würde nicht lange brauchen, um ein Experte für Internetrecherche zu werden, für den Augenblick aber musste er sich mit dem zweiten Band des Robert begnügen – ein zerfleddertes Exemplar, dem der Einband fehlte. An jenem Tag, als ich das erste Mal auf Armes Belgien! stieß, da dachte ich an ihn, ich hatte ihn wieder vor Augen, wie er das einem Charles gewidmete Vorwort entzifferte, mit welchem er, abgesehen vom Vornamen und Dandyismus, doch so wenig gemein hatte. Und ich würde das Thema meines Großvaters nicht vollständig erschöpft haben, wenn ich nicht auch das seines Kleidungsstils anschnitte.
Ganz im Gegensatz zum Rest der Familie, der sich durch eine schludrige Art und einen ausgeprägten Geschmack für Sportbekleidung auszeichnet, geht er ausschließlich in Samt- oder Tweedanzügen vor die Tür, zu denen er zitronengelbe Pullover trägt, rostfarbene, himmelblaue, bordeauxrote oder nilgrüne Westen – ganz abgesehen von den Krawatten, wie ich sie an sonst niemandem gesehen habe, wahrhafte Kunstwerke semifigurativer Natur, in zarten Aquarelltönen gehalten und sorgfältig mit seinem Aufzug abgestimmt.
Heute, in seinen Siebzigern, sieht er noch immer gut aus, hat beinahe nichts von seiner hohen Statur eingebüßt, trägt einen Kurzhaarschnitt bei der Pracht, die ihm noch bleibt, und lässt sich einen dünnen Schnauzer stehen. Von Baudelaire kennt er allein die ersten achtzehn Silben der »Katzen«, was ihn aber nicht daran hindert, diesen bei jeder Gelegenheit als außergewöhnlichen Dichter zu zitieren, als einen weiteren dieser Charles, denen ob ihres Vornamens ein glorreiches Schicksal verheißen ward. Der schändliche Tod Baudelaires ist ihm entgangen, wie ihm auch die bittere Geringschätzung entgangen ist, die der Dichter Belgien gegenüber stets verlauten ließ. Und hätte er je über diese beiden Informationen verfügt, er hätte sie umgehend zensiert, hopp, hopp, ab in die Versenkung mit der Hirnerweichung, dem crénom, dem schmerzhaften Todeskampf; ab in die Versenkung mit dem hämisch lachenden Pamphlet.
Ein weiteres seiner Geheimnisse zum Glück liegt bei Charlie in seiner selektiven Ignoranz, die von den anderen Mitgliedern meiner Familie ebenfalls praktiziert wird. So wird man verstehen, dass es mein zweiter Vorsatz war, Wissen anzuhäufen, das es mir ersparen würde, die Existenz mit ihrer schuldbeladenen Verblendung und ungenierten Heiterkeit zu durchschreiten. Nichts wollte ich von ihrer Heiterkeit, ich, ich wollte lieber Charles Baudelaire sein als Charles Meuriant; ich wollte hellsichtig sein, dunkel, gemartert und schließlich genial, auf die Gefahr hin, das Ende meiner Tage im Hotel Du Grand-Miroir zu fristen – schließlich lag dieses in Brüssel, und meine Liebe zu Belgien hat, im Gegensatz zu derjenigen, die mein belgischer Großvater in mir hervorrief, niemals nachgelassen.
Die Liebe zur Wahrheit zwingt mich zur Klarstellung, dass Baudelaire weder in Namur noch in Brüssel gestorben ist, und erst recht nicht im Hotel du Grand-Miroir, was für Belgien zwar bedauerlich, noch bedauerlicher aber für die Dichtung ist. Was Charlie betrifft, so wird er uns alle überleben, hat man doch, um die Lebenserwartung zu steigern, noch nichts Besseres entdeckt als die Eitelkeit.
5. NICHT WEITER SCHLIMM
Eines Tages fiel mir das einzige Foto, das von meiner Mutter aus der Zeit noch vor ihren Operationen stammt, in die Hände. Einige Monate alt, mit einem Stoffhütchen bedeckt, ist sie abgelichtet auf dem Arm ihres Vaters, von dem nur der furchtlose Nacken und Hinterkopf zu sehen sind. Sie klammert sich mit einer Hand an Charlies Schulter fest und streckt ihre andere dem Fotografen entgegen, bei dem es sich wahrscheinlich um Claudette handelt. Das Objektiv hat ihren Ausdruck heiterer Überraschung und kindlichen Begehrens gut eingefangen. Wahrscheinlich versucht sie, den Apparat zu berühren, oder will aus dem Arm ihres Vaters auf denjenigen ihrer Mutter. Es ist ein klassisches Foto, eines, wie es alle jungen Eltern von ihren Babys schießen. Ich glaube übrigens, in unserem Familienalbum ähnliche gesehen zu haben: Svetlana oder Lorenzo, mit dem gleichen lachenden Ausdruck und der gleichen den ganzen winzigen Körper durchziehenden Anspannung, über der Schulter von Maman oder Papa.
Was Gladys betrifft, so war’s das dann auch mit dem Klassischen, denn der Rest ist abscheulich: die Nase grotesk, auf der einen Seite platt und wie aufgerissen auf der anderen, nach oben, zu den fleischrosigen Nasenschleimhäuten hin, offen, während die Oberlippe beiderseits der Spalte kleine, wulstige Lappen bildet, die großflächig den Blick auf das gleichfalls chirurgisch rosige Zahnfleisch freigeben – aber wenn der Gladyssche Mund auch nichts von einem Mund hat, so ist ihr Lachen doch ein wahrhaftes Lachen, ein Babylachen, das auf wundersame Weise beim Betrachter Zuneigung und Freude zu bewirken vermag.
Dieses Foto findet sich in keinem unserer Alben. Claudette hat es in einem Karton zusammen mit anderen älteren Fotos verstaut, die sie als Kind zeigen, in den Straßen von Algier, im Garten des Hauses in Kouba, oder auch gemeinsam mit ihren Brüdern am Strand von Sidi Fredj. Es sind kleine Fotos, schwarz-weiß, mit gezackten Rändern. Andere, in anderem Format und auf dickerem Papier, wurden in einem Fotostudio aufgenommen, dessen Adresse rückseitig auf einem Etikett zu lesen ist. Auf ihnen ist Claudette als Baby abgelichtet, auf einer Tierhaut liegend, von der sich ihre feisten Pobäckchen abheben; Claudette, größer dann, artig auf den Knien meiner Urgroßmutter; Claudette und ihre Brüder, im Sonntagsstaat und Hand in Hand; Claudette zur Erstkommunion, Claudette mit zwanzig über eine Reling des Schiffs gelehnt, das sie fortbringt nach Marseille und endgültig ihrer Kindheit und wahrscheinlich auch dem Glück entreißt.
Ich verschließe den Karton über den sepiafarbenen Erinnerungen meiner Großmutter wieder, Erinnerungen, über die sie nur wenig spricht, im Gegensatz zu Charlie, der stets sehr geschwätzig ist ob seiner Lütticher Kindheit, seines Wehrdienstes oder seiner ersten Schritte ins Berufsleben. Ich verschließe den Karton in der Hoffnung, dass Gesten, so schlicht wie diese, existieren, um das Vergessen mechanisch in Gang zu bringen. Ich muss nicht gerade wissen, wie meine Mutter in ihren ersten eineinhalb Jahren aussah; muss auch nicht wissen, worüber meine Großmutter auf immer untröstlich ist. Ich habe schon genug mit meinen eigenen Erinnerungen zu schaffen, den wahren wie den falschen, bunt miteinander vermengt, den Erinnerungen aus Träumen, den Träumen aus Erinnerungen, den geborgten Erinnerungen, den retrospektiven Hirngespinsten, dem märchenhaften Schreiten zwischen schwarzen Schwänen und Kandiszuckerhäuschen; der ersten Geburt unter dem unerbittlichen Neonlicht einer Klinik in Marseille und der zweiten inmitten von Sand und Schaum. Ich bin zwölf Jahre alt. Vor drei Jahren schon habe ich Schluss gemacht mit der Liebe, doch nun kommt sie mir wieder hoch, gleich einem üblen Kloß im Halse. Eine Sache ist es, gegen seine Familie in den Krieg zu ziehen, eine andere aber, zu fühlen, in welchem Maße alles