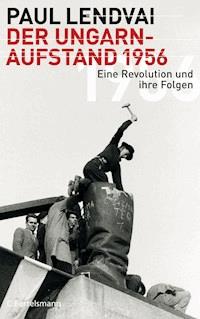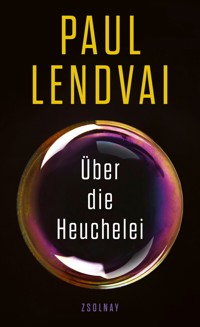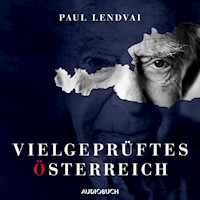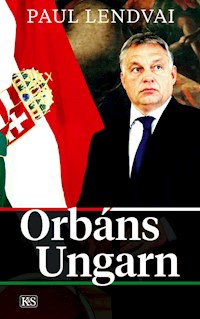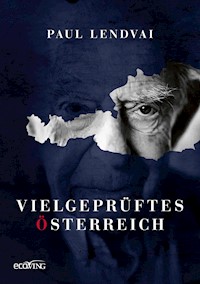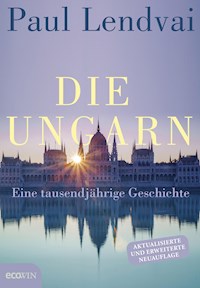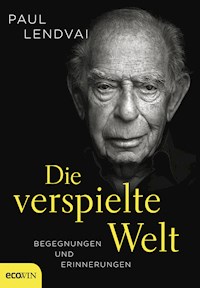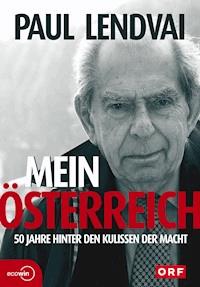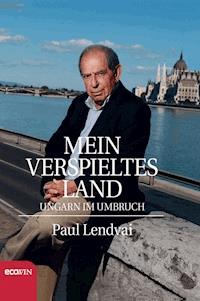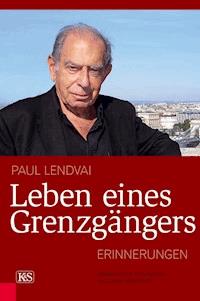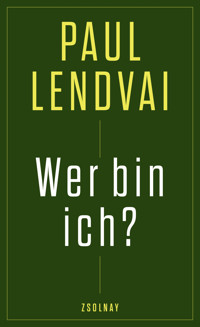
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der große Journalist Paul Lendvai als Zeuge des Jahrhunderts Der 95-jährige Paul Lendvai ist Österreicher, Ungar, Jude und Europäer: Was bestimmt seine Identität? Geboren in Budapest, überlebte er nur knapp den Holocaust. 1953 wurde er als »Trotzkist« inhaftiert und danach mit Berufsverbot belegt, 1957 gelang ihm die Flucht nach Österreich. Hier fand er eine neue Heimat, hier wurde er zum international tätigen Journalisten. In seinem neuen Buch verknüpft er Biografisches mit Analytischem, heimische mit europäischer Politik. Trotz aller Kritik an Viktor Orbán ist er mit Ungarn eng verbunden. Und seit der Antisemitismus weltweit zunimmt, fühlt er sich stärker denn je als Teil der jüdischen Schicksalsgemeinschaft. In seinen Schilderungen wird deutlich: Identität besteht aus vielen Facetten, zusammen bilden sie das Wesen des Menschen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 126
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Der 95-jährige Paul Lendvai ist Österreicher, Ungar, Jude und Europäer: Was bestimmt seine Identität? Geboren in Budapest, überlebte er nur knapp den Holocaust. 1953 wurde er als »Trotzkist« inhaftiert und danach mit Berufsverbot belegt, 1957 gelang ihm die Flucht nach Österreich. Hier fand er eine neue Heimat, hier wurde er zum international tätigen Journalisten. In seinem neuen Buch verknüpft er Biografisches mit Analytischem, heimische mit europäischer Politik. Trotz aller Kritik an Viktor Orbán ist er mit Ungarn eng verbunden. Und seit der Antisemitismus weltweit zunimmt, fühlt er sich stärker denn je als Teil der jüdischen Schicksalsgemeinschaft. In seinen Schilderungen wird deutlich: Identität besteht aus vielen Facetten, zusammen bilden sie das Wesen des Menschen.
Paul Lendvai
Wer bin ich?
Über die Identität
Paul Zsolnay Verlag
Das Leben kann nur in der Schau nach rückwärts verstanden, aber nur in der Schau nach vorwärts gelebt werden.
Søren Kierkegaard
Einleitung
Die Debatten über Migranten und Flüchtlinge und ihre Integration in den Aufnahmeländern, über das Verhältnis zwischen der Heimat und dem Fremden sind die Folgen der politischen, wirtschaftlichen und kommunikativen Globalisierung. Diese kann man allein durch den Nationalstaat nicht steuern, sondern nur durch konsequente und glaubhafte internationale Zusammenarbeit allmählich und oft nur zeitweilig unter Kontrolle bringen. Krieg und Verfolgung, Armut und die Sehnsucht nach einem besseren Leben treiben viele Menschen weltweit auf den schwierigen Weg der Flucht und Auswanderung, auf ein Rennen weg von ihrer angestammten Heimat. Die Triebkraft dieses Rennens hat schon Franz Kafka, wie so vieles in der menschlichen Gesellschaft, an einem Beispiel überzeugend veranschaulicht:
»Ich befahl, mein Pferd aus dem Stall zu holen. Der Diener verstand mich nicht. Ich ging selbst in den Stall, sattelte mein Pferd und bestieg es. In der Ferne hörte ich eine Trompete blasen, ich fragte ihn, was das bedeute. Er wusste nichts und hatte nichts gehört. Beim Tore hielt er mich auf und fragte: ›Wohin reitest du, Herr?‹ ›Ich weiß es nicht‹, sagte ich, ›nur weg von hier, nur weg von hier. Immerfort weg von hier, nur so kann ich mein Ziel erreichen.‹ ›Du kennst also dein Ziel‹, fragte er. ›Ja‹, antwortete ich, ›ich sagte es doch: Weg von hier — das ist mein Ziel.‹«1
So würde wohl die ehrliche Antwort der Tausenden und Abertausenden Menschen lauten, die, von verzweifelter Sehnsucht nach dem reichen Westen getrieben, die italienischen, griechischen oder spanischen Inseln erreichen.
Dank der langen Reihe unvorhergesehener Wendungen des Schicksals gehörte auch ich im Alter von siebenundzwanzig Jahren zu jenen, die das Ziel ihres künftigen Lebens im »weg von hier« gesehen haben, in diesem Fall weg von der Diktatur in Ungarn. Erst später folgte das Bedürfnis, dazuzugehören und nicht nur dem Pass nach, sondern auch gefühlsmäßig, ein Österreicher zu werden. Der Zugewanderte ist der Fremde, »der heute kommt und morgen bleibt«, diese klassische Definition des Soziologen Georg Simmel trifft auch auf mich zu.
Österreich ist seit dem Zweiten Weltkrieg zu einem fast klassischen Einwanderungsland geworden. Im Jahr 1961 lebten hier nur einhunderttausend ausländische Staatsangehörige, was einem Anteil an der Gesamtbevölkerung von 1,4 Prozent entsprach. Bis Anfang 2024 stieg ihre Zahl auf 1,8 Millionen oder 19,7 Prozent. Diese zwei Zahlen sagen fast alles. Aber nur fast: Man muss auch, unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft, die Bevölkerung mit Migrationshintergrund berücksichtigen. Darunter versteht man Personen, deren beide Elternteile im Ausland geboren wurden. Anfang 2024 lebten fast 2,5 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Österreich, 27,2 Prozent der Gesamtbevölkerung. Von diesen wurden drei Viertel im Ausland geboren. Rund ein Viertel sind ihre in Österreich geborenen Nachkommen. Diese bezeichnet man in der Statistik als »zweite Zuwanderungsgeneration«.2
Ich gehöre also zur sogenannten ersten Generation mit Migrationshintergrund. Dass ich mich in Wien trotzdem zu Hause fühle, hängt wohl nur am Rande damit zusammen, dass fast jeder zweite Wiener zugewandert ist und jeder fünfte aus dem ehemaligen Jugoslawien stammt. In der Steiermark haben weniger als zwanzig Prozent der Bevölkerung einen Migrationshintergrund, und in Altaussee, meinem langjährigen zweiten Wohnsitz, dürfte der Anteil statistisch nicht einmal wahrnehmbar sein.
Dass die Integration der Zuwanderer, vor allem aus den nichteuropäischen Ländern, eine sehr schwierige Aufgabe ist, zeigen die Statistiken über die Sprachkenntnisse ausländischer Kinder in den Volksschulen und darüber, welche Sprache die Zugewanderten zu Hause und mit Freunden sprechen. Auch Faktoren wie das Zugehörigkeitsgefühl zu Österreich beziehungsweise zum Herkunftsland, die Schwierigkeiten im Zusammenleben von Österreichern und Migranten sowie die Erfahrungen mit Diskriminierung spielen eine große Rolle bei den Diskussionen über die Identität.
Es gibt aber auch Erfolgsgeschichten: Hier genügt es, auf den Werdegang von Bundespräsident Alexander Van der Bellen oder jenen der ehemaligen Justizministerin Alma Zadić hinzuweisen: Beide waren Flüchtlingskinder.3 Auf internationaler Ebene kann man als Beispiele für erfolgreiche Politiker mit Migrationshintergrund etwa den ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger nennen (er floh vor den Nazis aus Deutschland), oder den Sicherheitsberater von US-Präsident Jimmy Carter, Zbigniew Brzeziński (er kam aus Polen), Arnold Schwarzenegger, den ehemaligen Gouverneur von Kalifornien (aus Österreich), und den derzeitigen US-amerikanischen Außenminister Marco Rubio, dessen Eltern aus Kuba zugewandert sind. In einem tieferen Sinn spiegelt die Biografie von Angela Merkel den Übergang von einer ostdeutschen zu einer bundesdeutschen Identität. Den Weg von einer deutschen zu einer amerikanischen Identität gingen die Historiker Fritz Stern und Walter Laqueur, deren Erinnerungen von diesem schwierigen Prozess überschattet wurden, während das Leben von Lord George Weidenfeld und Lord Ralf Dahrendorf die erfolgreiche Bewältigung von mehrfachen Identitäten spiegelt.
Ist es nicht zu spät, im fortgeschrittenen Alter über meine Identitäten nachzudenken, zumal ich meine Erinnerungen schon vor rund dreißig Jahren erstmals niedergeschrieben habe?4 Gerade die politischen Veränderungen der vergangenen dreißig Jahre, international und auch in Österreich, überzeugten mich, die Suche nach meiner Identität zwischen Österreich und Ungarn, Judentum und Europa im Spiegel der jüngsten Ereignisse zu beschreiben. Die Erfahrungen, die ich gesammelt, erlebt und manchmal erlitten habe, sind — so hoffe ich — auch für die jüngeren Generationen nicht langweilig und vielleicht lehrreich. Für mich sind sie jedenfalls immer spannend gewesen.
Ein österreichischer Patriot mit ungarischem Akzent
Die ungarischen Flüchtlinge 1956
Der Sitzungssaal des Presseclubs Concordia war an diesem Vormittag des 11. November 1986 voll. Kein Wunder angesichts der leidenschaftlichen Polemiken um die Vergangenheit des kurz zuvor zum Bundespräsidenten gewählten Kurt Waldheim nicht nur in Österreich, sondern auch in der internationalen Öffentlichkeit. Doch diesmal ging es um etwas anderes: um die Folgen eines dramatischen Ereignisses, des Volksaufstandes in Ungarn im Oktober 1956. Unter dem Titel »Zeitzeugen — 30 Jahre danach« stellten sich acht ehemalige Flüchtlinge, inzwischen bekannte Persönlichkeiten, der österreichischen und ausländischen Presse, um dem Asylland Österreich, stellvertretend für fast zweihunderttausend, ihren Dank auszusprechen. Die Österreicher seien hilfsbereit und fröhlich, freundlich und frei von Fremdenhass gewesen, sagten sie alle übereinstimmend bei der Schilderung ihrer Erlebnisse im Spätherbst und Winter 1956 nach der blutigen Unterdrückung des Volksaufstandes durch die sowjetische Armee.
Der Journalist Stephan Vajda, der in die USA oder nach Schweden hätte gehen können, blieb aus einem bemerkenswerten Grund in Österreich: Nach den Erfahrungen in einer Diktatur sei er allergisch gegenüber all den Fragen gewesen, die auf den Konsulaten gestellt worden seien. Hingegen habe ihn die Fremdenpolizei in Wien nur gefragt, ob er an diesem Tag schon gegessen habe, ob er wisse, wo er am Abend schlafen werde, und ob er schon jenen Ausweis besitze, mit dem er die Straßenbahn gratis benützen könne. Es sei eben wirklich so, wie es Franz Grillparzer seinerzeit geschrieben habe. »Es ist ein gutes Land, glauben Sie mir!«
Der Schriftsteller György Sebestyén erzählte, wie er von Heimito von Doderer und Alexander Lernet-Holenia liebevoll unter die Fittiche genommen worden sei. »Du bist ein Ungar und deshalb ein Österreicher«, schärfte ihm Doderer ein. Auch der inzwischen zum Präsidenten der Versicherungsgruppe Erste Allgemeine Generali gewordene Karl Kornis und der Presse-Redakteur Peter Martos erinnerten sich an die Hilfsbereitschaft der Österreicher. Die Berichte über die Pressekonferenz betonten allerdings schon damals die bange und dort nicht ausgesprochene Frage: Wie wäre es heute? Würde die Aufnahme jetzt auch so herzlich sein? Und ist von jener moralischen Kraft, die es damals in der Politik der Zweiten Republik gab, überhaupt noch etwas vorhanden?1
Mein lebenslanger Freund Kurt Vorhofer (1929 bis 1995) schrieb damals in der Kleinen Zeitung auch im Sinne des obigen Doderer-Zitats, dass wir privilegiert seien, weil eben aus Ungarn stammend: »Die Magyaren sind das einzige Nachbarvolk, über das hierzulande nicht gewitzelt oder gar gehöhnt wird. Selbst im Zerrbild der Wiener Operette kommen die Ungarn als respektable Feschaks meist recht gut weg.« In einer Sondernummer der Zeitschrift Europäische Rundschau über Österreich-Ungarn im neuen Europa vertiefte der Politikwissenschaftler Norbert Leser zehn Jahre später die Analyse.2 Er hob die Gemeinsamkeiten der beiden Völker hervor, die trotz der Konflikte während der Doppelmonarchie und um den Zankapfel Burgenland in der Zwischenkriegszeit bestünden, sie seien nicht nur in nachbarlicher Nähe und verwandten geschichtlichen Erfahrungen begründet, sondern auch im Lebensstil und im Nationalcharakter — hier sei vor allem die besondere Affinität der Wiener und der Budapester zu nennen. Der Aufstand vom Oktober 1956 war »für Österreich und die Österreicher eine Bewährungsprobe der Menschlichkeit und eine Möglichkeit, die Dankbarkeit dafür, dass Österreich um so viel besser gefahren ist als Ungarn, den lebenden Ungarn zugutekommen zu lassen«, so Norbert Leser.
Wer erinnert sich heute, außer den überlebenden Großeltern, noch daran, was damals an den Grenzen nach der brutalen Niederschlagung des Aufstandes passierte? In den Wochen nach dem sowjetischen Großangriff gegen die revolutionäre Regierung Anfang November 1956 erlebte Österreich den gewaltigsten Flüchtlingsstrom seiner Geschichte. Immerhin waren im November 113.810, im Dezember 49.685 und im Januar 1957, nach der hermetischen Abriegelung der Grenze, noch 12.882 Männer und Frauen aus dem wieder geknebelten Nachbarland nach Österreich geflüchtet; dann nahm die Zahl der »Neuzugänge« rapide ab. Der Eiserne Vorhang war kaum mehr zu überwinden. Insgesamt betrug die Zahl der Flüchtlinge, einschließlich jener, die aus Jugoslawien nach Österreich kamen, fast zweihunderttausend.
Zweifellos war der Ungarn-Aufstand und dessen Niederschlagung durch die Sowjets auch ein politischer und psychologischer Wendepunkt in der österreichischen Nachkriegsgeschichte. Dass ein Land nach sieben Jahren »Anschluss« und Krieg, nach zehn Jahren Besetzung und so kurz nach dem Abzug der fremden Soldaten die ungarischen Flüchtlinge derart selbstverständlich, unerschrocken und großzügig aufnahm, blieb für eine ganze Generation prägend und hat nicht wenig zum Selbstverständnis der Zweiten Republik beigetragen. Hier bestand ein Volk seine historische Bewährungsprobe. Wie zahlreiche Freunde und Bekannte kann auch ich die Feststellung Norbert Lesers bestätigen: »Die Ungarn wurden in Österreich nicht als Fremdlinge und Einwanderer, sondern als getrennte Brüder und Schwestern, denen man wie Familienmitgliedern half und beistand, empfunden.« Niemand musste unter freiem Himmel schlafen oder Hunger leiden. Es war einmalig, was die Österreicher damals leisteten — von den improvisierten Lagern und spontanen Spendenaktionen bis zur Mobilisierung der Weltöffentlichkeit und der Staatengemeinschaft. Doch je länger die Flüchtlinge in Österreich blieben, umso mehr Spannungen gab es natürlich mit den Einheimischen, sowohl in den Lagern wegen des Wartens auf Auswanderung als auch infolge der Belastung der Infrastruktur.
Ich kann mich hier nicht mit dem Schein und Sein der gesamten Flüchtlingspolitik der Regierungen des letzten halben Jahrhunderts beschäftigen, sondern möchte nur meine persönlichen Eindrücke und meine damaligen Informationen von anderen Ungarnflüchtlingen wiedergeben. In »Mein Österreich« schrieb ich vor mehr als eineinhalb Jahrzehnten: »Für die Ungarnflüchtlinge, die aus der totalen Abkapselung aufgetaucht und in Österreich ohne Rücksicht auf Herkunft und Vergangenheit mit offenen Armen aufgenommen wurden, war Wien nicht bloß ein Schaufenster des Westens, sondern auch, ja vor allem, ein Leuchtturm der Freiheit, der Toleranz und der Menschlichkeit. Als mir Jahrzehnte später österreichische und erst recht ausländische Freunde zuweilen vorwarfen, ›du idealisierst noch immer das Land‹, musste ich häufig an diese unvergesslichen ersten Eindrücke denken. Die Flüchtlinge hatten damals das gute Österreich kennengelernt, wo die Menschen nicht nachforschten, wer was ist oder als was er gilt, sondern einfach halfen. Genau so übrigens wie 1968 den Tschechen und Slowaken, 1980/1981 den Polen, 1991 bis 1995 den Flüchtlingen aus dem zerfallenen Jugoslawien und 1999 den Kosovo-Albanern.«3
Mit diesen Sätzen von mir beginnt die Historikerin Sarah Knoll ihre massive Abrechnung mit der Heuchelei der offiziellen Asyl- und Flüchtlingspolitik Österreichs im Kalten Krieg.4 »Von Regierung, Medien, aber auch Hilfsorganisationen hervorgehoben, wurde [die Hilfsbereitschaft der Öffentlichkeit] eine zentrale Grundlage für das Bild vom humanitären Österreich«, was aber, so schreibt sie, auch zu »einer teilweisen Mystifizierung und Fehlinterpretation der Leistungen« beigetragen habe. In ihrer Studie betont sie, auch mit der detaillierten Darstellung der Geschichten der Flüchtlinge aus der Tschechoslowakei, aus Polen, der DDR und Rumänien, dass »die internationale Unterstützung bei der Versorgung, Integration und Weiterreise oft durch Öffentlichkeit oder Regierung ausgeblendet« werde.
Ich will nicht bestreiten, dass das offizielle Österreich von Anfang an und sogar zur Rechtfertigung der späteren Verhärtung samt Grenzkontrollen den zum Mythos gewordenen Begriff »Asylland« bewusst zur Schaffung und Stärkung eines positiven Images verwendet hat. Trotzdem will ich auch im Rückblick betonen, dass ich persönlich nie eine Spur von Fremdenhass oder Diskriminierung erfahren und von den mir bekannten Ungarn und Ungarinnen weder damals noch in den folgenden Jahren von erniedrigenden Erfahrungen gehört habe.
In dieser Hinsicht ist das zutiefst persönliche Bekenntnis des aus einer assimilierten jüdischen Familie stammenden einstigen Ministerialrates im Bundespressedienst, Peter Stiegnitz (1936 bis 2017), zu Österreich besonders erwähnenswert.5 Er widmete sein Buch »Österreich aus der Nähe«, geschrieben lange nach seiner Pensionierung, »Österreich, dem Land, das meinen Eltern und mir Freiheit und Sicherheit bot«. Er war als Zwanzigjähriger im November 1956 mit seiner Familie nach Österreich geflüchtet: »Seit unserer Flucht nach Österreich ist immerhin ein halbes Jahrhundert vergangen, und in dieser Zeit hörten wir niemals und nirgends ein ›Du bist nur ein Zugereister‹ […] Der wirkliche Grund der Nichtakzeptanz, der Ablehnung der ›Ausländer‹, liegt im Anpassungsunwillen, in der freiwilligen Ghettoisierung, in der Vorliebe für Parallelgesellschaften gewisser Zuwanderer.« Es würde den Rahmen dieser Darstellung sprengen, würde ich anfangen, alle mir bekannten ungarischen Erfolgsgeschichten aufzuzählen. Die große Aufnahmebereitschaft so vieler westlicher Staaten, die es in dieser Form danach nie mehr gegeben hat, war nicht nur das Resultat der verzweifelten Hilferufe der Regierung in Wien, sondern vor allem auch einem offensichtlichen Schuldgefühl der Regierungen der freien Welt geschuldet, dass sie in jenen Novembertagen kläglich versagt hatten. Die internationale Bewunderung für die Freiheitskämpfer, die freilich nur einen relativ kleinen Prozentsatz der geflüchteten Ungarn ausmachten, kam dank der einfühlsamen Berichterstattung der Auslandskorrespondenten praktisch allen Ungarnflüchtlingen direkt oder indirekt zugute. Entscheidend für die langfristige Aufnahmebereitschaft war die unglaublich schnelle, international organisierte Ausreise der Flüchtlinge.
Insgesamt reisten laut Zählung des Innenministeriums in knapp acht Wochen, vom 7. November bis 31. Dezember 1956, 93.148 Personen bereits weiter ins Ausland. Bis Ende 1958 verließen alle auswanderungswilligen Flüchtlinge Österreich, insgesamt 157.000 Menschen. Rund 12.000 kehrten nach Ungarn zurück. Am Ende blieb nur etwa jeder zehnte Ungarnflüchtling in Österreich.6
Ankommen in Österreich
Ich kann hier (wie übrigens auch hinsichtlich meiner Jugend in Ungarn) nur als Zeitzeuge, als Mitbetroffener sprechen und möchte den deutschen (Exil-)Schriftsteller Hans Sahl zitieren, der — wenn auch in anderem Zusammenhang — schrieb:
»Wir sind die Letzten.
Fragt uns aus.
Wir sind zuständig.«7