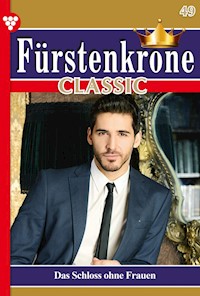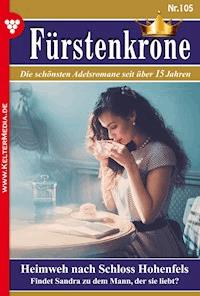Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fürstenkrone
- Sprache: Deutsch
In der völlig neuen Romanreihe "Fürstenkrone" kommt wirklich jeder auf seine Kosten, sowohl die Leserin der Adelsgeschichten als auch jene, die eigentlich die herzerwärmenden Mami-Storys bevorzugt. Romane aus dem Hochadel, die die Herzen der Leserinnen höherschlagen lassen. Wer möchte nicht wissen, welche geheimen Wünsche die Adelswelt bewegen? Die Leserschaft ist fasziniert und genießt "diese" Wirklichkeit. "Fürstenkrone" ist vom heutigen Romanmarkt nicht mehr wegzudenken. Vor ein paar hundert Jahren, als die Freiherrn von Vercello noch große, reiche Grundherren waren, bauten sie zur Ehre Gottes und für ihr Seelenheil, sowie das ihrer Leibeigenen, denen der Zugang zur Schloßkapelle natürlich nicht erlaubt war, eine wunderschöne Dorfkirche auf einen Teil des Schloßparks, den sie durch eine hohe Mauer vom übrigen Park abgrenzten, um nur nicht von den minderen Leuten belästigt zu werden. Selbstverständlich bauten sie die Kirche nicht selbst, sondern sie beauftragten die berühmten Brüder Asam, und die taten ihr Bestes, um ihre Auftraggeber zufrieden zu stellen. Die Kirche wurde der Heiligen Dreifaltigkeit geweiht, und man kann über sie in jedem Kunstführer nachlesen. Inzwischen waren die Freiherrn von Vercello nicht mehr reich und die Bauern keine Leibeigenen mehr. Ganz im Gegenteil: sie waren zumeist wohlhabender als der letzte Baron Vercello, der, ein charmanter Herr von fünfzig Jahren, sich nur mehr durch zwei Dinge auszeichnete: seine völlige Unfähigkeit, das Wenige, das ihm verblieben war, nutzbringend zu verwalten, und seine bildschöne Tochter Jolanda, kurz »Jo« genannt. Baron Oswald war durch die betrüblichen äußeren Umstände allerdings nicht merkbar belastet. Er belieh und verkaufte die paar Wiesen, die er noch besaß, ohne jede Hemmung und wartete voller Optimismus darauf, daß Jo eines Tages eine hervorragende Partie machen würde, welche den Vercelloschen Besitz wieder in altem Glanz erstrahlen ließ. Oder wenigstens schuldenfrei machte. Nun war es keineswegs so, daß Jo nicht schon lange hätte gut und passend verheiratet sein können. Die Schwierigkeit bestand darin, daß sie nicht wollte. »Ich verkaufe mich doch nicht!« erklärte sie hochmütig. Und Baron Oswald, der vor Jahren auch lieber die ebenso schöne wie arme Gräfin Susanne Hochburg geheiratet hatte, als die reiche, aber unansehnliche Komteß Langheim aus neuem Fabrikanten-Adel, verstand sie zwar, seufzte aber doch bekümmert, wenn sie ihm erzählte, wem sie eben wieder eine Abfuhr erteilt hatte. Der eine oder andere Bewerber hätte ihm gut gefallen, am besten aber gefiel ihm Graf Ludger Hochburg, ein entfernter Neffe seiner verstorbenen Gemahlin, die aus einer Nebenlinie dieses hochadeligen Geschlechtes gestammt hatte. »Stimmt, er ist wirklich nett, und ich mag ihn auch. Aber ich finde, daß das zum Heiraten nicht reicht!« Zum Glück zeichnete sich Ludger nicht nur durch ein fast unschätzbares Vermögen, eine blendende Erscheinung, eine beachtliche Intelligenz und einen bewundernswerten Humor aus, sondern auch durch eine überraschende Geduld, was sein Werben um die schöne, eigenwillige Jo anging. Und aus dieser Tatsache schöpfte Baron Oswald immer wieder neue Hoffnung. Die Zeiten, in denen ein eigener Benefiziat in der Schloßkapelle für die uradelige Herrschaft Messen gelesen hatte, waren längst vorbei.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 108
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fürstenkrone – 145–
Wer mit wem?
Vergnüglicher Roman um die Suche nach dem richtigen Mann
Jutta von Kampen
Vor ein paar hundert Jahren, als die Freiherrn von Vercello noch große, reiche Grundherren waren, bauten sie zur Ehre Gottes und für ihr Seelenheil, sowie das ihrer Leibeigenen, denen der Zugang zur Schloßkapelle natürlich nicht erlaubt war, eine wunderschöne Dorfkirche auf einen Teil des Schloßparks, den sie durch eine hohe Mauer vom übrigen Park abgrenzten, um nur nicht von den minderen Leuten belästigt zu werden.
Selbstverständlich bauten sie die Kirche nicht selbst, sondern sie beauftragten die berühmten Brüder Asam, und die taten ihr Bestes, um ihre Auftraggeber zufrieden zu stellen. Die Kirche wurde der Heiligen Dreifaltigkeit geweiht, und man kann über sie in jedem Kunstführer nachlesen.
Inzwischen waren die Freiherrn von Vercello nicht mehr reich und die Bauern keine Leibeigenen mehr. Ganz im Gegenteil: sie waren zumeist wohlhabender als der letzte Baron Vercello, der, ein charmanter Herr von fünfzig Jahren, sich nur mehr durch zwei Dinge auszeichnete: seine völlige Unfähigkeit, das Wenige, das ihm verblieben war, nutzbringend zu verwalten, und seine bildschöne Tochter Jolanda, kurz »Jo« genannt.
Baron Oswald war durch die betrüblichen äußeren Umstände allerdings nicht merkbar belastet. Er belieh und verkaufte die paar Wiesen, die er noch besaß, ohne jede Hemmung und wartete voller Optimismus darauf, daß Jo eines Tages eine hervorragende Partie machen würde, welche den Vercelloschen Besitz wieder in altem Glanz erstrahlen ließ. Oder wenigstens schuldenfrei machte.
Nun war es keineswegs so, daß Jo nicht schon lange hätte gut und passend verheiratet sein können. Die Schwierigkeit bestand darin, daß sie nicht wollte.
»Ich verkaufe mich doch nicht!« erklärte sie hochmütig. Und Baron Oswald, der vor Jahren auch lieber die ebenso schöne wie arme Gräfin Susanne Hochburg geheiratet hatte, als die reiche, aber unansehnliche Komteß Langheim aus neuem Fabrikanten-Adel, verstand sie zwar, seufzte aber doch bekümmert, wenn sie ihm erzählte, wem sie eben wieder eine Abfuhr erteilt hatte.
Der eine oder andere Bewerber hätte ihm gut gefallen, am besten aber gefiel ihm Graf Ludger Hochburg, ein entfernter Neffe seiner verstorbenen Gemahlin, die aus einer Nebenlinie dieses hochadeligen Geschlechtes gestammt hatte.
Wenn er eine entsprechende Bemerkung machte, sagte Jo:
»Stimmt, er ist wirklich nett, und ich mag ihn auch. Aber ich finde, daß das zum Heiraten nicht reicht!«
Zum Glück zeichnete sich Ludger nicht nur durch ein fast unschätzbares Vermögen, eine blendende Erscheinung, eine beachtliche Intelligenz und einen bewundernswerten Humor aus, sondern auch durch eine überraschende Geduld, was sein Werben um die schöne, eigenwillige Jo anging.
Und aus dieser Tatsache schöpfte Baron Oswald immer wieder neue Hoffnung.
Die Zeiten, in denen ein eigener Benefiziat in der Schloßkapelle für die uradelige Herrschaft Messen gelesen hatte, waren längst vorbei. Immerhin waren in der Dorfkirche die ersten zwei Bänke für sie reserviert, die mit einem Türchen verschlossen waren. In das Eichenholz hatten die Asams das freiherrliche Wappen eingeschnitzt. Der eine Kirchenstuhl war leer – aber versperrt, in dem andere saßen oder knieten die beiden letzten Vercellos: Oswald und Jo.
Und wenn zufällig an einem Feiertag ein adeliger Verehrer kam, saß der bei ihnen. Oder man sperrte die zweite Kirchenbank auf.
Was Baron Oswald aber wirklich Sorgen bereitete, waren nicht seine finanziellen Verhältnisse oder die Tatsache, daß Jo sich noch immer nicht für eine passende Partie entscheiden konnte, sondern daß es einen jungen Mann gab, von dem Jo hartnäckig behauptete, daß sie ihn liebte.
Und dies seit ihrem fünften Lebensjahr. Inzwischen war sie dreiundzwanzig.
Nicht, daß Baron Oswald etwas gegen diesen jungen Mann persönlich hatte. Er mochte ihn sogar ganz gern. Und schätzte ihn – ganz im Gegensatz zu seinem Vater. Aber er fand, daß er alles andere als der passende Ehemann für seine Tochter war. Obgleich weder gegen sein Vermögen noch gegen seinen Verstand etwas einzuwenden gewesen wäre.
Dieser junge Mann war Quirin, der Sohn des Großbauern Matthias Feichtner, dessen Groß- und Urgroßeltern inzwischen fast alle Gründe der ehemals freiherrlichen Besitzungen aufgekauft und ihren ehemals recht schäbigen Äckern aus den Tagen, in denen sie noch Leibeigene waren, hinzugefügt hatten.
Matthias Feichtner konnte den Baron Oswald genauso wenig ausstehen wie dieser ihn. Nur in einem Punkt waren die beiden Väter sich einig: Der Quirin brauchte eine andere Frau als diese Baroneß, und die Jo brauchte einen anderen Mann als diesen Bauernbuben.
Eine Meinung, welche die beiden jungen Leute nicht teilten, obgleich… Ja, da war eine gewisse Scheu.
Es war Sonntag, die Glocken der Asamkirche läuteten zum Gottesdienst, und im Schloß machte man sich zum Kirchgang bereit. Baron Oswald trug als bayerischer Edelmann einen Trachtenanzug mit einer Schilfleinen-Joppe. Baroneß Jo wählte das bezaubernde, mit teurer Schlichtheit bestechende Leinenkleid eines italienischen Designers, und die alte Köchin, die ihnen als einzige ständige Hausangestellte noch geblieben war, hatte ein Dirndl angezogen und marschierte, drei Schritt hinter der Herrschaft, die ihr zwei Monatslöhne schuldete, was sie aber nicht übel nahm, da sie genau wie der Herr Baron auf eine gute Partie Jos wartete – wobei sie weniger gegen den Quirin einzuwenden gehabt hätte – durch den verwilderten Schloßpark zu dem in die Parkmauer eingelassenen Türchen, welches direkt zur Kirche und dem neben ihr liegenden Erbbegräbnis der Freiherrn von Vercello führte.
Der Baron grüßte jovial nach allen Seiten, und weil sie es seit jeher so gewöhnt waren, grüßten die versammelten Dorfbewohner höflich zurück.
Ausgenommen die Feichtners.
Der Bauer grinste unverschämt und sagte so laut, daß es jeder, auch die Vercellos, hören konnten:
»Da schaut sie an, wie sie daher kommen! Als wenn sie noch von Bedeutung wären! Dabei haben sie wahrscheinlich sogar ihre Kleider auf Pump gekauft! Geh, Quirin, die ist doch nichts für dich!«
Jo drehte sich um und blinzelte dem Quirin fröhlich zu, und der schluckte seinen Ärger auf den Vater hinunter und blinzelte zurück.
Die Schloßleute betraten die Kirche, Baron Oswald sperrte die Tür zu ihrem Kirchenstuhl auf, und die Köchin Julie setzte sich in die Bank hinter den beiden. Denn auch wenn sie kein Geld mehr hatten, um sie zu bezahlen, ein Baron war ein Baron, und es war immer noch eine Ehre, für ihn zu kochen. Zumindest, wenn man wie Julie zum alten Schlag gehörte.
Draußen vor der Kirche wurden nun mehr spöttische und gehässige Bemerkungen laut.
»Ich habe gehört, daß er sogar einen Teil vom Schloßpark mit einer Hypothek belastet hat«, wußte ein Bauer.
»Das glaube ich sofort«, rief der Feichtner mit einem zornigen Lachen.
»Und ich habe gehört«, sagte eine Bäuerin, »daß die Julie nicht nur keinen Lohn mehr kriegt, sondern sogar von ihrem Ersparten das Essen für die zwei kauft!«
»Wenn sie so dumm ist!« dröhnte der Feichtner.
»Dummes Gerede!« ärgerte sich der Quirin.
»Aber geh, das würde doch der Quirin niemals zulassen!« mischte sich nun die Waltraud Aigner ein. Sie war die Tochter vom Bürgermeister und fand, daß der Quirin wirklich weit besser zu ihr passen würde als zu dieser notigen, eingebildeten Baroneß. Was übrigens auch die dazu gehörenden Eltern fanden.
Genau wie der Viehhändler Kleeberger und seine Frau, welche ihre Frieda liebend gern dem Quirin zugeschoben hätten.
»Das glaube ich auch!« rief die nun und lachte kreischend. »Da würde der Quirin bestimmt einspringen!«
Die Waltraud nickte ihr beifällig zu, auch wenn sie sie sonst nicht ausstehen konnte – schließlich war sie genauso auf den Quirin scharf wie sie selbst.
»Wie kann man nur so böse sein«, sagte leise die hübsche Vreni vom Häusler Peter Höfner, der die Schafe vom Feichtner hütete. Sie war ein liebes blondes Ding und, solange man sie nicht mit der rassigen Jo verglich, das hübscheste Mädchen in der Gegend: mit großen blauen Augen, einem roten Kirschenmund und einer Stupsnase.
Dazu besaß sie eine besonders reizende Figur, wie auch Baron Oswald immer bemerkte. Er machte ihr freundliche Komplimente, wenn er sie zufällig traf.
Früher hätte man ein so hübsches Ding als Zofe angestellt! Aber vielleicht kam die Zeit ja eines Tages wieder!
Quirin hatte die Bemerkung gehört und lächelte ihr nun zu. Es amüsierte ihn, wie sie prompt rot wurde. Er wußte, daß er ihr mehr als nur gefiel, und er mochte sie auch von all den Dorfmädeln weitaus am liebsten. Aber freilich – da war Jo, und außer einer freundschaftlichen Sympathie brachte er für ein anderes weibliches Wesen nicht mehr auf.
Die Kirchturmuhr setzte zum Schlag der vollen Stunde an, und jetzt hieß es, sich alle Spitzen und Bosheiten für später aufzuheben und sich auf die angestammten Plätze zu begeben, um dem Herrgott die Ehre zu erweisen.
*
Nach der Messe erklärte Jo ihrem Vater, daß sie noch einen kleinen Spaziergang machen wolle.
»Vergiß nicht, Ludger hat sich zum Essen angesagt!« erinnerte der Baron sie.
»Nein, nein, ich komm schon«, gab Jo zur Antwort. Ludger hatte letzthin zwei Gockel gebracht, die er auf einer Treibjagd erlegt hatte.
So schnell sie konnte, lief Jo durch den Park bis zu dem kleinen Weiher, an welchem sie und Quirin sich trafen. In dem Teil des Weihers, der noch zum Park gehörte, wuchsen Seerosen und Schilf. Der Bach, der sich durch die Gründe der Feichtner schlängelte, war klar und sauber und wurde als Fischwasser genutzt.
Jo gefielen die Seerosen besser.
Kurz nach ihr traf Quirin ein. Er zog ein besorgtes Gesicht.
»Ist das wahr, Jo?«
»Was?«
»Daß die Julie von ihrem Geld einkauft?«
»Ach was«, sagte Jo, die es nicht mochte, wenn er ihr Hilfe anbot, »die Fasanen heute hat uns der Ludger geschenkt!«
Quirin sagte nichts. Aber eigentlich wäre es ihm lieber gewesen, wenn sich dieser attraktive und reiche Graf nicht so oft hätte sehen lassen.
»Die Leute reden so böse!« sagte er und zog sie in seine Arme. Nach einem langen Kuß machte sich Jo mit einem glücklichen Seufzer los.
»Das kratzt mich nicht!« behauptete sie. Sie setzte sich auf den Stamm eines umgestürzten Baumes und klopfte auf den Platz neben sich. Quirin ließ sich nicht lange bitten. Er rückte nahe an sie heran und legte den Arm um sie.
»Wie lange bleibt denn dieser Ludger?« erkundigte er sich unwillig.
Jo lachte.
»Er ist nett – aber du mußt dir nichts denken. Irgendwann sieht mein Vater schon ein, daß ich nur dich mag.«
»Und meiner muß es dann auch einsehen!« Er wollte sie wieder küssen, aber ihr war im Moment nicht nach Schmusen zumute.
»Wann hast du dich in mich verliebt?« wollte sie wissen, obgleich er es ihr schon hundert Male erzählt hatte.
Er grinste.
»Ach, ich erinnere mich kaum mehr!«
»Dann vergesse ich es auch!« drohte sie.
»Wehe!« Er packte sie und balgte sich mit ihr herum, mit dem Hintergedanken, so zu den vorher verweigerten Küssen zu kommen.
Aber Jolanda war flink und geschmeidig, und er wollte nicht zu fest zupacken, um ihr nicht weh zu tun.
»Ich will es hören!« schnaufte sie atemlos.
»Und du erzählst mir dann…« Sie nickte, und er konnte ihr schnell einen Kuß rauben. Einen kleinen nur.
Es war ein Spiel, von dem sie nie genug bekamen: das Erinnern, wann sie sich ineinander verliebt hatten.
*
Natürlich wurde die kleine Jo zu allen Kindergeburtstagen auf die Schlösser und Herrensitze eingeladen, die einigermaßen erreichbar waren. Aber sie fuhr nie gerne hin, und man schätzte sie dort auch nicht besonders.
Jo langweilte sich zwischen den kleinen Mädchen mit den langen Korkenzieherlocken, die feine Spitzen- und Rüschenkleider trugen und schrecklich hochnäsig waren, weil ihr Papa so reich und ihre Mama so vornehm waren.
Die Buben aus diesen Familien waren etwas besser. Aber die wollten natürlich nicht mit einem kleinen Mädchen spielen.
Jo war traurig, weil sie keine Geschwister hatte. Zumindest bis sie sah, wie Geschwister miteinander umgingen. Vielleicht war es doch besser so, wie es war!
Glücklicherweise gab es nicht mehr so lästige Einladungen als durchschnittlich einmal im Monat! Aber die restlichen neunundzwanzig Tage waren auch nicht viel besser. Ihre Eltern hätten nichts dagegen gehabt, wenn Jo mit den Kindern der Dorfleute oder der Angestellten, von denen es damals noch den ein oder anderen gab, gespielt hätte.
Aber seltsamerweise waren es diese Kinder, die Jo nicht mitspielen ließen. Sie wurden nicht zu Jos Geburtstag eingeladen – da kamen die anderen Kinder! Sollte die dumme Gans also schauen, wo sie den Rest des Jahres verblieb.
Den Rest des Jahres wanderte Jo vom Schloß hinunter ins Dorf und schaute sehnsüchtig von ferne zu, wie die kleinen Mädchen und Buben spielten, sich mit Dreck bewarfen und einander böse Worte nachschrien. Sie fand das beneidenswert.
Jo war ein wildes Kind. Sie kletterte auf Bäume, sie konnte mit fünf Jahren reiten wie eine Große, sie schwamm und tauchte. Man hätte denken können, daß sie ein wunderbares Leben führte. Das dachten auch die Dorfkinder. Aber sie hatte keine Freunde – und das war für ein mutterloses Kind – ihre schöne Mami war sehr früh gestorben – schlimmer als alles andere. Vielleicht auch für ein Kind, das eine Mutter hatte.
Papa war ja sehr lieb. Aber auch sehr beschäftigt und außerdem bloß ein erwachsener Mann.