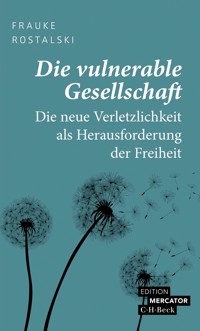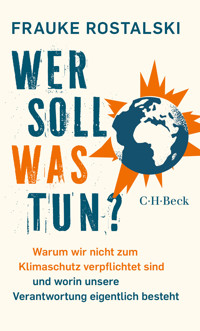
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Hafermilch, Elektroauto, Wärmepumpe und der Urlaub vor der eigenen Haustür sind zu Insignien einer ökologischen und deshalb besseren Lebensweise geworden. In Sachen Klimawandel scheinen sich viele einig zu sein: Wir alle sind verpflichtet, unseren individuellen Verbrauch von Treibhausgasen umfangreich zu reduzieren. In ihrem aufrüttelnden Essay tritt Frauke Rostalski diesem Narrativ entgegen und sagt: Eine Pflicht zur Reduktion des CO2-Ausstoßes besteht derzeit gar nicht. Nationale wie individuelle Heldentaten verlaufen im Sand oder erweisen sich schlimmstenfalls sogar als kontraproduktiv, solange auf internationaler Ebene kein effektives System existiert, in das sie sich einfügen.
Rechtliche und ethische Pflichten sind stets daran gebunden, dass das, was verlangt wird, überhaupt geeignet ist, zu dem gewünschten Ziel beizutragen. Die harte Wahrheit lautet aber, dass der Klimawandel ein globales Problem ist, das auch nur auf globaler Ebene effektiv gelöst werden kann. Hier steht in erster Linie die Politik in der Pflicht, auf ein effektives globales Konzept zur Bekämpfung des Klimawandels hinzuwirken. Derweil ist eine Abkühlung unserer Klimadebatte geboten, in der Bekenntniszwänge und emotionale Anschuldigungen eine Mauer der Antipathie aufrichten, die sachliche Auseinandersetzungen behindert. Allen sollte klar sein: Klimaschutz ist keine Frage der Haltung oder starker Symbole. Er verlangt vielmehr zielführende Handlungen, bei denen es nicht bloß darum geht, die eigene moralische Überlegenheit gegenüber seinen Mitmenschen zur Schau zu stellen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
FRAUKE ROSTALSKI
WER SOLL WAS TUN?
Warum wir nicht zum Klimaschutz verpflichtet sind und worin unsere Verantwortung eigentlich besteht
C.H.BECK
Übersicht
Cover
INHALT
Textbeginn
INHALT
Titel
INHALT
EINLEITUNG
1: KEINE VERANTWORTUNG OHNE EFFEKTIVITÄT
Zwei Perspektiven von Verantwortung
Rechtliche Verantwortung: Das Staatsziel des Umweltschutzes und die «Möglichkeit der Zweckerreichung»
Ethische Verantwortung: Weil es darauf ankommt, was wir durch unsere Handlungen bewegen
2: WAS SOLLEN KOLLEKTIVE TUN? – Internationale Klimapolitik in der Sackgasse
Kollektive Verantwortung im Zeitalter des Klimawandels
Das Pariser Übereinkommen als stumpfes Schwert im Kampf gegen die globale Erwärmung
Warum auch der Europäische Gerichtshof und die «KlimaSeniorinnen» den globalen Klimawandel nicht aufhalten
Weshalb das Narrativ einer deutschen «Vorreiterrolle» ins Leere geht
Warum gegenwärtig keine Verpflichtung zur Reduktion nationaler Treibhausgase besteht – und weshalb der «Klimaschutzbeschluss» des Bundesverfassungsgerichts nichts anderes besagt
Dann doch lieber Gesinnungsethik?Zur Stellungnahme «Klimagerechtigkeit» des Deutschen Ethikrats
Was nun?Kollektive Schritte zur Bekämpfung des globalen Klimawandels, die schon heute ergriffen werden sollten
3: UND WAS SOLLEN EINZELNE TUN? – Individuelle Verantwortung in Zeiten unkoordinierter globaler Klimapolitik
Es besteht keine rechtliche Verantwortung zu sozialem Engagement für den Klimaschutz
Auch ethisch sind Individuen nicht zu sozialem Engagement für den Klimaschutz verpflichtet
Ist nicht zumindest eine ökologische Haltung geschuldet?Die verbreitete Fokussierung auf den Konsumenten als «schlafenden Riesen»
«Moralspektakel» in der Debatte über Konsumentenverantwortung
Eine ungerechtfertigte Verantwortungsverlagerung auf das Individuum
Klimaschutz ist keine Frage der richtigen Haltung
4: FREIHEIT ODER LEBEN – Über die Grenzen der Zumutbarkeit
Selbst in der Krise gilt kein absoluter Lebensschutz
Steigerung und Relativierung: Eine kurze Geschichte des Lebensschutzes
Die «erfüllte Zeit» des Lebens: Bleibefreiheit ist individuelle Freiheit
Die Aufladung des Lebensschutzes durch Rechte der Natur und die Vagheit des Würdeschutzes
Ein Quantum «gutes» Leben: Menschenwürde ist mehr als bloßes Überleben
Aushandeln – Jetzt!
SCHLUSS
DANK
ANMERKUNGEN
Einleitung
Keine Verantwortung ohne Effektivität
Was sollen Kollektive tun?
Und was sollen Einzelne tun?
Freiheit oder Leben
PERSONENREGISTER
Zum Buch
Vita
Impressum
EINLEITUNG
Viele haben den Klimawandel zur «Menschheitsaufgabe», gar zu einer der größten Aufgaben dieser Zeit erklärt.[1] Diese Bezeichnung ist treffend, da sie doch gleich zwei Facetten der Herausforderung hervorhebt, die durch die Veränderungen des Klimas entsteht. Zum einen geht der Klimawandel alle an: Jeder einzelne Mensch auf dem Planeten wird früher oder später von seinen Folgen unmittelbar betroffen sein – wenn er es nicht jetzt schon ist. Dasselbe gilt für alle künftigen Generationen. Zum anderen stellt der Begriff die Verantwortung in den Mittelpunkt, die für die Menschheit mit den klimatischen Veränderungen einhergeht. Der Klimawandel erscheint nur vordergründig als etwas, das Menschen äußerlich «geschieht». Er ist vielmehr eine Folge des Verhaltens von Menschen – des Verhaltens in vielen Jahren der Menschheitsgeschichte.[2] Deshalb handelt es sich um eine Menschheitsaufgabe: Wo wir heute stehen, hängt unmittelbar damit zusammen, wie wir und unsere Vorfahren leben und gelebt haben bzw. welchen Umgang wir mit den natürlichen Ressourcen pflegen, die uns umgeben. Der Klimawandel erscheint also deshalb als eine Frage der Verantwortung, als eine Menschheitsaufgabe, weil der Mensch durch sein Verhalten zum Klimawandel beigetragen hat und weiterhin dazu beiträgt.
Aber worauf richtet sich die Verantwortung? Auf den ersten Blick erscheint die Antwort sehr einfach: Weil der vom Menschen verursachte Ausstoß von Kohlenstoffdioxid wesentlich dafür ist, wie (schnell) sich die klimatischen Bedingungen auf dem Planeten verändern,[3] muss es darum gehen, Verhaltensweisen zu unterbinden bzw. zumindest zu reduzieren, die zum Ausstoß von CO2 führen. Hierin liegt der Schlüssel zur Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen. Vor diesem Hintergrund ist die Annahme sehr verbreitet, jeder Staat, jedes Unternehmen und jeder einzelne Bürger sei dafür verantwortlich, seinen eigenen CO2-Ausstoß zu reduzieren, bestenfalls auf null.[4] Wie tief sich diese Vorstellung bereits in das Bewusstsein vieler Menschen gegraben hat, zeigt sich zum Beispiel dann, wenn die Nase gerümpft wird über die Nachbarin, die bereits zum dritten Mal in diesem Jahr eine Flugreise unternimmt, oder die Eltern, die ihr Kind unbeirrt mit dem Pkw zur Schule bringen, anstatt mit dem Fahrrad zu fahren oder zu laufen. Es zeigt sich weiter an dem moralischen Zeigefinger gegenüber SUV-Fahrern, Swimmingpool-Besitzern und dem Konsumenten tierischer Lebensmittel oder anderer Produkte, die im Verdacht stehen, einen besonders großen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen.
Die Beispiele zeigen, wie weit die Erwartungshaltung vieler reicht, wenn es darum geht, die Verantwortung des Gegenübers in Sachen Klimawandel abzustecken. Ernährung, Fortbewegung, Wohnen – nichts scheint mehr bloße Privatangelegenheit zu sein. Weil sich nahezu jede Lebensäußerung des Menschen in einen Ausstoß von CO2 übersetzen lässt, erlangt alles eine Bedeutung und wird letztlich dem Zugriff moralischer Bewertungen anderer ausgesetzt. Ausbuchstabiert werden diese in verschiedenen politischen Lagern, von Seiten zivilgesellschaftlicher Gruppen, in Medien und Wissenschaft. Dabei lautet der verbreitete Grundtenor, dass jeden die Verantwortung trifft, Maßnahmen zur Reduktion des eigenen CO2-Ausstoßes zu ergreifen – häufig begleitet von der Mahnung, dass bislang viel zu wenig getan wurde, dass nicht ausreicht, was gegenwärtig unternommen wird und dass die Zeit, die der Menschheit noch bleibt, möglicherweise nicht genügt, um der Aufgabe des Klimaschutzes gerecht zu werden.
Dem stehen jene gegenüber, die jede Verantwortung für den Klimawandel – sei es von privater oder staatlicher Seite, sei es von Unternehmen – deutlich zurückweisen. Entstanden ist dabei nicht zuletzt eine eigenständige Literaturgattung, die die vermeintliche «Klimalüge» anprangert,[5] womit gemeint ist, dass die empirischen Grundlagen des vom Menschen verursachten Klimawandels für sich genommen bestritten werden. Entweder, weil es den Klimawandel gar nicht gebe oder, weil zumindest der Mensch keinen Anteil daran habe,[6] werden innerhalb dieses Meinungsspektrums sämtliche denkbaren Pflichten zur Abwendung der klimatischen Veränderungen bestritten.
Dabei schlagen die Emotionen in beiden Lagern mitunter besonders hoch. Während die einen die «Klimakatastrophe» am Horizont aufziehen sehen und damit in vielen Fällen große Existenzängste verbinden,[7] fühlen sich die anderen durch diverse Szenarien bedroht, in denen sie ihren eigenen Lebensstil zum Schutz vor dem Klimawandel mitunter erheblich – aus ihrer Sicht: zum Schlechteren – ändern müssten. Die erwartbare Folge einer massiven Diskursverschlechterung ist längst eingetreten. «Klimaleugner» sprechen kaum mehr mit «Greta-Jüngern» und umgekehrt. Wer die eigene Meinung nicht teilt, wird schnell als «Gegner» diffamiert – mit dem Ergebnis, dass es nicht länger gelingt, Sachargumente über die hohen Mauern gegenseitiger Antipathie zu heben.
Dies hat nicht zuletzt negative Folgen für die Debatten innerhalb des Teils der Bevölkerung, der sich durchaus einig ist im Hinblick auf den Anteil des Menschen am globalen Klimawandel. Denn die Frage der Verantwortung in Sachen Klimawandel begrenzt sich nicht darauf, bestimmte naturwissenschaftliche Erkenntnisse anzuerkennen oder nicht. Bei dieser Anerkennung handelt sich dabei vielmehr lediglich um eine (wenn auch bedeutsame) Basis dafür, den Gegenstand der Verantwortung und deren Träger weiter zu konkretisieren. Letzteres kommt allerdings zu kurz, wenn sich vorrangig darüber gestritten wird, ob der Klimawandel tatsächlich im Wesentlichen vom Menschen verursacht wird bzw. was es über die Person des Gegenübers aussagt, wenn sie diese Prämisse teilt oder nicht teilt. So finden wir uns aktuell in einer Situation wieder, in der sachliche Diskussionen über die Reichweite der Verantwortung im Zusammenhang mit dem Klimawandel schnell durch einen eigentümlichen Bekenntniszwang verstellt sind: «Klimaleugner – Ja oder nein?» Doch wenn diese Frage in Einklang mit der weit überwiegenden naturwissenschaftlichen Einschätzung des menschlichen Beitrags zum Klimawandel verneint worden ist, bleibt es häufig dabei – jedes weitere Fragen nach den konkreten Konturen der Verantwortung, die sich daraus ergibt, erscheint schnell als Relativierung des soeben geleisteten Bekenntnisses und weckt Zweifel an der Redlichkeit der eigenen Person.
Auf diese Weise ist die Debatte über den Klimawandel in den letzten Jahren zunehmend zu einer Frage der richtigen Haltung verkommen. Je nachdem, in welchem Lager man steht, erweist es sich als richtig oder falsch, von der menschlichen Verursachung des Klimawandels überzeugt zu sein. Wir erleben insoweit eine gewisse Parallele zu gesellschaftlichen Diskussionen, die während der Corona-Pandemie geführt wurden. Auch damals ließen sich gesellschaftliche Gruppen ausmachen, die grundlegende epistemische Zweifel äußerten und von diesem Standpunkt aus in kein sinnvolles Gespräch darüber eintreten konnten, wie mit dem Virus angemessen umzugehen wäre – denn wer abstreitet, dass es das Corona-Virus überhaupt gibt, wird notwendig jedwede staatliche Maßnahme zum Schutz der Bevölkerung als im Kern verfehlt betrachten. Während der Pandemie hat dies zu einem verbreiteten Lagerdenken geführt, das sachlichen Gesprächen entgegenstand: Andersdenkende sprachen nicht länger miteinander, sondern bloß noch übereinander.[8] Dies hatte nicht zuletzt die für den gesellschaftlichen Diskurs besonders negative Folge, dass mehr oder weniger jeder, der Kritik an den Corona-Schutzmaßnahmen äußerte, über den Kamm derer geschoren wurde, die bereits die epistemischen Grundlagen der Pandemie bestritten – selbst wenn er dies selbst gar nicht tat. Denn viele, wenn nicht die meisten Menschen, die nicht mit der offiziellen Corona-Politik einverstanden waren, bestritten gar nicht, dass die Gesellschaft mit einem neuartigen Virus konfrontiert war, das für bestimmte Bevölkerungsgruppen ein hohes Letalitätsrisiko aufwies. Stattdessen richtete sich ihre Kritik auf die Wertungen, die den politischen Entscheidungen zugrunde gelegt wurden, und damit auf die normative Seite der Corona-Schutzmaßnahmen. Es ging ihnen beispielsweise darum, dass Maßnahmen gegenüber Kindern und Jugendlichen solch erhebliche Folgeschäden bei dieser Personengruppe nach sich ziehen würden, dass es ihnen nicht angemessen erschien, so weitreichend in deren Freiheitsrechte einzugreifen.[9] Von politischer Seite wurde der Gesundheits- und Lebensschutz während der Pandemie rigoros verfolgt. Teile der Bevölkerung waren hiermit nicht einverstanden – ihren Wertvorstellungen hätte es eher entsprochen, mehr auf Selbstverantwortung zu setzen und den Freiheitsrechten selbst gegenüber den Rechtsgütern Gesundheit und Leben ein höheres Gewicht beizumessen. In der Tat dreht sich die ethische wie rechtliche Frage nach dem Umgang mit einer Pandemie genau um diese Pole. Sie lautet: Was überwiegt, Freiheits- oder Lebensschutz?
Trotz der normativen Relevanz der Kritik vieler «Maßnahmengegner», die der Sache nach auf die Konfliktlage zwischen Freiheits- und Lebensschutz rekurrierten, war ihnen aber zumeist das schon beschriebene Schicksal beschieden, mit denen «in einen Topf» geworfen zu werden, die empirische Belege der Corona-Pandemie von Grund auf abstritten. Diese Kritiker wurden zu «Coronaleugnern», «Covidioten» oder «libertär Autoritären».[10] Die Folge liegt auf der Hand: Der gerade in einer Pandemie so wichtige Diskurs darüber, wie Freiheitsrechte und Lebensschutz in ein angemessenes Verhältnis zu bringen sind, konnte kaum geführt werden – wer es gleichwohl versuchte, über dessen Kopf schwebte das Damoklesschwert der gesellschaftlichen Stigmatisierung als einer, der die realen Gefahren durch das Corona-Virus zulasten vulnerabler Gruppen unzulässig leugnete.
Ähnliche Mechanismen offenbart der Diskurs über den Umgang mit dem Klimawandel. Wer kritisch hinterfragt, ob die eine oder andere Maßnahme zur Reduktion des nationalen Treibhausgasausstoßes tatsächlich sinnvoll ist, droht schnell, als «Klimaleugner» abgetan und als solcher aus der Debatte ausgeschlossen zu werden.[11] Allerdings genügt es weder aus ethischer noch aus rechtlicher Sicht, die grundsätzliche Verantwortung von Menschen für die Bekämpfung des Klimawandels herauszustreichen. Vielmehr handelt es sich hierbei bloß um den ersten Schritt, dem notwendig weitere nachfolgen müssen. Zu fragen ist nämlich unbedingt, worauf sich diese Verantwortung konkret erstreckt, wen sie trifft und zu welchem Zeitpunkt. Die Antworten auf diese Fragen haben teils weitreichende Folgen, weil Klimaschutzmaßnahmen (ganz ähnlich wie Corona-Schutzmaßnahmen) mitunter ganz erheblich in die Freiheitsrechte Einzelner eingreifen. Wie genau die Verantwortung jedes Einzelnen – aber auch von Kollektiven wie Staaten und Unternehmen – ausgestaltet ist, entscheidet also darüber, in welchem Umfang Freiheit künftig beschnitten werden darf. Schon dieser Zusammenhang zeugt von der hohen Bedeutung von Diskursen, die in Sachen Klimawandel über die bloße Frage nach dem «Ob» einer Verantwortung hinausgehen.
Zu einem solchen Diskurs soll mit diesem Buch beigetragen werden. Dabei möchte ich zeigen, dass die eingangs bereits referierte und besonders verbreitete Annahme, jeden einzelnen Bürger treffe die Pflicht, seinen persönlichen CO2-Ausstoß zu reduzieren, zumindest in der gegenwärtigen Situation nicht zutrifft – weder aus einer ethischen noch aus einer rechtlichen Perspektive. Als Grund dafür verweise ich auf die Notwendigkeit, bei der Frage nach einer Verantwortung von Individuen und Kollektiven den Sachgedanken der Effektivität einzubeziehen: Ob jemand eine Verantwortung für etwas hat, hängt davon ab, ob der Beitrag, der ihm abverlangt wird, tatsächlich einen effektiven Einfluss auf das hat, was erreicht werden soll. Sprich: Sinnlose (da ineffektive) oder gar kontraproduktive Maßnahmen sind nicht Gegenstand von Verantwortung.
Effektivität in diesem Sinne spielt für die Begründung von Pflichten eine zentrale, aber nicht selten unterschätzte Rolle. Im ersten Kapitel möchte ich diese Rolle näher begründen. Rechtlich lässt sich die Bedeutung von Effektivität für die Annahme von Verantwortung bereits aus dem Grundgesetz ableiten. In ethischer Hinsicht argumentiere ich für eine Verantwortungsethik in Abkehr von – derzeit freilich besonders verbreiteten – gesinnungsethischen Konzeptionen.
Auf dieser Basis komme ich zu dem Ergebnis, dass in der derzeitigen Situation keine Pflicht einzelner Bürger besteht, den privaten CO2-Verbrauch zu reduzieren. Diese Schlussfolgerung wird manche überraschen und ist mit dem dargestellten diskursiven Risiko belastet, allein schon aufgrund dessen ins Abseits der «Klimaleugner» gestellt zu werden. Ich begründe meine Position damit, dass es derzeit an einem wirksamen globalen Instrument zur Bekämpfung des Klimawandels fehlt. Die Veränderung des Klimas, die den gesamten Planeten betrifft, ist eine globale Herausforderung. Es liegt in der Natur dieser Herausforderung, dass sie allein auf einer globalen Ebene gemeistert werden kann. Selbst noch so gut gemeinte Einzelbeiträge genügen nicht, um die Situation in den Griff zu bekommen. Und nicht nur das: Unkoordinierte Alleingänge sind, wie ich zeigen werde, sogar dazu geeignet, dem übergeordneten Ziel einer Bekämpfung des Klimawandels abträglich zu sein. Grund für diese Situation ist die Untauglichkeit des Pariser Übereinkommens, notwendige Kooperation in Sachen Klimawandel auszulösen. Das Übereinkommen setzt nicht bloß falsche Anreize, es fehlt ihm überdies an einem Mechanismus, um seine tatsächliche Umsetzung sicherzustellen.
Dies hat weitreichende Folgen für die Frage, worauf sich die Verantwortung von Individuen und Kollektiven gegenwärtig eigentlich richtet. Im Kapitel 2 lege ich dar, dass eine Pflicht zur Reduktion von Treibhausgasen erst dann besteht, wenn die jeweilige Form der Reduktion auch einen effektiven Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leistet. Hierfür bedarf es aber zunächst auf globaler Ebene entsprechender Übereinkommen, die an die Stelle des Pariser Vertrags treten. In deren Fokus muss der Gedanke der Kooperation stehen, für dessen konkrete Umsetzung die Verhaltenswissenschaften wichtige Erkenntnisse liefern. Erst, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, so möchte ich zeigen, besteht eine individuelle Pflicht, sich an Maßnahmen zu beteiligen, die auf nationaler Ebene zur Reduktion von Treibhausgasen ergriffen werden. Bevor es hierzu gekommen ist, lassen sich gleichwohl Verantwortlichkeiten auf individueller wie kollektiver Ebene formulieren – allein liegen diese nicht darin, den privaten bzw. gesellschaftlichen CO2-Ausstoß zu reduzieren. Vielmehr geht es dabei in erster Linie darum, auf die notwendigen globalen Übereinkommen hinzuwirken. Diese Pflicht trifft staatliche Akteure. Auf individueller Ebene möchte ich im Kapitel 3 diskutieren, ob es ethische Pflichten von Bürgern gibt, auf eine entsprechende Politik hinzuwirken – wie zum Beispiel durch die Beteiligung an Wahlen, zivilgesellschaftliches Engagement oder gar Formen des zivilen Ungehorsams.
Freilich sind hiermit noch nicht alle Fragen beantwortet, die unter dem Gesichtspunkt der Verantwortung im Zusammenhang mit dem Klimawandel eine Rolle spielen. Denn sollte es (endlich) so weit sein, dass global effektive Instrumente zur Bekämpfung des Klimawandels vereinbart sind, ist zu entscheiden, wie weit die Verantwortung reicht, die Kollektive und Individuen trifft. Der Klimawandel gefährdet die natürliche Grundlage sämtlichen Lebens auf der Erde. Der «Einsatz», um den es geht, könnte daher kaum höher sein. Nicht bloß das Überleben der Menschen, sondern sämtlicher heute bekannter Tier- und Pflanzenarten ist durch eine immer weitere Erwärmung der Erde gefährdet.[12] Aus ethischer wie rechtlicher Perspektive fragt sich dennoch, ob dem Schutz des Lebens wirklich alles untergeordnet werden darf. Gibt es nicht Grenzen, soweit es um die Beschränkung individueller wie kollektiver Freiheit geht? Und falls ja: Wo genau liegen diese? Ist Leben mehr als bloßes Überleben bzw. gehört zum Leben nicht die Freiheit dazu? Diesen Fragen wird in Kapitel 4 näher nachgegangen. Sie münden in die Einsicht, dass die Debatte über Verantwortung im Zusammenhang mit dem Klimawandel eines nicht aus dem Blick verlieren darf: die hohe Bedeutung der Demokratie für einen erfolgreichen Umgang mit den klimatischen Veränderungen. Gerade in der Klimadebatte ist die Demokratie traditionell großen Anfechtungen ausgesetzt – zu schwerfällig, zu vielstimmig, zu langsam, um nur einige Kritikpunkte zu nennen. Sie alle überzeugen nicht. Die Demokratie ist nach wie vor die beste Staatsform, um gute Lösungen gerade in Bezug auf so große Herausforderungen wie den Klimawandel zu finden. Hierfür bedarf es gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse, die festlegen, wie weit zugunsten des Lebensschutzes in die Freiheitsrechte eingegriffen werden darf. Expertokratien oder gar eine Künstliche Intelligenz liefern keine Verbesserung, weshalb es selbst im «Auge des Sturms» der Wahrung demokratischer Verfahren bedarf, um weitreichende Entscheidungen für die Zukunft treffen zu können.
Weil damit die gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel entscheidend bleiben, möchte ich abschließend auf gegenwärtige Schwächen des Klimadiskurses hinweisen, die im Interesse einer erfolgreichen Klimapolitik behoben werden sollten. Im Vordergrund steht dabei das bereits angesprochene Lagerdenken, d.h. die Entwicklung, dass ein Sprechen über den Klimawandel mehr und mehr von einem Bekenntniszwang überschattet wird, der jeden sachlichen Diskurs behindert. Wie mit dem Klimawandel gesellschaftlich umzugehen ist, wird zunehmend als Frage der (richtigen) Haltung diskutiert, nicht aber als offener Austausch von Sachargumenten. Die sich hieraus ergebenden kommunikativen Hürden erschweren den sachlichen Diskurs und stehen guten Lösungen entgegen. Ebenjene Problematik wird sich voraussichtlich umso weiter verschärfen, je weniger Zeit zur Bekämpfung des Klimawandels verbleibt. Dies betrifft sämtliche Diskursteilnehmer und damit gerade auch jene, die schon heute meinen, jeder Einzelne habe die Pflicht, alles in seiner Möglichkeit Liegende zu tun, um seinen privaten CO2-Ausstoß zu reduzieren. Selbstverständlich steht es jedem Bürger grundsätzlich frei, Maßnahmen zum Schutz vor dem Klimawandel in seinem privaten Leben zu ergreifen, die er für sinnvoll erachtet. Ein erhobener Zeigefinger gegenüber dem abweichend agierenden Nachbarn verbietet sich zum jetzigen Zeitpunkt jedoch. Außerdem sollte auch bei privaten Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels nicht aus dem Blick verloren werden, dass ein «moralisches Heldentum» seinerseits an Bedingungen geknüpft ist. Wie heldenhaft ist es nämlich bei genauerer Betrachtung, ein Verhalten an den Tag zu legen, das überhaupt keinen positiven Einfluss auf den Klimawandel hat und lediglich das eigene Gewissen befriedigt? Gerade hierin kann schließlich ein Risiko liegen: Wenn nämlich allzu schnell der persönliche Eindruck entsteht, durch bestimmte private Verhaltensumstellungen «genug» für das Klima getan zu haben, kann dies dem eigentlichen Ziel sogar abträglich sein – weil gerade nicht die Maßnahmen ergriffen werden, die tatsächlich einen Unterschied machen können.
Vor diesem Hintergrund betrifft das Verhältnis von Klimawandel und Verantwortung auch eine kommunikative Ebene. Die gegenwärtige Debatte ist durch Unschärfen gekennzeichnet, die sachlichen Aushandlungsprozessen nicht selten entgegenstehen. Angesichts der Größe der Herausforderung, die der Klimawandel an die Gesellschaft stellt, erweist sich dieser Umstand als besonders problematisch. Verantwortung im Kontext des Klimawandels umfasst daher auch die Art und Weise, wie über das Thema gesprochen wird. Einer sachlichen Debatte steht nicht bloß das Leugnen wissenschaftlicher Erkenntnisse entgegen, sondern auch die Überbetonung von Ängsten wie auch die moralische Abwertung von Personen, die in Fragen des Klimaschutzes nicht dem eigenen Meinungsspektrum zugerechnet werden.
Der Klimawandel geht alle an. Er schafft für jedes Individuum, für jedes Kollektiv spezifische Verantwortlichkeiten. Diesen nicht nachzukommen, verbietet sich; schon allein deshalb, weil die Konsequenzen kaum gravierender sein könnten. Dabei trifft eine besondere Verantwortung all jene, die noch heute in den Industriestaaten von Bedingungen profitieren, die erst dadurch ermöglicht wurden, dass Menschen vor ihnen in besonderem Maße auf CO2-intensive Technologien zurückgriffen bzw. dies nach wie vor tun, um den jeweiligen Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Zumal die privilegierte Position der Länder des Globalen Nordens auch mit der europäischen Kolonialgeschichte und globalen Machtstrukturen zusammenhängt, die daraus hervorgegangen sind und sich über Jahrhunderte weiter verfestigt haben.[13]
Umso wichtiger ist es, das Richtige zu tun, also genau das, worauf sich die Verantwortung gegenwärtig richtet. Derzeit kann davon keine Rede sein. Es fehlt an einem grundlegenden Konzept, das auf globaler Ebene eine effektive Bekämpfung des Klimawandels ermöglicht. Währenddessen erwärmt sich die Erde immer weiter. Deshalb sollte sich die Gesellschaft weder in gegenseitigen Schuldzuweisungen verlieren noch ihre Energie darauf verwenden, Haltungsnoten zu vergeben. All dies kostet Zeit – Zeit, die für anderes, wirklich sinnvolles Handeln verloren geht, um der «Menschheitsaufgabe» Klimawandel tatsächlich gerecht zu werden.
1
KEINE VERANTWORTUNG OHNE EFFEKTIVITÄT
Soll eine Aussage darüber getroffen werden, wofür ein Individuum, ein Staat oder ein Unternehmen verantwortlich ist, rückt der Begriff der Verantwortung in den Mittelpunkt. Sowohl für das Recht als auch für die Ethik bildet die Verantwortung heute eine der zentralen Kategorien. In beiden Wertungssystemen geht es um die Frage, was getan werden soll – wobei der formale Unterschied darin liegt, dass rechtliches Sollen anders als ethisches mit staatlichem Zwang durchgesetzt werden kann. Dem Verantwortungsbegriff kommt in Recht und Ethik daher die Aufgabe zu, eine «starke» normative Beziehung zwischen Subjekten und bestimmten Objekten – Gegenständen, Handlungen, Handlungsfolgen oder Zuständen – herzustellen. Verantwortungsmodelle liefern hierfür Kriterien. Der Blick in die Geistesgeschichte offenbart freilich eine große Vielfalt an Verantwortungskonzeptionen, die teils heterogen sind und eine hohe Kontextabhängigkeit aufweisen.[1] Ihr gemeinsames Bindeglied bildet der Gedanke der Zurechnung als Funktion des Verantwortungsbegriffs.
Zwei Perspektiven von Verantwortung
Es lassen sich zunächst zwei Gruppen von Verantwortungskonzepten kontrastieren, deren zentraler Unterschied in der Perspektive liegt, die sie bei der Zurechnungsfrage zugrunde legen: zurückschauend oder vorausschauend. Dabei dominierte lange Zeit ein retrospektives Verständnis von Verantwortung, wobei der Begriff selbst erst im Verlauf des 19. Jahrhunderts an Bedeutung erlangte, um von da an eine steile Karriere hinzulegen. Zunächst beschrieb nämlich in erster Linie der Terminus «Schuld» das, was später klassischerweise als Verantwortung gekennzeichnet wurde: eine Beziehung zwischen einem menschlichen Subjekt und den schädigenden Folgen seines Handelns. Vor allem im Recht erlangte die Schuldkategorie früh an Bedeutung und beeinflusste auch die philosophische Sicht auf die Zurechnungsproblematik.[2] Schuld setzt voraus, dass eine Person durch ihr Verhalten[3] Folgen herbeigeführt hat, die sich schädigend auf andere auswirken. Um Schuld zuzuschreiben, genügt es allerdings gerade nicht, auf das Verhältnis der Ursächlichkeit zwischen der Handlung und ihren Folgen zu verweisen. Kausalrelationen gibt es schließlich auch bei bloßen Naturereignissen. Für die Zuschreibung von Schuld bedarf es vielmehr einer Berücksichtigung der subjektiven Seite und damit der Frage, ob die konkreten Folgen für den Betreffenden vorhersehbar waren und ob er sie hätte vermeiden können. Außerdem muss das jeweilige Handeln auch verboten gewesen sein, weswegen der Begriff der Schuld – und später der gleichbedeutend verwendete Begriff der Verantwortung – einen Bezug zu einem übergeordneten Normensystem herstellen muss. Nur dann, wenn das jeweilige Tun oder Unterlassen ver- oder geboten ist, muss der Einzelne es auch vermeiden und daher sein Verhalten nach der jeweiligen Norm ausrichten.[4]
Damit wird klar, dass Schuld und Verantwortung bereits eines voraussetzen: die prinzipielle Freiheit des Einzelnen, Entscheidungen zu treffen und sein Verhalten an ihnen zu orientieren. Die Feststellung von Schuld bzw. die Aussage, dass eine Person für bestimmte schädigende Handlungsfolgen «verantwortlich» ist, geht mit einem Werturteil einher. Dem Betreffenden wird ein Vorwurf gemacht. Dies wäre nicht möglich, wenn der Betreffende keine Steuerungsmöglichkeit in Bezug auf seine Handlungen hätte. Zwar wird bis heute von manchen angenommen, der Mensch sei in seinem Verhalten determiniert, weshalb selbst so etablierte Institutionen wie das rechtsstaatliche Strafrecht abgeschafft werden müssten. Der Streit soll an dieser Stelle nicht vertieft werden[5] – zumal wenig Aussicht darauf besteht, gesellschaftliche Akzeptanz für den Gedanken vollständiger oder auch nur weitgehender Determiniertheit des menschlichen Handelns zu erzielen. Es entspricht eben alltäglichen Anschauungen, dass das Gegenüber die Freiheit hat, sein eigenes Tun oder Unterlassen zu steuern, weshalb der Betreffende auch als grundsätzlich verantwortlich für die schädigenden Folgen angesehen wird, die er dadurch herbeiführt – von Ausnahmen wie kleinen Kindern oder Menschen, die unter einer schweren geistigen Beeinträchtigung leiden, einmal abgesehen. Freiheit ist in diesem Sinne ein zumindest für die gegenwärtige Gesellschaft normativ notwendiges Prädikat. «Pointiert gesagt ist es nicht nur so, daß Verantwortung Freiheit voraussetzt; vielmehr wird zugleich auch Freiheit unterstellt, um Verantwortung zuschreiben zu können.»[6]
Als Subjekt von Verantwortung kommt daher nur in Betracht, wer die Fähigkeit besitzt, sein Verhalten an der jeweiligen Verhaltensvorgabe auszurichten. Nur derjenige kann für einen Verstoß gegen das Recht oder ethische Regeln zur Rechenschaft gezogen werden, der überhaupt dazu in der Lage ist, die überwiegenden Gründe für das Ver- oder Gebot zu erfassen, gegen das er verstoßen hat. Zum Beispiel bei kleinen Kindern ist dies bei komplexen Verhaltensvorgaben in aller Regel nicht der Fall. Sie können zwar häufig zumindest nachvollziehen, dass von ihnen etwas Bestimmtes verlangt wird – oftmals aber nicht die Gründe dafür. Letzteres ist allerdings in einem freiheitlichen Gemeinwesen entscheidend. Das Grundgesetz fußt auf dem Bild des prinzipiell vernunftbegabten und in diesem Sinne «mündigen» und eigenverantwortlichen Bürgers.[7] Rechtliche bzw. gesetzliche Vorgaben richten sich an Bürger, nicht an Untertanen, denen ein bloßer Gehorsam abverlangt würde.[8] So liegt dem Recht die Idee zugrunde, dass sich prinzipiell jeder Einzelne unter Anstrengung seiner eigenen Vernunftbegabung von den Gründen affizieren lässt, die für die eine oder andere Verhaltensvorgabe sprechen. Dies lässt sich auf die Ethik übertragen. Zur ethischen wie rechtlichen Verantwortung gehört es daher, dass bei ihrem Subjekt die grundsätzliche Fähigkeit vorhanden ist, sich von Gründen ansprechen zu lassen, die für ein spezifisches Ge- oder Verbot sprechen. Liegt sie nicht vor, kommt die Person nicht als Träger von Verantwortung in Betracht – mit der Konsequenz, dass ihr nichts abzuverlangen ist und sie für abweichendes Verhalten nicht zur Rechenschaft gezogen werden kann.[9]
Neben der Fähigkeit, die Gründe für eine bestimmte Norm zu erkennen und sich davon ansprechen zu lassen, setzt Verantwortung die grundsätzliche Freiheit des Einzelnen voraus, gemäß dieser Einsicht zu handeln. Letztere liegt zum Beispiel dann nicht vor, wenn der Betreffende zwar erkennt, dass ein bestimmtes Tun oder Unterlassen in seiner Situation geboten ist, er aber nicht die Fähigkeit besitzt, dem zu entsprechen. Zum Beispiel: Eine Pflicht, einen anderen Menschen aus dem reißenden Fluss vor dem Ertrinken zu retten, kann nur dann bestehen, wenn der potentielle Retter ein guter Schwimmer ist.[10] Bringt er sich selbst durch die Rettung aufgrund mangelnder Fähigkeiten in Lebensgefahr, ist ihm dies nicht abzuverlangen.
Gegenüber der Schuld erweist sich der Verantwortungsbegriff insoweit als vorteilhaft, als er das Kommunikative des Zuschreibungsprozesses sprachlich deutlich besser zum Ausdruck bringt. In ihrer etymologischen Bedeutung weist die Verantwortung nämlich auf das «Antwortgeben» zurück und zeichnet dabei ein zweiseitiges Verhältnis von Rede und Antwort.[11] Nicht zuletzt für das Strafrecht, für das der Begriff der Schuld bis heute zentral ist, erweist sich diese Perspektive als mehr als treffend, schließlich ist doch gerade der Akt der Bestrafung ein Vorgang der Kommunikation zwischen Gesellschaft und Täter: Wer durch sein Verhalten gegen ein rechtliches Ge- oder Verbot verstößt, kommuniziert gegenüber der Gesellschaft, dass die jeweilige in der Situation ihn konkret betreffende Norm für ihn nicht gilt. Er nimmt sich dabei ein Mehr an Freiheit, das ihm nicht zusteht, und stellt in diesem Umfang das Recht in Frage. Durch die Bestrafung «antwortet» ihm die Gesellschaft auf seine ungerechtfertigte Freiheitsanmaßung und teilt ihm mit, dass er falschliegt, das Recht auch für ihn gilt und er daher ein Quantum seiner Freiheit opfern muss, um einen Ausgleich für das unberechtigt Erlangte zu erzielen.[12]
Damit enthält der ältere retrospektive Verantwortungsbegriff zumindest vier Elemente: ein Subjekt, ein Objekt, ein bestimmtes System von Bewertungsmaßstäben sowie eine Instanz der Verantwortung.[13] Letztere bildet im rechtlichen Zusammenhang die Rechtsgemeinschaft, im Prozess vertreten durch das Gericht, während im ethischen Zusammenhang von so unterschiedlichen Instanzen wie Gott, der Gemeinschaft, dem eigenen Gewissen, der allgemein geteilten Vernunft oder dem Naturgesetz die Rede ist.[14]
Neben das retrospektive Verantwortungsverständnis tritt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein weiterer Begriff der Verantwortung, der seinen Blick bildlich gesprochen in die Zukunft richtet. Die Rede ist von prospektiven Verantwortungsmodellen, die angesichts der Veränderungen des menschlichen Handelns, die seit dem 18. Jahrhundert einsetzten, bedeutsam wurden. Infolge grundlegender neuer Arbeitsstrukturen, die durch ein hohes Maß an Arbeitsteilung und eine immer weitere technische Durchdringung gekennzeichnet waren, erwies sich die bloße Klärung der Frage, wer für eingetretene Schäden verantwortlich ist, als unzureichend, um den neuen gesellschaftlichen Herausforderungen zu begegnen.[15] Diese lagen insbesondere darin, dass die Verbindung zwischen Handlungsfolgen und deren Urheber immer mehr verwischte – sei es aufgrund der menschlichen Arbeitsteilung oder infolge der Selbsttätigkeit technischer Werkzeuge, die immer häufiger zum Einsatz kamen. Zugleich traten zunehmend Schädigungen ein, die in ihrer Intensität und Reichweite eine gesellschaftliche Dimension besaßen und infolge verbesserter Kommunikationsmedien auch viel stärker in der Breite der Bevölkerung wahrgenommen wurden.[16] In der Konsequenz richtete sich der gesellschaftliche Fokus mehr und mehr auf Fragen der Prävention und in diesem Zusammenhang nicht zuletzt auf die Rolle des Staates, dem gegenüber dem Bürger eine Schutzfunktion zukommt, der er gerade auch durch Regulierung nachkommen kann.