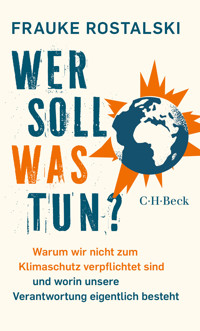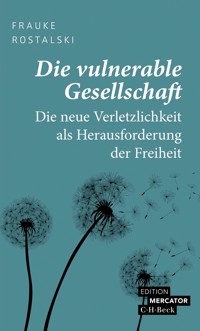
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Viele der gegenwärtig sehr heftig geführten Debatten sind Ausdruck einer schleichenden Werteverschiebung. Sie verändert unsere Gesellschaft grundlegend, ist uns aber kaum bewusst. Mehr und mehr scheinen wir bereit, Einschränkungen unserer individuellen Freiheit hinzunehmen, um einem gesteigerten Sinn für Verletzbarkeit gerecht zu werden. So verwandeln wir uns langsam in eine Gesellschaft von "Vulnerablen". In ihrer packenden Untersuchung macht uns Frauke Rostalski auf diesen neuen Konflikt zwischen Freiheit und Verletzlichkeit aufmerksam – und plädiert für ein offenes Gespräch: Wieviel Vulnerabilität möchten wir uns auf Kosten der Freiheit zugestehen? Rostalski zeigt, wie sehr Vorstellungen von Vulnerabilität bereits zu Veränderungen im Recht geführt haben – nicht nur in Fragen medizinischer Risiken wie einer Pandemie, sondern auch im Bereich der sexuellen Selbstbestimmung, der Suizidbeihilfe, des Schutzes vor Diskriminierung und des Schwangerschaftsabbruchs. Vulnerabilität ist aber nicht nur das heimliche Leitmotiv eines neuen Rechts und einer neuen Ethik. Die neue Empfindlichkeit hat auch unsere Debattenkultur eingenommen und blockiert so gesellschaftliche Aushandlungsprozesse. Frauke Rostalski fordert uns dazu auf, diese «Diskursvulnerabilität» in Schach zu halten – damit wir das dringende Gespräch über Freiheit und Verletzbarkeit auch wirklich führen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Frauke Rostalski
Die vulnerable Gesellschaft
Die neue Verletzlichkeit alsHerausforderung der Freiheit
C.H.Beck
Zum Buch
Viele der gegenwärtig sehr heftig geführten Debatten sind Ausdruck einer schleichenden Werteverschiebung. Sie verändert unsere Gesellschaft grundlegend, ist uns aber kaum bewusst. Mehr und mehr scheinen wir bereit, Einschränkungen unserer individuellen Freiheit hinzunehmen, um einem gesteigerten Sinn für Verletzbarkeit gerecht zu werden. So verwandeln wir uns langsam in eine Gesellschaft von «Vulnerablen».
In ihrer packenden Untersuchung macht uns Frauke Rostalski auf diesen neuen Konflikt zwischen Freiheit und Verletzlichkeit aufmerksam — und plädiert für ein offenes Gespräch: Wieviel Vulnerabilität möchten wir uns auf Kosten der Freiheit zugestehen? Rostalski zeigt, wie sehr Vorstellungen von Vulnerabilität bereits zu Veränderungen im Recht geführt haben — nicht nur in Fragen medizinischer Risiken wie einer Pandemie, sondern auch im Bereich der sexuellen Selbstbestimmung, der Suizidbeihilfe, des Schutzes vor Diskriminierung und des Schwangerschaftsabbruchs. Vulnerabilität ist aber nicht nur das heimliche Leitmotiv eines neuen Rechts und einer neuen Ethik. Die neue Empfindlichkeit hat auch unsere Debattenkultur eingenommen und blockiert so gesellschaftliche Aushandlungsprozesse. Frauke Rostalski fordert uns dazu auf, diese «Diskursvulnerabilität» in Schach zu halten — damit wir das dringende Gespräch über Freiheit und Verletzbarkeit auch wirklich führen können.
Vita
Frauke Rostalski, geboren 1985, ist Professorin für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie, Wirtschaftsrecht, Medizinstrafrecht und Rechtsvergleichung an der Universität zu Köln. Seit 2020 ist sie Mitglied des deutschen Ethikrates. Zuletzt ist von ihr erschienen: «Der Tatbegriff im Strafrecht» (2019) und «Das Natürlichkeitsargument bei biotechnologischen Maßnahmen» (2019).
Inhalt
Einleitung
1: Kennzeichen einer vulnerablen Gesellschaft
Vulnerabilität und Resilienz
Die Ausweitung der Risikozone
2: Der Staat der vulnerablen Gesellschaft
Staat und Freiheit: Eine kleine Geschichte der Souveränität
Wovor man sich mehr zu fürchten hat: Der vorsorgende Staat oder die Freiheit zum Konflikt
Staatliche Risikovorsorge in der vulnerablen Gesellschaft
3: Das Recht auf dem Weg in die vulnerable Gesellschaft
Die neue Verletzlichkeit der Ehre
Der logische Dreischritt der Vulnerabilität: Ausdehnungen des Strafrechts zum Schutz der sexuellen Selbstbestimmung
Die rechtliche Regulierung der Suizidassistenz
Das Selbstbestimmungsrecht und die neue Vulnerabilität der schwangeren Frau
Pandemiepolitik der vulnerablen Gesellschaft
4: Diskursvulnerabilität
Was Diskursvulnerabilität ist und was aus ihr folgt
Debattenkulturen in Zeiten von Diskursvulnerabilität
Freiheitsverluste infolge von Diskursvulnerabilität
5: Vulnerabilität und Freiheit
Schluss
Danksagung
Anmerkungen
Einleitung
Kennzeichen einer vulnerablen Gesellschaft
Der Staat der vulnerablen Gesellschaft
Das Recht auf dem Weg in die vulnerable Gesellschaft
Diskursvulnerabilität
Vulnerabilität und Freiheit
Register
Einleitung
Die Rede von Vulnerabilitäten erlebt heute eine Konjunktur. In das Licht der Öffentlichkeit ist der Vulnerabilitätsbegriff spätestens in den Coronajahren getreten. Natürlich gab es ihn auch schon früher. Verwendet wurde er dann allerdings vornehmlich in akademischen Diskursen der Sozial- und Kulturwissenschaften, in der Medizin und Psychologie. Dies hat sich grundlegend verändert. Zum Modewort avancierte die Vulnerabilität während der Pandemie als Bezeichnung derjenigen, deren Gesundheit durch eine Infektion mit dem Coronavirus besonders gefährdet war. Dabei handelte es sich vornehmlich um Ältere und Vorerkrankte, wenngleich einige Stimmen zugleich auf die Vulnerabilität derer hinwiesen, die in besonderer Weise von den Coronaschutzmaßnahmen betroffen waren. Der Deutsche Ethikrat schrieb hierzu:
Nicht nur ältere und behinderte Menschen, sondern auch junge Menschen, Familien und Kinder waren in verschiedenen Phasen und in unterschiedlicher Form verletzlich oder verletzbar. […] [Verschiedene] Problemlagen haben verdeutlicht, dass gerade auch jüngere Menschen durch Schutzmaßnahmen in besonderer Weise eingeschränkt wurden und in der Folge in erheblichem Umfang von spezifischen psychosozialen Schwierigkeiten betroffen waren, obwohl sie im Vergleich zu älteren ein geringeres Risiko für die Entwicklung schwerer Krankheitssymptome und letaler Verläufe haben.[1]
Aus dem Kontext der Pandemie gelang dem Vulnerabilitätsbegriff allerdings schnell der Sprung in ganz andere gesellschaftliche Themenfelder. Mittlerweile werden Vulnerabilitäten in sehr unterschiedlichen Lebensbereichen und im Hinblick auf viele verschiedene Menschen und Personengruppen festgestellt. Als vulnerabel werden beispielsweise Sexarbeiterinnen[2] und Opfer sexualisierter Gewalt[3] bezeichnet, aber die Begrifflichkeit findet auch Anwendung auf Geflüchtete,[4] Transgender,[5] arme Länder,[6] Lebensphasen,[7] digitale Gesellschaften,[8] die kritische Infrastruktur[9] u.v.m. Es zeigt sich: Vulnerabilität hat als Begriff den Wortschatz breiter Bevölkerungsteile bereichert. Seine geradezu inflationäre Verwendung lässt die Annahme zu, dass er eine Lücke geschlossen hat – und so vielleicht ein präziseres Sprechen über die Verletzlichkeit bestimmter Personen oder Institutionen ermöglicht als zuvor. Dabei deutet die Häufigkeit, in der von Vulnerabilitäten in ganz verschiedenen Zusammenhängen die Rede ist, darauf hin, dass der Begriff einen Nerv getroffen hat. Er wird immer dann herangezogen, wenn ein besonders wichtiges Anliegen artikuliert werden soll. Dieser Zusammenhang leitet sich unmittelbar aus der Verwendung des Vulnerabilitätsbegriffs in der Corona-Pandemie ab. Weil es darin um den Schutz von Leib und Leben einzelner Menschen ging, war der Begriff von Anfang an mit einer starken Wertung aufgeladen. Es liegt nahe, dass dieser Bedeutungsgehalt über den Kontext der Pandemie hinausgetragen wurde. Wer gegenwärtig in einem anderen Bereich auf Vulnerabilitäten hinweist, verbindet damit in aller Regel wiederum eine sehr starke Wertung. Die Kennzeichnung von Menschen als vulnerable dient also dazu, deren Anliegen und Interessen als besonders bedeutsam zu markieren und die Gesellschaft hierauf aufmerksam zu machen.
Wenig überraschend findet sich der Vulnerabilitätsbegriff daher gerade in denjenigen gesellschaftlichen Debatten, die gegenwärtig besonders intensiv geführt werden. Zu denken ist nur an Fragen der sozialen Gerechtigkeit oder des Klimawandels. In beiden Kontexten findet sich der Vulnerabilitätsbegriff mit einer gewissen Konstanz und Häufigkeit. Er macht etwa darauf aufmerksam, dass Angehörige sozial marginalisierter Gruppen gegenüber Angriffen auf ihre Person besonders schutzlos sind. Ein Beispiel liefert der digitale Raum, in dem sich Beleidigungen dieser Personengruppen häufen und auf sie besonders einschüchternd wirken. Im Zusammenhang mit dem Klimawandel kennzeichnet der Begriff der Vulnerabilität die spezifische Ausgesetztheit des Menschen gegenüber der Natur und den klimatischen Veränderungen. Die für die Coronazeit so typische tiefgreifende Erfahrung eigener und kollektiver Vulnerabilität findet hier ihre Fortsetzung. Zumal die aktuellen weltpolitischen Entwicklungen kaum Zeit geben zum Durchatmen, Aufarbeiten oder Vergessen. Der seit Februar 2022 andauernde russische Angriffskrieg auf die Ukraine verdeutlicht seinerseits die besondere Verletzlichkeit des Menschen. Und auch schon vorher erschien das gesellschaftliche Leben manchen immer mehr als Stolpern von einer Krise in die nächste – ob diese nun das Währungssystem, den Immobilienmarkt oder den Umgang mit geflüchteten Menschen betraf. All diese Ereignisse sind geradezu prädestiniert dafür, die Verwundbarkeit des Einzelnen und der Gesellschaft in den Blickwinkel zu rücken. Es kann daher wenig verwundern, dass Vulnerabilitäten zunehmend auffallen und offen diskutiert werden. Was allerdings eher neu zu sein scheint, ist der Umfang, in dem Vulnerabilitäten ernstgenommen werden. Dass Vulnerabilität ein Grund dafür ist, gesellschaftlich mehr und mehr aktiv zu werden – hierin liegt ein Phänomen, dessen nähere Betrachtung mir lohnenswert erscheint.
Sei es zur Stärkung der Rechte sozial marginalisierter Gruppen oder zur positiven Beeinflussung der klimatischen Entwicklungen durch menschliche Verhaltensänderungen: Einsichten in individuelle wie kollektive Verwundbarkeiten zeitigen gegenwärtig mitunter besonders weitreichende Konsequenzen. Sie schaffen teilweise erst die Basis dafür, dass wichtige gesellschaftliche Schritte eingeleitet werden, um einer bestimmten Herausforderung entgegenzutreten. Nicht selten gehören zu diesen Schritten auch rechtliche. Für den Kampf gegen das Coronavirus, gegen soziale Ungerechtigkeiten und den Klimawandel bietet sich das Recht als ein wirksames gesellschaftliches Handlungsinstrument an. Überraschend ist dies nicht: Umso wichtiger die Ziele, die eine Gesellschaft verfolgt, desto wahrscheinlicher ist es, dass bei ihrer Umsetzung auch das Recht zum Einsatz kommt – weil das Recht nicht zuletzt aufgrund seiner Möglichkeit der zwangsweisen Durchsetzung eine besondere Effizienz der jeweiligen Maßnahme verspricht. Vulnerabilität ist damit auch ein rechtliches Thema. Umso wichtiger der Gesellschaft der Schutz Vulnerabler wird, desto näher liegt der Einsatz des Rechts. Aktuelle Debatten über Vulnerabilität lassen sich deshalb zugleich als ein Zeichen dafür deuten, dass eine Wertediskussion ansteht und ein Wertewandel im Gang ist – ein Wandel, der nicht zuletzt mit rechtlichen Mitteln vollzogen werden soll.
Damit tritt aber eine weitere Kategorie auf den Plan, die für das gesellschaftliche Miteinander von besonderer Bedeutung ist: die Freiheit. Weil Recht zwingt, muss es sich in einer freiheitlichen Ordnung rechtfertigen. Dient Recht dazu, vulnerable Personen zu schützen, gerät dieses Schutzziel in ein Spannungsverhältnis zur individuellen Freiheit. Das macht es so wichtig, die Konjunktur von Vulnerabilitäten näher zu betrachten. Je verletzlicher sich eine Gesellschaft bzw. ihre Mitglieder begreifen, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie sich vor Risiken durch das Recht schützen wollen. Gesetze, Maßnahmen oder sonstige Rechtsakte bedeuten aber grundsätzlich eine Beschneidung individueller Freiheit. Es liegt daher eine besondere Herausforderung darin, beides miteinander in Einklang zu bringen: das Bedürfnis, Vulnerabilitäten zu schützen – und zwar möglicherweise umfänglicher als bislang –, und die verfassungsrechtlich garantierte Freiheit einzelner Bürger.
Dabei kann schon die These auf Kritik stoßen, staatliche Maßnahmen zum Schutz vulnerabler Personen oder Gruppen würden zu individuellen Freiheitsverlusten führen. Verbreitet ist demgegenüber nämlich die Annahme, dass es insbesondere im Bereich von Fragen sozialer Gerechtigkeit vornehmlich darum gehe, Freiheiten neu zu verteilen. Vereinfacht gesprochen ist damit gemeint, dass der staatlich erzwungene Freiheitsverlust des einen zu einem Freiheitszugewinn des anderen führt, und zwar in dem Sinne: den einen wird genommen, was den anderen gegeben wird. Auch wenn sich diese Vorstellung häufig lesen lässt, trifft sie nicht zu. Vielmehr möchte ich aufzeigen, dass immer dann, wenn der Staat mit seinen Mitteln dafür sorgt, Vulnerable zu schützen, Freiheit auf allen Seiten verloren geht – nicht bloß bei denjenigen, die zu den jeweils «Stärkeren» gehören. Alle verlieren Freiheit, auch die Vulnerablen, sobald der Staat eingreift. Auf die Debatten über neue Gesetze zum Schutz vulnerabler Personen – sei es im Kontext des Klimawandels, sozialer Gerechtigkeit oder des Umgangs mit Umweltrisiken – kann sich diese Einsicht erheblich auswirken. So drängt sich bisweilen der Eindruck auf, der Streit habe sich darum zu drehen, wer wem wieviel Freiheit «schulde» – wer wieviel seiner eigenen Freiheit abgeben muss, damit der andere mehr davon hat als bislang. Dieses Bild ist aber aus rechtlicher Perspektive schief und bedarf dringend der Korrektur. Davon verspreche ich mir nicht zuletzt einen klareren Blick auf die Sachprobleme, die gegenwärtigen und künftigen gesellschaftlichen Debatten zugrunde liegen. Geht es um die Freiheit, sollten wir richtigerweise nicht über «Verteilungskämpfe» zwischen den Bürgern bzw. unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen sprechen und uns von Neid bzw. Besitzdenken leiten lassen. Wenn überhaupt, kommt es zu einer Verteilung zwischen Bürgern und Staat – denn hoheitliche Maßnahmen zum Schutz vulnerabler Menschen sorgen allein bei letzterem für einen uneingeschränkten Zugewinn an Handlungsmacht. Die Freiheit des einen fließt also gerade nicht in die Hände eines anderen Bürgers, sondern primär in die des Staates.
Dabei vertrete ich die These, dass Vulnerabilitäten bereits in einer Vielzahl von Gesetzen Einfluss auf die Rechtsentwicklung genommen haben – und zwar weit über die Grenzen der Pandemie oder Fragen der sozialen Diskriminierung hinaus. Besondere Verletzlichkeit hat ihre Spuren im Recht hinterlassen, nicht zuletzt im Strafrecht. Diese Veränderungen sind weitreichend und greifen tief in individuelle Freiheiten ein. Ein Anliegen dieses Buches ist es daher, auf eben jenen bereits im gegenwärtigen Recht anzutreffenden Zusammenhang aufmerksam zu machen und ihn dem Leser näher zu erläutern: Kommt es zum Schutz vulnerabler Personen durch staatliche Maßnahmen, gehen allen Mitgliedern der Gesellschaft Freiheitssphären verloren.
Mir geht es in erster Linie nicht darum, diese Entwicklung zu kritisieren. Nach meiner persönlichen Auffassung werden Vulnerabilitäten zu Recht in verschiedenen Lebensbereichen ernstgenommen – und ihr Schutz wird gesellschaftlich mitunter auch zu Recht gerade durch Gesetze vollzogen. Ein Beispiel liefert das Sexualstrafrecht: In den letzten Jahren hat sich vieles bewegt, was den Schutz der sexuellen Selbstbestimmung angeht. Grund dafür sind nicht zuletzt wichtige Einsichten darin, wie schwer Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung für die Opfer wiegen. Insofern treffe ich gerade nicht die Aussage, dass jedes Nachgeben gegenüber den Interessen vulnerabler Personen durch staatliche Maßnahmen negativ sei. Aus meiner Sicht wäre es falsch, einen allzu simplifizierenden Antagonismus zwischen Vulnerabilität und individueller Freiheit aufzubauen, der dann einseitig zugunsten der letzteren aufgelöst wird – mit dem Ergebnis, dass Vulnerabilitäten gar in Gänze für das Recht als irrelevant eingestuft würden. Weder der Komplexität des Themas noch der auch rechtlichen Bedeutung von Vulnerabilitäten würde dies im Ansatz gerecht. In welcher Weise individuelle Freiheit und Vulnerabilitätsvorstellungen in einem Spannungsverhältnis stehen, und wie deren Spannung schlussendlich aufzulösen ist, kann nur von Fall zu Fall entschieden werden. Was für die Ausweitung des Sexualstrafrechts richtig ist, muss in anderen Bereichen nicht stimmen. Es ist nicht das Anliegen dieses Buches, definitive Antworten auf Detailfragen zu geben. Der Leser wird also am Ende wenig darüber erfahren, was nach meiner Auffassung mehr wiegt: die Selbstbestimmungsfreiheit der vulnerablen Schwangeren oder der Lebensschutz des ungeborenen Kindes, wenn es um die Frage des Schwangerschaftsabbruchs geht. Oder aber die Selbstbestimmungsfreiheit Suizidwilliger verglichen mit dem Lebensschutz, wenn wir uns der rechtlichen Regulierung der Suizidassistenz widmen. Ich beantworte diese aktuellen Rechtsfragen nicht abschließend. Ich ziehe ihre Analyse vielmehr dazu heran, um meine These zu stützen, dass Vulnerabilitäten in den letzten Jahrzehnten bereits spürbar auf die Entwicklung des Rechts Einfluss genommen haben.
Dieser Befund rührt letztlich an einer der Grundfragen eines freiheitlichen Rechtsstaats: Wie sehr beschneidet die Gesellschaft individuelle Freiheiten, um ihrem Sicherheitsbedürfnis Rechnung zu tragen? Denn im Kern versteckt sich hinter dem Verweis auf Vulnerabilitäten eben dies: der Wunsch nach mehr Sicherheit für bestimmte Menschen und deren Rechtspositionen. Daher lohnt es, diese so alte und zugleich grundlegende rechtliche Fragestellung anhand der Konjunktur von Vulnerabilitäten erneut und insoweit in einem anderen Licht zu betrachten. Denn eines hat sich durchaus verändert: Vulnerabilitäten spielen eine zunehmende und stetig wachsende Rolle, wenn es um die Veränderung der geltenden Gesetze geht. Es lässt sich gar sagen, dass Vulnerabilität mehr und mehr zum Leitmotiv von Gesetzesreformen wird. Vollziehen sich also derzeit rechtliche Erneuerungen, stehen Vulnerabilitäten meist im Vordergrund. Der Verweis auf die besondere Verletzlichkeit bestimmter Personen oder Gruppen markiert die Bedeutsamkeit damit verbundener Rechtspositionen und sorgt dafür, dass es zu relevanten Verschiebungen in der gesellschaftlichen Sicherheitsarchitektur kommt. Infolge gewachsener Vulnerabilitätsannahmen werden Einzelne oder Gruppen stärker durch Gesetze geschützt – mit der Folge einer Ausdehnung staatlicher Hoheitsbefugnisse. Insofern folgt aus meiner Analyse die Diagnose, dass sich die Gesellschaft selbst immer mehr in eine vulnerable entwickelt. Dieser Prozess findet Ausdruck in einer Vielzahl an Gesetzesänderungen.
Dabei ist eine Gesellschaft innerhalb der verfassungsrechtlichen Grenzen prinzipiell frei darin, das Maß ihres auch rechtlich abgesicherten Sicherheitsbedürfnisses offen auszuhandeln und damit die Grenzen individueller Freiheit in die eine oder andere Richtung zu verschieben. Das heißt also, dass gerade auch besonders ausgeprägten Vulnerabilitätsvorstellungen prinzipiell durch Gesetze, die in einem demokratischen Verfahren zustande gekommen sind, Rechnung getragen werden darf. Die darin zum Ausdruck kommenden gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse sind in ihrem Ergebnis unter Achtung des Verfassungsrechts grundsätzlich frei. Problematisch erscheint mir aber, dass sich die derzeitige Entwicklung einer zunehmenden Bedeutung von Vulnerabilitätsannahmen in der Rechtsfortbildung weniger offen vollzieht, als dies wünschenswert wäre. Denn wenn sich relevante rechtliche Grunddeterminanten einer Gesellschaft verschieben, indem Freiheitsspielräume neu vermessen werden, erscheint es ratsam, derartige Prozesse in vollem Bewusstsein zu vollziehen. Und dieses Bewusstsein sollte nicht bloß auf den vergleichsweise kleinen Kreis juristischer Experten begrenzt sein. Wieviel Freiheit in der Gesellschaft gewährt wird, ist Angelegenheit aller Bürger. Gesetze sind Ergebnisse von Aushandlungsprozessen, in denen genau solche Fragen diskutiert werden sollten wie die, ob bzw. in welchem Umfang Vulnerabilitäten durch das Recht Rechnung zu tragen ist.
Kernanliegen dieses Buches ist es daher, zu eben jenen Aushandlungsprozessen beizutragen, die die Gesellschaft aktuell und künftig führt, wenn es um Veränderungen der geltenden Rechtslage geht. In einem ersten Schritt erläutere ich deshalb das Spannungsverhältnis, in dem Vulnerabilitätsvorstellungen und individuelle Freiheit stehen. Im Anschluss daran geht es mir darum, anhand verschiedener Rechtsentwicklungen der jüngeren Zeit zu verdeutlichen, wie sehr veränderte Vulnerabilitätsvorstellungen bereits Einfluss auf die Gesetzeslage genommen haben. Es zeigt sich, dass Vulnerabilität deutlich ernster genommen wird als noch vor einigen Jahrzehnten. Darüber hinaus werden Vulnerabilitäten in neuen Lebensbereichen ausgemacht, für die sodann ein rechtlicher Handlungsbedarf angemeldet wird. Dies hat zu einer spürbaren Reduzierung von individueller Freiheit geführt.
Dabei möchte ich bereits einleitend dem möglichen Einwand begegnen, der Hinweis auf den Verlust an individueller Freiheit infolge verstärkter Vulnerabilitätsvorstellungen diene mir lediglich dazu, die berechtigten Belange sozial marginalisierter und deshalb zugleich vulnerabler Menschen zu unterminieren. Eine solche Kritik spielt sich auf einer Ebene ab, die jedenfalls nicht primär Gegenstand dieses Buches ist. Mir geht es hier nicht darum, zu bewerten, ob die eine oder andere Rechtsentwicklung der Sache nach gerechtfertigt ist oder nicht – zumal die Blickverengung auf Fragen der sozialen Gleichstellung marginalisierter Gruppen das ganze Konfliktfeld von Vulnerabilität und Freiheit, das sehr verschiedene gesellschaftliche Bereiche betrifft, nicht angemessen ins Bild zu setzen vermag. Insofern dringe ich erst gar nicht vor zu der Frage, wie bedeutsam in bestimmten Kontexten die schutzwürdigen Interessen von vulnerablen Personen sind, und ob diese es rechtfertigen, individuelle Freiheiten durch Gesetze einzuschränken. Es ist auch aus meiner Sicht wichtig, auf diese Fragen von Fall zu Fall Antworten zu finden – und zwar «als Gesellschaft». Solche Antworten können allerdings nur in einem Prozess der demokratischen Aushandlung gefunden werden. Und hierfür erscheint es mir wichtig, diese so wichtigen Aushandlungen dadurch zu unterstützen, dass Kenntnisse darüber vermittelt werden, wie sehr Vulnerabilitätsvorstellungen bereits in der Vergangenheit Einfluss auf das Recht genommen haben. Dies kann von Bedeutung sein, wenn es um eine Entscheidung darüber geht, ob dieser Weg immer weiter zu verfolgen ist oder ob bestimmte Bereiche individueller Freiheit selbst zum Schutz von Vulnerabilitäten nicht angetastet werden sollten. Zumal ich in diesem Buch aufzeige, dass auch vulnerable Menschen, zu deren Schutz staatliche Maßnahmen ergriffen werden, individuelle Freiheit verlieren – ein Umstand, der in den gegenwärtig geführten Debatten allzu oft übersehen wird, sich aber auf das Ergebnis des Aushandlungsprozesses durchaus auswirken könnte.
Das Thema der Vulnerabilität spielt für demokratische Aushandlungsprozesse allerdings nicht allein deshalb eine Rolle, weil es darin auf Einsichten in den Zusammenhang zwischen gesteigerten Vulnerabilitätsannahmen und der Beschneidung individueller Freiheit ankommt. Denn es gibt eine Form von Vulnerabilität, die sich unmittelbar auf Verfahren der Deliberation auswirkt und daher in einer Arbeit über das Spannungsverhältnis von Freiheit und Vulnerabilität nicht fehlen darf. Die Rede ist von einem Phänomen, das ich als Diskursvulnerabilität bezeichnen möchte. Gemeint ist damit, dass sich Menschen als besonders verwundbar durch das Gespräch selbst erweisen – und zwar insbesondere bei gesellschaftlich wichtigen Fragen wie zum Beispiel dem Umgang mit der Corona-Pandemie oder der Lieferung schwerer Waffen in Kriegsgebiete. Das bloße Sprechen über ein bestimmtes Thema kann stark negative Gefühle der Betroffenheit auslösen, in denen sich die Verletzbarkeit von Einzelnen niederschlägt. Für sie wird das Gespräch selbst zum Grund für persönliches Leid. Dieses mittlerweile häufig auftretende Phänomen äußert sich in einer Abkehr von gängigen und guten Formen des Diskurses – man kann sagen: in einer Diskursverrohung. Beispiel dafür sind der Ausschluss von Menschen aus der jeweiligen öffentlichen Debatte, deren Positionen als verletzend wahrgenommen werden, oder von spezifischen Argumenten und Standpunkten, die ihrerseits die Gefühle mancher Gesprächsteilnehmer verletzen können. Diskursvulnerabilität erweist sich als schädlich für den freien Austausch von Ideen und Meinungen, wie er den Kern einer Demokratie bildet. Werden Personen, Argumente oder ganze Themen aus dem Diskurs ausgeschlossen, bedroht dies die Qualität der Ergebnisse, die im Rahmen des jeweiligen gesellschaftlichen Aushandlungsprozesses erzielt werden. Dies wiederum hat negative Konsequenzen für die individuelle Freiheit. Denn ein schlechtes Ergebnis liegt beispielsweise dann vor, wenn Gesetze erlassen werden, die die Freiheit des Einzelnen mehr einschränken, als dies gerechtfertigt ist – etwa aus dem Grund, weil wichtige Argumente im Diskurs kein Gehör finden konnten.
Am Ende handelt dieses Buch also davon, worüber und wie gesellschaftlich bei gegenwärtigen und künftigen Gesetzesreformen gesprochen werden sollte. Es möchte einen Beitrag leisten zu Inhalt und Ausgestaltung von Debatten – und fußt dabei auf der Einsicht, dass der Diskurs als solcher für eine Demokratie essenziell ist und deren eigentliche Stärke begründet. In der Beobachtung verschiedener Diskurse der jüngeren Zeit drängt sich der Eindruck auf, dass eben dieses Kernelement einer lebendigen Demokratie mehr und mehr Störquellen ausgesetzt ist. Risiken drohen dabei gerade von innen: Weil manche die Überzeugung verloren zu haben scheinen, dass es sinnvoll ist, miteinander zu sprechen, selbst wenn das Gegenüber ganz anderer Meinung ist. Und weil manche angesichts der fundamentalen Herausforderungen, die der Gesellschaft beispielsweise im Hinblick auf den Klimawandel bevorstehen, ganz den Glauben an die Demokratie verloren haben oder zumindest auf dem Weg dahin sind. In dieser Gemengelage möchte ich für einen offenen Diskurs plädieren: Über Vulnerabilitäten und trotz (oder gerade wegen) eigener Vulnerabilität. Eines sollte nicht vergessen werden: Auch die Demokratie ist verletzlich. Und zwar insbesondere dann, wenn es um ihr Herzstück, den freien Diskurs, geht.
1
Kennzeichen einer vulnerablen Gesellschaft
Jeder Mensch ist verletzlich. Menschen können einander Wunden zufügen – physische wie psychische. Sie können krank werden, in wirtschaftliche Not geraten, einsam sein. Pandemien und Naturkatastrophen bedrohen den Wohlstand und die Existenz. Jeder muss eines Tages sterben. In ihrer Verletzlichkeit sind die Menschen unweigerlich aufeinander angewiesen. Das Kleinkind wird von seinen Eltern auf jedem seiner Schritte begleitet. Es wird gefüttert, an die Hand genommen, getragen. Der alte Mensch bedarf selbst wieder der Unterstützung durch andere, die seinen Arm halten und ihm den Alltag erleichtern, manches Mal auch erst ermöglichen. Wer schwer krank wird, ist auf Pflege angewiesen. Verletzlich sind auch diejenigen, die sich selbst nicht so fühlen. Ihre Unversehrtheit ist zerbrechlich. Verletzungen können sie jederzeit treffen und ihnen mitunter ganz plötzlich widerfahren. Wer heute stark ist, kann morgen schwach sein und der Hilfe bedürfen.
Verletzlichkeit weist verschiedene Dimensionen auf. Sie betrifft neben dem Körper des Menschen auch dessen Psyche und kann sich in ganz unterschiedlichen Weisen und Zusammenhängen zeigen, in denen der Mensch anderen und seiner Umwelt ausgesetzt ist. Die Gründe für ein solches Ausgesetztsein sind vielschichtig. Sie können sich aus der bloßen Nähe zu anderen ergeben, die Zugriff auf den eigenen Körper oder die eigene Psyche erlangen. Verletzlich ist der Mensch dann etwa gegenüber der Gefahr gewalttätiger Übergriffe oder verbaler Attacken. Die Unfähigkeit, sich anderen zu entziehen, kann aber auch aus bestimmten sozialen Strukturen erwachsen. Vulnerabilität zeigt sich in Abhängigkeitsverhältnissen wie etwa in der Schule, der Ausbildung oder in Einrichtungen der Pflege, soweit sie durch ein Machtgefälle bestimmt sind. Menschen können besonders verletzlich sein aufgrund bestimmter persönlicher Eigenschaften wie Behinderung, Krankheit oder Alter. Ebenso können sie durch ihre Lebensumstände vulnerabel sein, was sich beispielsweise bei Geflüchteten zeigt, die in Gemeinschaftsunterkünften leben, in denen wenige Rückzugsmöglichkeiten für den Einzelnen bestehen. Daneben sind Einsamkeit und wirtschaftliche Not wichtige Faktoren für die individuelle Verletzlichkeit des Menschen. Soziale Ungerechtigkeit schafft bzw. vertieft die Vulnerabilität der davon Betroffenen. Und nicht zuletzt: Verletzlichkeit äußert sich in einem spezifischen Grad der Ausgesetztheit gegenüber nichtmenschlichen Gewalten – wie etwa bei Überschwemmungen, starker Hitze und Trockenheit, Erdbeben oder Pandemien.
Im ersten Kapitel wollen wir die Merkmale einer vulnerablen Gesellschaft näher kennenlernen. Dazu widmen wir uns den für diese Untersuchung so wichtigen Begriffen der Vulnerabilität und der Resilienz. Ich beziehe mich dabei auf verschiedene Wissenschaftsdisziplinen, wobei ein Fokus auf der Philosophie von Emmanuel Lévinas liegt, der sich in besonderer Weise mit der Verletzlichkeit als Conditio humana befasst hat. Eine vulnerable Gesellschaft entsteht erst dann, wenn eine kritische Masse an Bürgern sich selbst als vulnerabel begreift. Es ist daher von vordringlichem Interesse, welche Eigenschaften einem Prototyp des vulnerablen Menschen zugeschrieben werden können. Hierüber geben die Gedanken Lévinas’ in besonderer Weise Aufschluss.
Vulnerabilitätsannahmen wirken sich darauf aus, wie von gesellschaftlicher Seite mit Risiken umgegangen wird. Von zentraler Bedeutung für eine vulnerable Gesellschaft ist daher auch die Wahrnehmung von Risiken und die Frage, wie diese verarbeitet werden. Dabei möchte ich dafür argumentieren, dass wachsende Zuschreibungen von Verletzlichkeit dazu führen, dass die eigenverantwortliche Risikobewältigung mehr und mehr in den Hintergrund rückt. Begreifen sich Menschen zunehmend als vulnerabel, liegt es nahe, dass sie im Umgang mit Risiken nach externer, vor allem staatlicher Unterstützung verlangen. In den Worten der Philosophin Svenja Flaßpöhler: «Je empfindsamer der Mensch für Gewalt, Leid, Tod wird, desto größer das Begehren, diese Gefahren verlässlich zu bannen. Je sensibler eine Gesellschaft, desto lauter der Ruf nach einem schützenden Staat.»[1] Für diese Entwicklung sprechen nicht zuletzt aktuelle Vorschläge aus dem rechtswissenschaftlichen Spektrum, die wir näher betrachten werden.