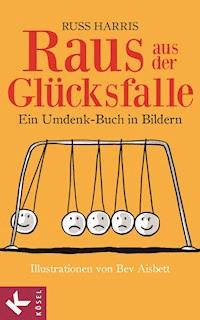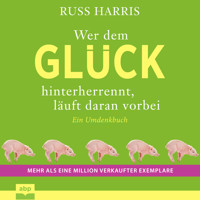19,99 €
Mehr erfahren.
Bestsellerautor Russ Harris hilft in seinem Ratgeber beim Umgang mit schwierigen Erlebnissen.
Das Leben läuft nicht immer so, wie wir es gerne hätten. Plötzlich passieren Dinge, die uns aus der Bahn werfen – und nichts ist mehr, wie es war. Der Tod eines geliebten Menschen, eine schwere Erkrankung oder der Verlust des Arbeitsplatzes kann wie ein Keulenschlag wirken. Aber auch weniger gravierende Ereignisse können wehtun und uns aus dem Gleichgewicht bringen.
Der erfahrene Therapeut und Bestsellerautor Russ Harris zeigt in der komplett überarbeiteten und aktualisierten Neuausgabe seines erfolgreichen Longsellers, wie wir die Herausforderungen des Lebens souverän meistern. Viele neue Beispiele und Übungen aus der Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT) verleihen diesem praktischen Selbsthilfebuch neue Aktualität. Es bestärkt und ermutigt und sollte von allen gelesen werden, die sich in einer kritischen Lebenssituation befinden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Der Autor
Dr. med. Russ Harris, geboren 1966, ist Arzt, Coach und Psychotherapeut. Seine Arbeitsschwerpunkte sind psychische Gesundheit, Psychoneuroimmunologie und Stressmanagement. Er leitet weltweit Ausbildungen für Psychologen und Therapeuten in ACT. Der Autor lebt mit seiner Familie in Melbourne, Australien.
www.actmindfully.com.au
Das Buch
Basierend auf dem Ansatz der Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT) stellt Russ Harris, international gefragter Ausbilder zahlreicher Psychologen, eine wirksame Strategie vor, Herausforderungen zu meistern, die uns aus der Bahn zu werfen drohen: der Tod eines geliebten Menschen, eine schwere Erkrankung oder Verletzung, ein Unfall oder der Verlust des Arbeitsplatzes. Er zeigt, wie wir schwierige Zeiten akzeptieren und durchstehen, schmerzhafte Erfahrungen bewältigen und die innere Balance wiedergewinnen.
Die Neuausgabe dieses erfolgreichen Longsellers enthält viele neue Beispiele und Übungen und erhält dadurch neue Aktualität.
Russ Harris
Wer vor dem Schmerz flieht, wird von ihm eingeholt
Unterstützung in schwierigen Zeiten
ACT in der Praxis
Aus dem Englischen von Bernhard Kleinschmidt
Kösel
Für mein einziges Kind. Als ich die erste Ausgabe dieses Buchs schrieb, warst du erst fünf Jahre alt, und jetzt, da ich an der zweiten arbeite, bist du ein junger Mann von vierzehn Jahren. In all der Zeit, die ich dich kenne, warst du mein bei Weitem größter Lehrer. Danke, dass du mir so viel darüber beigebracht hast, wie man leben und lieben kann, dass du mir geholfen hast, zu wachsen und mich zu entwickeln, und dass du so viel Freude und Liebe in mein Leben gebracht hat. Ich liebe dich mehr, als Worte sagen können.
Inhalt
Teil 1: Ein neuer Anfang
1 Wenn das Leben wehtut
2 Eins nach dem anderen
3 Freundliche Worte
4 Das Kämpfen aufgeben
5 Wenn es stürmisch wird
6 Mentaler Smog
7 Wahrnehmen und benennen
8 Leben und loslassen
9 Verbündete in unserem Inneren
10 Ein neugieriger Blick
11 Eine freundliche Hand
12 Wenn Erinnerungen wehtun
Teil 2: Das Leben wiederaufbauen
13 Dem Leben Sinn verleihen
14 Ein kleiner Schritt
15 Die Herausforderungsformel
16 Im Ärger gefangen
17 Es ist nie zu spät
18 Schlechte Gewohnheiten ablegen
Teil 3: Neue Lebenskraft gewinnen
19 Die Bühnenshow des Lebens
20 Die ganze Erfahrung
21 Freude und Leid
Anhang
Anhang A
Anhang B
Anhang C
Weiterführende Hinweise und Materialien
Danksagung
Verzeichnis der Übungen
Adressen
Teil 1
Ein neuer Anfang
1 Wenn das Leben wehtut
Nichts bereitet uns auf die Momente vor, in denen uns die Realität eine derartige Ohrfeige verpasst, dass wir zu Boden stürzen und unser Leben aus den Fugen gerät. So ein Realitätsschock kann viele unterschiedliche Formen annehmen: Es kann der Tod eines geliebten Menschen sein, eine schwere Erkrankung oder Verletzung, ein furchtbarer Unfall, Scheidung, Betrogenwerden, eine Gewalttat, Untreue, ein Verbrechen, Arbeitslosigkeit, Insolvenz, Krieg, ein Brand, eine Flutkatastrophe, ein Erdbeben, eine Pandemie … Die Liste ist endlos. Wir mögen solche Realitätsschocks nicht und würden gern darauf verzichten – aber wenn wir lange genug leben, begegnen sie uns allen. Dabei ist eines klar: Je größer der Schock, desto stärker sind unsere Schmerzen. Je nachdem, womit wir es zu tun haben, empfinden wir Betroffenheit, Traurigkeit, Wut, Angst, Nervosität, Beklemmung, Schuldgefühle, Scham, vielleicht sogar Hass, Verzweiflung oder Ekel. Manchmal ist der Schmerz so intensiv und unerträglich, dass unser Nervensystem die Führung übernimmt und unsere Gefühle gewissermaßen ausschaltet, sodass wir uns betäubt, leer oder innerlich tot fühlen.
Wenn wir Glück haben und der Schock nicht zu stark ist, erholen wir uns manchmal ziemlich schnell davon. Wir können uns aufrappeln, den Staub abklopfen, eine Lösung für das Problem finden und unser Leben fortsetzen. Aber was ist, wenn es keine einfache Lösung gibt – wenn ein geliebter Mensch stirbt, wenn Partnerin oder Partner uns verlassen, wenn wir unseren Job verlieren? Wenn wir eine schlimme Verletzung erleiden, schwer krank oder Opfer eines Gewaltverbrechens werden, das unser Leben völlig durcheinanderbringt? Wenn nahe Angehörige krank sind oder auf andere Art leiden? Wenn die Welt durch eine Pandemie im Chaos versinkt?
Ein Realitätsschock ist immer mit einem Verlust verbunden. Zum Beispiel verlieren wir eine wichtige Beziehung, durch Tod, Scheidung, Trennung oder Konflikt. Wir können unsere Gesundheit, unsere Arbeit und unsere Unabhängigkeit verlieren. Verlieren können wir auch ein Gefühl von Sicherheit oder Vertrauen. Wir können unsere Freiheit, die Unterstützung durch andere und unser Zugehörigkeitsgefühl verlieren – und vieles andere, was von großer Bedeutung für uns ist.
Durch einen Realitätsschock kommt es normalerweise zu einer Krise, einer Zeit großer Schwierigkeit und Ungewissheit, in der wir mit etwas Schrecklichem umgehen, über das wir nur wenig Kontrolle haben. Besonders wahrscheinlich ist das bei jenen niederschmetternden und zerstörerischen Realitätsschocks, die von der Psychologie als Trauma bezeichnet werden. Zur selben Zeit – oder sehr bald danach – überkommt uns Trauer. Entgegen der landläufigen Meinung handelt es sich bei Trauer nicht um Traurigkeit; sie ist überhaupt keine Emotion. Trauer ist ein psychischer Prozess, mit dem wir auf einen bedeutsamen Verlust reagieren. Im Verlauf eines Trauerprozesses können wir ein breites Spektrum an Emotionen empfinden, von Traurigkeit und Beklemmung bis hin zu Wut und Schuldgefühlen. Auftreten können auch körperliche Reaktionen wie Schlafstörungen, Erschöpfung, Lethargie, Apathie und ein veränderter Appetit.
Die fünf Phasen der Trauer
Von Elisabeth Kübler-Ross stammt die Einteilung in fünf Phasen der Trauer: Nicht-wahrhaben-Wollen, Zorn, Verhandeln, Depression und Annahme. Kübler-Ross hat sie besonders auf den Vorgang des Sterbens bezogen, doch diese Phasen lassen sich auf alle Arten von Verlust, Krisen und Traumata anwenden. Es handelt sich allerdings nicht um einzelne, klar voneinander unterscheidbare Stufen, und viele Menschen erleben sie nicht alle. Außerdem treten sie nicht in einer bestimmten Reihenfolge auf, sondern häufig gleichzeitig. Sie entstehen, vergehen und vermischen sich miteinander; oft scheinen sie zu enden, um dann wieder von Neuem zu beginnen. Egal, welchen Verlust man erleidet, man durchlebt zumindest einige dieser Phasen, weshalb ich sie kurz erläutern will.
Das »Nicht-wahrhaben-Wollen« bezieht sich auf eine bewusste oder unbewusste Weigerung oder Unfähigkeit, die Realität der Lage anzuerkennen. Konkret kann sich das in einer mangelnden Bereitschaft äußern, darüber zu sprechen oder nachzudenken; in dem Versuch, so zu tun, als würde das Geschehen nicht stattfinden; als Betäubung oder Lähmung oder als umfassendes Gefühl der Unwirklichkeit, indem man benommen umhergeht und den Eindruck hat, alles sei nur ein schlimmer Traum. In der Phase des »Zorns« kann man wütend auf sich selbst, auf andere oder auf das Leben selbst werden. Daneben melden sich oft viele verwandte Empfindungen: Ärger, Entrüstung, Empörung und ein starkes Gefühl, man sei unfair und ungerecht behandelt worden.
In der Phase des »Verhandelns« versucht man, gewissermaßen einen Deal zu machen, mit dem die Realität verändert werden soll. Zum Beispiel bittet man Gott um eine Gnadenfrist oder fordert vom Chirurgen, den Erfolg einer Operation zu garantieren. Häufig treten Wunschdenken und Fantasien über alternative Realitäten auf: »Wenn nur das geschehen wäre …« oder »Wenn das nur nicht geschehen wäre …«.
Die Phase »Depression« trägt leider die falsche Bezeichnung, da es sich nicht um die bekannte affektive Störung gleichen Namens handelt. Vielmehr bezieht sich dieser Ausdruck hier auf Gefühle von Traurigkeit, Kummer, Bedauern, Angst, Nervosität und Ungewissheit, die natürliche menschliche Reaktionen auf Verlusterfahrungen sind.
In der Phase des »Annehmens« schließt man dann Frieden mit der neuen Realität, statt dagegen anzukämpfen oder sie zu verleugnen. Das befreit uns, wodurch wir unsere Energie dafür einsetzen können, unser Leben allmählich wiederaufzubauen (was Ihnen im Moment durchaus unmöglich vorkommen kann).
Kampf, Flucht, Erstarren
Im ganzen Chaos eines Realitätsschocks erleben wir mehrere unangenehme körperliche Reaktionen. Die wohlbekannte Kampf-oder-Flucht-Reaktion tritt dabei immer auf, in manchen Fällen auch die weniger bekannte Reaktion des Erstarrens.
Um zu verstehen, was für Reaktionen das sind, weshalb sie auftreten und was sie mit uns machen, wollen wir uns auf eine kleine Zeitreise begeben. Stellen wir uns vor, dass sich einer unserer frühen Vorfahren allein auf Kaninchenjagd befindet, als er plötzlich einer riesigen Bärenmutter gegenübersteht. Für einen Sekundenbruchteil erstarrt er. Darauf bedacht, ihre zwei Jungen zu beschützen, empfindet die Bärenmutter den Menschen als Bedrohung – und greift an.
Wenn unser Vorfahr diese Begegnung überleben will, hat er lediglich zwei Optionen: die Flucht ergreifen oder stehen bleiben und kämpfen. Daher übernimmt sein autonomes Nervensystem, das schneller als das bewusste Denken funktioniert, die Führung. Nun bedeutet Autonomie bekanntlich, eigene Entscheidungen zu treffen. Daher hat das autonome Nervensystem seinen Namen, denn es trifft seine eigenen Entscheidungen darüber, was gut für uns ist, und zwar ohne jeden Input des Bewusstseins. Dieses beschließt also nicht: »O je, ich sollte jetzt in den Kampf-oder-Flucht-Modus umschalten!« Diese Entscheidung trifft unser autonomes Nervensystem, bevor wir Zeit haben, auch nur einen einzigen Gedanken wahrzunehmen. Es bereitet den Körper augenblicklich auf Kampf oder Flucht vor.
Zurück zu unserem Vorfahren. Der Kampf-oder-Flucht-Modus tritt in Funktion. Die großen Muskeln in Armen, Beinen, Brust und Hals spannen sich an und machen sich zur Aktion bereit. Der Körper wird mit Adrenalin geflutet, der Herzschlag beschleunigt sich und pumpt Blut in die Muskulatur. Unser Vorfahr verfällt in den Kampf-Modus und schleudert mit aller Kraft seinen Speer.
Leider ist es kein guter Wurf. Der Speer streift die Bärin nur und verursacht kaum eine Wunde. Jetzt ist das Tier endgültig wütend, und unser Vorfahr hat keine weiteren Waffen. Daher rennt er so schnell davon, wie er kann. Jetzt geht es nur noch um Flucht.
Doch die Bärenmutter ist schneller als der Mensch. Sie holt ihn ein und schlägt ihn mit der Pranke zu Boden. Abwehren kann der Mensch die Bärin nicht, und wegrennen kann er auch nicht mehr. Daher übernimmt wieder das autonome Nervensystem die Kontrolle, schneller als jeder bewusster Gedanke. Da es erkennt, dass Kampf oder Flucht keinen Sinn mehr haben, befiehlt es dem Körper zu erstarren. Weshalb? Weil Bären es nicht mögen, wenn ihre Beute sich wehrt. Je mehr der Mensch schreit und zappelt, desto wütender würde die Bärin ihn angreifen. Die beste Überlebenschance hat er daher dann, wenn er so still und reglos daliegt wie möglich.
Hier kommt daher die Erstarrungsreaktion zum Zug. Der dorsale Teil des Vagus (der Vagusnerv ist nach dem Rückenmark der zweitgrößte Nerv im Körper) macht den Menschen bewegungsunfähig. Er lähmt die Muskeln, sodass tatsächlich keine Bewegung mehr möglich ist. Zugleich schaltet er die Gefühle des Menschen gewissermaßen ab, aus einem einfachen Grund: Je weniger Schmerz der Mensch empfindet, desto weniger schreit und zappelt er. Deshalb liegt er einfach da, buchstäblich »wie betäubt«, »vor Angst gelähmt«, »starr vor Furcht«. Wenn er Glück hat, verliert die Bärin dadurch das Interesse und trollt sich davon, oder er überlebt so lange, bis jemand kommt und ihn rettet.
Unser Nervensystem und unser Körper sind darauf ausgerichtet, auf diese Weise – Kampf, Flucht oder Erstarren – auf jede Art Bedrohung zu reagieren. Übrigens gilt das auch für das Nervensystem aller anderen Säugetiere, aber auch für Vögel, Reptilien und die meisten Fische. Da Realitätsschocks bedrohlich sind, reagieren wir darauf alle mit Kampf oder Flucht. Am häufigsten äußert sich das als Angst und Beklemmung (Flucht), aber manchmal herrscht auch Wut vor (Kampf). Und wenn unser Nervensystem in den schlimmsten Fällen wahrnimmt, dass Kampf und Flucht vergeblich sind, erstarren wir. Falls Ihnen das zustößt, spüren Sie womöglich buchstäblich, wie Ihr Körper starr wird; Sie können sich weder bewegen noch etwas sagen. Eventuell haben Sie sogar einen Blackout oder eine außerkörperliche Erfahrung.
In den Tagen und Wochen nach einem Realitätsschock treten die drei Reaktionen wahrscheinlich immer wieder auf. Ausgelöst werden sie durch alles, was uns daran erinnert, was wir durchgemacht haben. Dazu gehören Dinge in unserem Inneren – wie Erinnerungen, Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen – und solche außerhalb von uns, zum Beispiel bestimmte Personen, Orte, Speisen, Musikstücke, Fotos und andere Gegenstände, Bücher, Zeitungsberichte und so weiter. »Kampf« zeigt sich als Wut, Frustration und Reizbarkeit, »Flucht« in Form von Angst, Beklemmung und Besorgtheit. »Erstarren« wiederum äußert sich als Betäubung, Apathie, Müdigkeit, geistige Abwesenheit oder Teilnahmslosigkeit – und mündet oft in einem Gefühl von Vergeblichkeit, Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung.
Da wir jetzt die üblichen Reaktionen auf einen Realitätsschock kennen, stellt sich die große Frage …
Was können wir da tun?
Es ist schlicht so, dass die meisten von uns nicht gut mit Realitätsschocks zurechtkommen. Wir verfangen uns leicht in den ganzen schmerzhaften Gedanken, Gefühlen, Erinnerungen und Körperreaktionen, die uns beuteln und zu kontraproduktiven Verhaltensweisen bringen. Vielleicht greifen wir zu stark nach Alkohol und anderen Suchtmitteln, kapseln uns von Freunden und Angehörigen ab, verzichten auf Aktivitäten, die uns früher Freude gemacht haben, streiten mit Menschen, die wir lieben, verstecken uns vor der Welt oder verbringen viel zu viel Zeit im Bett und auf dem Sofa.
Solche Verhaltensweisen sind alle völlig normal – und extrem häufig anzutreffen. Problematisch an ihnen ist, dass sie unsere Lage normalerweise verschlimmern statt verbessern. Erfreulich ist hingegen, dass wir diesen Zustand ändern können; das heißt, wir können uns neue und wirkungsvollere Methoden aneignen, mit Trauer, Verlust und Krisen umzugehen. Dieses Buch basiert auf einem Ansatz, der als Acceptance and Commitment Therapy, kurz ACT, bezeichnet wird (ausgesprochen wie das englische Verb act). Diese wissenschaftlich fundierte Methode wurde in den 1980er-Jahren von dem amerikanischen Psychologen Steven C. Hayes entwickelt. Inzwischen (2020) belegen mehr als dreitausend in führenden wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlichte Studien, dass ACT bei vielen Problemen wirksam ist, von Trauer, Depression und Ängsten bis hin zu Sucht, chronischen Erkrankungen und Trauma. Es handelt sich um eine praktische Methode, die Menschen helfen kann, ihren Schmerz und ihr Leiden zu überwinden und trotz widriger Umstände ein erfülltes, sinnvolles Leben zu führen. In den folgenden Kapiteln werde ich sie Ihnen allmählich, Schritt für Schritt, vorstellen.
Bevor wir weitergehen, muss ich auf zwei wichtige Punkte hinweisen. Erstens: Es gibt keine bestimmte Reaktion auf einen Realitätsschock, die »richtig« oder »angemessen« wäre. Wir reagieren alle unterschiedlich. Werfen Sie also alle vorgefassten Vorstellungen über Bord, was Sie empfinden oder nicht empfinden sollten und wie lange so ein Zustand dauern oder nicht dauern sollte. Zum Beispiel weinen manche Leute tage- und wochenlang unaufhörlich, während andere nie auch nur eine einzige Träne vergießen. Beide Reaktionen sind völlig normal.
Zweitens: Keine bestimmte Methode ist die »beste« oder »richtige«, wenn wir mit Trauer, Verlust und Krisen umzugehen haben. Wir verarbeiten solche Situationen alle unterschiedlich, und was bei der einen Person funktioniert, kann bei einer anderen wirkungslos sein. Daher enthält dieses Buch eine Menge Tipps, Werkzeuge, Strategien und Vorschläge, die sich bei vielen Menschen als hilfreich erwiesen haben, aber nichts wirkt in jedem Fall. Experimentieren Sie mit allem in diesem Buch, verändern und passen Sie es so an, dass es zu Ihrer individuellen Situation und den damit verbundenen Herausforderungen passt. Das bedeutet zugleich, dass Sie auf alles verzichten sollten, was nicht funktioniert!
Wenn man mein Alter (53) erreicht hat, hat man im Allgemeinen eine anständige Zahl an Realitätsschocks hinter sich gebracht. Bei mir hat das schon in der Kindheit angefangen, mit jahrelangem, wiederholtem Missbrauch durch zwei nahe Verwandte. Im späteren Leben kam der Tod beider Eltern hinzu, der Tod von weiteren Angehörigen und Freunden, eine schmerzhafte Scheidung, eine schwere, zu chronischen Schmerzen führende Verletzung und eine extrem anstrengende Periode von vier Jahren, in denen mein kleiner Sohn wegen eines sehr ernsten Problems intensiv behandelt werden musste. Zu meiner großen Erleichterung hat er sich inzwischen vollständig davon erholt. Dabei hatten wir großes Glück, und mir ist bewusst, dass viele Leute, die dieses Buch lesen, das nicht hatten. Bei diesen schwierigen Ereignissen in meinem Leben hat ACT mir sehr geholfen; ich wiederum habe damit vielen anderen geholfen.
Am meisten beeindruckt hat mich am ACT-Modell jedoch seine umfassende Anwendbarkeit. So habe ich 2015 im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein ACT-Programm für den Einsatz in Flüchtlingslagern entworfen. Inzwischen hat die WHO es in mehreren Ländern – darunter die Türkei, Uganda und Syrien – dazu eingesetzt, Flüchtlingen beim Umgang mit vielen gewaltigen Realitätsschocks zu helfen. Diese Menschen haben Krieg, Verfolgung und Gewalt erlebt, den Tod von nahen Angehörigen und den Verlust ihres Heims, ihrer Arbeit und ihres Landes. Außerdem standen sie vor der Aufgabe, in den prekären Umständen eines Flüchtlingslagers zu überleben. Ich muss gestehen, dass ich mein Programm anfangs mit Skepsis betrachtete, weil ich mich fragte, wie es Menschen in einer derart schlimmen Situation wohl helfen könnte. Daher war ich zugleich erleichtert und froh, als die WHO mehrere Jahre später endlich ihre Forschungsergebnisse veröffentlichte. Wie sich herausstellte, gefiel den Flüchtlingen das Programm nicht nur; sie fanden es sehr hilfreich dabei, mit ihren harschen Lebensumständen umzugehen.
Das Buch, das Sie in den Händen halten, ähnelt dem WHO-Programm stark. Ich habe es in drei Teile gegliedert. Teil 1 trägt den Titel »Ein neuer Anfang«. Hier geht es darum, sich nach einem Rückschlag wieder zu sammeln und die Fassung wiederzuerlangen. Im Zentrum steht dabei, wie man sich um sich selbst kümmern und mit den vielen schmerzhaften Gedanken und Gefühlen umgehen kann. Teil 2 heißt »Das Leben wiederaufbauen«. Hier beschäftigen wir uns damit, wie man sein Leben von Neuem aufbaut, einen kleinen Schritt nach dem anderen tut – egal, wie umfassend und schwer der entstandene Schaden sein mag. Teil 3 schließlich trägt den Titel »Neue Lebenskraft gewinnen«. Hier geht es darum, wieder Kraft und Vitalität zu schöpfen und schätzen zu lernen, was das Leben trotz allem zu bieten hat. Auch wenn Ihnen das im Moment unmöglich vorkommen mag.
Als Ergänzung für dieses Buch habe ich ein kostenloses E-Book mit dem Titel The Reality Slap: Extra Bits zusammengestellt. Es enthält zusätzliches (englischsprachiges) Material, hauptsächlich Audioaufnahmen der in diesem Buch enthaltenen Übungen. Erhältlich ist es über die Rubrik »Free Resources« auf meiner Website www.thehappinesstrap.com.
An diesem Punkt legt Ihr Kopf womöglich Protest ein und behauptet, Ihre persönliche Situation sei anders als die aller anderen, weshalb dieses Buch Ihnen nicht helfen könne und Ihr Leben leer oder unerträglich bleiben werde. Wenn dem so ist, machen Sie sich keine Sorgen – das sind völlig normale Gedanken, die viele Leute haben, wenn diese Methode neu für sie ist. Außerdem ist es so, dass Ihnen dieses Buch mit hoher Wahrscheinlichkeit helfen wird, ich Ihnen das jedoch nicht garantieren kann. Garantieren kann ich hingegen Folgendes: Wenn Sie jetzt aufhören zu lesen, weil Sie Zweifel im Kopf haben, werden Sie von diesem Buch eindeutig überhaupt nicht profitieren.
Falls Ihr Kopf also Zweifel hat, wie wäre es, wenn wir ihn einfach reden lassen? Soll er Ihnen doch erzählen, was er will, aber Sie lassen sich davon nicht vom Lesen abhalten. Lassen Sie ihn vor sich hin plappern wie ein im Hintergrund spielendes Radio, während wir gemeinsam erforschen, wie man überleben und sich entfalten kann, wenn das Leben heftig zugeschlagen hat.
2 Eins nach dem anderen
Natalie war kreidebleich. An ihren Wangen strömten Tränen herab und tropften auf ihre Bluse; ihr ganzer Körper zitterte beim Weinen. Vor zehn Tagen war ihr Sohn, ein Teenager, von einem Auto überfahren worden und noch an Ort und Stelle gestorben. Der Verantwortliche hatte Fahrerflucht begangen und war von der Polizei noch nicht gefasst worden. »Mein Herz ist in tausend Teile zerbrochen«, sagte Natalie, als es ihr gelang, inmitten ihres Schluchzens ein paar klare Worte herauszubringen. »Was soll ich nur tun?«, sagte sie immer wieder. »Was soll ich tun? Ich weiß nicht, was ich tun soll.«
Konzentration auf das, was wir unter Kontrolle haben
Wenn ein Verlust oder ein Trauma ein klaffendes Loch in unsere Welt reißt, empfinden wir meist ein beängstigendes Gefühl der Machtlosigkeit, während wir versuchen, mit schrecklichen Ereignissen umzugehen, über die wir wenig oder gar keine Kontrolle haben. In diesem Kapitel lernen Sie daher einige praktische Tipps kennen, wie man direkt nach einem Realitätsschock reagieren kann.
Der erste Schritt besteht darin anzuerkennen, dass Angst und Beklemmung unvermeidlich sind. Beides sind normale, natürliche Reaktionen auf eine Situation, die unser Leben durcheinanderbringt und mit Bedrohung und Unsicherheit verbunden ist. Wir machen uns rasch große Sorgen wegen allerhand Dingen, die wir nicht beherrschen können: Was wird in der nahen Zukunft geschehen, was wird es mit uns und unseren Angehörigen machen, was wird später geschehen? Ebenso leicht kann man sich in der Vergangenheit verlieren. Während man auf die schmerzhaften Ereignisse zurückblickt, überlegt man, was man hätte anders machen können und was das bewirkt hätte. Oder man versucht herauszubekommen, wer oder was an allem schuld war. Je mehr wir uns aber auf das konzentrieren, was wir nicht unter Kontrolle haben, desto hoffnungsloser, verunsicherter und wütender fühlen wir uns. Das Nützlichste, was man als Reaktion auf jede Art Verlust, Krise oder Trauma tun kann, ist daher, sich darauf zu konzentrieren, was man unter Kontrolle hat.
Was in der Zukunft geschehen wird, können wir ebenso wenig kontrollieren wie das, was in der Vergangenheit passiert ist. Wir haben keine Kontrolle über das, was andere Menschen tun. Und unsere Gedanken und Gefühle können wir erst recht nicht kontrollieren; es ist absolut unmöglich, alle schmerzhaften Emotionen und Erinnerungen zu eliminieren und sie wie durch Zauberhand durch Glück und Freude zu ersetzen. Tatsächlich kontrollieren können wir aber, was wir hier und jetzt mit unseren Armen und Beinen, unseren Händen und Füßen tun; wir haben Kontrolle über unser körperliches Handeln. Darauf müssen wir daher unsere Energie und Aufmerksamkeit richten. Das also ist der erste Schritt, einen Realitätsschock zu überleben: die Kontrolle über unser Handeln zu übernehmen. Sehen wir uns einige Möglichkeiten dafür an.
Niemand ist eine Insel
Als Shantis Mann sie verließ und mit ihrer Jugendfreundin, mit der er seit zwei Jahren eine Affäre hatte, davonlief, war sie in ihren eigenen Worten wie »zerschmettert«. Zu ihrem emotionalen Unwetter gehörten wilde Fluten von Zorn, herniederprasselnde Traurigkeit und orkanartige Stürme aus Angst, Scham und Verlegenheit. Shanti reagierte auf ihren Verlust, indem sie sich von der Außenwelt abkapselte. Sie brach den Kontakt zu Freunden und Angehörigen ab und verbarrikadierte sich in ihrem Haus. Etwas ganz Ähnliches taten Michelle nach einem gewaltsamen sexuellen Übergriff und Dave, nachdem er seine Arbeit verloren hatte. Für ihre Abschottung hatten Shanti, Michelle und Dave ganz ähnliche Gründe – sie wollten keine anderen Menschen um sich haben, weil sie über das, was passiert war, nicht sprechen wollten. Sie hatten Angst, das würde zu peinlich und unangenehm für sie sein; es würde zu viele schmerzhafte Gefühle und Erinnerungen zum Vorschein bringen.
Bei Helen und Philip lag eine etwas andere Motivation für ihren Rückzug vor. Helens Mann war plötzlich und unerwartet an einem schweren Herzinfarkt gestorben, während Philips Lebenspartner nach mehreren Monaten einem Pankreaskarzinom erlegen war. Nach ihrem Verlust zogen sich Helen und Philip in erster Linie deshalb von Freunden und Verwandten zurück, weil sie erschöpft waren. Sie hatten schlicht nicht genügend Energie für irgendwelche sozialen Interaktionen.
Manchmal ziehen wir uns nur von bestimmten Gruppen von Menschen zurück, vor allem dann, wenn die etwas besitzen, was wir verloren haben. Wenn wir den gewaltigen Unterschied zwischen ihrem und unseren Leben sehen, kann das zu schmerzhaft sein, um es ertragen zu können. Zum Beispiel hat Yoko den Kontakt zu allen Freunden mit Kindern abgebrochen, nachdem ihre kleine Tochter an Meningitis gestorben war; Alana hat sich nach einer Fehlgeburt ebenso verhalten. Beiden tat es einfach zu weh, einer Familie mit kleinen Kindern zu begegnen.
Rada wiederum hat ihren Realitätsschock in Form einer Krankheit namens Fibromyalgie erlebt. Sie spürte ein schmerzhaftes Brennen und Pochen in den Oberarmen, den Schultern, in Hals, Rücken und Bauch, außerdem Kopfschmerzen, Morgensteifigkeit, extreme Müdigkeit und Erschöpfung. Das bedeutete eine erhebliche Einschränkung ihrer Fähigkeit, vielen täglichen Aktivitäten nachzugehen, die sie bisher für selbstverständlich gehalten hatte. Daher zog sie sich von ihr nahestehenden Menschen zurück, weil es erschöpfend für sie war, mit anderen zusammen zu sein, und weil es für sie körperlich derart anstrengend war, ihre Wohnung zu verlassen.
Es gibt viele verschiedene Gründe, weshalb wir den Wunsch haben, uns von den Menschen zurückzuziehen, die uns am nächsten stehen. In manchen Fällen wollen wir anderen nicht »zur Last fallen«, wir wollen uns nicht »aufdrängen« oder jemanden »in Verlegenheit bringen«. Vielleicht merken wir auch, dass andere tatsächlich verlegen sind und nicht recht wissen, wie sie sich uns gegenüber verhalten und was sie zu uns sagen sollen – was natürlich für uns ebenso unangenehm ist wie für sie. Oder wir verfallen in eine schicksalsergebene Einstellung wie: »Eigentlich sollte ich doch in der Lage sein, das allein durchzustehen; jemand anderen brauche ich da nicht.«
All diese Reaktionen sind vollkommen normal. Das habe ich zwar bereits mehrere Male geschrieben, aber es ist ausgesprochen wichtig, es zu wiederholen, weil wir so stark dazu neigen, unsere Reaktionen als unnormal, mangelhaft oder schlicht »falsch« zu verurteilen. Problematisch am Rückzug von anderen Menschen ist, dass es unser Leiden normalerweise vergrößert. Nicht umsonst wird der Mensch als soziales Wesen bezeichnet. Damit es uns gut gehen kann, müssen wir schöne Stunden mit anderen verbringen. Sobald uns die Realität einen Schock versetzt, entziehen wir uns jedoch nur allzu oft den Menschen, denen wir am meisten bedeuten. Und wenn wir uns in unser Elend einkapseln, verschlimmert das unseren Schmerz nur.
Daher ist es wichtig, dass wir auf andere zugehen – solange sie fürsorglich, unterstützend und verständnisvoll sind. Mit welchen Menschen aus Ihrem Kreis könnten Sie jetzt wohl Kontakt aufnehmen? Und wie könnten Sie das tun? Indem Sie sie direkt ansprechen? Durch einen Telefonanruf? Einen Video-Chat? Eine Textnachricht? Auf andere zuzugehen, ist etwas, das wir kontrollieren können. Dabei ist es völlig in Ordnung, ein Zeitlimit für den Austausch zu setzen oder zu sagen, was Sie gemeinsam tun wollen: »Ich wollte dich mal kurz anrufen, allerdings hab ich jetzt nur fünf Minuten Zeit«, »Klar, du kannst gern vorbeikommen, aber momentan schaffe ich wahrscheinlich nur eine halbe Stunde, sonst wird es mir zu viel«, »Nichts für ungut, aber ich will jetzt eigentlich nicht über das, was passiert ist, sprechen«, »Ich will jetzt nichts sagen, bitte halt mich nur in den Armen«, »Sehen wir uns doch einfach bloß einen Film an.«
Völlig in Ordnung ist es auch, Nein zu sagen. Wenn Sie wirklich nicht mit anderen zusammen sein wollen, sollten Sie das akzeptieren und irgendwelche Einladungen ablehnen. Und wenn Sie sich gerade mit jemandem unterhalten und das Gefühl haben, eine Pause zu brauchen, nehmen Sie sich die bitte. Sagen Sie einfach: »Tut mir leid, ich brauche eine Pause, mir wird es jetzt ein bisschen zu viel.« Dann können Sie einen Spaziergang machen oder sich in ein anderes Zimmer zurückziehen.
Leider ist es oft so, dass andere Menschen keine Ahnung haben, wie sie mit uns umgehen sollen; sie versuchen zu helfen, ohne das auf die richtige Weise zu tun. Zum Beispiel kommen sie mit Binsenweisheiten an (»Alles, was passiert, hat irgendeinen Grund«), sie erklären uns, wir müssten jetzt »stark« sein, oder sie wollen uns dazu bringen, »positiv« oder »rational« zu denken. Manchmal vermeiden sie es auch bewusst, uns zu fragen, was passiert ist und wie wir uns fühlen, und versuchen, uns abzulenken, indem sie das Thema wechseln. Sie halten uns vor Augen, dass es uns in der Zukunft wieder viel besser gehen wird, sie geben uns Ratschläge, wie wir mit unseren Problemen fertigwerden sollen, oder sie fangen an zu predigen: »Gott setzt uns nur Dinge vor, mit denen wir umgehen können.« Das alles ist nicht der Fehler dieser Leute; normalerweise versuchen sie nur, uns nach besten Kräften zu helfen und uns zu unterstützen. Leider lernen wir in der Art von Gesellschaft, in der wir leben, nicht, wie man so etwas sinnvoll tun kann.
Experimentieren
Eine kurze Suche auf Google fördert ein gewaltiges Sortiment an Ratschlägen zutage, wie man mit einem Realitätsschock umgehen kann. Manche sind ausgezeichnet, manche sind absoluter Schrott, aber absolut nichts, was man findet, gilt für uns alle. Daher müssen wir unbedingt experimentieren, indem wir Verschiedenes ausprobieren, um herauszubekommen, was für uns passt.
Nach diesem Hinweis möchte ich Ihnen zwei praktische Tipps vermitteln. Erstens finden es viele Leute hilfreich, an die frische Luft zu gehen. Ein Spaziergang in der Natur wirkt oft sehr tröstlich, weil dabei ein Gefühl der Verbundenheit mit etwas Größerem entsteht. Dazu kommt die Erleichterung, den Herausforderungen des Lebens in den eigenen vier Wänden zu entkommen. Draußen in der Natur ist es leicht, man selbst zu sein; für das Gras, die Bäume und den Himmel muss man kein tapferes Gesicht aufsetzen. Man muss überhaupt nichts tun. Man kann vor sich hingehen, atmen, die Welt ringsum wahrnehmen und sich dabei erlauben, das zu fühlen, was man fühlt.
Zweitens sollten Sie sich davor hüten, wichtige Entscheidungen zu treffen. Selbst unter den besten Umständen sind solche Entscheidungen schwierig, und nach einem Realitätsschock ist das erst recht so, weil wir dann nicht vollständig über unsere geistigen Fähigkeiten verfügen. Wir sind oft erschöpft oder leiden unter Schlafmangel; unser Kopf versucht, mit so vielen verschiedenen Dingen fertigzuwerden, dass es uns schwerfällt, klare Gedanken zu fassen. Wenn Sie also wichtige Entscheidungen treffen müssen, fragen Sie sich bitte: Wäre es nicht besser, diese Entscheidungen eine Weile aufzuschieben oder sie an eine Person zu delegieren, der Sie vertrauen? Falls beides für Sie nicht infrage kommt, sollten Sie zumindest die Übung »Den Anker werfen« in Kapitel 5 nutzen, um sich zu zentrieren, bevor Sie die Entscheidung treffen.
Viele weitverbreitete Ideen darüber, wie man mit Trauer, Verlust und Trauma zurechtkommen kann, sprechen zwar den gesunden Menschenverstand an, haben aber keine wissenschaftliche Gültigkeit. Dazu gehört die Vorstellung, man müsse »seine Gefühle ausdrücken«. Tatsächlich ist es so, dass man das nicht tun muss. Natürlich empfinden die meisten Leute es als hilfreich, ihre Gefühle auszudrücken, und falls Sie ebenfalls meinen oder wissen, dass Ihnen das helfen könnte, gibt es viele Möglichkeiten, es zu tun. Am einfachsten ist es, mit Freunden, Angehörigen, in einer Selbsthilfegruppe oder einer Therapiestunde aufrichtig und offen darüber zu sprechen, was man fühlt. Eine sehr beliebte Alternative ist es, das in einem Tagebuch zu notieren. Und wenn Sie kreativ veranlagt sind, drücken Sie Ihre Gefühle vielleicht lieber aus, indem Sie ein Gedicht oder eine Geschichte schreiben, Musik machen, ein Bild malen oder zeichnen, eine Skulptur modellieren oder tanzen.
Es ist jedoch wichtig, sich klarzumachen, dass nicht alle Menschen so etwas hilfreich finden, und auf jeden Fall ist es nicht unverzichtbar! Das heißt, Sie können einen Realitätsschock überleben und damit fertigwerden, ohne je über Ihre Gefühle zu sprechen oder zu schreiben. Sollten Sie daher nicht sicher sein, ob es zu Ihnen passt, Ihre Gefühle auszudrücken, dürfte es am besten sein, damit zu experimentieren und zu beobachten, was passiert. Wenn Sie es nützlich finden, machen Sie damit weiter, wenn nicht, hören Sie auf.
Ein Balanceakt
Beim Begriff »Selbstfürsorge« sträuben sich Ihnen vielleicht die Nackenhaare. Trotzdem müssen wir uns damit beschäftigen. Natürlich kann jetzt im Moment schon die Vorstellung, etwas für sich selbst zu tun, eine Überforderung für Sie sein. Wenn dem so ist, dann ist das völlig in Ordnung. In den nächsten Kapiteln werden Sie lernen, mit diesem Gefühl der Überforderung umzugehen und sich behutsam zu motivieren, das zu tun, worauf es ankommt.
Selbstfürsorge ist ein Balanceakt. Einerseits wollen wir uns eine Pause gönnen, uns von Druck befreien, einige unserer Verantwortlichkeiten ablegen und uns Zeit nehmen, auszuruhen und uns zu erholen. Andererseits wollen wir weiter das tun, was gesund für uns ist. Daher werden viele nach einem Realitätsschock wahrscheinlich davon profitieren, sich mehr Ruhe und eine »Auszeit« zu gönnen. Sinnvoll ist das, weil erschütternde Lebensereignisse viel Energie in Anspruch nehmen; emotionale Stürme sind erschöpfend, und außerdem schlafen wir in solchen Zeiten oft schlecht. Wenn wir jedoch über Wochen hinweg einen großen Teil des Tages im Bett bleiben oder auf dem Sofa liegen, wird es uns langfristig schlechter gehen statt besser.
Ähnlich verhält es sich damit, dass sich viele Menschen mit Essen trösten – mit Schokolade, Eiscreme, Pizza – oder mehr Alkohol als sonst trinken. In Maßen stellt das wahrscheinlich kein Problem dar, aber wenn wir es exzessiv tun, fügt es den bereits vorhandenen Problemen weitere hinzu.
Für Sport und Bewegung gilt dasselbe. Es ist normal, dass wir in Stresssituationen durch das, was wir durchmachen, von unserer Routine abweichen. Aber wenn wir uns überhaupt nicht mehr bewegen, leidet unsere Gesundheit; es ist unheimlich wichtig, den Körper in Schwung zu halten. In besonderem Maße gilt das, wenn man an einer chronischen Erkrankung oder Verletzung leidet wie Rada. Wegen der Auswirkungen ihrer Fibromyalgie – Schmerzen, Steifheit und Erschöpfung – war sie einfach nicht mehr in der Lage zu den körperlichen Aktivitäten, mit denen sie sich vorher fit gehalten hatte. Vor allem waren das lateinamerikanischer Tanz und Aerobic gewesen. Ohne jede sportliche Betätigung verschlimmert sich Fibromyalgie allerdings wie beinahe jede chronische Erkrankung, die es gibt, ob es sich nun um Diabetes oder Herzkrankheiten handelt, um Asthma oder Bluthochdruck. Das bedeutet, dass Rada innerhalb der Einschränkungen durch ihre Krankheit neue Möglichkeiten finden musste, sich in Bewegung zu halten. Am Anfang waren das von ihrer Physiotherapeutin empfohlene einfache Dehn- und Kräftigungsübungen und ganz kurze Spaziergänge mithilfe eines Gehstocks.
Es lohnt sich, ein bisschen Zeit für einen Plan zur Selbstfürsorge vorzusehen. Überlegen Sie, wie Sie sich um Ihren Körper kümmern können, durch Sport und Bewegung, gesunde Ernährung, einen – falls nötig – mäßigeren Alkohol- und Drogenkonsum, genügend Ruhe und Entspannung sowie ein vernünftiges Schlafverhalten. Blieben Sie zugleich aber realistisch. Wenn Ihnen das alles zu schwerfällt, wenn es zu viel ist, zu früh, zu überfordernd, dann ist es in Ordnung, es vorläufig bleiben zu lassen. Wenn Sie bei Kapitel 18 zum Thema »Schlechte Gewohnheiten ablegen« angekommen sind, werden Sie alle nötigen Methoden zur Verfügung haben, sich erfolgreich selbst zu motivieren.
Nicht zu vergessen sind auch Hobbys, kreative Tätigkeiten und andere Interessen, die in stürmischen Zeiten oft hintangestellt werden. Manchmal ist es klug, das tatsächlich eine Weile zu tun, während man sich darauf konzentriert, mit den vorhandenen Problemen umzugehen. Für viele Menschen ist es jedoch gut, so rasch wie möglich wieder damit anzufangen. Zuerst werden Sie diese Dinge vielleicht nicht so genießen wie früher, weil Sie zu traurig, müde oder ausgelaugt sind, um sich ganz darin zu versenken. Aber wenn Sie durchhalten, werden Sie womöglich darüber staunen, wie sehr Sie so etwas inmitten Ihres Leidens trösten, ermutigen und stärken kann.
Natürlich müssen Sie Ihre Selbstfürsorge so gestalten, dass sie zu Ihren persönlichen Umständen passt. Wenn Sie sich von einer umfangreichen Operation, einer Chemotherapie oder einer schweren Krankheit erholen, werden Sie sicher nicht ins Fitnessstudio gehen können, aber es dürfte leichte Übungen geben, die im Bett möglich sind. Sobald Sie aufstehen dürfen, können Sie mit einfachen, ärztlicherseits empfohlenen Übungen allmählich Kraft aufbauen. Falls zu Ihrem Realitätsschock keine Verletzung oder Krankheit gehört, haben Sie offensichtlich wesentlich mehr Möglichkeiten, aber womöglich nicht die Energie, Ihr gewohntes Programm durchzuziehen. Erlauben Sie es sich dann, etwas Leichteres zu machen, zum Beispiel einen Spaziergang.
Als Natalie ständig überlegte, was sie tun sollte, hat sie sich eine ausgesprochen nützliche Frage gestellt. Die Vergangenheit ändern und ihren Sohn wieder ins Leben zurückrufen, um ihr gebrochenes Herz zu heilen, konnte sie natürlich nicht. Sie war jedoch in der Lage, immer wieder ein kleines bisschen fürsorglich mit sich umzugehen, und das war ein wichtiger Schritt, allmählich einigermaßen die Kontrolle über ihr Leben wiederzugewinnen.
Denken Sie immer daran, dass Selbstfürsorge nicht mit einer großen Anstrengung verbunden sein muss. Jedes Mal, wenn Sie sich die Zähne putzen, sich unter die Dusche stellen und etwas Gesundes essen, sorgen Sie für sich selbst. Das tun Sie auch, wenn Sie Kontakt zu Freunden haben, Musik hören, die Ihnen Freude macht, oder dieses Buch lesen. Und jedes kleine Stück Selbstfürsorge zählt, selbst wenn Ihr Kopf das Gegenteil behaupten sollte.
3 Freundliche Worte
Wenn die Realität Ihnen einen schweren Schlag versetzt, der Sie taumeln lässt, was brauchen Sie dann von den Menschen, die Sie lieben? Normalerweise brauchen wir alle mehr oder weniger dasselbe. Wir wollen wissen, dass jemand für uns da ist, jemand, dem unser Wohlergehen wirklich am Herzen liegt, der sich die Mühe macht, uns zu verstehen, der unseren Schmerz erkennt und sich bewusst ist, wie sehr wir leiden. Jemand, der sich Zeit nimmt, bei uns zu sein, und der uns erlaubt, unsere wahren Gefühle mitzuteilen, ohne von uns zu erwarten, dass wir die Zähne zusammenbeißen, uns nichts anmerken lassen und so tun, als wäre alles in schönster Ordnung. Jemand, der uns unterstützt, uns freundlich behandelt und seine Hilfe anbietet. Jemand, der durch sein Handeln demonstriert, dass wir nicht allein sind. Daher stellt sich die brennende Frage: Wenn wir von anderen so behandelt werden wollen – mit Fürsorglichkeit, Verständnis und Freundlichkeit –, warum gehen dann die meisten von uns so schlecht mit sich selbst um?
Mit einer harschen Realität konfrontiert, brauchen wir so viel Freundlichkeit wie möglich. Meistens finden wir aber nicht so leicht Zugang dazu. Warum nicht? Weil unser Kopf von Haus aus dazu neigt, uns zu verurteilen, uns zu kritisieren, uns fertigzumachen. Er holt den Rohrstock hervor und verpasst uns eine anständige Abreibung, er versetzt uns einen Fußtritt, wenn wir ohnehin am Boden liegen. Zum Beispiel sagt unser Kopf uns, wir seien nicht stark genug, wir sollten besser mit allem umgehen können, andere seien viel schlimmer dran als wir, weshalb wir uns nicht beklagen sollten. Er sagt uns, wir sollten die Sache in den Griff bekommen, uns zusammenreißen und nicht so schwach oder jämmerlich sein. In manchen Fällen behauptet unser Kopf sogar, wir seien selbst an allem schuld.
Wenn jemand, den wir lieben, stirbt, wirft unser Kopf uns womöglich vor, diesen Menschen nicht genug geliebt zu haben, nicht genug für ihn dagewesen zu sein oder ihm nicht genug gesagt zu haben, wie sehr wir ihn lieben. Manchmal kommt sogar der Vorwurf, wir hätten den Tod dieses Menschen nicht verhindert, vor allem, wenn es um Suizid geht. Einer meiner Klienten hat sich vorgeworfen, dass er einen Flugzeugabsturz überlebt hatte. Sein Kopf hielt ihm vor, es sei nicht fair, dass er noch am Leben war, wo doch zwölf andere Passagiere gestorben waren – und dass er »es nicht verdiente zu leben«. So etwas wird als Überlebensschuld-Syndrom bezeichnet. Eine Klientin wiederum gab sich die Schuld an der Schizophrenie ihres Sohnes: »Ich bin verantwortlich, schließlich hat er die schlechten Gene von mir.«
Selbst wenn unser Kopf keinen persönlichen Angriff startet, ist er oft harsch, kalt und lieblos; statt uns zu helfen, deprimiert er uns. Zum Beispiel behauptet er, wir könnten das alles nicht verkraften, oder das Leben sei nicht lebenswert. Er sagt uns, wir sollten aufhören zu jammern und zu klagen, oder er ruft furchtbare Ängste vor der Zukunft hervor. Wie ich immer wieder betone, ist das alles völlig normal, aber besonders hilfreich ist es nicht. Was also ist die Alternative?
Hippie-Kram!
Antonio, ein massiger, muskulöser australischer Polizist mit italienischen Wurzeln, zog eine Grimasse und verschränkte die Arme vor der Brust. »Kommen Sie mir bloß nicht mit diesem Hippie-Kram!«, knurrte er. Seine Frau Cathy hatte ihn dazu gedrängt, mich aufzusuchen, und er versuchte erst gar nicht, seinen Frust darüber zu verbergen. Mehrere Wochen vorher war Sophia, das kleine Töchterchen des Paares, am plötzlichen Kindstod gestorben. Beide Eltern waren zutiefst erschüttert, gingen mit ihrem Kummer jedoch ganz unterschiedlich um.
Cathy tat viel von dem, was wir im letzten Kapitel besprochen haben. Sie nahm Kontakt zu Freunden und Familienmitgliedern auf, drückte ihre Gefühle aus, erlaubte sich zu weinen (manchmal stundenlang) und kümmerte sich im Allgemeinen gut um sich selbst. Im Gegensatz dazu kapselte Antonio sich von praktisch allen Menschen ab und verbrachte jeden Abend vor dem Fernseher. Er sagte wenig, trank jedoch umso mehr. Und immer wenn Cathy versuchte, mit ihm über Sophias Tod und über den gemeinsamen Kummer zu sprechen, wurde er wütend und brachte sie zum Schweigen.
Trotz seiner Abneigung dagegen, mich aufzusuchen, liebte Antonio seine Frau sehr und wollte die Lage der beiden verbessern. Bald war er in der Lage zu erkennen, dass sein Verhalten in erster Linie ein Versuch war, dem Schmerz zu entkommen. Er liebte seinen Beruf und konnte sich den Tag über so darin versenken, dass er den Tod seiner Tochter weitgehend vergaß. Zu Hause war die Lage anders. Dort erinnerte ihn alles an die kleine Sophia, vor allem seine Frau. Und mit der Erinnerung war ein Schmerz verbunden, wie er ihn noch nie erlebt hatte. Sein Alkoholkonsum, seine Gesprächsverweigerung, seine Stunden vor dem Fernseher waren Verhaltensweisen, die ihm eine gewisse Erleichterung von diesem schrecklichen Schmerz verschafften, aber um den Preis, dass die Beziehung zu seiner Frau erheblich beeinträchtigt wurde.
»Ich bin ein verdammtes Arschloch«, sagte er. »Eigentlich sollte ich für Cathy da sein, doch das bin ich nicht. Es ist bloß so, dass ich … Scheiße, ich will nicht mal darüber nachdenken. Es ist zu, es ist einfach zu … ach, ich bin dermaßen schwach. Richtig jämmerlich.«
»Sich selbst fertigmachen können Sie aber ganz gut«, sagte ich.