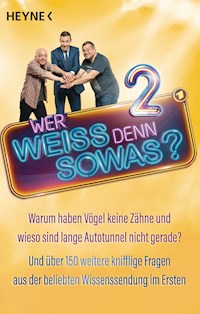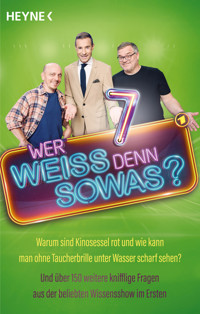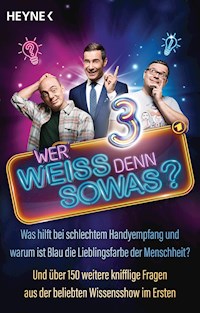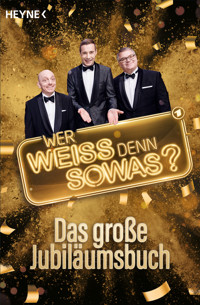
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Wer weiß denn sowas?
- Sprache: Deutsch
Die erfolgreichste Vorabendquizshow feiert Geburtstag!
Im Jahr 2025 wird „Wer weiß denn sowas?“ zehn Jahre alt – Grund zum Feiern. In dieser hochwertig ausgestatteten Jubiläumsausgabe finden Sie neue Fragen (und Antworten) aus den letzten zehn Jahren – wie immer witzig, kurios, nützlich, informativ. Das Buch verrät interessante Details zu Sendung und Gästen, die selbst Fans noch nicht wussten, und es ist ergänzt durch Beiträge von Elton, Bernhard Hoëcker und Kai Pflaume.
Rätseln Sie mit und lassen sich von spannenden Fragen und Antworten überraschen!
- Mit exklusiven Beiträgen von Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton
- Das Jubiläumsbuch: besonders ausgestattet im größeren Format und mit vielen Fotos
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Das große Jubiläumsbuch
Die verblüffendsten Fragen, die erstaunlichsten Antworten aus der erfolgreichsten Vorabendquizshow aller Zeiten
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2025 ARD Werbung und OneGate Media GmbH – A Studio Hamburg Company, Lizenz durch ARD Degeto Film GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.
Copyright © 2025 by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Autoren: Anja Stiller, Conny Heindl, Alexander Rudow, Gerald Drews
Illustrationen: Isabel Klett, Barcelona
Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich,
unter Verwendung eines Fotos von © ARD/MORRISMACMATZEN und von Motiven von © Shutterstock
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-33095-8V001
www.heyne.de
Liebe Leserinnen und Leser,
vor einiger Zeit fuhr ich mit meinem Auto durch einen Tunnel und grübelte, warum lange Autotunnel so selten schnurgerade gebaut sind. Plötzlich sah ich Bernhard vor meinem geistigen Auge, der mit erhobenem Zeigefinger bemerkte: »Genau dazu hatten wir mal eine Frage bei uns in der Sendung.« Neben ihm steht ein zustimmend nickender Elton, in seinem »The-Cure«-Bandshirt und schaut mich erwartungsvoll an. Dank dieser Art von Bildern in meinem Kopf vergesse ich auch nie, dass man ein Fischfilet vor dem Erhitzen erst in die kalte Pfanne legt, damit es beim Anbraten gleichmäßig gold-braun wird, und man Bienenstiche am besten mit Würfelzucker und Spucke behandelt.
Falls Sie also demnächst in einer ähnlichen Situation sind, in der Sie auf derlei Tricks und Kniffe zurückgreifen müssen, finden Sie in diesem Buch vielleicht Ihre passenden Antworten. Denn vor Ihnen liegt die Jubiläumsausgabe zu zehn Jahren »Wer weiß denn sowas?«, gefüllt mit vielen wissenswerten Fakten, aber auch unzähligen kuriosen Antworten auf skurrile Fragen, die Sie sich so noch nie gestellt haben.
Was haben wir in zehn Jahren »Wer weiß denn sowas?« nicht alles erlebt!
Ich erinnere nur mal an unseren 25-Stunden-Live-Marathon. Ganze 20 Runden haben wir live und am Stück ausgestrahlt und dabei eine Summe von 61 968 € erspielt. Das war die Sendung, in der Bernhards Gymnastikball zum Einsatz kam, Elton massiert wurde und ich frisch rasiert rein- und mit »Vollbart« wieder rausgegangen bin. Und nur fürs Protokoll: Bernhard hat als Erster gegähnt!
Für mich steht fest: Auch nach elf Staffeln, 1297 Folgen im Vorabend und 41 XXL-Ausgaben bekomme ich einfach nicht genug davon, wie unsere Gäste gemeinsam den Teamkapitänen über die spektakulären Fragen hinter der »Wer weiß denn sowas?«-Wand rätseln.
Ach, und um die Frage noch zu klären: Lange Autotunnel verlaufen meist leicht gekrümmt, damit Autofahrer vor dem sogenannten Tunnelblick und schneller Ermüdung geschützt werden.
Also auf die nächsten zehn Jahre
Euer Kai
2015
Die allererste Frage aus »Wer weiß denn sowas?«
Die finnische Maßeinheit »Poronkusema« misst, wie …?
A: lange ein Rentier laufen kann, ohne Wasser zu lassen
B: viel Wodka man trinken kann, ohne betrunken zu werden
C: lange man in einer Sauna schwitzen kann, ohne auszutrocknen
A: lange ein Rentier laufen kann, ohne Wasser zu lassen
Finnland ist für ein paar Dinge bekannt, darunter sein gutes Bildungssystem und allerhand skurrile Wettbewerbe wie Handyweitwurf und Baumumarmen. Wenig wissen wir dagegen über eine bestimmte Maßeinheit dieses nordischen Landes, in dem neben 5,6 Millionen Menschen auch 200 000 Rentiere leben. Womit wir direkt beim Thema wären. Denn genau diese Rentiere sind es, nach denen die alten Samen ihre Maßeinheit benannt haben, die bis heute in Finnland gebräuchlich ist: das »Poronkusema«. Das Wort setzt sich zusammen aus den Begriffen »poron«, deutsch: Rentier, und »kusema«, auf Deutsch: uriniert von, zusammengesetzt: das Urinieren des Rentiers.
Wenn die Samen in früheren Zeiten mit ihren Rentierschlitten unterwegs waren, konnten sie kaum einschätzen, welche Distanzen sie zurücklegten. Allerdings beobachteten sie, dass ihre Rentiere regelmäßig einen Stopp einlegten, um Pipi zu machen, im Fachausdruck: zu miktieren. Denn im Laufen klappt es bei Rentieren nicht. Aus diesen Intervallen zwischen zwei Stopps entwickelten sie, sozusagen als Längenmaß, das Poronkusema. Der nächste Markt lag dieser Maßeinheit zufolge zum Beispiel fünf Poronkusema entfernt, bis zum See waren es drei Poronkusema. Mittlerweile wissen wir es ganz präzise: Ein Poronkusema beträgt genau 7,5 Kilometer.
Damit Kaffee am besten wirkt, trinkt man ihn idealerweise …?
A: eine Stunde nach dem Aufstehen
B: handwarm
C: aus hohen dunklen Bechern
A: eine Stunde nach dem Aufstehen
Den ersten Kaffee kurz nach dem Aufwachen zu trinken, ist neuen Studien zufolge nicht nur sinnlos, es kann sogar kontraproduktiv sein. Denn wenn wir morgens aufstehen, schüttet unser Körper ohnehin seinen, wenn man es so nennen will, eigenen Wachmacher aus: das Stresshormon Cortisol. Es erreicht seinen Wirkhöhepunkt eine halbe Stunde nach dem Aufstehen und bleibt dann für ungefähr eine weitere Stunde auf diesem Niveau. Zu dieser Zeit braucht der Körper kein Koffein, wir sind bereits so wach wie möglich. Wer jetzt trotzdem Kaffee trinkt, der steigert damit seinen Grad an Wachheit nicht nur kein bisschen, es kann sogar geschehen, dass der Körper sich ans Koffein gewöhnt, man spricht hier von einer »Koffein-Toleranz«. Um in Zukunft den gewünschten Wach-mach-Effekt überhaupt noch zu verspüren, brauchen wir deutlich mehr Kaffee. Wer um 7.30 Uhr aufsteht, sollte demnach seinen ersten Kaffee zwischen 8.30 und 10.30 Uhr trinken. Zu dieser Zeit ist der Cortisolspiegel deutlich gesunken, und der Kaffee kann seine Wirkung voll entfalten.
Mit welchen Haushaltsmitteln lässt sich im Notfall eine Kerze basteln?
A: Leberwurst und Streichholz
B: Honig und Paketband
C: Butter und Toilettenpapier
C: Butter und Toilettenpapier
Eine Kerze aus Butter herzustellen, ist weniger kompliziert, als es im ersten Moment scheint. Die Flamme züngelt zwar nicht besonders hoch, aber wer gerade keine andere Lichtquelle zur Hand, dafür aber ein Päckchen Butter vorrätig hat, kann sich in der Dunkelheit auf diese Weise behelfen. Da Butter alleine eher zerlaufen würde, als Licht zu spenden, wenn man sich ihr mit der Flamme eines Streichholzes nähert, benötigt man zusätzlich ein oder zwei Blätter Toilettenpapier. Das faltet man zunächst diagonal, sodass ein Dreieck entsteht. Dieses Dreieck rollt man von der Spitze aus zu einer Art dünnem Docht.
Für die Behelfskerze genügt etwa ein Viertel des 250-Gramm-Päckchens Butter. Man legt sie auf einen Teller oder einen anderen feuerfesten Untergrund und sticht in die Mitte ein schmales, tiefes Loch. Am besten funktioniert das mithilfe eines Zahnstochers, einer Strick- oder einer dickeren Nähnadel. In dieses Loch wird jetzt der Toilettenpapierdocht gesteckt, und zwar so weit, dass nur noch ungefähr ein Zentimeter heraussteht. Den zündet man nun an. Die Butter unmittelbar neben dem Docht schmilzt, steigt an dem Docht nach oben und – brennt. Man berechnet pro Esslöffel Butter ungefähr eine Stunde Licht. Eine Warnung sei aber angebracht: Diese improvisierte Kerze nie unbeaufsichtigt lassen!
Was gilt laut einer Studie für deutsche Arbeitnehmer, die Kaiser, König oder Ritter heißen?
A: Sie essen in der Kantine besonders gerne deftiges Essen.
B: Sie kommen häufig zu spät zur Arbeit.
C: Sie haben eine größere Chance auf eine Führungsposition.
C: Sie haben eine größere Chance auf eine Führungsposition.
Träger der Nachnamen Kaiser, König oder Ritter haben tatsächlich bessere Chancen, in die Führungsetage zu gelangen, als ihre gleichermaßen qualifizierten Mitbewerberinnen und Mitbewerber Bauer, Schuster oder Schmidt. Das fanden Wissenschaftler der Universität Cambridge und der HEC Paris heraus. Die Forscher erklären sich diesen Karrierevorsprung damit, dass wir alle automatisch assoziativ denken. Das bedeutet, dass wir den herausgehobenen Status sofort mitdenken, wenn wir die Herrschaft im Nachnamen hören. Gleichzeitig, auch das ist eine Hypothese der Wissenschaftler, haben Träger dieser adeligen Namen auch eine höhere Meinung von sich selbst und treten daher anders auf.
Allerdings lässt der Name keineswegs zwingend auf eine adelige Herkunft schließen: Denn derart häufig, wie diese Namen allein in Deutschland vertreten sind, haben sich Kaiser und Könige auch zur Blütezeit des Hochadels nicht vermehrt. Im Gegenteil wurden diese Namen auch Menschen gegeben, die zwar nicht aus einem Herrscherhaus kamen, aber besonders prahlerisch auftraten. Außerdem sei an dieser Stelle all den Trägern profaner Nachnamen gesagt, dass es auch eine Frau Koch und ein Herr Weber zum Chef eines großen Konzerns bringen können – Qualifikation vorausgesetzt.
Präriewühlmäuse sind besonders ausdauernd, denn sie …?
A: überleben 23 Tage ohne zu trinken in der Wüste
B: rennen 33 Kilometer ohne Pause
C: haben bis zu 40 Stunden lang Sex
C: haben bis zu 40 Stunden lang Sex
Sie leben im Mittleren Westen der USA versteckt in Getreidefeldern und Grassteppen, sie sind braun und unscheinbar, und sie gelten als Schädlinge: die Präriewühlmäuse. Ungewöhnlich sind sie jedoch in zweierlei Hinsicht: Präriewühlmäuse leben monogam. Und sie haben ein erstaunliches Paarungsverhalten. Das Weibchen wird erst paarungsbereit, wenn es ein passendes Männchen in der Nähe riecht. Damit werden innerhalb von kurzer Zeit hormonelle Prozesse in Gang gesetzt, die die Eierstöcke aktivieren. Damit diese sogenannte Brunst einsetzen kann, schüttet der Körper zum einen Östradiol aus. Zum anderen Progesteron, das, so wird angenommen, die Dauer des Geschlechtsakts bestimmt.
Bei den Präriewühlmäusen erhöht sich der Progesteronspiegel aber erst viele Stunden nach Beginn der Paarung. Und das heißt wiederum: Diese Mäuse haben lange Sex. Die Weibchen lassen sich nach Beginn der Brunst 30 bis 40 Stunden lang immer wieder decken. Umgekehrt bewirkt diese lange Paarungsphase wohl auch die monogame Bindung zwischen den Tieren, denn durch den Körperkontakt wird das Bindungshormon Oxytocin ausgeschüttet. Später, wenn das Weibchen bereits sexuelle Erfahrung (samt Partner fürs Leben) hat, geht es übrigens sehr viel schneller.
Wer sich etwas merken möchte, sollte beim Einprägen …?
A: an sein Ohr greifen – beim Wiedergeben an die Nase
B: die rechte Faust ballen – beim Wiedergeben die linke
C: tief einatmen – beim Wiedergeben stark ausatmen
B: die rechte Faust ballen – beim Wiedergeben die linke
Jede der beiden Gehirnhälften im Stirnbereich ist für bestimmte Fähigkeiten verantwortlich. Beim Lernen genauso wie beim Verarbeiten des neuen Lernstoffs ist die linke Gehirnhälfte aktiv. Wenn diese Erinnerungen später abgerufen werden sollen, tritt die rechte Gehirnhälfte in Aktion. Diese Erkenntnis lässt sich für Lernaufgaben nutzen, wie eine Studie aus den USA nachgewiesen hat. So hilft es, wenn man vor Beginn des Lernens zweimal hintereinander für etwa 45 Sekunden die rechte Hand zur Faust ballt.
Man kann auch einen weichen Ball in die Hand nehmen und ihn zusammendrücken. Anschließend legt man eine kurze Pause ein, danach beginnt man mit dem Lernen. Der Stoff sollte sich nun besser einprägen, als er es ohne die vorherige Stimulation der Hand täte. Dasselbe Vorgehen wiederholt man mit der linken Hand kurz bevor man das gelernte Wissen abrufen möchte. Diese Methode funktioniert deshalb seitenverkehrt, weil sich im Gehirn die Nervenstränge kreuzen. Die rechte Körperseite ist mit der linken Gehirnhälfte verbunden und wird von ihr gesteuert und umgekehrt. Für Linkshänder gelten diese Regeln übrigens genau in die andere Richtung: Links wird zum Lernen aktiviert, rechts zum Abrufen des Gelernten. Wer die Technik falsch herum anwendet, kann seinen Erfolg sogar reduzieren.
Mit welchem Hilfsmittel lassen sich Teelichter in engen tiefen Gefäßen am besten anzünden?
A: Satin-Geschenkband
B: Spaghetti-Nudel
C: Leder-Schnürsenkel
B: Spaghetti-Nudel
Hübsch sehen sie schon aus, Gläser, die von innen zum Leuchten gebracht werden, in der Regel, indem man ein Teelicht hineinstellt. Besonders dekorativ sind diese Gläser, wenn die Wand bunt verziert ist. Eine Schwierigkeit kennt aber vermutlich jeder, der schon einmal versucht hat, so ein Teelicht ganz unten am Boden des Glases anzuzünden. Kurze Streichhölzer sind meist abgebrannt, noch bevor man sie überhaupt an den Docht halten konnte. Nötig wären deshalb lange Streichhölzer oder ein Stabfeuerzeug.
Ist beides nicht zur Stelle, bleibt noch eine dritte Möglichkeit, denn dieses Utensil ist in so gut wie jedem Haushalt vorrätig: die Spaghetti. Sie brennt genauso gut wie ein Streichholz und schafft es durch ihre Länge und die entsprechende Brenndauer auch ganz leicht bis an den Boden jedes noch so tiefen Gefäßes, bevor die Flamme wieder erlischt. Vorsicht ist aber angebracht, denn die dünnen Nudeln brechen leicht ab. Die Kerzen eines Tannenbaums sollte man daher nicht auf diese Weise entzünden, sonst kann es schnell zum Zimmerbrand kommen.
Galaktologie ist die Lehre von der …?
A: Kommunikation mit Außerirdischen
B: Gletscherbildung
C: Zusammensetzung und Beschaffenheit der Milch
C: Zusammensetzung und Beschaffenheit der Milch
Der Begriff »Galaktologie« setzt sich aus den beiden griechischen Wörtern »gála« (deutsch: Milch) und »logos« (deutsch: die Lehre) zusammen. Die Galaktologie ist demnach die Lehre von der Milch. Denn sie, die Milch, ist keineswegs ein schlichtes, sondern ein komplexes, vielschichtig zusammengesetztes Produkt. Kuhmilch besteht beispielsweise zu 87 Prozent aus Wasser und zu vier Prozent aus Fett. Hinzu kommen 4,7 Prozent Laktose (Milchzucker), 3,3 Prozent Eiweiß, 0,75 Prozent Mineralstoffe (Calcium, Kalium und Phosphor-Verbindungen), 0,2 Prozent Zitronensäure und Vitamine und Enzyme. Diese Zusammensetzung ist allerdings nicht vollkommen unveränderlich, sondern sie variiert leicht, je nachdem, um welche Rinderrasse es sich handelt. Eine weitere Rolle spielen die Fragen, wie und wo die Kühe gehalten werden und welche Art Futter sie bekommen.
Die Wissenschaftler, die sich mit all diesen Aspekten, vor allem mit den chemischen und physikalischen Eigenschaften der jeweiligen Milch, beschäftigen, nennt man übrigens »Milchtechnologen«.
Wer bekommt »Rohrgeld«?
A: Kanalarbeiter
B: Blasmusiker
C: Schornsteinfeger
B: Blasmusiker
Wer in einem festen Anstellungsverhältnis steht, dem wird meist ein vollständig ausgestatteter Arbeitsplatz bereitgestellt. Anders verhält sich die Situation bei Profimusikern, etwa in einem Orchester. Jeder und jede von ihnen spielt auf einem Instrument, das er oder sie sich selber kaufen muss. Diese Instrumente sind in der Regel alles andere als preiswert. Damit sie ihre Klangqualität über die Jahre behalten, müssen sie zudem regelmäßig gewartet, instandgesetzt, gelegentlich auch repariert werden. Auch das kostet noch einmal Geld. Und genau diese Kosten werden, zumindest anteilig, vom Arbeitgeber übernommen.
Handelt es sich dabei um Blasinstrumente wie etwa Tuba, Horn oder Trompete, dann spricht man vom sogenannten Rohrgeld. All diese Blasinstrumente müssen regelmäßig professionell von innen gereinigt werden, ab und zu werden Ventile erneuert, Unebenheiten oder sogar Dellen ausgebessert und defekte Teile ersetzt. Bei einer Generalüberholung nimmt man das Instrument komplett auseinander, bessert aus, was nötig ist, und verlötet es anschließend wieder. Zum Schluss wird noch die Oberfläche auf Hochglanz poliert. Bei Saiteninstrumenten heißt dieser Zuschuss übrigens Saitengeld, bei Klarinette und Saxofon ist es das Blattgeld.
Was versteht das Amtsdeutsch unter »Gelegenheitsverkehr«?
A: großer Andrang bei Schlussverkäufen
B: Benutzung von Taxis oder Mietwagen
C: Megastaus an Ferienwochenenden
B: Benutzung von Taxis oder Mietwagen
Bei Schlussverkäufen ist zwar jede Menge los in den unterschiedlichen Geschäften, man könnte daher durchaus von einem »Verkehr« sprechen, der durch einen bestimmten Anlass, eine Gelegenheit ausgelöst wird. Ähnlich verhält es sich bei den obligatorischen Verkehrsstaus zu Ferienbeginn. Auch die Ferien wären die »Gelegenheit« für das Gedränge auf den Autobahnen. Aber: Beides ist falsch.
Der Begriff »Gelegenheitsverkehr« findet sich im Personenbeförderungsgesetz, und zwar unter Paragraf 46. Wörtlich heißt es da unter Punkt 1 in schönstem Amtsdeutsch: »Gelegenheitsverkehr ist die Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeugen, die nicht Linienverkehr (…) ist.« Und unter Punkt 2 desselben Paragrafen wird an erster Stelle der »Verkehr mit Taxen« genannt. Zweitens gehören organisierte Busreisen von Reiseanbietern hierzu, an dritter Stelle findet sich der »Verkehr mit Mietomnibussen und Mietwagen«. Und als Letztes nennt das Gesetz den »gebündelten Bedarfsverkehr«. Auch das bezieht sich auf Transporte mit kommerziellem Interesse, nicht zum Privatverkehr. In diesen Bereich gehören unter anderem Sammeltransfers, etwa zu Flughäfen, oder auch Sammeltaxis. Private Fahrgemeinschaften fallen nicht darunter.
Wie kann man einen Strauß Rosen noch retten, wenn er schon ziemlich welk aussieht?
A: etwas Salz in die Vase geben
B: die Stängel über Nacht in Orangensaft baden
C: den Strauß kurz in kochend heißes Wasser stellen
C: den Strauß kurz in kochend heißes Wasser stellen
Wenn Rosen ihre Köpfe hängen lassen, werden sie meist sofort entsorgt. Das ist aber oft noch gar nicht nötig. Vielmehr kann man versuchen, ihnen mit einem simplen Trick zu neuer Frische zu verhelfen. Die Rosen dürften nämlich an Wassermangel leiden. Nur hilft es in diesem Fall nicht, sie einfach in frisches Wasser zu stellen. Denn das hatten sie ja bisher auch schon. Nun aber sind ihre Wasserlaufbahnen verstopft und müssen erst wieder gereinigt werden. Dafür nimmt man die schon leicht welken Exemplare zuerst einmal aus der Vase und schneidet ihre Stängel schräg an. Am besten über mehrere Zentimeter, denn je mehr vom Inneren des Stängels freiliegt, umso besser für die nun anschließende Behandlung.
Jetzt stellt man die so präparierten Rosen bis zu den Köpfen ins heiße Wasser. Vorsicht: Das Wasser muss zwar heiß sein, sollte aber nicht kochen! Auf diese Weise gerinnt das Eiweiß aus den Stielen, und die Luftbläschen, die die Wasserlaufbahnen in den Stielen verstopft haben, können entweichen. Während das Wasser langsam abkühlt, erholen sich die Blumen und sehen wieder deutlich frischer aus. Anschließend wieder in die mit frischem lauwarmem Wasser gefüllte Vase zurückstellen.
Was lässt sich am einfachsten öffnen?
A: eine Bierflasche mit einer Tageszeitung
B: ein Gurkenglas mit einem Papiertaschentuch
C: eine Konservendose mit einem Kondom
A: eine Bierflasche mit einer Tageszeitung
Die Flasche mit dem Bier steht da. Was fehlt, ist der Flaschenöffner. Die bekannten Utensilien, um den Deckel auch ohne Öffner zu entfernen, sind entweder ein Feuerzeug oder gleich die ganze Bierkiste beziehungsweise deren Rand. Wem auch das nicht zur Verfügung steht oder wer seine Bekannten mit einer ungewöhnlichen Technik überraschen möchte, greift einfach zu einer Zeitung und trennt eine Seite heraus.
Damit dieser »Flaschentrick« funktionieren kann, muss das Papier einfach nur korrekt zurechtgeknickt werden: Im ersten Schritt faltet man es an der Längsseite drei- bis viermal, bis ein ca. ein Zentimeter breiter Streifen entsteht. Nun werden die beiden Enden des Streifens aufeinandergelegt, und dieser halbierte Streifen noch einmal halbiert, sodass eine stabile Kante entsteht. Die Zeitungsseite ist zum Hebel geworden, mit dem sich die Flasche ganz einfach öffnen lässt. Wer gerade keine Zeitung zur Hand hat, kann sich auch mit einem Blatt Papier oder einem weichen Karton behelfen.
Wie lässt sich die Reifung von Bananen beschleunigen?
A: den Strunk in Folie einpacken
B: eine Tomate danebenlegen
C: sie an einen Haken hängen
B: eine Tomate danebenlegen
Wenn Tomaten reifen, geben sie Ethylen ab, eine gasförmige Kohlenwasserstoffverbindung, die als Pflanzenhormon wirkt. Dieses Gas ist unsichtbar, riecht aber leicht süßlich. Es wird von den Pflanzen gebildet und steuert ihren Reifungsprozess. Gleichzeitig geben sie es aber auch nach außen ab, und zwar alle Pflanzen. Tomaten sind allerdings dafür bekannt, dass sie im Verhältnis zu anderen Pflanzen besonders viel Ethylen verströmen. Da dieses Gas nicht nur im Inneren der Pflanzen wirkt, sondern auch von außen aufgenommen wird, reifen Obst oder Gemüse, die neben einer Tomate liegen, besonders schnell.
Möchte man den Prozess, der aus einer noch grünen eine essfertige Banane werden lässt, beschleunigen, platziert man am besten in ihrer unmittelbaren Nähe eine Tomate. Tatsächlich sollte sie möglichst nah an der Banane liegen, denn Ethylen verliert mit der Entfernung an Wirkung. Die Wirkung des Ethylens macht sich übrigens auch die Lebensmittelindustrie zunutze: Oft werden Früchte in ihrem Anbauland noch unreif geerntet und später am Zielort mit Ethylen behandelt, um den Reifungsprozess zu beschleunigen und sie damit verzehrfertig in den Handel zu bringen.
Welche erstaunliche Eigenschaft trifft auf Giraffen zu?
A: Sie können sich nur zwei Mal in ihrem Leben fortpflanzen.
B: Sie kommen mit weniger als zwei Stunden Schlaf am Tag aus.
C: Sie müssen nur alle zwei Wochen Wasser trinken.
B: Sie kommen mit weniger als zwei Stunden Schlaf am Tag aus.
Was für viele Tiere und auch für Menschen sehr gesund ist, das ist für eine Giraffe lebensgefährlich: der Schlaf, erst recht der Tiefschlaf. Denn Giraffen sind Beutetiere, und eine schlafende Giraffe macht es ihren Jägern außerordentlich leicht, sie zu erlegen. Darum schlafen diese riesigen, schlanken Tiere selten. Stattdessen dösen sie nur für ein paar Minuten, das aber auf Tag und Nacht verteilt immer wieder. Zählt man diese Zeiten zusammen, schläft oder eher: döst eine Giraffe von den 24 Stunden des Tages ungefähr zwei bis vier. Und sie bleibt dabei stehen. Beides schadet ihrer Konstitution keineswegs.
Grundsätzlich kann zwar auch eine Giraffe sehr tief schlafen, dazu muss sie sich allerdings hinlegen, was gleichzeitig bedeutet, dass sie sich zusammenrollt. Für Löwen, Leoparden, Hyänen oder Wildhunde ist sie damit noch leichtere Beute. Denn es braucht Zeit, bis sie sich wieder aufrichten und – eine ihrer wichtigsten Verteidigungsformen – um sich treten oder weglaufen kann. Darum legen sich Giraffen zum Schlafen nur hin, wenn sie sich absolut sicher fühlen, und auch dann nie länger als maximal eine halbe Stunde.
Womit sollten Spüle und Armaturen einmal pro Woche eingerieben werden, damit kein Kalk entsteht?
A: Bund Petersilie
B: Babyöl
C: Limonade
B: Babyöl
Niemand mag Kalkflecken. Und dennoch entstehen sie nur zu schnell überall dort, wo Wasser mit im Spiel ist. Die Spüle in der Küche und Armaturen gehören zu den Flächen, auf denen sich der Kalk am schnellsten und vor allem mit schöner Regelmäßigkeit immer wieder anlagert. Aber es gibt einen Trick, um den ungeliebten Flecken beizukommen, und zwar Babyöl. Denn Wasser und Öl vermischen sich nicht.