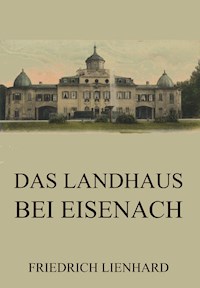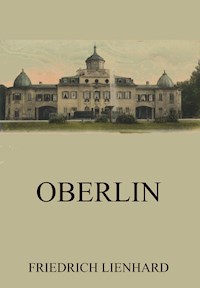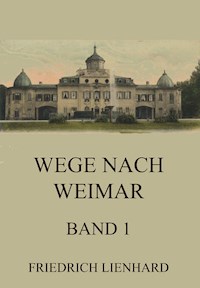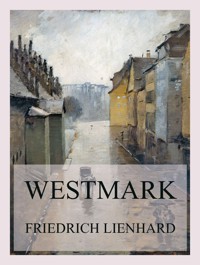
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Neben dem großen Kultur- und Weltanschauungsproblem der Jahrzehnte vor dem Ersten Weltkrieg beschäftigte Lienhard innerlich besonders das Schicksal seiner Heimat. Er setzte die "Heimat" mit ihrer Fülle landschaftlicher und geschichtlicher Werte gegen die heimatlose Zivilisation der modernen Großstadt. So förderte er zwar die "Heimatkunst", ist aber selbst nicht als Heimatdichter im engeren Sinne anzusehen, da er, obwohl immer wieder Kräfte aus dem geliebten Elsass ziehend, sich durchaus unter das Schicksal der allgemeinen deutschen Volksgeschichte stellte und von hier aus urteilte. Er, der einst die "Wasgaufahrten" geschrieben hatte, musste durch den Verlust des Elsass an Frankreich aufs tiefste getroffen werden. Dieses Schicksal verarbeitet er in seinem letzten Zeitroman "Westmark" (1918). Prachtvoll ist die Gestalt des alten Pfarrers von Lützelbronn, der sich schließlich für Deutschland entscheidet und nach Heidelberg hinüberwandert. Dieser kerndeutsche Elsässer ist gleichsam der tragende Stamm im Gezweig dieser Geschichte. Um ihn sind in mannigfaltigen Gestalten alle Stimmungen und Meinungen des Elsässertums geordnet, vom ganz am deutschen Geiste hängenden Sohn des Pfarrers bis hin zum unbedenklichsten Französling. Für die Kenntnis der elsässischen Seele und der elsässischen Zustände während des Krieges ist dieses Werk äußerst wertvoll.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Westmark
FRIEDRICH LIENHARD
Westmark, F. Lienhard
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783988681669
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
Erstes Kapitel. Drei Einsiedler1
Zweites Kapitel. Dreierlei Gespräche. 15
Drittes Kapitel. Elsass und Thüringen. 31
Viertes Kapitel. Ein Nachtgang. 37
Fünftes Kapitel. Ein Nachtgang. 46
Sechstes Kapitel. Das Weinberghäuschen. 62
Siebtes Kapitel. Briefe eines Elsässers. 72
Achtes Kapitel. Ein Tag in Straßburg. 80
Neuntes Kapitel. Aus Speckels Tagebuch. 98
Zehntes Kapitel. Das Grab im Birkenwäldchen. 106
Elftes Kapitel. Stille Menschen. 126
Zwölftes Kapitel. Heidelberg. 135
Erstes Kapitel. Drei Einsiedler
Die Welt ist groß: zieh hin und her,
Du findest doch kein Elsass mehr!
Ehrenfried Stöber
Herbstwehmut überschauerte bereits die Gefilde der Westmark. Die Weinberge um Lützelbronn begannen sich zu vergolden. Gärten und Felder hatten ihre Sommerarbeit getan und waren willens, ihre Früchte den Menschen abzugeben.
Über der Ebene und am Gebirge entlang war jener zarte Duft, der zumal im Abendrot der elsässischen Spätsommerlandschaft einen wehmutsvollen Zauber verleiht. Noch glaubt man die Gluten des Sommers irgendwo in den Tiefen zu spüren; aber sie sind vergeistigt, verhalten, nur noch Melodie und Farbe, nicht mehr Leidenschaft.
Oder war diese veredelte Glut nur in der Seele des Einsamen, der oben am Waldrand saß und den ernsten Blick in die Landschaft sandte?
Es war ein langer, hagerer Mann von etwa fünfzig Jahren, in dunkler Kleidung, die sofort den Pfarrer oder Gelehrten verriet. Auf seinem Lodenmantel gelagert, hatte er den Ellenbogen aufgestützt; neben ihm lagen Buch und Filzhut. Die Stirn trat aus gelichtetem, angegrautem, kurzem Haar bedeutend hervor. Herb, fast schwermütig wirkte das längliche bartlose Gesicht mit den zwei tiefen Kummerfalten, die sich von der Nase zu den Mundwinkeln herunterzogen.
Der Boden zwischen Weinberg und Kastanienwäldchen war trocken. Ein wilder Kirschbaum breitete seine spitzen, welk herniederhangenden Blätter über den Träumenden aus. Ein paar lange Halme standen regungslos. Vergilbte Kastanienblätter bildeten einen Teppich; hie und da lag eine gesprungene Schale der essbaren Früchte. Und Risse im Boden zeigten, dass sich in dieser geschützten hohen Waldecke nicht viel Regen zu sammeln pflegte. Ein toter Winkel, der aber weit und breit den schönsten Rundblick bot.
Es war ein Elsässer aus altem Geschlecht, der von diesem Lieblingsplatz seine schwermütigen Gedanken über die Heimat hinauswandern ließ. Pfarrer Johann Friedrich Arnold amtierte seit Kriegsbeginn in seinem Heimatdorfe Lützelbronn. Aber so friedlich sich auch das Dörfchen zu seinen Füßen von hier oben beschauen ließ: welch ein Lebenswirrsal lag hinter dem stillen Manne! Er hatte einige Jahre auf seinem kleinen Landgut Windbühl gesessen und gesonnen; er hatte noch früher als philosophischer Privatdozent in Heidelberg Fuß zu fassen gesucht. Er galt bei seinen Landsleuten und Amtsgenossen zwar als »arg gelehrt«, genoss auch als vornehmer Charakter unbestimmte Achtung, erschien aber doch den meisten als ein etwas abenteuerlicher Sonderling, der seine Ziele überspannt hatte und nun eigentlich in einer unfruchtbaren Ecke saß.
Der Elsässer hatte von einem Landsmann gelesen, der vor hundert Jahren im Steintal, tief im Wasgenwalde, segensreich gewirkt hatte. Die »Zeder« hatten sie jenen schlichten, frommen und festen Pfarrer von Waldersbach genannt. Im Jahre 1826, im hohen Alter von sechsundachtzig Jahren, war der Allverehrte gestorben. Jenen Patriarchen Friedrich Oberlin hatte er sich zum Vorbilde genommen. Es waren in jenem Edelmenschen Fähigkeiten an der Arbeit gewesen, die sich einst beruhigend und beseelend auf die Umwelt ausgestrahlt hatten.
»Ich habe mir selbst ähnliche Kräfte auszuwirken gewünscht«, dachte der Spätling auf seinem Hügel. »Allein das Schicksal hat mir kein Wirkungsfeld gestattet.«
Er sah im Geist seine leidvoll hingesiechte Frau; er sah sich erschüttert vor ihrem verzerrten Angesicht stehen bei jenem letzten furchtbaren Besuch im Irrenhause ... Er sah im Geist seinen Sohn, der jetzt da unten im Giebelzimmer des Pfarrhauses saß, mit einer Nervenerschütterung heimgekommen aus der Somme-Schlacht ...
Und jäh zuckte nun er selbst empor. Ein ferner Kanonenschuss! Das kam aus den Südvogesen. Unheimlich, ob auch gedämpft, rollte das nun wieder Schlag um Schlag über die lang widerhallenden Berge. Es gab Tage, wo diese Batterien nur tropfenweise zu vernehmen waren; und andre Tage, wo die Fenster zitterten. Zwei Völker rangen dort wieder um des deutschen Reiches Westmark! Zwei nur? Nein, viele Völker! Seit vier Jahren schon ein Lebenskampf zwischen Deutschland und fast der ganzen übrigen Welt! Und dieses deutsche Elsass-Lothringen, dieses Alemannenland, das die Gegner eine geraubte französische Provinz zu nennen wagten, war bei alledem eins der leidenschaftlich umstrittenen Kampfziele. Auf den Tag der Rache hoffte ja Frankreich seit Jahrzehnten! Auf den Tag der Rache hatte auch im Elsass eine kleine gehässige Minderheit gewartet und gewühlt seit Jahrzehnten! Nun hatten sie ihren Rachekrieg. Europa blutete. Und das Niederträchtige dabei war, dass die feindlichen Völkerschaften dem deutschen Volk und dem deutschen Kaiser alle Schuld zuschoben ...
Vier Jahre Weltkrieg! Er dachte an die ersten lodernden Kriegstage zurück: wie er Schwester und Tochter seines damals krank liegenden Nachbarn und Freundes Bieler noch im letzten Augenblick aus den Südvogesen holte. Welche Flucht! Die furchtbaren Donnerschläge der Kanonen, die hinter ihnen den dunkelblauen Nachthimmel in rote Glut und die Dörfer in Rauch und Brand verwandelten! Die Franzosen waren über die Schlucht und von Belfort her in Gebirge und Ebene eingebrochen. Eine Reihe von elsässischen Ortschaften wurde besetzt; die Bevölkerung der Kampfzone floh. In einem kleinen Gefährt holte er noch rasch die zwei Frauen, die dort auf Besuch waren. Jenes ganze Dorf war auf der Flucht. Bald wuchteten Bergwände hinter dem Zug der verstörten Flüchtlinge. Die Sinne vernahmen wieder die Geräusche der Nähe. Lauter knarrten und ächzten die Wagen; die schlürfenden Schritte und das Schnaufen der Rinder machten sich stärker vernehmbar; ein Husten oder Niesen klang kühner hinaus; auch zahlreicher als zuvor ein Weinen oder eines Kindes Geplärr. Und vernehmlich rauschte neben der Straße der mitwandernde Waldbach, der sich gleich jenen Elsässern in die Rheinebene zu flüchten schien. Wohl verfolgte dumpfer Kanonenton Gehör und Gemüt noch lange. Doch das Mordfeuer klang spärlicher und durch Ferne gemildert in die Seele der Entsetzten.
Er sah sie im Geiste zwischen ihrem hochgetürmten Gerät. Mit gezügelten oder gemessenen Schritten bewegten sich neben den Ochsen und Kühen die Knaben und Greise, gedämpften Tones die Zugtiere ermunternd und die nachwandelnde Herde antreibend. In der sternenhellen, mondlosen Nacht blitzte von Zeit zu Zeit eine Laterne auf. Der vorderste Bauer hatte seine Leuchte am Leiterwagen befestigt und erhellte als Führer den Weg. Der alte Lehrer schritt manchmal die Reihe entlang und rief ermunternd einzelne Namen in die Nacht hinaus; und von da und dort scholl beruhigende oder seufzende Antwort. So kroch der Zug aus der Finsternis des Wasgenwaldes in das weithin klaffende morgengraue Flachland. Im Osten, über der Linie der Schwarzwaldberge, flimmerte der erste Purpurschimmer der Morgenröte ...
Und ergreifend war es dem Pfarrer in Erinnerung, dass plötzlich in jenem Flüchtlingszuge ein Knabe zu singen begann. Mit schöner Bergstimme sang der Sohn der südlichen Elsassberge das deutsche Volkslied:
»Zu Straßburg auf der Schanz,
Da ging mein Trauern an.
Das Alphorn hört' ich drüben wohl anstimmen,
Ins Vaterland wollt' ich hinüberschwimmen,
Das ging nicht an« ...
Wohl verwies ihm eine scheltende Frauenstimme das unpassende Singen. Aber der Knabe fuhr leiser fort, ohne sich sonderlich einschüchtern zu lassen. Und das trauervolle Lied schwebte fortan über der alemannischen Flüchtlingsschar, wie das Weinen einer Seele, die mit verhülltem Antlitz vor den Dämonen des westlichen Hasses nach Osten flieht ...
Dann ein andres Bild: jener begeisterte Auszug der elsässischen Regimenter aus Straßburg! Wie dröhnte die Meisengasse, wo einst Rouget de l'Isle die Marseillaise gesungen, vom Marschgesang der blumengeschmückten deutschen Soldaten! »Lieb' Vaterland, magst ruhig sein! Fest steht und treu die Wacht am Rhein!« Und winkende Hände und Taschentücher aus allen Fenstern — und heiße Tränen und heiße Hoffnungen! Unbekannte schüttelten einander die Hand: »Auch ein Sohn dabei? Jetzt hat's mit dem Zwitterwesen ein Ende! Jetzt bluten wir miteinander!« Und seht doch, da springt einer aus dem Volk heraus und nimmt dem Fahnenträger begeistert die Fahne ab — und Frauen und Kinder laufen weinend und lachend neben den Todgeweihten einher ... Auch sein Sohn Gustav war dabei, leuchtend von inneren Flammen! ...
Und nun vier Jahre lang schwerer Kampf gegen ungeheure Übermacht! Der letzte deutsche Angriff des Sommers 1918 war leider ebenso missglückt wie der Angriff der Österreicher an der italienischen Front. Die deutsche Westfront wich langsam, langsam zurück ...
Der Träumer schauerte zusammen. Ein alter Bauer am Rande des Hohlweges trug schwermütig Stangen auf einen Handwagen. Nur flüchtig hatte der Alte bei der einsetzenden Kanonade nach Süden gelauscht. Jetzt klapperten wieder gleichmäßig seine Holzschuhe durch die reine Luft herauf. Sonst kein Laut. Das Dörfchen zu Füßen des Gelehrten schimmerte mehr und mehr in einem letzten lieben Sonnenblick. Das zarte Birkenwäldchen im Garten des Winzers Bieler, unmittelbar neben dem weißen Pfarrhause, stand verklärt und zum Betreten nahe. Wie schön und rein dieses geliebte Land, wenn man sein Bild mit stiller Seele aus etlicher Höhe in sich aufnahm!
Steile Pappeln wuchsen in der Ebene. Sie standen wie feierliche Zypressen auf einem Gottesacker. Die Störche rüsteten nun zur Südfahrt; die Schwalben desgleichen.
»Elsass gleicht in Wahrheit einem herbstlichen Friedhof«, dachte der Einsame. »Mein Ohr vernimmt ein Lied der Schwermut. Wir sind ungeheuer verlassen, wir Elsässer!«
Der Pfarrer und Professor war musikalisch. Er glaubte jetzt Liszts zweite Ungarische Rhapsodie zu vernehmen, die über die Ebene brauste wie ein Heer von Geisterrossen und wieder verwehte — nein, sich verwandelte in ein Notturno oder eine Ballade von Chopin. Dann schien das magische Singen und Klingen wieder verflogen. Ein ganz leiser Abendhauch bewegte die Halme. Des Einsiedlers Blick umschattete sich ...
Aus dem Birkenwäldchen zu seinen Füßen erhob sich eine Gestalt. Die Erscheinung wuchs. Jetzt füllte sie sein Gesichtsfeld aus — und es entspann sich ein Gespräch.
»Wer bist du?« fragte der Seher.
»Die Seele, die du liebst.«
»Wer ist die Seele, die ich liebe?«
»Von der du träumst.«
»Wie kann Gestalt annehmen, was in Lüften lebt? Kann elsässische Seele Person werden? Kann sie als Mann oder Mädchen vor mein Auge treten? Kann ich ihr die Freundeshand reichen oder sie liebend ans Herz ziehen? Denn siehe, ich habe um die Seele meines Volkes gerungen lebenslang — und habe sie nicht gefunden.«
»Hat deine Liebe nicht einst Gestalt genommen und einen Sohn gezeugt?«
»Ich habe wohl einen Sohn, doch ich bin um ihn bange. Um sein Gemüt noch mehr als um seine zarte Gesundheit. Denn auf ihm lastet dieses Landes tragisches Schicksal. Er wird darunter vergehen, fürcht' ich, wie seine Mutter vergangen ist. Zwanzig Jahre bin ich allein; ich habe mein Herz und meine Hoffnung in meinen Sohn ergossen. Und mein Sohn droht mir zu zerbrechen.«
»Hast du niemanden als ihn?«
»Seine Braut, meine Schülerin und junge Freundin, die mir nicht minder gut ist als ihm.«
»Wie kannst du sagen, dass du einsam seiest? Haben dich nicht beide lieb?«
»Beide haben mich lieb. Und ich wüsste niemanden, den ich mehr liebe. Und in ihnen lieb' ich dieses Land, das sich weit und wehmütig hinter ihnen ausdehnt. Warum senkst du das Haupt?«
»Siehst du das Birkenwäldchen in deines Nachbars Garten?«
»Ich sehe es.«
»Dort wird ein Grab stehen.«
»Ein Grab? Wessen Grab?«
Die Luftgestalt erhob beide Arme, beschrieb einen Bogen, als wollte sie das Land umfassen, und wiederholte:
»Ein Grab.«
»Ein Grab? Willst du mich damit schrecken? Schätzest du meine geistigen Kräfte so gering ein? Du täuschest dich und mich mit diesem Spinnwebgewand der Trauer. Willst du dieses Landes Seele sein? Nein, nein, du bist nicht die letzte Tiefe der Westmark! Unseres Wesens Kern ist trotz alledem Kraft, unsre letzte Tiefe ist schaffende Liebe. Immer neu in jedem Frühling belebt sich die Natur, und aus Trümmern erblüht Leben. Wirf dein Gewand ab, enthülle deinen Kern, deine Tiefe! Enthüllst du dich nicht, Gespenst, so will ich selbst dich entzaubern! Denn wir sind die Seele dieser Westmark, wir Schaffenden, wir Lebendigen! Wir gestalten dich — du nicht uns! Verschwinde!«
Ein Ruck, ein Griff in die blasse Luft: das Gesicht verschwand. Der Seher warf einen Bann ab. Er saß nun aufrecht und atmete befreit.
Und siehe da! Die Sonne brach noch einmal in entzückender Strahlenbrechung quer herüber in das Birkenwäldchen. Und dort, zwischen den jungfräulichen weißen Stämmen, stand in der Tat eine menschliche Gestalt in hellem Frauengewand und winkte herauf.
»Es ist Fanny«, sagte der Erwachte.
Und er nahm Hut, Buch und Mantel und ging mit großen Schritten hinunter ins Tal.
* * *
Fanny Bieler hatte lange Stunden in ihrem Stübchen auf dem Fußboden gesessen und in alten Briefen gekramt. Schubladen standen offen, Papiere, Bänder, gepresste Blumen lagen umher. Und mitten darin saß die blonde kleine Gestalt, derart vertieft, dass sie die ganze Außenwelt vergaß.
Da waren die Briefe ihres Bräutigams Gustav, sehr zahlreich, sehr sauber geschrieben und gehaltvoll; dann waren da in großer, kräftiger Schrift die meist kurzen, hingeschleuderten, sprühenden Briefe ihres entfernten Verwandten Erwin ... Waren es nicht Liebesbriefe, glühender als Gustavs gehaltene Schreibart?
... »Da sitz' ich auf dem Petersberg zu Erfurt, genialste aller Basen, hab' einen ausgezeichneten Feldwebel und einen widerwärtigen Hauptmann, werde mir aber meine Begeisterung nicht zerrupfen lassen durch einen Überpreußen, dessen schnarrende Stimme sämtliche neun Musen in die Luft sprengt. Was tut also der findige Rekrut? Er versetzt seiner Cousine Liebeserklärungen. Weib, Weib, glückselig der Mann, der dich in die Arme schließt! Ich könnte Freund Gustav, den grundguten Kerl, prügeln, dass er Dich nicht jeden Tag jauchzend durch die Stube trägt, Du anmutigstes elsässisches Maidel, dessen einziger, erster und letzter Kuss von damals — weißt Du, beim Auszug, in unsrer Stube am Münster — o Straßburger Münster —, dessen einziger Kuss, sag' ich, mir heut' noch und für immer auf den Lippen brennt! Leb' wohl, Fanny, ich schwöre Dir, kein Mädchen zu berühren, und nichts zu tun, was Dich betrüben könnte! Und ich danke dem Himmel, dass im Elsass Mädchen wachsen wie Du! Wenn Du ein Eckplätzchen in deinem Herzen neben Deinem Gustav übrig hast, so lass mich dort uffm Schemele sitzen und behalt e bissl lieb.
Deinen Freund und Vetter Erwin.«
Solche Briefe liest ein hübsches Mädchen nicht ohne Stolz und Ergriffenheit, selbst wenn sie noch so glücklich verlobt ist. Fanny kam in ein holdes Verträumtsein; dann prüfte sie sich selbst. »Kann ich denn treu sein?« dachte sie plötzlich. Und sie ertappte sich darauf, dass sie oft mit mehr Lust und Laune an Erwin schrieb als an ihren Bräutigam. Und doch: wie innig hatte sie Gustav lieb! Sie war so entsetzt über diese feine Untreue, über dieses leise, leise Liebesspiel mit dem lebhaften, langen, blonden Erwin, dessen Augen so lustig hinter dem Kneifer sprühten; sie war so bestürzt über die Möglichkeit, für einen andern noch Raum zu haben in ihrem bräutlichen Herzen — dass sie jäh aufsprang, alle Briefe in die Schublade warf, abschloss und mit zwei, drei Schritten die Treppe hinunterflog an das Klavier, wo sich ihre heiße Natur in Liszt und Chopin austobte.
Dann lief sie hinaus in den Garten.
Sie war im Städtchen gewesen und trug noch ihr hellgraues Kleid mit breitem rotem Gürtel. Den Lodenmantel hatte sie umgeworfen; die Wangen glühten; die feste, volle Brust atmete stark.
Alles in der feingebauten, spannkräftigen, nicht großen Gestalt war beherrschte Glut. Um ihr blondes, über den Schläfen geringeltes Haupthaar hatte sich das Netz einer Spinne gewickelt. Das junge Mädchen blieb mit zusammengepressten Lippen stehen, blinzelte nach oben und suchte das Gespinst zu entfernen. Der rote Mund war erstaunlich schmal, aber voll, gleichsam gewölbt; die Adlernase zwischen den blauen Augen wirkte bedeutend und gab dem ovalen, rosigen Gesichtchen Charakter. So klein die Gestalt war, sie bekundete Festigkeit und Wärme zugleich.
»Allons donc!« rief sie jetzt und schleuderte das lästige Anhängsel mit kurzem, raschem Ruck an ein Birkenstämmchen, das erschrocken einige Blätter über das ungeduldige Persönchen fallen ließ.
Sie lief nun im höheren Teil des Gartens hin und her, wo das Wäldchen an den Pfarrgarten grenzt. Wie oft war der Jugendfreund und Geliebte über diese Mauer gesprungen! Sie lauschte insgeheim auch heute auf sein Kommen. Aber sie war zu stolz, um sich diese schmerzliche Ungeduld merken zu lassen. Scheinbar wohlgemut schritt sie flinken, federnden Schrittes hin und her, als ob sie zu lange gesessen hätte und sich etwas erwärmen wollte. Ja, sie summte leis-wehmütig ein Liedchen von der schönen armen Lilofee vor sich hin, das sie vom Wandervogel Erwin gelernt hatte, und blickte hartnäckig nach der Ebene hinaus oder nach dem Wald empor. Im Weinkeller klopfte der Vater mit dem lahmen Schauli an den Fässern herum — — und fernher von Süden setzte nun wieder die Kanonade ein.
Drüben aber, im Giebelstübchen des Pfarrhauses, freilich auf der abgelegenen Seite, saß der beurlaubte kränkelnde Gustav, keine hundert Schritte von der lebensprühenden Geliebten entfernt. Seine Ruhr und seine Wunde waren geheilt; aber Herz und Nerven gehorchten noch nicht. Vom stolz-einsamen Vater und von der menschenscheuen, aus dem Irrenhause in die Ewigkeit hinübergeschlichenen Mutter hatte der begabte Jüngling viel Einsamkeitsbedürfnis im Blut. Seine Dachkammer war sein Reich; die Tür an der Speichertreppe pflegte er von innen zu verriegeln. So war er unnahbar. Niemand konnte ihn aus der selbstgewählten Einsiedelei herunterlocken, wenn er nicht Lust hatte; auch nicht der verehrte Vater und noch weniger die Braut und Spielgenossin. Er hatte seine Trutzstunde; man musste ihn allein lassen.
Manchmal freilich überwältigte den Jüngling der Drang, sich an Menschen anzuschmiegen. Dann herunter, ein Sprung über die Mauer — es lag dort ein altes Brett, das man schief anstellte, um der Fußspitze einen Halt zu geben — und er war in den Armen der küssedurstigen Geliebten der zärtlichste und bei aller Inbrunst ritterlichste Liebhaber.
Mit Tränen der Dankbarkeit und der Rührung dachte Fanny an all die liebenswerten Eigenschaften des Leidenden. Sie selber, sinnenstark und rein zugleich, verband ungewöhnliche Liebeskraft mit einem ungewöhnlichen jungfräulichen Stolz. So war es ihr denn nicht gegeben, den Geliebten zu umwerben oder gar an seiner Türe zu betteln. Eher die Lippen blutig beißen — —
Sie riss eine letzte Rose so hastig ab, dass sie sich in den Zeigefinger stach. Mit Ingrimm, einem schmollenden Kinde nicht unähnlich, stand sie nun und saugte am Finger. Der dunkelgrüne Lodenmantel war von der Schulter geglitten. Und wie sie nun in ihrem hellen Kleide dastand, den zierlichen Finger am Munde, dachte sie lebhaft an Onkel Arnold; so pflegte sie den Vater ihres Bräutigams zu nennen. Er war so oft mit seiner Weisheit und Ruhe ihr Zufluchtsort: wo blieb er denn heute?
Ein Vorgang drängte sich lebhaft und anschaulich vor ihr inneres Auge. Das war damals eine der schwersten Nächte ihres Lebens. Zittern überlief die kleine Gestalt, wenn sie daran dachte. Das war die Nacht im Herbst 1914, als ihr Bruder Georges, im Auto vorüberkommend, nach der Schweiz und nach Frankreich zu fliehen entschlossen war, mit falschem Pass — ein fahnenflüchtiger Stabsarzt! Furchtbare Nacht! Ihr Bruder und der herübergeeilte Pfarrer waren aneinandergeraten, deutschgesinnt der reife Onkel Arnold, verhetzt von Französlingen der junge Elsässer. Es ward ein Ringen auf Tod und Leben. Vater Bieler verkroch sich; das junge Mädchen saß mit zusammengebissenen Zähnen in der Sofaecke, grausam eingekeilt zwischen dem geliebten Pfarrer und nicht minder geliebtem Bruder. Und ihr Bräutigam, der kerndeutsch gesinnte Elsässer, stand derweil auf dem deutschen Schlachtfeld! Noch einmal hatte der Pfarrer den Flüchtling zur Pflicht zurückgeführt; aber tags darauf entwich dieser dann doch seinem deutschen Vaterlande. Und nun stand Georg Bieler längst auf der Liste der ausgebürgerten Elsässer — ein Landesverräter!
Sie war damals dem geliebten Onkel Arnold an den Hals geflogen, als er den Bruder noch einmal beredet hatte. Und — wann war's doch? Ein zweites Mal, schon früher, hatte der väterliche Freund sie an sein Herz gerissen, der hohe, nach außen so kühle Mann, und mit einem Jubelruf in die Lüfte gehoben. Das war — ja, das war in jener Philosophiestunde mit Gustav auf dem Gutshof Windbühl, als sie den Kant zornig an die Wand warf. Die Stelle wusste sie nicht mehr; aber sie erinnerte sich ihres Entsetzens nach der jähen Tat, sie erinnerte sich des verärgert scheltenden Gustav — und wie sie dastand, den Finger am Munde, von dem Gedanken gelähmt: »Um Gottes willen, was wird nun Onkel Arnold sagen, der Philosoph?!« Aber Onkel Arnold, der Mensch, lachte laut auf; er packte das temperamentvolle Mädchen unter den Armen, hob es wie ein Kind hoch und küsste es mitten auf den blühend warmen Mund. Es war wirklich so: sie wurde von ihm geküsst — und hatte doch Kants Kritik der reinen Vernunft an die Wand geworfen!
Immer war es Onkel Arnold, der sie verstand, der ihr zu Hilfe kam, der vor allem ein lebendiger Mensch war und dann erst ein Gelehrter.
Und während sie nun, den Finger noch am Munde, wie damals in der philosophischen Stunde, ihre Augen am Berghang schweifen ließ — siehe, da saß ja Onkel Arnold oben am Kastanienwäldchen unter dem Kirschbaum!
Sofort begann sie zu winken. Endlich ein Mensch!
* * *
Gustav stand in seinem Dachstübchen am offenen Fenster und beobachtete durch den Feldstecher den Vollmond.
»Ich bin geheimnisvoll mit dem Mond verbunden«, dachte er. »Der Tag ist mir zu grell und zu laut.«
Bleich wie das langsam über das Gebirge emporsteigende Nachtgestirn war auch sein Antlitz. Er trug neben dem kurzen dunklen Schnurrbart noch an den Backenknochen etlichen Haarwuchs, so dass er mit seinem etwas düstern Ausdruck einem Bildnis des Dichters Lenau nicht unähnlich sah. Schlank, von feinem Gliederbau, in Gebaren und Sprechweise gedämpft, gehörte der gewissenhafte junge Mann zu jenen Naturen, die sich weder aufdrängen noch durchsetzen, sondern am liebsten ihre Person auswischen möchten.
»Gäb's doch nur eine Tarnkappe!« seufzte er manchmal. »Ich möchte am liebsten unsichtbar durchs Leben gehen.«
Er hatte sich zur wohlgelungenen Abgangsprüfung vom Gymnasium ein wertvolles Zeisssches Fernglas erbeten. Sternkunde war eine seiner Leidenschaften. Da war es nicht verwunderlich, dass man ihm den Spitznamen »Sterngucker« anhängte.
Andrerseits war er ein Kleinkrämer, ein Sammler, der mit fast komischer Zärtlichkeit wunderlichste Dinge einheimste und aufbewahrte: Steine, Blumen, Briefmarken und eine Fülle von kleinen Erinnerungen, mit beschriebenen Bändern oder Aufschriften versehen, ebenso genau geordnet und durchgeführt wie sein Tagebuch. Philosophie und Literatur waren sein Studium; die Sternenliebhaberei zu vertiefen, war er zu wenig Mathematiker. Und seine Schwäche auch in seiner Wissenschaft bestand darin, dass er sich gar zu gern in Kleinkram verlor. Er verbrachte oft Stunden damit, eine nicht genau bezeichnete Stelle aus Goethe oder dergleichen selber aufzusuchen, auch wenn der Gewährsmann, dessen Buch er las, noch so zuverlässig scheinen mochte.
»Warum nur die Leute nicht genau die Seiten angeben,« knurrte er ärgerlich, »wenn sie einen Dichter anführen!«
Alsdann schrieb er sich Band und Seite seiner Quelle mit Bleistift an den Rand und war beruhigt. Dem Gehalt des angeführten Wortes nachzudenken, vergaß er darüber.
Er war der geborene Spezialist und Kleinforscher und gehörte in eine Bibliothek oder auf den Lehrstuhl einer modernen Hochschule.
Und diesen feingestimmten Nervenmenschen packte das Schicksal und stellte ihn mitten in das Grauen der Somme-Schlacht. Gewissenhaft und treu hielt er in den Gasgranaten aus bis zum Letzten. Er liebte sein deutsches Vaterland. Eine Glutwelle der Begeisterung hatte auch ihn hinausgerissen, wie seinen liebsten Freund, den anders gearteten Erwin.
Jetzt saß der junge Elsässer hier mit zerrütteten Nerven. Er starrte die zerfurchte Mondfläche an, legte dann das Glas beiseite und kam in eine sinnlose schaukelnde Bewegung, wobei er immer — in Erinnerung an einen Satz des Philosophen Kant — die Worte vor sich hin leierte: »Der bestirnte Himmel über mir — das moralische Gesetz in mir — über mir — in mir — —« bis er sich, plötzlich erwachend, umsah und in ein Stöhnen ausbrach: »Herrgott, ich bin ja krank!«
Schwer warf er sich auf den Diwan, zog die Decke über sich, schloss die Augen und murmelte leis in sich hinein: »Ich bin krank, ich bin krank!«
Ein widerlicher Duft, der aus dem Keller zu kommen schien, lag über dem Dorfe. Oh, wie das an die Leichengerüche der Schlachtfelder erinnerte! Warum man ihn nur so allein ließ? Er ringelte sich zusammen, ganz klein — und Bilder aus den grauenvollsten Kriegstagen rollten ununterbrochen und marternd über seine Seele hinweg. Nur bittere, nur quälende Bilder — ein Mückenschwarm von Dämonen und Fratzen! ...
Plötzlich — er fuhr empor — kamen schwere Stiefelschritte die Bodentreppe herauf.
»Was ist das? Nicht möglich! Hab' ich denn vergessen, die Bodentüre zu verriegeln?«
Gustav sprang auf. Und schon hüstelte draußen jemand, klopfte an und streckte dem aufschließenden Bewohner ein drollig lächelndes, wohlgenährtes Gesicht entgegen.
»Salüt, Güschtel!«
Das französische »Salut« und dabei eine feldgraue Uniform? Doch was für eine Uniform war denn das?
Gustav stand sprachlos. Violetter Kragen — ein Generalstäbler? Nein, dieses pfiffig-dumme Gesicht passte nicht in den Generalstab. Maschinengewehr? Jäger? Was denn eigentlich?
»Gel, Güschtel, do gücksch jetzt?« rief der Eingetretene, eine stämmige, fast feiste Gestalt. Und jetzt erkannte Gustav seinen Schulkameraden, den Sohn des Gastwirtes, der als Apotheker im Städtchen tätig war.
Apotheker also!
»Ich bin nämlich ein deutscher Krieger«, sprach der eintretende Elsässer mit komisch betontem Hochdeutsch, »und verteidige das Vaterland.«
Er sah an seiner Uniform hernieder und nahm sich offenbar selber nicht ernst. Um den sinnlichen Mund war ein etwas unsicheres, fast ängstliches Lächeln, in den Augen ein Zwinkern und Blinzeln. Er hielt sich gebückt und schien immer um sich zu horchen, ob nicht jemand um den Weg sei, vor dem man die Knochen zusammennehmen müsse. Und an der niedrigen Stirn dieses unwillkommenen Besuchers sah Gustav wieder jene wohlbekannten Falten, die wie ein breites Grinsen sichtbar wurden, wenn der Spaßmacher die kleinen Augen hoch riss — dieser Spaßmacher und Lebemann, der durch sein überlegen weltmännisches Gebaren so oft den schüchternen Jungen begönnert und lüstern belehrt hatte. Wie eine Dunstwolke schob es sich in das Zimmerchen eines vornehmen Einsiedlers, der die dargebotene Hand kaum mit den Fingerspitzen berührte.
»Salut, Alterle!« wiederholte der Dicke gemütlich und nahm gleich das Fernrohr zur Hand. »Bisch, glauw' ich, wieder emol e bissel Sternegücker? Wie geht's denn allewil?«
Gustav murmelte einiges, und jener trat ans Fenster, äugelte durch das Glas, bedauerte, dass man nicht zu Bielers Fanny hinübergucken könnte und fragte blinzelnd, »wie weit« denn der Verlobte mit der »kleinen netten Mamsell Bieler« sei. Er schnalzte dabei, als ob es sich um eine besonders feine Weinsorte handelte. Und dann fuhr er fort, in seiner gemütlich-sinnlichen Art zu erzählen, dass er sich mit den Etappenoffizieren ganz gut stehe, besonders mit dem dortigen neuen Hauptmann. Mit vielen »weisch, Güschtel«, setzte er spöttelnd auseinander, das sei so ein »hungernder Agrarier aus Pelzpommern«, dem das Fell fast platze, so verstehe er sich zu mästen. Und besonders sei der Schwob »hinter de Maidle her«. Aber jetzt krache die Front bald zusammen, dann rutsche die ganze Bande über den Rhein ...
»Weisch, Güschtel, was Maidle anbelangt, macht er mir nix vor!«
Er setzte sich und schlug sich lachend auf den Schenkel. Dies alles geschah mit so zwangloser Selbstverständlichkeit, als wäre Gustav nicht nur sein alter Duzfreund, sondern auch der Gesinnungsgenosse seiner gemeinen Gelüste. Durch Anbiederungston pflegt die Gattung der Lüstlinge ihre Gewalt auszuüben. Gustav duckte sich dann gewöhnlich und hatte gegenüber so viel Sicherheit nicht den Mut zur Gegenwehr.
Auch heute drohte der arme Junge dem lähmenden Dunstkreis zu erliegen. Er wollte nicht unhöflich sein; er gab wortkarge Antwort — doch immerhin: er gab Antwort. Und der gesprächige andere sorgte schon dafür, dass keine Stockung eintrat.
Auf einmal aber kam etwas zur Sprache, was den zarten Leidenden an seiner empfindlichsten Stelle traf und zum wildesten Gegenkampf herausrief.
Der Hauptmann aus dem Städtchen — so plauderte der Eindringling — sei ein herzhafter Trinker und, wie gesagt, ebenso handfest hinter den Mädchen her ...
»Na, nimm din' Braut in Obacht, Güschtel! Die isch e hitzig's Ding, die klein' Bieler. Das wär' so e Bisse, wenn er sich emol hinter die hermacht! Der versteht's besser als dü Hasefües!«
Sehr viel weiter kam der unglaubliche Bursche allerdings nicht. Als noch eine hässliche Anspielung fiel, war es zu Ende. Gustav zuckte empor, Gustav trommelte mit beiden Händen — und auf einmal sprang er auf, packte den Feisten mit grimmiger Gewalt am Hals, schüttelte ihn, stieß den Überraschten mit unnatürlicher Kraft an die Stubentür und schlug ihm, schäumend vor Zorn, mit der Faust ins Gesicht. »Dü hundsgemeiner Kerl! Du hast mich vergiftet von Kind an! Du bist schuld an meinen kaputten Nerven! Rüs mit dir — oder ich bring' dich um! Ich bring' dich um!«
Der Brünstling schrie auf vor Angst — »Güschtel, mach' m'r nix« — tastete nach der Mütze, bot diesem wahnsinnigen Anfall gegenüber ein Bild des Entsetzens — und taumelte endlich, ohne den leisesten Versuch einer Gegenwehr, die Treppe hinunter, von den krankhaft herauszuckenden Zornrufen des Rasenden verfolgt. Es war ein schrecklicher Auftritt. Das Wort »Lump«, aus Gustavs feinem Munde immerzu wiederholt, war das letzte, was über den Speicher scholl. Dann schleuderte er dem Fliehenden noch ein Paar Handschuhe nach, warf den Riegel in die Bodentür und lief in sein Stübchen zurück, das er gleichfalls fest hinter sich abschloss. Geschüttelt von nervösen Atemstößen, lag der Kranke nun wieder auf seinem Diwan, während der andere mit dem geschwollenen Auge unten der verstört herbeigelaufenen Haushälterin Lisy zurief: »Der do owe isch verruckt!«
* * *
Fanny war inzwischen dem heimkehrenden Pfarrer entgegengegangen und hatte ihm halb ärgerlich, halb kummervoll geklagt, dass Gustav wieder einmal unnahbar auf seiner Dachkammer hause.
»Also drei Einsiedler«, versetzte Onkel Arnold ruhig. »Nun, zwei davon haben sich wenigstens zusammengefunden.«
»Du bist müde, Onkel Arnold, gel? Sonst käm' ich nach dem Abendessen hinüber — und wir spielten Gustav die fünfte Symphonie vor.«
»Ja, komm nur, Kind! Müde? Na, man ist halt doch nicht so kräftig genährt und hat seit Kriegsbeginn fünfundzwanzig Pfund abgenommen. Hungerblockade! Diese Fastenkur haben wir dem Präsidenten der amerikanischen Plutokratie zu verdanken. Der Mann will uns vergeistigen. Hörst du, wie es da im Süden bis in die Nacht hinein pocht? Dämonen nageln einen Sarg zu. Das Zeitalter des Materialismus stirbt ... Ja, Kind, komm nur! Ich hab' noch ein paar Amtsgeschäfte, dann spielen wir den unsterblichen Beethoven. Das lockt den dritten Einsiedler herunter.«
Und so geschah es.
Gustav hatte sich nach der ungewöhnlichen Turnbewegung merkwürdig rasch erholt. Er ertappte sich sogar auf Lachanfällen. Zu komisch, wie der dicke Feigling winselte: »Güschtel, mach m'r nix!« Und den Sieger durchströmte ordentlich ein Wohlbehagen, dass sein Faustschlag so gut gesessen.
»Hätt' ich's vor zehn Jahren schon getan, mir wär' wohler in meiner Haut«, murmelte er. »Von außen ein sogenannter gemütlicher Kerl — von innen ein sittlicher Lump und gemein bis ins Mark!«
Und als unten das vierhändige Spiel emporrauschte, durchflutete ihn wieder der Drang nach einer reinlichen Lebensgemeinschaft. Er schlich unauffällig hinunter, an der kurz und herzlich während des Spiels ihm zunickenden Fanny vorbei, und kauerte dann auf dem Schaukelstuhl, seiner Lieblingsmusik lauschend.
»Was hast du denn mit dem Apotheker gehabt?« fragte der Vater, als sie nachher allein waren. Er fragte möglichst gelassen, gleichsam nebenhin, während er seine lange Pfeife in Brand setzte.
Den habe er, entgegnete Gustav, mit Wucht und Wonne die Treppe hinuntergeschmissen, denn der Kerl habe mit gemeinen Redensarten sein Zimmer verstänkert.
»Papa,« fügte er nach einigem Zaudern hinzu, »was ist denn das für ein neuer Hauptmann im Städtel?«
»Je weniger man von ihm spricht, umso besser für ihn und uns,« entgegnete der Pfarrer. »Er schnarrt, nennt uns Elsässer eine Rasselbande und beginnt jeden dritten Satz mit: ›Sagen Se mal!‹ Ein Zerrbild preußischer Energie, und ein Hohn auf altpreußische Einfachheit. Hoffentlich richtet er kein Unheil an.«
Zweites Kapitel. Dreierlei Gespräche
Oh Elsass, Oberlins und Speners Land!
Zwei Völkern den Versöhnungsbund zu stiften,
Sei zwischen beiden du das Liebesband!
Adolf Stöber
Der nächste Tag brachte dem Einsiedler Gustav ein Göttergeschenk, wie er sich jubelnd ausdrückte. Sein Freund Erwin, der junge Straßburger Lehrer, kam jählings angeflogen, um nach kurzem Urlaub Abschied zu nehmen. Denn es ging wieder an die flandrische Front.
»Gott sei Dank, dass du gekommen bist!« rief Gustav. »Dich brauch' ich ja ganz herzbitterlich! Sie lassen mich hier alle so grausam allein! Gott sei Dank, dass man sich endlich wieder einmal aussprechen kann!«
Er zerdrückte dem langen, blonden Feldgrauen, dessen sonnige Blicke durch Brillengläser strahlten, fast die Hand.
»Herrschaft, Güschtel, was isch denn los?«
Die Unterhaltung zwischen den beiden elsässischen Unteroffizieren ward in des Landes alemannischer Mundart geführt, sprang aber oft in Hochdeutsch über.
»Sie versteh'n mich nicht! Kein einziger hier versteht mich!«
»Oho! Was fängst du denn wieder für Mücken, Gustav! Dein Vater soll dich nicht verstehen? Und die unvergleichliche Fanny? Babbel doch kein so dumm Dings daher, alter Hypochonder!«
Erwin warf seine Mütze auf den Tisch, schwang sich daneben und begann einen Apfel zu essen, den er im Vorbeigehen auf dem Speicher mitgenommen hatte.
Sie verstanden sich immer vortrefflich, die beiden Vettern oder vielmehr sehr entfernten Verwandten. Erwin nannte Gustav »Cousin«, gab aber auch Fanny den Namen »Cousine«; und irgendwo mochte ja auch eine Verwandtschaft oder Familienfreundschaft stecken, ohne dass man alle die Verschwägerungen oder sonstigen Versippungen nachzurechnen für nötig hielt. Im übrigen aber war der leichtblütige Blondkopf Erwin von außen und innen ein Gegenbild zu dem dunklen Düsterling. Er liebte das Wandern im Wasgenwald und in den Alpen, war Schneeschuhläufer, wie sein Bruder Willy, und ein Freund von Sonnenbädern und Ruderfahrten. Leichten Schrittes pflegte er einherzuschreiten, Sonne verbreitend, wohin er kam, bei Schülern und Amtsgenossen beliebt, nur dem trockenen und etwas grämlichen Schulinspektor verdächtig, weil er vor allem Mensch und dann erst und dadurch Lehrer war.
»Großherzig und giftfrei«, fasste einmal der Philosoph Arnold sein Urteil über ihn zusammen.
Mit seinem sonnigen Gemüt ergänzte Erwin den Grübler und Einspänner Gustav vortrefflich und wirkte lösend und mitreißend auf dessen schwerflüssige Denkart. Der Sterngucker war in seiner Gegenwart immer wie verwandelt und warf in eifriger Mitteilsamkeit seine scheuen Verhüllungen ab.
»Du bist mir immer ein Sonnenbad«, gestand er dem Langen. »Man läuft mit dir gleichsam splitternackt auf den Matten herum und freut sich an Licht und Luft.«
»Was quält dich denn? Rüs mit d'r Sproch'!«
»Acht Monate sitz' ich jetzt da 'rum, Erwin, mit schwachem Gedärm und schlechten Nerven! Zum Verzweifeln!«
»Du hast doch deinen Vater« — —
»Ja, ja, und habe Fanny, ja, schon recht! Aber die sind gesund! Verstehst du? Gesund, viel zu gesund für mich! Unter uns: ich bin ihnen nicht gewachsen.«