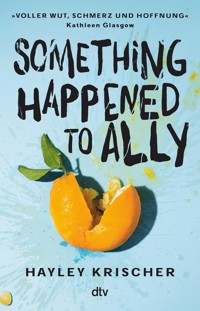12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein fesselnder Roman über Berühmtheit, Fan-Sein und den Preis des Ehrgeizes, der von der obsessiven Suche einer Journalistin nach einem verschwundenen Hollywood-Starlet handelt. Ein fesselnder Roman über Berühmtheit, Fan-Sein und den Preis des Ehrgeizes, der von der obsessiven Suche einer Journalistin nach einem verschwundenen Hollywood-Starlet handelt. Als Echo Blue, der berühmteste Kinderstar der Neunzigerjahre, am Vorabend der Jahrtausendwende verschwindet, werden sofort bösartige Theorien aufgestellt. Goldie Klein, eine ehrgeizige junge Journalistin, die zufällig auch Echos größter Fan ist, weiß, dass hinter der Geschichte mehr stecken muss, und beginnt zu recherchieren. Und was sie findet, ist eine junge Frau, die wie so viele von Hollywood verschlungen und ausgespuckt wurde und die vielleicht den höchsten Preis dafür zahlen musste.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Where are you, Echo Blue?« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
((bei fremdsprachigem Autor))
Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch von Babette Schröder
© Hayley Krischer 2024
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»Where are you, Echo Blue«, 2024 erschienen bei Dutton, einem Imprint von Penguin Random House, New York.
© Piper Verlag GmbH, München 2025
Redaktion: Catherine Beck
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München nach einem Entwurf von Dominique Jones
Covermotiv: David Mushegain / Trunk Archive und Viola Rolando
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Zitat
Filmografie
Goldie
1.
2.
3.
Echo
1980–1991
4.
5.
6.
Goldie
7.
8.
9.
10.
11.
Echo
1991
12.
13.
14.
Goldie
15.
16.
Echo
1992–1993
17.
18.
19.
Goldie
20.
21.
Echo
1993–1994
22.
23.
24.
25.
Goldie
26.
27.
28.
Echo
1994–1995
29.
30.
31.
32.
Goldie
33.
34.
35.
36.
Echo
1995–1996
37.
38.
Goldie
39.
40.
Echo
1996
41.
Goldie
42.
43.
44.
Echo
1997–1998
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Goldie
51.
52.
53.
Echo
1998–1999
54.
55.
56.
57.
58.
Goldie
59.
60.
61.
Echo
31. Dezember 1999
62.
2000
63.
Goldie
64.
Echo
65.
Goldie
Epilog
Weblog
Mein Dank gilt …
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Widmung
Für Melissa, die mich inspiriert hat.
Zitat
But she never escaped my mind, and I just grew
Tangled up in blue.
Bob Dylan, »Tangled Up in Blue«
Filmografie
Spielerin Nummer Acht, 1992
Joey
Pollyanna, 1993
Pollyanna
Holly und der Hund, 1994
Holly
Stars Everywhere, 1994
Pricilla
Holly und der Hund 2, 1996
Holly
Emma, 1998
Emma
Goldie
1.
Im Jahr 2000, kurz nach der Jahrtausendwende, begann ich mit meiner Suche nach Echo Blue, dem berühmtesten Kinderstar des späten 20. Jahrhunderts.
Ich war besessen. Aber das wisst ihr ja schon.
Da meine Begabung nicht ausreichte, um selbst bei der New York Times zu arbeiten, berichtete ich über die dortige Silvesterfeier. Ich arbeitete als Juniorreporterin beim Manhattan Eye. Dort war ich gelandet, weil sie die Einzigen waren, die mich zum Gespräch eingeladen hatten, was ich allerdings nur ungern zugab.
Ich war zweiundzwanzig und hätte mich glücklich schätzen sollen, die Stelle zu haben. ME war eine Institution, ein angesehenes Magazin, ein Sprungbrett für Times-Journalisten und -Redakteure, aber auch ein Dinosaurier ohne die Abonnentenzahlen der Times.
Ich hatte den Auftrag angenommen, weil ich an jenem Abend noch nichts vorhatte, und ich dachte, ich könnte wenigstens ein paar Leute kennenlernen. Nur leider waren die Redakteure alle betrunken. Keine Chance, Kontakte zu knüpfen.
Zwischen den Schreibtischen und Arbeitsnischen im elften Stock der Times servierte Personal mit weißen Handschuhen ein schickes Abendessen mit Filet Mignon und Garnelen, während auf dem hell erleuchteten Balkon eine Jazzband spielte. Alte weiße Redakteure standen in biederen Smokings um ihre Drucker und Schreibtische herum. Es war, als würde man den Untergang der Titanic miterleben.
Die angestellten Journalisten saßen hinter großen Fenstern allein an ihren Schreibtischen, ganz offensichtlich zu beschäftigt, um teilzunehmen – oder wenigstens hofften sie, so zu wirken. Dreimal ging ich am Büro der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Kolumnistin Siobhan O’Donnell vorbei und beobachtete, wie sie auf ihrer Tastatur herumklapperte, bis sie ein Buch nach mir warf und schrie, ich solle nicht vor ihrer Tür herumlungern. Ich knabberte ein paar Garnelen und trank einen Schluck aus der Champagnerflöte, in die 01-00-00 eingraviert war. Ich knipste ein Foto des falschen Datums. Dann schrie ein Reporter, der wohl auf LSD war: »Wag es ja nicht, mich zu fotografieren«, und versteckte sich hinter einer Trennwand.
Auf einem Tisch in der Ecke des Raums standen drei große Fernseher, in denen lokale Nachrichtensender liefen. Niemand schien sie zu beachten, darum schlich ich mich zu einem der Geräte und schaltete beiläufig auf MTV um, wo ich erwartete, Echo Blue locker im Gespräch mit Moderator Carson Daly zu sehen. Ihr Auftritt war seit Wochen groß angekündigt worden. Stattdessen herrschte ein ziemlicher Tumult im Studio, und die Produzenten drängten sich im Hintergrund um die Mikrofone.
Dann sprach Carson Daly direkt in die Kamera. »Okay, also, es sieht so aus, als würde Echo Blue es nicht schaffen.«
Das Publikum im Studio stöhnte auf.
»Ich weiß. Tut mir wirklich leid.« Dann tuschelte er mit jemandem im Off, doch das Mikrofon war noch eingeschaltet: »Wissen sie gar nicht, wo sie ist?« Er fasste sich und blickte wieder nach vorn. »Ich weiß, dass sich alle darauf gefreut haben, von ihr zu hören – ich ganz bestimmt –, und ich bin sicher, wir werden sie bald sehen. Frohes neues Jahr, Echo.«
Es war, als hätte mich ein elektrischer Blitz mit all meinen Erinnerungen in meine Kindheit zurückkatapultiert. Echo Blue war nicht zu ihrem Auftritt erschienen? Was hatte das zu bedeuten? Ich sah mich um, ob noch jemand so überrascht war wie ich. Ihr Gesicht prangte auf dem Bildschirm von mindestens einem der Fernsehgeräte. Aber die arroganten Journalisten von der New York Times konzentrierten sich weiter auf Millenniumskuchen und Garnelen. Nur wenige Minuten zuvor hatte ich sie noch beeindrucken wollen, jetzt verurteilte ich sie für ihre Gleichgültigkeit gegenüber der möglicherweise größten Promimeldung des Jahrzehnts.
Im Juni hatte Echo Blue einen Aufenthalt in einer Entzugsklinik beendet, in der sie wegen »Erschöpfung« gewesen war. Bis zu jenem Zeitpunkt war Echos Leben selbst ein Film gewesen. Ihre Eltern gehörten zur Hollywood-Elite. Ihre Mutter war Mathilde Portman, die in der bekannten Fernsehserie Goldrausch mitgespielt hatte, und ihr Vater, Jamie Blue, hatte einst zu den attraktivsten und charismatischsten Stars der Branche gehört. Außerdem spielte Echo innerhalb von sechs Jahren in sechs Filmen mit und gewann mit nur vierzehn einen Oscar als beste Nebendarstellerin.
Ich hasse es, wie die Klatschpresse zu klingen, aber um es kurz zu machen: Echo wurde praktisch über Nacht vom Goldkind zur Teenieschlampe. Damit begannen die Probleme – der obszöne Klatsch, der Schauspieler zu albernen Karikaturen macht. Sie ließ ihren Eltern das Sorgerecht entziehen (obwohl sie darauf bestand, dass sie das nur wegen der gesetzlichen Vorschriften zum Drehen mit Kindern getan hatte), dann folgten die Beziehung und Trennung von ihrem deutlich älteren Freund. Sie wurde von Stalkern bedroht – alle männlich –, gegen die sie Berichten zufolge zahlreiche einstweilige Verfügungen erwirkte. Angeblich wurde sie bei Bergdorf Goodman beim Ladendiebstahl erwischt, obwohl ich nie einen Polizeibericht fand, der das bestätigte. Und es gab ein unglückliches Interview mit Vanity Fair, bei dem sie ganz offen als Minderjährige in einer Bar einen Martini trank. Die Schlagzeile der New York Post lautete: »ECHO: WIETIEFWIRDSIENOCHSINKEN?« Das alles hatte ich verfolgt.
Doch sie stand kurz vor ihrem Comeback – wenigstens wurde das in den Ankündigungen für ihren Silvesterauftritt behauptet. Sie sollte in einem Independent-Film mitspielen, Ich hasse Campen. Sie war clean und hatte sich von ihrem miesen Freund getrennt. Warum sollte jemand, der gerade erst sein Leben in den Griff bekommen hatte, nicht bei einer der größten Promoveranstaltungen des Jahrhunderts erscheinen? Irgendetwas stimmte nicht.
Ich war zittrig und fühlte mich wie betäubt, also versuchte ich, meine Atmung zu verlangsamen, wie meine Therapeutin es mir vor Jahren beigebracht hatte. Es wurde Zeit, dass ich diese öde Veranstaltung verließ. Aus irgendeinem Grund – ich gebe meinen Nerven die Schuld – winkte ich einem meiner Kontakte auf gekünstelte Prinzessinnenart zu und schlich mich aus der Redaktion. Im Aufzug rang ich unter den Neonröhren um Atem und versuchte, mich zu beruhigen, denn ich wusste, dass die Antworten nur im bitteren Geruch der Morgenzeitung zu finden sein würden.
2.
Meine Besessenheit von Echo Blue begann im Sommer 1992, kurz vor der zehnten Klasse auf der Highschool, als ich sie in ihrem ersten Film Spielerin Nummer Acht sah. Sie spielte ein zwölfjähriges Mädchen, das sich einem Softballteam anschließt, das von einem schrulligen Typen trainiert wird. Der Film sollte eine Mädchenversion von Die Bären sind los sein.
Mein Vater, ein Shakespeare-Professor an der NYU, der immer meinte, von allen über den Tisch gezogen zu werden, bereitete in der zweiten Sommerhälfte seine Vorlesungen vor, während meine Mutter in der Kosmetikabteilung von Day’s Emporium arbeitete, einem kleinen Kaufhaus in North Jersey. Meine Eltern brachten meinen Bruder Sam und mich zu einer Elf-Uhr-Matinee im örtlichen Kino und holten uns erst um fünf Uhr nachmittags wieder ab. Damals durfte man als Kind den ganzen Tag im Kino sitzen, solange man Popcorn und Limonade kaufte. Wir hätten im Laufe des Tages wenigstens den Film wechseln können, aber ich und damit auch Sam – ihm blieb als kleiner Bruder keine Wahl – entschieden uns, uns immer wieder Spielerin Nummer Acht anzusehen.
Und dies ist die Szene, die mich so faszinierte: Das Training dauerte schon eine Ewigkeit, und der verschrobene Trainer ließ keinen Hinweis darauf erkennen, dass er es demnächst beenden würde. Mit einem Stolz, der an Matt Dillon in Der Fremde erinnerte, schritt Joey, gespielt von Echo, über das Spielfeld auf die Trainerkabine zu und forderte zumindest eine Pause, damit sich die Spielerinnen erfrischen konnten. Echos wilde blonde Mähne, ihre gebräunte Haut und ihre engelsgleichen Wangen standen im Gegensatz zu ihrem schlauen Blick. Sie hatte die Angewohnheit, die Kappe abzunehmen und ihr Haar auszuschütteln, sich kurz am Kopf zu kratzen und die Kappe dann sorgfältig wieder aufzusetzen. Ich versuchte, diese Geste zu kopieren, aber jedes Mal fragte meine Mutter mich, ob ich Läuse hätte.
Echo klopfte an die Trainerkabine und sagte: »Mir ist egal, gegen wen wir spielen, wenn Sie uns nicht eine Stunde Zeit zum Aufladen geben, verspreche ich Ihnen, dass die Hälfte der Mannschaft geht.«
Sie wirkte stark und selbstsicher.
Sie war wunderschön.
In einer Kritik wurde sie als die Norma Rae des Softballs bezeichnet.
Ich hatte noch nie ein Mädchen in einem Film gesehen, das so gefährlich war oder so auf Konfrontation ging. Entweder machten sie vor der älteren männlichen Figur einen Rückzieher oder sprachen sie gar nicht erst an.
»Du gehst zurück aufs Feld, wie ich es dir gesagt habe, und beendest das Training«, befahl der Trainer.
Sie trat aus der Trainerkabine und pfiff auf zwei Fingern. Ich kannte nur einen Menschen, der so auf den Fingern pfeifen konnte, und das war mein Vater. (Er hatte also auch ein paar gute Eigenschaften.) Die Mädchen ließen alle auf einmal ihre Handschuhe fallen, verließen das Spielfeld und sammelten sich hinter ihr. Am liebsten hätte ich sie verschlungen und wäre sie geworden. Sie gab Teeniemädchen die Erlaubnis, sich über gesellschaftliche Regeln hinwegzusetzen, gegen patriarchalische Führer aufzubegehren. Raum einzunehmen. Frech zu sein.
Ich saß im Kino, gerade erst ein Teenager, schüchtern und unterwürfig, und auf der Leinwand nahm Echo das Heft in die Hand. Diese eine Szene riss mich aus meinem Leben, in dem ich machtlos war. Ich mit meinen wuscheligen Locken und meinem durchdringenden Blick, für den ich nichts konnte (»Willst du, dass die Leute dich für seltsam halten?«, fragte mein Vater), und mit meinen abgelaufenen Doc Martens, weil meine Eltern kein Geld für neue rausrücken wollten. In dem dunklen Kino konnte ich Echo so lange anschauen, wie ich wollte, ohne dass mich jemand vorwurfsvoll ansah. Wenn ich Echo studierte und alles über sie lernte, konnte ich vielleicht so sein wie sie.
. . .
Meine Kindheit war von meinem Vater und seiner schwierigen Vergangenheit geprägt. Seine Mutter, meine Großmutter, die ich nie kennengelernt hatte, war eine abergläubische polnische Einwanderin. Mein Vater erzählte gern von dem missbräuchlichen Verhalten seiner Mutter, zum Beispiel davon, wie sie ihm eine Woche lang die linke Hand auf den Rücken gebunden hatte, damit er die rechte benutzte. Seine Linkshändigkeit war für sie ein Zeichen von Schwäche, was sie ihn fortwährend wissen ließ.
Er versuchte, anders zu sein als seine strenge Mutter, jedenfalls sagte er uns das. Aber unsere Gegenwart nervte ihn. Im Auto, wenn wir alte Beatles-Kassetten hörten, waren Singen, Summen und Schnipsen verboten. Sam und ich saßen mit gefalteten Händen da und wippten mit den Köpfen zur Musik. Er hasste »Krawall«. Ständig sagte er uns, dass wir wie »Elefanten« die Treppe hinaufliefen. Dass wir wie »Schweine« Zahnpasta im Waschbecken hinterließen. Dass wir unsere Kleidung wie »Schlampen« falteten. Beim Abendessen ärgerte er sich, wenn wir zu geschwätzig waren oder auf unseren Plätzen herumhüpften, zu viel Ketchup nahmen oder zu laut auf unseren Gurken herumkauten.
Als ich in der fünften Klasse war, fing er an, meine Hausaufgaben zu korrigieren. Voller Panik wartete ich in meinem Zimmer darauf, dass er sie mir zurückgab. Aufbau schlampig. Beispiele redundant. Noch mal. Meine Mutter sagte, er wolle mir nur helfen, aber Schreiben war seine Lieblingssprache, und ich hatte das Gefühl, Hassbriefe zu erhalten. »Willst du eine gute oder eine beschissene Schriftstellerin sein?«, fragte mein Vater immer. »Wie willst du was lernen, wenn ich nicht ehrlich zu dir bin?«
Es gab keine Gürtel, keine Ohrfeigen. Aber auch kein Erbarmen. Ich glaube, ich wurde aus Trotz Schriftstellerin, nicht weil es mir Spaß machte.
Meine Mutter war eine starke Frau mit eigener Meinung. Aber sie stellte sich nicht gern gegen meinen Vater. »Es ist wichtig, dass du dich selbst mit Männern auseinandersetzt«, sagte sie mir. Oder: »Anfangs ist dein Vater hart, aber dann wird er weich.« Sie hatte eine Menge nerviger Sprüche auf Lager, wie man ihn beschwichtigen könne. »Warum nimmst du ihn immer in Schutz?«, fragte ich. Aber sie sah seine weichere Seite und wollte, dass ich es auch tat. Ihr Vater war ein Alkoholiker gewesen, der nicht viel sprach. Ständig erinnerte sie mich daran, was wir für ein Glück hätten.
Und sie hatte ja recht. Mein Vater war nicht nur schlecht. Ich gebe das nur ungern zu, weil es von der knallharten Geschichte ablenkt, die ich mir ausgedacht habe, aber ich wusste, dass er mich liebte. Jeden Abend kam er in mein Zimmer, um mir Gute Nacht zu sagen, oft legte er mir dann ein Buch hin, das er mir aus der Universitätsbibliothek mitgebracht hatte. Aber das änderte nichts an dem Druck, den ich unter seinem Blick verspürte, an dem Gefühl, nicht zu genügen.
. . .
In jenen Jahren, den schwersten meiner Kindheit, kam mir Echo wie eine verwandte Seele vor. Ich lernte ihren Text in Spielerin Nummer Acht auswendig und übte vor dem Spiegel ihre Haltung auf dem Spielfeld. Ich schnitt Schnappschüsse aus der Zeitschrift Teen Beat aus und erwarb vier Exemplare ihres Titelblatts von Sassy, auf dem sie ein bauchfreies rotes T-Shirt mit einem großen Mund auf der flachen Brust trug. Ich fertigte eine Collage an, klebte sorgfältig Bilder von ihr zusammen, drapierte sie mit einer Herzgirlande und hängte sie über meinem Bett auf. Am besten gefiel mir ein Foto von Echo und ihrem Vater, dem Schauspieler Jamie Blue, beim Verlassen eines Restaurants, auf dem er schützend den Arm um ihre Schultern gelegt hatte, so wie ich es mir von meinem Vater gewünscht hätte.
Wenn ich allein unter der Dusche stand und das heiße Wasser auf meiner Haut brannte, dachte ich an Echo, die sich nach einem Drehtag wusch. Was für ein Shampoo benutzte sie? Hatte sie auch Schuppen, so wie ich? Hatte sie Hautausschlag und rote Beulen an den Innenseiten ihrer Oberschenkel? »Goldie! Was machst du so lange da drin? Ich muss auch duschen!«, schrie Sam dann und hämmerte an die Tür, und vor lauter Schreck schnitt ich mich beim Rasieren. Echo hatte keinen Bruder; sie war Einzelkind. Wahrscheinlich hatte sie ihre eigene Dusche. Eine riesige Dusche mit frischen Handtüchern und nach Lavendel duftender Seife.
In meinen frühen Teenagerjahren war Echo Blue meine einzige Freundin, weil die nach Jungs verrückten Mädchen in meiner Klasse mich einschüchterten. Sie redeten über Sex und dass sie gefingert werden wollten. Derweil spielte ich noch mit Puppen. Ich war im Oktober geboren, und einige der Mädchen in meiner Klasse waren fast ein Jahr älter als ich. Sie hatten Brüste und Pickel und rochen streng. Ich hatte nur ein paar vereinzelte Haare in den Achselhöhlen und einen Flaum aus Schamhaar statt ein dichtes Vlies, wie ich es bei ihnen vermutete. Ich wollte mich mit ihnen anfreunden und versuchte es, aber ich fand einfach keinen Anschluss.
Dennoch zwang meine Mutter mich, ein paar Mädchen zu einer Übernachtungsparty einzuladen, als ich im Oktober nach meiner Spielerin Nummer Acht-Zeit fünfzehn wurde.
»Du musst nicht viele Freundinnen haben, Goldie. Du musst nicht zu einer Clique gehören, aber man sollte zumindest eine Freundin haben. Es ist nicht gesund, dass du gar niemanden hast«, betonte sie. »Wir laden einfach ein paar Mädchen aus der Nachbarschaft ein, wie Emma Branfield und Ashley Manley – weißt du noch, früher bist du immer mit ihnen zusammen zur Schule gegangen?«
Ich hatte mich seit meinem sechsten Lebensjahr nicht mehr mit Emma und Ashley getroffen, aber sie ließ mir keine Wahl.
Sie drängte mich, die Bilder von Echo in meinem Zimmer für die Geburtstagsparty abzunehmen, aber ich weigerte mich.
»Ich dachte, du hättest gesagt, Freundinnen sollten einen so akzeptieren, wie man ist«, sagte ich.
Mit besorgter Miene starrte sie auf meine Echo-Collage. »Das stimmt, aber … sie werden das alles nicht verstehen, Süße.«
Ich weiß nicht, warum ich mich weigerte, ihren Standpunkt zu akzeptieren. Vielleicht wollte ich sie dafür bestrafen, dass sie mich zu einer Pyjamaparty zwang, obwohl ich mir eigentlich nur einen Vanillekuchen backen wollte. Ich wollte mit meinem Vater in ein Restaurant gehen, so wie Echo. Wollte, dass meine Mutter akzeptierte, dass ich anders war; dass sie mich schön und lustig fand, nicht unbeholfen mit einer schrecklichen Körperhaltung und Essensresten in der Zahnspange.
Obwohl meine Mutter für die Party alles im Keller vorbereitet hatte – dekoriert mit bunten Limonaden, rosa Luftballons und einer Discokugel –, wollten die Mädchen schließlich mein Zimmer sehen. Ich hatte unterschätzt, wie grausam Ashley, die Bienenkönigin, sein konnte. »Das letzte Mal war ich vor acht Jahren in eurem Keller, und ich hätte fast einen Asthmaanfall bekommen, weil es so nach Schimmel roch.«
Sie hatte nicht unrecht. Die Luft da unten war stickig, und manchmal juckten mir die Augen. Mädchen wie ihr ist es egal, ob sie in deinem Haus sind oder ob es deine Geburtstagsparty ist. Sie entscheiden, was gemacht wird.
Oben sah Ashley sich um.
»Was zum Teufel ist das alles?«, fragte sie.
»Das ist Echo Blue«, antwortete ich.
»Ich weiß, wer das ist, du Dummi. Warum hast du einen Schrein von ihr an der Wand? Bist du lesbisch?«
Ob man lesbisch war oder nicht, war damals ein wichtiges Thema.
Ich wusste es nicht, aber das war nicht der Punkt. Ashley wollte eine Antwort haben, und ganz egal, was ich sagte, ich konnte sie nicht zufriedenstellen. Ich sah den Raubtierblick in den Augen der Mädchen. Sie kannten den Geruch von Blut und sehnten sich nach einem Opfer. Sie waren durchtrieben und gemein.
Ashley stand auf meinem Kopfkissen und riss das selbst gemachte große Poster von Echo von der Wand. Doch das war noch nicht alles. Dann nahm sie sich das Filmplakat von Spielerin Nummer Acht vor. Das signierte Schwarz-Weiß-Foto vom Fanclub. Das People-Titelbild von ihr und ihrem Vater. Das Sassy-Titelbild. Die Fotos aus Siebzehn, auf denen sie ihren Arm um Belinda Summers, ihre Mitspielerin, gelegt hatte. Sie riss die bezaubernde Collage mit ihrem lächelnden Gesicht herunter, die ich im Einkaufszentrum gekauft hatte, und nahm dann mit spitzen Fingern die Herzgirlande ab, als wäre sie voller Läuse. Ashley zerrte alles herunter und warf es auf den Boden, während die anderen das Grauen schweigend mit ansahen.
Plötzlich klopfte meine Mutter an die Tür und fragte, ob wir bereit seien, Pizza zu essen. Später, nach dem Kuchen, schliefen sie alle im Keller, während ich mich in mein Zimmer verkrümelte – offenbar zogen sie den Schimmel meinem »Schrein« vor. Ich konnte sie bis ein Uhr nachts kichern hören. Ganz bestimmt hörte meine Mutter es auch. Derweil starrte ich auf die Bilder von Echo Blue, die ich schnell wieder an ihrem rechtmäßigen Platz befestigt hatte.
Kurz darauf ging ich zu Dr. Watts, weil meine Mutter einen Stapel Briefe gefunden hatte, die ich an Echo geschrieben, aber nie abgeschickt hatte. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass es eher so eine Art Tagebucheinträge waren. Ich schrieb an Echo, als wäre sie eine höhere Macht. »Ist das mit Echo und mir nicht so wie bei anderen Menschen mit Gott?«, sagte ich zu meiner Mutter, in der Annahme, es würde sie beruhigen. »Die Menschen tun jeden Tag so, als würden sie zu Gott sprechen. Das hier ist nichts anderes.«
Sie dachte kurz nach. »Aber Echo ist keine Religion, Goldie«, sagte sie schließlich verzweifelt. »Das ist das Problem.«
Dr. Watts war jung und hübsch, und sie hatte riesige Ledersessel, in die ich mich hineinkuscheln konnte, aber unsere Sitzungen änderten nichts an meinen Gefühlen. Sie sagte, meine Leidenschaft sei eine gute Sache, aber sie wolle, dass ich sie kanalisiere. Dass ich dem Theaterclub beitrete. Oder dem neu gegründeten Feministinnenclub. Oder dem Filmclub. Auf diese Weise könne ich Freundinnen mit ähnlichen Interessen finden – und Leute, mit denen ich im wirklichen Leben über Echo sprechen könne, damit nicht alles nur in meinem Kopf stattfände. Aber Echo gab mir Sicherheit, ich hatte eine innere Verbindung zu ihr entwickelt.
Schließlich lernte ich, meine Gefühle für sie zu verbergen und diese Träume für mich zu behalten. Als ich aufs College kam, bat ich um ein Einzelzimmer, damit ich mich vor niemandem zu rechtfertigen brauchte. Sieben Jahre später war ich zwar immer noch isoliert, aber seither hatte sich eine Menge verändert. Echo war nicht mehr der Mittelpunkt meines Lebens. Als ich jedoch hörte, dass sie verschwunden war, klang eine Saite in mir an, erwachte etwas in mir, das lange geschlummert hatte. Und es gab keinen Weg zurück.
3.
Eine ganze Woche lang schaffte ich es, mich zurückzuhalten, dann ging ich ins Büro meiner Vorgesetzten Dana Bradlee. Seit Echo an Silvester nicht erschienen war, hatte es keine seriösen Nachrichten über ihren Verbleib gegeben. In einigen frühen Berichten wurde spekuliert, sie sei tot oder nach einer wilden Nacht wieder in der Entzugsklinik gelandet. Doch wenn eines dieser Szenarien zuträfe, wäre sie nicht verschwunden. Man hätte sie gefunden. Ich stellte mir vor, dass jemand ihre Leiche entdeckt hätte, so wie die arme Natalie Wood 1981 an der Küste von Catalina.
Aber nein. Echo tauchte nirgendwo auf, weder tot noch lebendig. Sieben ganze Tage lang. Eine Quelle sagte, ihr Vater, Jamie Blue, habe Angst um das Leben seiner Tochter und wolle sie nur wieder sicher zu Hause haben. Eine andere Quelle zitierte ihre Agentin mit den Worten: »Keine Sorge, Echo geht es bestens.« Aber mir war klar, dass sie damit wohl nur die Gerüchte zerstreuen wollte. Echo wurde vermisst, und mit jedem Tag, der verging, war ich überzeugter davon, dass ich sie finden würde.
Ich wusste, dass Dana mir eine Abfuhr erteilen würde, weil Echo nicht mein Thema war. Ich war (noch) keine Promireporterin und verfügte nicht über Kontakte zu Agenten, Managern und PR-Leuten. Aber ich konnte ackern. Ich übernahm die Aufträge, die niemand haben wollte. So berichtete ich beispielsweise darüber, dass das Viertel um die Fifth Avenue auf die Renovierung des Washington Arch drängte. Oder darüber, dass dieser Faschist, Bürgermeister Giuliani, die mit wildem Gras bewachsenen Hochbahngleise über der Tenth Avenue abreißen wollte und von dem Rettungsversuch einiger Anwohner. Mein bisher größter Artikel war ein Interview mit Jimmy Glenn, dem Besitzer des Times Square Boxing Club, über die Arbeit inmitten des frisch renovierten Times Square (seltsamerweise war dies der Lieblingsartikel meines Vaters).
Echos Verschwinden war endlich eine Geschichte, die mich ernsthaft interessierte. Ich war geboren, um sie zu schreiben. Ich musste nur noch etwas Überzeugungsarbeit leisten.
Dana war eine junge Redaktionsleiterin und hatte den Job bei ME aufgrund eines Blogs erhalten, in dem sie über ihr Dasein als Assistentin in einem großen Verlagshaus berichtet hatte – mit Mindestlohn und einer Studiowohnung auf der Lower East Side. Sie warf den Verlagsriesen Vetternwirtschaft vor (ironischerweise war sie die Enkelin von Ben Bradlee) und behauptete, alle Redakteure seien Alkoholiker. Das war kein Geheimnis – in den Neunzigerjahren gab es noch flüssige Mahlzeiten und Spesenkonten für Redakteure der oberen Etagen. Aber sie bettelte geradezu darum, gefeuert zu werden.
Die Personalabteilung bat sie zum Gespräch und warnte sie, dass man sie als »Whistleblowerin« bezeichnen würde, was Dana für hysterisch hielt. Am nächsten Tag berichtete sie über das Treffen mit der Personalabteilung. Ein paar Tage später schrieb sie einen anonymisierten Artikel über eine Lektorin, die für mindestens drei Bestseller verantwortlich zeichnete und gelegentlich an ihrem Schreibtisch einschlief. Als Nächstes prangerte sie einen Verlagsmanager an, der ihr im Aufzug an den Hintern gefasst hatte. Die New York Post bezeichnete sie als die »Klatschexpertin« der Verlagswelt. Kurze Zeit später erhielt Dana einen Anruf von ME, weil man dort jüngere Redakteure suchte, Autoren, die für Aufsehen und höhere Verkaufszahlen sorgten. Dana sagte, es sei alles nur eine Frage des Timings gewesen, aber ich hielt sie für knallhart. Wenn irgendjemand meinen Ehrgeiz verstand, dann sie.
Ich klopfte an ihre Bürotür, und sie winkte mich herein.
»Ich hab heute Morgen einen weiteren Anruf wegen des Millennium-Artikels über die Times erhalten – keine E-Mail, einen Anruf. Man hat mich gebeten, den Teil über das falsche Datum auf der Champagnerflöte zurückzuziehen. Das sei ein historisches Ereignis und so weiter. Eine ganze Woche später.« Sie lächelte. Sie war viel zu glatt, um Redakteurin bei einer kleinen Zeitschrift zu sein, mit ihrem strengen Pony, dem straffen Pferdeschwanz und der dicken schwarzen Brille. »Gut gemacht, Goldie. Keinem außer dir ist dieses Detail aufgefallen.«
Mit dem Handballen klopfte sie auf den Boden einer Packung Marlboro lights und forderte mich auf, mich zu setzen.
»Also, was gibt’s? Was kommt als Nächstes? Willst du die Vogue zu Fall bringen? Hast du eine gute Schlagzeile über Anna Wintour?«
Ich atmete tief durch. Dana war direkt, ich musste gleich zum Punkt kommen. »Eigentlich möchte ich über das Verschwinden von Echo Blue schreiben.«
Dana schien verblüfft.
»Echo Blue? Wahrscheinlich hat sie eine Überdosis genommen oder so. Passiert das nicht allen Kinderstars?«, fragte sie gleichgültig. »Ich hab sie einmal bei Max Fish gesehen. Die Leute haben auf der Toilette Heroin genommen. Was für eine Katastrophe.«
Ich hatte in der Zeitung gelesen, dass sie mit jemandem bei Max Fish geknutscht hatte, aber nichts von Heroin.
»Meinst du nicht, man hätte es gemeldet, wenn sie eine Überdosis genommen hätte?«
»Weißt du, Goldie, selbst wenn ihr etwas Mysteriöses zugestoßen wäre, kann ich diese Geschichte nicht so einfach dir überlassen. Wenn sich herausstellt, dass es tatsächlich eine Story ist, werden andere Unterhaltungsredakteure darüber berichten wollen. Wenn ich sie dir gebe, würde es einen Aufruhr in der Redaktion geben. Außerdem sind Prominente nicht wirklich mein Gebiet. Um dir so einen Artikel zu geben, müsste ich ein paar Strippen ziehen.«
Ich spürte ein Stechen in der Kehle. Jeder Journalist braucht eine Pause. Und nach fast einem Jahr bei ME war ich es leid, Geschichten zu schreiben, die mich nicht interessierten. Und interessierte sich Dana nicht mehr für weibliche Stimmen? Das neue Jahrtausend war angebrochen, und noch immer wurden Schauspielerinnen hauptsächlich von männlichen Journalisten interviewt. Wer könnte das Winona-Ryder-Interview von Stephan Brody im Rolling Stone von 1994 vergessen? Auf dem Cover trug sie eine zerschlissene Latzhose ohne T-Shirt darunter.
So lautete der Einleitungstext: Winona Ryder kommt dreißig Minuten zu spät ins Café, aber das ist mir egal, denn sie ist meine Traumfrau. Sie ist unser aller Traumfrau.
Das Jahr 2000 war gerade angebrochen, und die Nachrichten über Echos Verschwinden waren von frauenfeindlichen Anschuldigungen geprägt – sie würde eine Schwangerschaft verheimlichen, oder sie habe sich wegen einer unglücklichen Beziehung umgebracht. Nur eine Quelle vertrat die Theorie, sie sei entführt worden, aber ganz sicher würden sie ihr am Ende noch vorwerfen, dass sie auch daran im Grunde selbst schuld sei.
Wenn ich die Chance bekäme, eine Geschichte über Echo zu schreiben, wäre ich mit dem Herzen dabei. In meinem Kopf sah ich eine meiner alten Fantasien vor mir: Wie ich mit ihr eingehakt durch eine malerische Straße in SoHo schlenderte. Ich würde sie fragen, wie sie früher mit ihrem Vater über den Kanälen von Venedig Frisbee gespielt hatte, und sie würde sagen: »Woher weißt du das?« Und ich: »Oh, ich habe meine Hausaufgaben gemacht«, denn ich hatte nicht nur über sie recherchiert, ich hatte Echo inhaliert. Ihre Kindheitsgeschichte war meine Kindheitsgeschichte. Wir würden zu ihr nach Hause gehen, und sie würde mit alten Töpfen für mich kochen, die sie auf dem Rose-Bowl-Flohmarkt gekauft hatte (jemand hatte sie dort einmal fotografiert). Sie würde mir alte Standfotos vom Set von Spielerin Nummer Acht zeigen. Ich würde sie nach ihrer Schauspielphilosophie befragen, nach ihrem Leben, danach, wer sie wirklich war. Ich würde mich nicht über ihr Aussehen auslassen.
Ja, diese Geschichte erforderte eine echte Journalistin, die sie respektierte, die sie verstand, die sich nicht über sie lustig machen wollte, die rücksichtsvoll und mitfühlend war. Jemand, der sie in- und auswendig kannte. Dieser Mensch musste ich sein.
»Was, wenn ich wüsste, wo sie ist?«, platzte ich plötzlich heraus.
»Ach? Und wo ist sie?«
»Weißt du, ich – wie soll ich das ausdrücken – verfolge sie seit Jahren, seit meiner Teeniezeit. Ich hab einige gute Hinweise. Aber nichts, worüber ich schon sprechen könnte«, sagte ich. Das war alles gelogen. Ich hatte gar nichts. Meine Hände zitterten, und weil ich Angst hatte, sie würden mich verraten, schob ich sie unter meine Schenkel. Reiß dich zusammen, Goldie. »Wie du immer sagst, ein Journalist muss seine Quellen schützen.«
»Du willst mir also erzählen, dass du all diese Hinweise innerhalb einer Woche bekommen hast?«, fragte sie mit hochgezogenen Augenbrauen.
»Du hast ja keine Ahnung, wie sehr ich diese Geschichte will, Dana.«
Sie nahm eine Zigarette aus der Schachtel und drehte sie zwischen den Fingern. Sie seufzte. »Das ist mein eigentliches Problem, und das würde ich jedem unserer Redakteure sagen. Echo Blue ist eine ehemalige Süchtige, richtig? Sagen wir, sie hat eine Überdosis genommen, was sehr wahrscheinlich ist. Was macht das zu einer Story? Herrgott, wir sind hier doch nicht beim People Magazine. Ja, sie war sehr berühmt, die Leute mochten sie, Nostalgie, bla, bla, bla, und jetzt ist sie verschwunden. Aber gibt es noch etwas darüber hinaus? Das würde ich gern wissen.«
»Okay, ich will dich mal was fragen«, sagte ich. »Warum stehen so viele Leute hinter Robert Downey Jr., aber jemand wie Echo Blue wird den Wölfen zum Fraß vorgeworfen? Bei ihm sitzt Sean Penn bei seiner Verhandlung im Gerichtssaal, und bei Echo schreiben die Leute Artikel darüber, dass ihre Karriere mit neunzehn vorbei ist. Das machen sie nur mit Frauen. Nur mit Kinderstars. Männer bekommen eine Million Chancen.«
Das schien Dana zu gefallen. Sie sah mich an und nickte. Sie rollte die Zigarette zum Ende des Tisches, riss eine Packung Nikotinkaugummis auf, steckte sich einen in den Mund und kaute wütend darauf herum. Ich war zwar keine Raucherin, wusste aber, dass ich mindestens drei Minuten Zeit hatte, bis die Nikotinwirkung nachließ und sie nach draußen flüchtete, wo die Tabakfans den Eingang zum Gebäude blockierten. Sobald man nach draußen trat, wurde man von Rauch umschlossen, und es war schwierig, sich unter vier Augen zu unterhalten. In den alten Raucherzimmern waren sie wenigstens getrennt gewesen.
»Echo Blue verdient es, dass jemand ein Porträt über sie schreibt«, fuhr ich fort. »Jemand, der sich für sie interessiert, der sie versteht. Jemand, der ihre wahre Geschichte aus ihrer Perspektive erzählen will. Du willst doch niemanden auf diese Geschichte ansetzen, der sich erst alle ihre Filme ansehen muss. Ich kenne diese Filme bereits, Dana. Ich hab sie verschlungen. Sie sind Teil meiner Psyche. Ich hab Tonnen von Archivmaterial.« (Dass dieses »Archiv« aus einem Karton unter meinem Bett im Haus meiner Eltern bestand, verschwieg ich.) »Im Grunde hab ich mich auf diese Geschichte vorbereitet, seit Spielerin Nummer Acht herauskam.«
»Ich hab Spielerin Nummer Acht nie gesehen«, sagte sie ausdruckslos.
»Wie bitte? Wie ist das möglich? In allen anderen Filmen vor Spielerin Nummer Acht waren die Mädchen Nebenfiguren oder wurden erstochen oder waren an ihrem sechzehnten Geburtstag hinter Typen namens Jake Ryan her. Sieh dir die Filme an, die nach Spielerin Nummer Acht herauskamen, Filme, in denen die Mädchen etwas zu sagen hatten: Clueless – Was sonst!, 10 Dinge, die ich an dir hasse, Hauptsache Beverly Hills. Ich kenne jede Zeile aus Spielerin Nummer Acht …«
Sie legte den Kopf schief, schob die Brille auf die Nasenspitze und sah mich über den Rand hinweg an. »Du wirst doch nicht einen auf Misery machen, Echo Blue in eine Hütte sperren und ihr die Knöchel mit einem Vorschlaghammer brechen, oder?«
Ich lachte. Ich musste vorsichtig vorgehen. Meine Fixierung auf Echo würde mich als geistesgestört erscheinen lassen, als ob ich die Story nur wollte, um sie zu treffen. Und obwohl ich mich darauf freute, sie kennenzulernen, war ich ernsthaft daran interessiert, ein Porträt zu schreiben, das meiner Karriere eine neue Richtung geben würde. Ich träumte von einer Geschichte, mit der ich auf einer Liste der »Dreiundzwanzig unter Dreiundzwanzigjährigen« landen würde. Ja, ich weiß, das klingt oberflächlich. Das ist nicht das, wonach man als Schriftstellerin streben sollte. Aber Echo war zufällig das Thema, mit dem ich mich am besten auskannte.
»Bitte, Dana. Gib mir diese Story. Ich bin die Einzige, die sie schreiben kann. Ich flehe dich an.«
»Vielleicht werde ich es bereuen, aber jemand hat mir einmal eine Chance gegeben, und deshalb, Goldie«, sie schlug mit der flachen Hand auf den Schreibtisch, »ist heute dein Glückstag. Wenn du sie findest und ein richtiges Interview mit ihr führst, und ich rede hier nicht von einer Viertelstunde, nicht von einem Anruf, in dem sie dir irgendeinen Blödsinn darüber erzählt, dass sie eine ›Auszeit vom Leben‹ brauchte. Das macht noch kein Promi-Interview. Ich spreche hier von einer echten Story. Bei einer guten Promi-Geschichte geht es nicht nur um den Prominenten oder darum, dass du promigeil bist. Der Autor muss etwas Interessantes aus der Geschichte machen. Wenn du es also schaffst, tief in die Materie einzutauchen, sie zu finden und mit ihr zu sprechen und dann auch noch einen anspruchsvollen Kommentar über ihr Umfeld zu schreiben, dann, und nur dann, werde ich dafür sorgen, dass diese Geschichte gut platziert wird.«
Ein heißer Blitz fuhr durch meine Arme bis hinauf in die Schultern und den Nacken. Das Blut schoss mir derart schnell in den Kopf, dass ich dachte, ich würde vor Aufregung in Ohnmacht fallen. Hatte sie mir gerade die Story überlassen? Und mir versprochen, sich um sie zu kümmern? Hatte sie mich auch als promigeil bezeichnet? Ruhig, ganz ruhig, sagte ich mir. Ich wollte nicht ohnmächtig werden und Danas Vertrauen zu mir erschüttern, bevor ich überhaupt eine Chance hatte, etwas zu schreiben. Zum Glück steckte sie mit dem Kopf in ihrer Schublade und durchwühlte ihren Schreibtisch, sodass sie mein fuchsiafarbenes Gesicht nicht bemerkte. »Wo zum Teufel ist mein Feuerzeug?«, fluchte sie ein paarmal vor sich hin. »Du hast nicht zufällig ein Feuerzeug?«, fragte sie schließlich mich.
Ich schüttelte den Kopf. »Bekomme ich ein Reisebudget?«, fragte ich vorsichtig.
Sie schnaubte. »Ja, wir werden dafür sorgen, dass die Firmenlimousine dich zum Flughafen bringt.«
»Was ist mit den Ausgaben?«
»Hast du eine Kreditkarte?«
Ich nickte. Meine Kreditkarte hatte ein Limit von zweitausend Dollar, und das meiste davon hatte ich bereits aufgebraucht.
»Gut«, sagte sie. »Ich muss eine rauchen, sonst bringe ich jemanden um. Sieh zu, was du kriegen kannst.« Und dann war sie aus der Bürotür, bevor ich mich noch bei ihr bedanken konnte.
Echo
1980–1991
4.
Meine Eltern sind beide Schauspieler. Meine Mutter war ein Kinderstar. Sie spielte in Goldrausch mit, der größten Fernsehserie der Siebzigerjahre, die auf einer erfolgreichen Buchreihe über ein Mädchen basierte, das mit seiner Familie in Kalifornien lebt. Sie war eines dieser bezaubernden Geschöpfe mit Sommersprossen und einem leichten Lispeln, das lange, glatte Haar zu Zöpfen geflochten. Große braune Augen. Es gab Puppen, die aussahen wie sie. Halloween-Kostüme. Sie war der bestbezahlte Fernsehstar der damaligen Zeit.
Als ich ungefähr neun war, erzählte sie mir die Wahrheit über ihre Karriere. Wir lagen zusammengerollt in ihrem Kingsizebett, wo wir uns an den meisten Abenden in die lilafarbene Seidenbettwäsche kuschelten und uns im Dunkeln Filme wie Was geschah wirklich mit Baby Jane? ansahen. Meine Mutter nahm stets eines ihrer vielen Medikamente ein, Pillen, die gegen eine Vielzahl Beschwerden wirkten, von Rücken- und Bauchschmerzen bis hin zu »einfach nur das Leben«.
Meine Mutter rauchte regelmäßig im Bett, und manchmal brannte sie ein Loch ins Laken, oder ein Stück Glut versengte den Teppich. Ich lernte, ihre Zigarette aufzufangen, sobald sie ihr aus den Fingern oder dem Mund glitt, und sie in die kleine Vertiefung des mit Kippen gefüllten dicken Glasaschenbechers neben ihrem Bett zu legen. Ständig erzählte sie mir mahnende Geschichten über den Ruhm – dass sie nie normale Freundschaften hatte, dass die Leute sie ständig gefragt hatten, was nach Goldrausch käme.
»Hab ich dir schon erzählt, dass mal jemand versucht hat, mich zu entführen?«
»Ja, Mama.«
»Ich war noch ein kleines Kind«, klagte sie.
»Du warst etwas Besonderes, Mama.« Das sagte ich oft. Ich dachte häufig an ihren berühmten Auftritt bei Johnny Carson. Sie war noch so jung, gerade einmal zehn. Sie tat so, als würde sie auf ihrem Stuhl einschlafen, ein Scherz, weil sie die ganze Nacht gedreht hatte. Das arme Ding war erschöpft, weil sie in der Lieblingsserie mitspielte, für die alle schwärmten. Sie wollte, dass es jemand bemerkte. Doch als sie in dem Glauben von der Bühne rannte, sie habe es sehr gut gemacht, weil das Publikum während ihres Auftritts gelacht hatte, gab meine Großmutter ihr einen Klaps auf den Hintern. Sie sei frech gewesen. »Man tut nicht so, als würde man bei Johnny Carson einschlafen! Man tut nicht so, als würde man im nationalen Fernsehen einschlafen.« Meine Großmutter erinnerte meine Mutter ständig daran, dass es Hunderttausende Mädchen gab, die ihre Rolle bei Goldrausch haben wollten, und meine Mutter meinte, sich respektlos verhalten zu können.
Meine Mutter tat mir sehr leid, all der Schmerz, den sie erlebt hatte, all das Misstrauen, das sie dem System und sogar ihrer herrischen Mutter gegenüber hegte. Wie Rose aus Gypsy. Sie hatte sich geschworen, niemals zuzulassen, dass mir so etwas zustieß. Dass ich ein so normales Leben wie möglich haben sollte.
Als NBC alle Rechte an Goldrausch kaufte, erhielt meine Mutter einen grandiosen Vertrag (Nana hatte meiner Mutter einen sehr guten Agenten vermittelt; sie wollte nicht, dass ihr kleines Mädchen über den Tisch gezogen wurde). Es ist unvorstellbar, wie viele Tantiemen sie noch immer erhält. Goldrausch war und wird immer noch im ganzen Land im US-Geschichtsunterricht eingesetzt, um über die Kinder aufzuklären, die mit ihren Eltern auf der Nordwestpassage und dem Oregon Trail nach Gold gruben. Meine Mutter ist auf dem Plakat von Goldrausch abgebildet; es ist das berühmte Bild ihrer Figur Lottie, die die Hand ihrer blinden Schwester hält, während sie hinter einem Wagen herlaufen. Man kann den Film auf TV Land, TBS und Nick at Nite sehen oder ihn bei Netflix-DVDs bestellen. Jedes Mal erhält meine Mutter einen Anteil vom Erlös.
So habe ich es geschafft, sie zu sehen, obwohl es verboten war. Wenn sie einschlief, schlich ich nach unten, um mir die Wiederholungen anzusehen. Warum auch nicht? Andere Kinder hatten die Fotoalben ihrer Eltern, doch die Jugend meiner Mutter war dort festgehalten, auf meinem Fernsehbildschirm. Ihre strahlenden Augen sahen mich an, ich hatte die gleichen Augen, und wir waren ungefähr im gleichen Alter. Lottie sah mir verblüffend ähnlich. Ich wollte Goldrausch schrecklich finden, aber ich fand es wundervoll. Diese energiegeladene, charmante Version meiner Mutter, eine Version von ihr, die ich nie kennenlernen durfte. Ich wollte meine Mutter unbedingt daran erinnern, wer sie wirklich war. Ihr sagen, wie viel mir die Serie bedeutete.
Einmal, nachdem ich die Folge gesehen hatte, in der sie sich in der Wildnis von Wyoming verirrte, konnte ich mich nicht mehr beherrschen. Ich schaltete den Fernseher aus und schlich auf Zehenspitzen ins Zimmer meiner Mutter. Sie war noch nicht ganz eingeschlafen, nahm die Zigarette aus dem Mund, legte sie in den dicken Glasaschenbecher und streckte die Arme aus. Sie war gut gelaunt. Das nutzte ich aus.
»Du warst so schön, Mama, so begabt«, sagte ich und legte meinen Kopf an ihre Brust; der Geruch ihrer Achselhöhlen zwischen uns. Wer weiß, wann sie das letzte Mal gebadet hatte, doch das war mir egal. Ich liebte sie, und es war schön, in ihren Armen zu liegen. Ich war mir nicht sicher, wie sie reagieren würde, aber sie sollte wissen, dass ich stolz auf sie war. Ich wollte ihr zeigen, wie viel sie der Welt zu bieten hatte. Das sollte nicht die Aufgabe einer Zehnjährigen sein, aber ich wollte, dass es ihr gut ging.
Sie streichelte meinen Kopf, der Rauch der Zigarette hing zwischen uns. »Manchmal weiß ich nicht, wo Lottie aus Goldrausch aufhört und Mathilde beginnt«, war ihre einzige Antwort.
Es wurde klar, dass mein Lob sie nicht aus ihrem verrauchten Bett holen würde. Man kann niemanden aus einer Depression herauszwingen. Sie sank zurück auf die Matratze, wie sie es seit Jahren getan hatte. Und während ich sie unterstützen, sie aufmuntern wollte, dachte ich ununterbrochen an meinen Vater und wünschte mir, er würde mich retten. Uns retten.
. . .
Mein Vater, Jamie Blue, war ganz anders als seine Ex-Frau. Er lebte für das Scheinwerferlicht. Er kam als James Stewart Blumenthal in Passaic, New Jersey, zur Welt. Seine Eltern waren ein berühmtes Gesangs- und Schauspielduo in den Catskills, und seine Großmutter war Bertha Kalich, eine der berühmtesten jiddischen Schauspielerinnen Anfang des 20. Jahrhunderts. Wie viele andere Schauspieler trennte sich mein Vater radikal vom letzten Teil seines Namens, als er nach Hollywood kam, und löschte damit Jahrzehnte jüdischer Identität aus.
Meine Eltern lernten sich auf einer Geburtstagsfeier bei Max Shine kennen, dem Produzenten von Goldrausch. Es war das letzte Jahr, das meine Mutter in der Serie mitspielte. Sie war neunzehn, mein Vater einundzwanzig, und er hatte gerade Erfolg mit seiner ersten Rolle in Sonnenschein im Wald unter der Regie von Donnie Champlain gehabt. Es war einer dieser großen Independent-Filme, die zwei Millionen Dollar gekostet hatten und an der Kinokasse zweihundert Millionen Dollar einspielten. Als er meine Mutter auf der anderen Seite des Pools stehen sah, war er beeindruckt, wie unschuldig und deplatziert sie wirkte. Diese Geschichte habe ich unzählige Male gehört.
»Du siehst nicht glücklich aus«, sagte er zu ihr und reichte ihr einen Drink.
»Warum sollte ich glücklich sein?«, fragte sie. »Ich bin auf einer langweiligen Party mit Leuten, die nur von sich reden, und die Krabben schmecken, als gehörten sie zurück ins Meer.«
Offenbar hatte sich mein Vater vor Lachen ausgeschüttet. Er war erst seit ein paar Jahren in Hollywood, aber er hatte sich daran gewöhnt, dass die Leute so taten, als wären sie zufrieden; an das falsche Lächeln und die Schleimerei. Er fand die Offenheit meiner Mutter erfrischend. »Mir geht dieser Hollywood-Scheiß auch auf die Nerven«, sagte er an jenem ersten Abend zu ihr. »Ich will richtige Filme drehen wie Newman. Will düstere Figuren spielen wie Brando. Keine Kompromisse machen. Ich will authentische Charaktere spielen. Charaktere, denen man noch nicht das ganze Leben ausgesaugt hat.« Damals glaubte sie an seine Reden. Er brauchte nur Brando und Newman zu erwähnen und zu sagen, dass es bei der Schauspielerei im Kern darum ginge, »die Wahrheit zu finden«, und sie war hin und weg.
Ein paar Tage später brannten sie zusammen durch. Ich glaube eher, dass sie beide auf ihre Weise von der Hochzeit profitierten. Ob meine Mutter es zugeben wollte oder nicht, sie war nicht bereit, auf Hollywood und die Annehmlichkeiten des Ruhms zu verzichten. Und mit meinem Vater konnte sie sich im Hintergrund halten. Sie konnte eine Nebenrolle spielen, anstatt der Star zu sein. Sich für eine Weile dem Druck entziehen.
Für ihn war sie die Eintrittskarte in die Welt der Hollywood-Elite. Die Leute wollten, dass sie zum Film wechselte, denn mit zunehmendem Alter wurde sie noch schöner. Doch sie weigerte sich, was sie nur interessanter machte. Sie war ein Rätsel, das seinen eigenen Reiz hatte. Solange man geheimnisvoll ist, ist man noch berühmt.
Nach allem, was ich gehört habe, bestanden ihre gemeinsamen Jahre aus leidenschaftlicher Liebe und ebenso leidenschaftlichem Streiten. Und wie nicht anders zu erwarten, scheiterten sie. Man kann von einem Kind nicht verlangen, dass es seine Eltern im Einzelnen versteht, aber soviel ich weiß, waren sie nicht dazu bestimmt, Kinder zu haben, denn sie waren selbst welche.
5.
Als ich zwei war, zog mein Vater aus und widmete sich ganz seiner Karriere – und er schlief mit jeder schönen Frau in Hollywood. Und meine Mutter zog sich so weit wie möglich aus der Öffentlichkeit zurück.
Eine meiner frühesten Erinnerungen an meinen Vater ist, wie ich ihn in einer Supermarktschlange auf dem Titelblatt einer Zeitschrift entdeckte. Es war ein Paparazzi-Foto, das ihn Händchen haltend mit seiner neuen Filmpartnerin Alexandra Moore zeigte. Ihre wilde Sexszene in einem weißen Ford Thunderbird Cabrio zu den Klängen von Roxy Musics pulsierendem »Love Is the Drug« wurde zum Titelsong ihrer Liebesaffäre. Doch als ich die Ausgabe durchblätterte, fiel mir eine Aufnahme auf, auf der er allein in die Kamera blickte, als würde er mich direkt ansehen. Er trug ein weißes T-Shirt mit V-Ausschnitt, und das Sonnenlicht schien auf sein zerzaustes Haar. Meine Mutter nahm mir das dünne Magazin weg, drehte es um und murmelte leise »Schund«. Ich wollte es in die Hand nehmen, es an meine Brust drücken und nicht mehr loslassen.
Im Alter zwischen fünf und sieben fanden meine Besuche bei ihm meist an Filmsets statt, damit ich in seinen vollen Terminkalender passte. Im Sommer 1985 drehte er Frannie und Frankie, angelehnt an Truffauts Jules und Jim. Es war sein zweiter Film mit Donnie Champlain, und sie hatten jetzt ein höheres Budget. Meine Mutter setzte mich am Studiogelände ab und ermahnte mich, entweder bei der Maske oder bei der Garderobe zu bleiben, weil sie wahnsinnige Angst hatte, dass mich jemand anfassen oder verletzen könnte oder, noch schlimmer: »Dass sie versuchen, dich zum Schauspielen zu überreden.« Ich freundete mich mit Crystal an, einer einundzwanzigjährigen Maskenbildner-Assistentin, die mich bezaubernd fand. »Wie eine kleine Erwachsene«, sagte sie, und wir kauerten auf dem Boden, um meinem Vater bei der Arbeit zuzusehen.
Dort saß ich tagelang. Ich sah ihm damals gern zu. Er war lustig und scheute sich nicht, albern zu sein, was für einen so gut aussehenden Mann nicht typisch war. Er war auch laut, ungestüm und hatte eine Menge Vorschläge. »Ich habe eine Idee!«, sagte er immer. Dann hörten alle auf zu reden, denn er beherrschte das Set. Ich verstand nicht, dass seine »Ideen« oft erst dann aufkamen, wenn jemand anderes etwas sagte, wie Donnie Champlain oder seine Kollegin Talia Bryson. Es verwirrte mich, wenn Donnie mit den Augen rollte oder Talia seufzte, denn war seine Kreativität nicht inspirierend?
Ich bin mir nicht sicher, warum ich es tat, vermutlich um Aufmerksamkeit zu erregen. Jedenfalls fing ich an, ihn nachzuahmen, wenn er sagte: »Ich habe eine Idee!« Crystal fand das so charmant, dass sie mich aufforderte, es auch für andere Mitglieder des Teams zu machen, beispielsweise für den Tonassistenten, den Tonangler und den Assistenten der Kamerabühne – allesamt ganz unten in der Hierarchie und diejenigen, die am meisten Unterhaltung brauchten. Wenn ich für sie spielte, beschleunigte sich mein Herzschlag. Es gefiel mir, sie zum Lachen zu bringen und zu sehen, wie sich ihre Gesichter aufhellten.
Eines Tages waren mein Vater und ich zwischen den Aufnahmen in seinem Wohnmobil. Er ging seinen Text durch, und ich spielte mit meiner Puppe und wiederholte immer wieder meine kleine Vorstellung – »Ich habe eine Idee« –, lauter und lauter, genau, wie er es mit seiner rauen Stimme gesagt hätte. »Hey, Daddy«, sagte ich schließlich. »Gefällt dir das? Ich habe eine Idee!« Ich wollte, dass er mich hörte, und hoffte, dass er genauso reagieren würde wie die Leute vom Team; ich stellte mir vor, dass er vor Stolz strahlen würde.
»Echo, lass das«, sagte er nach ein oder zwei Minuten in scharfem Ton. »Ich versuche, meinen Text zu lernen.«
»Aber ich mache doch dich, Daddy.«
»Was soll das heißen, du machst mich?«
»Du weißt schon, wie du immer sagst: ›Ich habe eine Idee!‹«
Die Scriptfrau (ich kann mich nicht mehr an ihren Namen erinnern) schlich sich unter dem Vorwand aus dem Wohnmobil, sie brauche einen Kaffee.