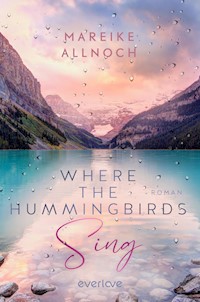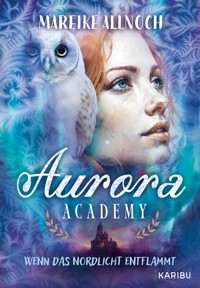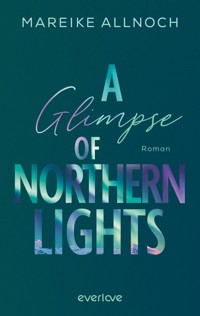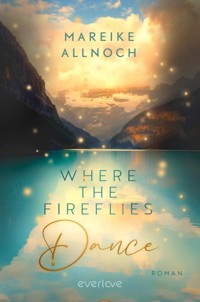
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Neue Anfänge und zweite Chancen am Ufer des traumhaften Lake Louise in Kanada! Nells Familie gehört das Chalet-Resort im idyllischen Lake Louise. Seitdem ihr Bruder Luke einen schweren Unfall hatte, kämpft Nell mit schrecklichen Angstzuständen. Sie kann nicht akzeptieren, dass Luke nun im Rollstuhl sitzt, und fühlt sich schuldig. Für ihre Eltern spielt sie die starke Tochter, die alles im Griff hat. Nur ihren Freunden Lily und Ben vertraut sie sich an. Doch dann taucht plötzlich der geheimnisvolle Caleb im Resort auf und stürzt Nell in ein heilloses Gefühlschaos. Aber Caleb ist nicht zufällig in Lake Louise. Er war auch in jener Nacht dort, als Lukes Unfall geschah. Sehnsuchts-Setting Kanada und bewegende Themen wie Trauerbewältigung, Selbstfindung und die große Liebe: Mareike Allnochs New-Adult-Dilogie mit Sehnsuchts-Setting Kanada und den Themen Naturschutz und Work-and-Travel ist die perfekte Lektüre für Leser:innen von Carina Schnell und Kira Mohn. Die Lake-Louise-Reihe: Band 1: Where the Hummingsbirds Sing Band 2: Where the Fireflies Dance
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.everlove-verlag.de
Wenn dir dieser Roman gefallen hat, schreib uns unter Nennung des Titels »Where the Fireflies Dance« an [email protected], und wir empfehlen dir gerne vergleichbare Bücher.
((bei fremdsprachigem Autor))
© everlove, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2023
Redaktion: Catherine Beck
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Liebe Leser:innen,
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Caleb
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
Caleb
12. Kapitel
13. Kapitel
Caleb
14. Kapitel
15. Kapitel
Caleb
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
Caleb
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
Caleb
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
Caleb
50. Kapitel
51. Kapitel
Caleb
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
Epilog
6 Monate später
Danksagung
Contentwarnung
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für alle, die auch mal ein Glühwürmchen benötigen, wenn die Welt ein bisschen dunkel erscheint.
Liebe Leser:innen,
Dieser Roman enthält potenziell triggernde Inhalte. Eine Contentwarnung findest du am Buchende.[1]
Prolog
Als ich am Unfallort eintreffe, steigt mir der Geruch von verbrannten Reifen und Blut in die Nase, und ein metallischer Geschmack legt sich auf meine Zungenspitze.
Angst frisst sich durch meinen Körper.
Immer wieder dieser eine Gedanke: Ich hätte es verhindern können. Es ist meine Schuld.
Kein einziger Stern ist am Himmel auszumachen. Die dunklen Wolken schlucken jegliches Licht. Angst und Tod liegen in der Luft, vermischen sich zu etwas Hässlichem.
Ich fühle mich wie in einem Horrorfilm, doch leider kann ich nicht auf Pause drücken. Oder auf Rückspulen.
Denn das hier ist kein verdammter Film, es ist mein Leben.
Wie ferngesteuert wanke ich auf den Ort des Geschehens zu und schlage das rot-weiße Absperrband beiseite. Blaulichter zucken wie grelle Blitze durch die finstere Schwärze. Überall wuseln Menschen herum und versperren mir die Sicht. Sanitäter und freiwillige Helfer der Feuerwehr geben Anweisungen und leisten Erste Hilfe, während Polizeikräfte um mich herum den Unfallort absperren.
Irgendjemand hält mich am Arm fest, will mich daran hindern, weiterzulaufen, doch ich reiße mich los.
Meine Beine können mich kaum tragen, so sehr zittere ich. Trotzdem kämpfe ich mich weiter voran.
Mein Blick fällt auf die vielen Einzelteile, die mal ein Moped waren und sich über die gesamte Fahrbahn verteilen. Die Leitplanke ist auf der einen Seite vollständig zerstört, Erdklumpen und Grasbüschel liegen auf dem grauen, nassen Asphalt.
Mein Brustkorb wird eng, und ich habe das Gefühl, nicht mehr atmen zu können.
Und dann sehe ich ihn.
Wie er reglos am Boden liegt und jegliche Farbe aus seinem Gesicht gewichen ist. Er sieht blass aus, Blut klebt in seinem blonden Haar und trocknet in Schlieren an seiner Schläfe.
Die Sanitäter bedecken ihn mit einer goldenen Folie, legen ihm eine Halskrause an, und er wird auf eine Trage gehoben.
Ich renne auf ihn zu, aber sie lassen mich nicht zu ihm.
Irgendjemand schreit, doch es dringt nur wie durch Watte an mein Ohr. Es dauert eine ganze Weile, bis ich begreife, dass es meine eigenen Schreie sind, die durch die Nacht hallen.
Ich fühle mich wie in einem Tunnel. Ein dunkler Tunnel, aus dem es kein Entrinnen, keinen Ausgang gibt.
Dann wird mir schwarz vor Augen, und die Welt um mich herum verschwindet.
1. Kapitel
Panisch schreckte ich aus meinem Albtraum hoch, das Herz schlug mir bis zum Hals. Schweißperlen standen auf meiner Stirn, meine braunen Haare hingen mir strähnig ins Gesicht, und mein dünnes Schlafshirt klebte unangenehm wie eine zweite Haut an mir.
Ich atmete ein und aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, zählte ich stumm, um mich zu beruhigen. Eine Atemtechnik, die ich immer dann anwandte, wenn ich drohte, mich in einem Gedankenstrudel und meiner eigenen Panik zu verlieren.
Zitternd griff ich nach dem halb vollen Wasserglas neben mir auf dem Nachttisch und nahm einen Schluck.
Ich konnte meine Hände kaum ruhig halten, sodass der Großteil des Wassers auf meiner Bettdecke landete. Während sich mein Herzschlag allmählich beruhigte, stellte ich das Glas zurück auf den Nachttisch und vergrub den Kopf in den Händen.
Fast jede Nacht träumte ich von Lukes Unfall. Davon, wie ich am Unfallort eingetroffen war und meinen Bruder blutend am Boden liegen gesehen hatte. Und überall Blaulichter, die die hoffnungslose Nacht durchleuchtet hatten.
Seit jenem Tag war nichts mehr, wie es einmal gewesen war. Es hieß, dass Schicksalsschläge zusammenschweißten. Doch unsere Familie hatten sie auseinandergebracht. Und mich hatte jene Nacht zu einem anderen Menschen gemacht.
Ich schlug die Bettdecke zurück und schwang meine wackeligen Beine über die Bettkante. An Schlaf war ohnehin nicht mehr zu denken.
Bevor ich wieder in diese beklemmenden Albträume fiel, blieb ich lieber den Rest der Nacht wach.
Auf nackten Füßen tapste ich durch mein Schlafzimmer und lief auf den Flur zur Kommode. Ich nahm das Foto, das Luke und mich in glücklichen Tagen zeigte, und strich über den weißen Bilderrahmen.
Der Tag war mir so klar in Erinnerung, als wäre es gestern gewesen. Ich schloss die Augen und wünschte mich an jenen Septembertag im letzten Jahr zurück. Wenn ich ganz fest daran dachte, hatte ich den intensiven Geruch von frischer Erde, Tannen und Kiefern in der Nase. Noch immer hörte ich die Vögel in den Bäumen über uns zwitschern.
Luke und ich hatten eine Wanderung durch die Rockies unternommen. Dabei hatten wir so viel gelacht und herumgealbert wie schon lange nicht mehr. An diesem Tag fühlte ich mich unbeschwert und frei.
Luke war übermütig wie eine Bergziege die Hänge hinaufgeklettert, und ich hatte mich ständig gesorgt, dass er stürzen und sich womöglich irgendetwas brechen könnte. Mein Bruder hatte noch nie die Füße stillhalten können. Die Blessuren und blauen Flecken, die er vom Eishockeytraining mit nach Hause gebracht hatte, waren ganz normal.
Doch es waren nicht die Berge, das Eishockey oder sein Übermut, die Luke letztendlich zum Verhängnis geworden waren, sondern eine einzige verdammte Nacht. Jetzt würde er mit seinen gerade mal zwanzig Jahren vielleicht nie wieder laufen können.
Und diese Schuld würde den Rest meines Lebens qualvoll auf mir lasten.
Tränen traten mir in die Augen, doch ich zwang mich, sie fortzublinzeln. Ich musste stark bleiben.
Ich stellte den Bilderrahmen zurück auf die Kommode, ging wieder ins Schlafzimmer und blickte aus dem Fenster.
Der Mond stand dick und rund am Himmel.
Dieses Haus … es war leer ohne Luke. Fremd. Und beinahe gespenstisch still.
Vor dem Unfall war es von Lachen und Stimmengewirr erfüllt gewesen. Doch all diese Geräusche, all das, was diesen Ort ausgemacht und zum Leben erweckt hatte, war nun verstummt.
Trotz der Tatsache, dass meine Eltern das Erdgeschoss bewohnten und ich eine eigene Wohnung direkt unterm Dach besaß, war es erstaunlich, wie sehr man sich aus dem Weg gehen konnte.
Wann immer meine Eltern und ich uns im Treppenhaus begegneten, war die Luft erfüllt von Unsicherheit und Schweigen. Von Angst.
Niemand traute sich, wirklich auszusprechen, was ihm durch den Kopf ging. Seit Monaten lief das schon so. Ich hatte stets das Gefühl, mich auf einem Seil über einer Schlucht zu befinden – nicht wissend, ob meine Familie mit all den Strapazen der letzten Wochen würde umgehen können.
Oder ob es uns geradewegs in den Abgrund stürzte.
2. Kapitel
Kurzerhand zog ich einen samtigen Morgenmantel über. Das Parkett knarrte leise unter meinen Füßen.
Die Küche war mein geheimer Zufluchtsort. Leider war ich in den letzten Wochen nur selten dazu gekommen, neue Rezepte auszuprobieren.
Ich liebte den rustikalen Charme meiner Landhausküche und die Harmonie von Holz und Stein mindestens ebenso sehr wie die massiven Balken aus Eiche, die sich durch meine Wohnung zogen und von denen Hängepflanzen herabhingen.
Kaum dass die Kochinsel in mein Sichtfeld kam, entspannte ich mich merklich.
Plötzlich wusste ich, was zu tun war. Ich entschied mich spontan dazu, einen Blueberry Pie mit Ahornsirup zu backen. Es war Lukes Lieblingskuchen, und vielleicht konnte ich meinem Bruder damit eine Freude machen, wenn wir ihn morgen aus der Klinik in Calgary abholten.
Außerdem lenkte es mich von dem stillen Kummer und den Schuldgefühlen ab.
Ich durchforstete den Kühlschrank, das Gewürzregal und die Schubladen. Zahlreiche Küchengeräte und Backutensilien fanden den Weg auf die Arbeitsfläche. Wie ein Wirbelwind fegte ich durch die Küche, bis ich alle Zutaten zusammenhatte. Jeder Handgriff saß. Wie bei einer To-do-Liste, die ich abarbeiten konnte und auf die ich stolz war, wenn ich sie erledigt hatte.
Ich war regelrecht süchtig nach To-do-Listen. Gäbe es für Häkchen-Kranke wie mich jemals eine Selbsthilfe-Gruppe – ich würde sofort eintreten.
To-do-Listen waren für mich wie ein sicherer Hafen, ein Fahrplan durch meinen chaotischen Alltag.
Es war befriedigend, ein Häkchen hinter erledigte Aufgaben setzen zu können. Da stand dann schwarz auf weiß, was ich geschafft hatte. Selbst wenn meine Liste nur aus diesen fünf Punkten bestand:
Aufwachen
Aufstehen
Nicht einschlafen
Niemanden töten
Überleben
Beim Kochen und Backen hielt ich mich allerdings nicht an genaue Rezeptangaben, sondern folgte lieber meinem Gefühl. Auch wenn ich das grobe Rezept gedanklich im Kopf durchging, mochte ich es, bei der Zubereitung einer Speise mit Zutaten und Mengenangaben zu spielen. Manchmal konnte das Hinzufügen oder Weglassen eines bestimmten Gewürzes oder einer weiteren Zutat ein vollkommen neues Gericht hervorzaubern.
An dem Blueberry Pie mochte ich die Komposition aus teils gekochten, teils frischen Blaubeeren und Orangensaft, denn das Aroma der Orangen verstärkte den Geschmack der Blaubeeren und ließ eine wahre Gaumenfreude entstehen.
Gestern hatten Lily, Ben und ich ganz in der Nähe kiloweise Blaubeeren gepflückt. Selbst gepflückt schmeckten sie viel besser, denn die wilden Blaubeeren hatten ein deutlich kräftigeres Aroma als die gezüchteten Beeren aus den Supermärkten. Uns hatten irgendwann schon die Bäuche wehgetan vom vielen Naschen.
Nachdem ich die Zutaten für den Boden miteinander vermengt hatte, gab ich den Teig abgedeckt noch für eine Stunde in den Kühlschrank.
Währenddessen bereitete ich die Füllung vor, die meiner Meinung nach das Beste am Blueberry Pie war. Der Zimt verlieh dem Ganzen eine wunderbar festliche Note, während der süße Ahornsirup einen feinen Karamellgeschmack hervorlockte.
Ich kochte die Beerenmasse auf, bis sie eindickte, und kleidete anschließend die Pie-Form mit der Hälfte des Teigs aus. Dann gab ich die Blaubeerfüllung hinein.
Zu guter Letzt rollte ich die zweite Hälfte des Teigs aus, schnitt sie in dünne Streifen und legte sie als Gittermuster auf den Pie.
Als ich die Backform in den Ofen schob, glich die Küche einem Schlachtfeld, doch der Anblick zauberte mir ein winziges Lächeln ins Gesicht.
Wenn ich mich in der Küche mit Chaos umgab, hatte ich paradoxerweise das Gefühl, etwas Ordnung in mein Leben bringen zu können. In dem Moment war es nur wichtig, den Teig unter meinen Fingern zu spüren und den betörenden Duft zu riechen, der beim Backen durch die Küche strich. Nichts anderes zählte.
Ich pustete mir eine mit Mehl bepuderte Strähne aus der Stirn. Während hinter mir der Ofen leise ratterte, lehnte ich mich mit dem Rücken an die Wand und ließ mich langsam auf den Fußboden gleiten.
Der verlockende Geruch von Blaubeeren, Orangen, Zimt, Ahornsirup und knusprigem Pie-Teig waberte durch den Raum, erfüllte das Haus mit Wärme und Lebendigkeit und weckte alte Kindheitserinnerungen in mir.
Für einen kurzen Moment vergaß ich sogar das Stechen in meiner Brust, das mir permanent vor Augen führte, dass nichts mehr so war wie früher.
3. Kapitel
Am nächsten Morgen fühlte ich mich wie gerädert. Als ich in den Innenspiegel in meinem Kleiderschrank sah, blickte mir lediglich ein Schatten meiner selbst entgegen.
Glanzloses Haar, dunkle Ringe, blasse Augen und fahle Haut. So hätte ich problemlos eine Rolle in The Walking Dead bekommen.
Ich fühlte mich innerlich zerrissen. Als hätte jemand einen Teil von mir mitgenommen.
Und ich würde alles dafür geben, die Zeit zurückdrehen zu können. Meine Entscheidung jener Nacht rückgängig zu machen.
Nachdem ich mich schleppend angezogen hatte, entschied ich mich, einen Abstecher zu Annie’s Bakery zu machen. Annie machte die mit Abstand besten Zimtschnecken, und ich wollte Luke gern ein paar davon in die Klinik mitbringen. Mit dem Blueberry Pie würde ich ihn überraschen, wenn er wieder zu Hause war.
Also schwang ich mich auf mein Rad und fuhr zügig durch den kleinen Ort. Nach wenigen Minuten schob sich am Ende der Samson Mall ein Gebäude mit Backsteinen und Holzelementen in mein Sichtfeld.
Vor dem schnuckeligen Lädchen hatte sich bereits eine beachtliche Menschentraube angesammelt. Kein Wunder, Annies Backkünste waren auch über die Grenzen von Lake Louise hinaus bekannt.
Während ich draußen wartete, schickte ich Luke eine Nachricht.
Ich freue mich so sehr darauf, dass du wieder nach Hause kommst.
Keine halbe Minute später folgte Lukes Antwort.
Ich mich auch, Schwesterherz. Das pappige Klinikessen kann ich langsam echt nicht mehr sehen.
Ich schmunzelte und schob mein Handy zurück in die Hosentasche. Mittlerweile war die Schlange kürzer geworden, und ich betrat die Bäckerei. Ein süßer Duft wehte mir um die Nase.
»Nell!«, begrüßte Annie mich freudig, und ihr Gesicht hellte sich auf. Sie kam hinter ihrer Theke hervor und drückte mich an sich. Ich ließ mich in ihre Umarmung fallen.
Annie schob mich eine Armeslänge von sich und musterte mich eingehend. »Wie geht es dir?«
Zuerst war ich versucht, mich möglichst tough zu geben, doch Annies sorgenvoller Blick genügte, dass mir Tränen in die Augen stiegen. Zurzeit war mir einfach alles zu viel. Auf der einen Seite freute ich mich ungemein, dass Luke endlich nach Hause durfte. Auf der anderen Seite schwirrten die quälenden Fragen durch meinen Kopf, wie es fortan wohl weitergehen und ob Luke wieder ganz gesund werden würde.
»Ach nein, Liebes. Ich kann das gar nicht gut mit ansehen, dass du so unglücklich bist. Heute wird Luke aus der Klinik entlassen, wenn ich mich recht erinnere?«
Ich nickte lediglich, da mich der Kloß in meinem Hals an einer Antwort hinderte.
»Aber das ist doch toll«, sagte Annie. »Er war in den letzten Monaten von hervorragenden Ärzten umgeben. Es wird alles gut werden, Nell.«
»Ich wünsche es mir so sehr«, krächzte ich.
Annie zögerte. »Und wie geht es deinen Eltern mit der Situation?«
»Keine Ahnung, wir reden so gut wie kaum miteinander.«
Annie strich mir mitfühlend über den Arm. »Deine Eltern meinen das nicht böse, Nell. Es ist nur ihre Art, mit dem Unfall umzugehen. Du weißt, dass sie Luke und dich über alles lieben. Für sie war das auch ein großer Schock.«
Ich erwiderte nichts darauf. Eigentlich war es traurig, dass ich mich Annie besser anvertrauen konnte als Mom und Dad.
»Was kann ich dir denn Gutes tun? Wahrscheinlich möchtest du Luke gern etwas in die Klinik mitbringen?«
Ich nickte erneut, dankbar für Annies Ablenkung. »Hast du noch welche von deinen weltbesten Zimtschnecken?«
»Als hätte ich es geahnt, dass du heute vorbeikommst, habe ich eine zusätzliche Ladung in den Ofen geschoben. Sie kühlen gerade noch aus. Warte, ich bin gleich wieder bei dir.«
Annie verschwand hinter einem Vorhang und kehrte kurz darauf mit einer voll befüllten Papiertüte zurück, die sie mir in die Hand drückte.
Ein zimtiger Geruch strömte daraus hervor. In Annies Zimtschnecken könnte ich mich reinlegen! Ich hatte schon ein paarmal versucht, sie nach ihrem Rezept nachzubacken, doch waren sie mir selbst nie so gut gelungen.
»Annie, du bist ein Schatz! Wie viel bekommst du?«
Sie winkte ab. »Geht aufs Haus. Und grüß mir Luke, deine Eltern, Lily und Ben ganz lieb, ja? Ich denk an euch!«
»Das mache ich, Annie. Danke dir! Hab noch einen schönen Tag!«
Schwungvoll drehte ich mich mit meiner Bäckertüte um und wäre fast in jemanden hineingelaufen.
»Nicht so stürmisch«, vernahm ich eine verschmitzt klingende Männerstimme, und als ich meinen Blick nach oben gleiten ließ, traf ich auf Augen, die so dunkel waren, dass sie mich an Obsidiane erinnerten.
Ich schluckte und musterte den attraktiven Fremden. Dunkelbraunes Haar reichte ihm bis zu den Schultern. Über dem weißen T-Shirt trug er eine schwarze, schon etwas abgewetzte Lederjacke. Löchrige Jeans und ausgetretene Sneakers rundeten das Outfit ab.
Ich fragte mich, wie viel er von meinem Gespräch mit Annie mitgehört haben mochte. Scham breitete sich in mir aus. O Gott, hoffentlich hatte ich keinen unfreiwilligen Seelen-Striptease vor dem Kerl hingelegt. Das wäre wirklich peinlich.
Um meine Verlegenheit zu überspielen, fragte ich eine Spur zu ruppig: »Haben Sie keine Augen im Kopf?«
»Tut mir leid«, entgegnete mein Gegenüber, »aber Sie wären doch fast in mich hineingerannt?«
Sein Lächeln wurde breiter, als würde er sich köstlich über mich amüsieren.
»Entschuldigen Sie bitte, ich habe die Klingel vollkommen überhört. Ich glaube, sie ist kaputt«, mischte sich Annie in unsere Unterhaltung ein, als hätte sie Sorge, ich könnte dem Kerl gleich an die Gurgel springen.
Der junge Mann – ich schätzte ihn auf etwa Mitte zwanzig, also höchstens zwei bis drei Jahre älter als ich – schob sich an mir vorbei in Richtung Tresen, während ich wie bestellt und nicht abgeholt dastand und die Situation zu verarbeiten versuchte.
Ich schluckte einen Kommentar herunter und betrachtete ihn möglichst unauffällig aus dem Augenwinkel.
»Was kann ich für Sie tun?«, fragte Annie den Kunden und strahlte ihn an.
»Ich hätte auch gern welche von den Zimtschnecken«, hörte ich den Fremden sagen. Er zwinkerte Annie zu, woraufhin diese förmlich einer Ohnmacht nahe war.
Ich verschränkte die Arme vor der Brust. Der Kerl sollte bloß nicht denken, dass er mich genauso einfach knacken konnte wie Annie. Dazu brauchte es schon etwas mehr als ein freches Zwinkern und schöne Augen.
Doch wieso musste ich direkt wieder an die Farbe von Obsidianen denken?
Nachdem Annie ihm die Zimtschnecken eingepackt hatte, bedankte er sich höflich und verabschiedete sich. Als er Anstalten machte, die Bäckerei zu verlassen, bemerkte er, dass ich noch immer wie angewurzelt im Laden stand. Unsere Blicke verkeilten sich ineinander.
Ein Schauer rieselte meinen Rücken hinab. Seine Lippen deuteten noch einmal ein spöttisches Lächeln an, bevor er schließlich zur Tür hinausging.
Das Einzige, was blieb, war der Geruch von Zimtschnecken und einem herben Aftershave in der Luft.
»Kennst du ihn?«, fragte ich Annie. Obwohl es mich eigentlich nicht interessieren sollte, schlich sich ein neugieriger Unterton in meine Stimme.
Annie schüttelte den Kopf. »Nein, ich habe ihn auch zum ersten Mal hier gesehen.« Sie musterte mich eingehend. »Hübsches Kerlchen, was meinst du?«
Ich brummelte etwas Unverständliches, woraufhin Annie lediglich lachte. Wir verabschiedeten uns abermals voneinander, und ich verließ die Bäckerei.
Während ich zu meinem Fahrrad ging, fiel mir auf, wie mein Blick beiläufig die Umgebung absuchte. Doch von dem Fremden war keine Spur mehr zu sehen.
Nachdenklich schwang ich mich auf mein Rad und konnte nicht verhindern, dass ich auf dem Nachhauseweg hin und wieder an Augen denken musste, die wie dunkle Edelsteine funkelten.
4. Kapitel
»Nell, wo warst du denn?«, empfing Mom mich mit vorwurfsvoller Stimme, kaum dass ich das Lake Louise Chalet Resort erreicht hatte und kurz vor unserem Haus abbremste.
Allem Anschein nach warteten meine Eltern schon auf mich. Sie hatten den SUV bereits aus der Garage gefahren und scharrten regelrecht mit den Hufen.
Ich hielt die braune Papiertüte von Annie in die Höhe. »Ich habe noch Zimtschnecken mitgebracht. Und ich soll Grüße von Annie ausrichten.«
Kurz ließ die Anspannung in Moms Gesicht nach, und ihre Züge wurden weicher. Sie lächelte mich an. »Das ist lieb, danke. Ich habe mich schon viel zu lange nicht mehr bei ihr blicken lassen. Ich sollte sie mal wieder zum Tee einladen. Wenn sie die Backwaren fürs Resort bringt, schaffen wir es immer nur, ein paar Worte zwischen Tür und Angel zu wechseln.«
Dad blickte auf seine Uhr. »Können wir dann los?«
In dem Moment kamen Lily und Ben händchenhaltend die Anhöhe vom Resort zu unserem Haus hinaufgelaufen. Seit sie nach einigen Umwegen endlich zusammengekommen waren, konnten sie kaum die Finger voneinander lassen.
Wenn ich zwei Menschen ihr Glück von Herzen gönnte, dann waren es Lily und Ben. Ich wüsste nicht, was ich in letzter Zeit ohne die beiden gemacht hätte. Sie waren eine bedeutsame Stütze gewesen.
Als die beiden auf gleicher Höhe mit uns waren, grüßten sie meine Eltern freundlich.
Lily nahm mich fest in den Arm. »Kopf hoch«, flüsterte sie an meinem Ohr. »Luke ist stark, und du bist es auch, vergiss das niemals.«
Ich erwiderte die Umarmung. Wieder stiegen mir Tränen in die Augen, doch ich wollte nicht, dass Mom und Dad es sahen.
Schwäche war in der Familie Brown kein Wort, das groß an die Glocke gehängt wurde. Bevor man Gefühle zeigte oder über etwas redete, wurde die Angelegenheit lieber totgeschwiegen. Denn dann existierte sie auch nicht. Zumindest theoretisch.
In der Praxis funktionierte das eher weniger gut. Irgendwann würden all die aufgestauten Gefühle in mir wahrscheinlich explodieren, denn dass es unter der Oberfläche brodelte, konnte ich kaum leugnen.
Als ich mich von Lily gelöst hatte, zog Ben mich an seine warme Brust. »Wir denken an euch.«
»Genau«, bestätigte Lily. »Und Emilia und ich halten die Stellung am Empfang.«
Wir hatten Emilia als zusätzliche Hilfskraft für die Rezeption des Resorts, das unserer Familie gehörte, eingestellt. Zurzeit konnten wir ein bisschen Unterstützung gut gebrauchen, da Lily nach Rücksprache mit meinen Eltern und mir ihre Arbeitsstunden reduziert hatte, um zeitgleich ein Schnupperpraktikum bei der bekannten Fotografin Cynthia White in ihrem Atelier in Banff zu machen.
»Nell, bist du so weit?«, vernahm ich Moms Stimme durch das offene Autofenster. Dad und sie hatten bereits im Wagen Platz genommen.
Nein, ich war ganz und gar nicht so weit.
Doch ich musste jetzt durchhalten.
Für Luke. Für die Familie.
Daher zwang ich mich zu einem Lächeln. Eins, zwei, drei, vier, fünf, zählte ich.
Ein letztes Mal atmete ich langsam aus, bevor ich mich in das Auge des Sturms begab.
5. Kapitel
Caleb
Sollte ich, oder sollte ich nicht? Seit einer geschlagenen Dreiviertelstunde stand ich auf dem Parkplatz des Lake Louise Chalet Resorts und konnte mich nicht dazu durchringen, aus meinem Toyota Corolla auszusteigen. In der Zwischenzeit waren bereits etliche Wanderer an meinem Auto vorbeigekommen und ein grauer SUV mit leicht getönten Scheiben die Anhöhe hinuntergefahren, die zu einem frei stehenden Haus nahe des Resorts führte.
Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, nach Lake Louise zu fahren, die Sache durchzuziehen und wieder in mein Leben nach Calgary zurückzukehren. Doch jedes Mal, wenn ich vor dem Resort stand, um mich endlich meinen Dämonen zu stellen, war ich wie festgefroren und verlor den Mut. Es war ätzend. Drei Tage ging das schon so.
Mittlerweile zog sich die Angelegenheit wie klebriger Kaugummi, weswegen ich mich kurzerhand in ein Bed & Breakfast in Lake Louise eingemietet hatte. Wenn ich allerdings nicht langsam die Eier hatte, mich der Wahrheit zu stellen, dann würde ich vermutlich noch an Weihnachten hier festsitzen.
Immer wieder glitt mein Blick zum Resort. Allmählich wurde es auffällig.
Die Zimtschnecken waren leider keine gute Idee gewesen. Auch wenn sie wirklich köstlich schmeckten, hatten sie meine Bauchschmerzen lediglich verstärkt.
Außerdem musste ich immer wieder an die kratzbürstige Schönheit aus der Bäckerei denken, was ich jetzt wirklich nicht gebrauchen konnte. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass ich sie irgendwo schon einmal gesehen hatte. Aber möglicherweise täuschte ich mich auch.
Mir kam der Gedanke, dass ich mich vielleicht nicht so großspurig hätte verhalten sollen, doch Coolness war immer noch die beste Taktik, um zu überspielen, wie beschissen man sich eigentlich fühlte.
Wieder schweifte mein Blick zum Chalet Resort hinüber.
Reiß dich verdammt noch mal zusammen, Caleb Barnett!
Mit diesem inneren Mantra stieg ich nach einer gefühlten Ewigkeit aus dem Wagen, schlug die Tür hinter mir zu und folgte dem Weg Richtung Haupthaus.
Als ich den Eingangsbereich betrat, stand eine blonde Frau am Empfangstresen. Bis auf einen älteren Herrn, der es sich in einem der Sessel links vom Empfang gemütlich gemacht hatte, war die Lobby leer.
Meine Hände waren schwitzig, und mein Herz hämmerte lautstark gegen die Rippen.
Zögerlich näherte ich mich der Rezeption. Ich hatte den Eindruck, dass mir der Schweiß vor lauter Anspannung aus allen Poren kroch. Wahrscheinlich hatte mein Deo schon längst den Geist aufgegeben.
Nervös schielte ich in Richtung Tür. Noch hatte mich die Mitarbeiterin des Resorts nicht bemerkt. Ich könnte …
»Kann ich Ihnen behilflich sein?«, riss mich eine weiche Stimme aus meinen Gedanken, und ich blickte geradewegs in zwei hellblaue Augen.
Ich schätzte die Rezeptionistin auf etwa achtzehn oder neunzehn Jahre. Sie hatte einen süßen Akzent, und auf ihrem Namensschild stand Emilia Silbernagl. Ich vermutete, dass sie aus der Schweiz oder Österreich kam. Dafür sprach auch ihr Trachtenschmuck. Um den Hals trug sie eine Kette mit einem Edelweißanhänger, und in ihr langes blondes Haar, das ihr fast bis zu den Hüften reichte, waren Blüten eingeflochten. Freundlich sah sie mich an.
Okay, eine Flucht hatte sich demnach erübrigt. Dann hieß es wohl Angriff.
»Ich, also …« Ich atmete tief durch. »Ist es möglich, Luke Brown zu sprechen? Oder seine Eltern?«
Die Hotelmitarbeiterin schüttelte bedauernd den Kopf. »Leider sind die Browns gerade nicht da.«
Es fühlte sich an, als würde ich kurz vorm Ziel an einer Mauer abprallen. Mit dieser Antwort hatte ich nicht gerechnet.
In den letzten Tagen hatte ich zig Szenarien in meinem Kopf durchgespielt, dieses gehörte allerdings nicht dazu.
»Wissen Sie, wann die Browns wieder da sein werden?«, hakte ich nach. Meine Anspannung wuchs.
»Das kann ich leider nicht so genau sagen. Die Browns holen ihren Sohn aus der Klinik in Calgary ab, es wird also sicherlich etwas dauern.«
Prompt schlug sie sich die Hand vor den Mund, als wäre ihr versehentlich eine streng geheime Info rausgerutscht.
»Warum rede ich nur immer so viel? Entschuldigung. Wissen Sie, es ist erst meine zweite Woche im Resort, und wenn ich nervös bin, dann beginne ich zu plappern.«
Obwohl meine Gedanken nur um das kreisten, was die junge Frau mir gerade anvertraut hatte, versuchte ich, mich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Da ich nicht unhöflich oder desinteressiert erscheinen wollte, fragte ich: »Wo kommen Sie denn her?«
»Aus Südtirol. Aus dem wunderschönen Ort Kastelruth.«
Aha, dann war sie also doch nicht aus der Schweiz oder Österreich, sondern aus Italien.
»Waren Sie schon einmal dort? Wenn nicht, kann ich es Ihnen nur empfehlen.« Emilia strahlte über das ganze Gesicht. »Es gibt nirgendwo besseren Kaiserschmarrn als bei uns. Bevor ich den Hof meiner Eltern übernehme, wollte ich jedoch unbedingt einmal nach Kanada. Ich bleibe drei Monate hier.«
Während Emilia weiter munter vor sich hinplapperte, von den Dolomiten, dem Bauernhof und den Ferienwohnungen ihrer Eltern erzählte, drifteten meine Gedanken erneut ab.
Immer wieder spulte dieser eine Satz in Dauerschleife durch meinen Kopf: Die Browns holen ihren Sohn aus der Klinik in Calgary ab.
Mir wurde flau im Magen. Ich hatte wirklich den schlechtesten Zeitpunkt abgepasst.
Ich merkte, wie mein Mut mit jeder weiteren Sekunde schwand.
Wahrscheinlich entging auch Emilia nicht, dass ich etwas abwesend und desillusioniert wirkte, denn sie hielt in ihrem Redefluss inne und musterte mich.
»Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Soll ich der Familie Brown vielleicht etwas ausrichten?«, drang ihre Stimme dumpf an mein Ohr.
Wie ferngesteuert schüttelte ich den Kopf. »Nein … oder doch. Könnten Sie mich vielleicht anrufen, wenn die Browns wieder zu Hause sind?«
Emilia nickte. »Selbstverständlich.« Sie notierte sich meine Handynummer.
Vorsorglich schob ich ihr auch die Visitenkarte des B & B zu. »Ich bin derzeit im Bed & Breakfast von Margie Smith in Lake Louise untergebracht. Unter ihrer Nummer bin ich auch gut zu erreichen.«
Emilia legte die Visitenkarte beiseite und sah mich an. »Wie ist denn Ihr Name?«
»Barnett. Caleb Barnett«, sagte ich.
Emilia strahlte mich abermals an. »Gut, Caleb. Ich werde ausrichten, dass Sie hier waren.«
Ich bedankte mich bei Emilia, wünschte ihr noch einen schönen Tag und verließ die Rezeption.
Draußen auf der Veranda verschränkte ich die Hände im Nacken und stieß einen leisen Fluch aus. Es sah ganz danach aus, als müsste ich meinen Aufenthalt hier in Lake Louise noch verlängern.
Scheiße.
6. Kapitel
Die Autofahrt verlief wortkarg.
Dad hatte den Blick auf den Straßenverkehr vor sich gerichtet. Mom trug eine Sonnenbrille, was lächerlich war, da die Sonne heute nicht einmal schien. Auch die Perlenkette um ihren Hals wirkte deplatziert.
Die Stille zwischen uns war ohrenbetäubend. Am liebsten hätte ich geschrien oder meine Eltern durchgerüttelt, um ihnen wenigstens irgendeine Reaktion zu entlocken.
Doch stattdessen presste ich meine Lippen zu einer schroffen Linie zusammen, knetete meine Hände und starrte in die Landschaft, die in schnellen Bildern an mir vorbeiflog.
Nachdem wir Calgary nach knapp zwei Stunden Autofahrt erreicht hatten, bog Dad irgendwann auf einen großen Parkplatz ab, an den ein hässlicher weißer Klotz grenzte.
So oft hatte ich Luke hier in den vergangenen Wochen besucht, doch auch jetzt löste der Gebäudekomplex Unbehagen in mir aus.
Schweigend überquerten wir den Parkplatz. Mom machte noch immer keine Anstalten, ihre überdimensionale Sonnenbrille abzunehmen.
Am Empfang wurden wir darüber informiert, dass Luke sich aufgrund des bevorstehenden Entlassungsgesprächs bereits in einem der Sprechzimmer befand.
Eine Krankenschwester zeigte uns den Weg, blieb schließlich vor einer schlichten weißen Tür stehen und dirigierte uns in das Zimmer.
»Luke!«, kam es über meine Lippen, kaum dass ich meinen Bruder sah. Bei dem Unfall war sein Rückenmark verletzt worden, und es hatte Wochen gedauert, bis wenigstens etwas Gefühl in seine Beine zurückgekehrt war.
Der Anblick schnürte mir die Kehle zu. Selbst nach all den Monaten, die seit dem Unfall vergangen waren, war ich immer noch tief betroffen, Luke im Rollstuhl sitzend zu sehen. Neben ihm lagen seine gepackte Reisetasche und ein Rucksack.
Die Krankenschwester schloss leise die Tür hinter uns. Ich ging auf meinen Bruder zu und zog ihn in eine Umarmung.
»Nell, schön, dass du da bist«, murmelte Luke dicht an meinem Haar, und ich vergrub das Gesicht an seiner Halsbeuge. Seine blonden Bartstoppeln kratzten an meiner Wange.
»Ich hab dich vermisst«, sagte ich. Der vertraute Geruch von Lukes Shampoo drang mir in die Nase, und für einen kurzen Augenblick wurde ich etwas ruhiger.
Als wir uns voneinander lösten, drückte ich Luke die Papiertüte aus der Bäckerei in die Hand. »Ich hab dir Zimtschnecken von Annie mitgebracht.«
Luke öffnete die Tüte und schnupperte daran. »Hmmh, die haben mir echt gefehlt. Danke, Nell.«
Lukes Lippen kräuselten sich zu einem Lächeln, doch es erreichte seine blauen Augen nicht. Als hätte sich ein Schleier über sie gelegt, der die Welt ein wenig blasser und farbloser erscheinen ließ.
Befangen nahm Mom ihre Sonnenbrille von der Nase, ihre Hände zitterten.
»Hallo, mein Schatz«, begrüßte sie Luke mit einem Zögern in der Stimme, und die beiden umarmten einander ebenfalls.
»Luke, mein Großer, wie fühlst du dich?«, erkundigte sich Dad unbeholfen und klopfte Luke auf die Schulter.
Er blieb ihm eine Antwort schuldig, denn in dem Augenblick wurde die Tür geöffnet. Dr. Ryan Tremblay, ein Arzt mit sonnengebräunter Haut, dunklem Haar und jeweils einem schwarzen Stecker im Ohr betrat das Zimmer. Erneut war ich überrascht, dass er so jung wirkte, und hatte mich schon mehr als einmal gefragt, wie alt er wohl sein mochte. Vielleicht achtundzwanzig?
Mom, Dad und ich hatten Dr. Tremblay bereits am ersten Tag von Lukes Reha kennengelernt. Seitdem hatte er meinen Bruder über die gesamte Therapie hinweg begleitet.
Der weiße Kittel flatterte um seine Beine, als er sich schwungvoll auf dem Drehstuhl uns gegenüber niederließ.
Er lächelte und reichte meinen Eltern, Luke und mir die Hand. »Mr und Mrs Brown, Luke, Nell«, er ließ seinen Blick von einem zum nächsten gleiten und nickte uns zu. »Bitte setzen Sie sich doch.«
Als wir auf den Stühlen gegenüber von Dr. Tremblay Platz nahmen, wurde ich das Gefühl nicht los, dass mir der Arzt ein wenig länger in die Augen sah als unbedingt notwendig.
Auch Luke war das nicht entgangen. Als Ryan Tremblay abwesend die Unterlagen auf seinem Tisch durchblätterte, nutzte Luke die Gelegenheit, um mir mit dem Ellenbogen sanft in die Rippen zu stoßen. Er grinste breit.
Ich verdrehte die Augen.
Als der Arzt wieder aufsah, setzte Luke eine Miene auf, als könnte er kein Wässerchen trüben.
Dann kehrte erneut Stille ein, und eine unangenehme Anspannung breitete sich im Zimmer aus. Mein Blick fiel auf die Uhr an der Wand mir gegenüber. Die Zeiger tickten unnatürlich laut in meinen Ohren und machten mich nervös. Das ganze Zimmer war so grässlich weiß und steril.
»Also …« Der Arzt verschränkte seine Finger ineinander und sah uns wieder der Reihe nach an. Seine Miene war unbewegt, aber seine Kiefermuskulatur war angespannt. Der Knoten in meinem Bauch wurde immer größer. Ob er solche unangenehmen Gespräche noch nicht oft geführt hatte?
»Ryan, nun sag schon, was los ist«, entfuhr es Luke genervt, und Mom sog zischend die Luft ein. »Werde ich wieder laufen können, ja oder nein?«