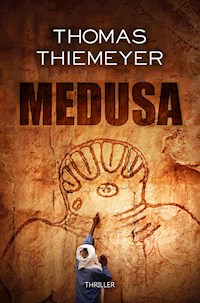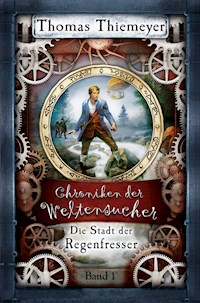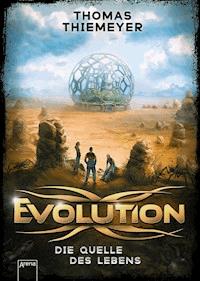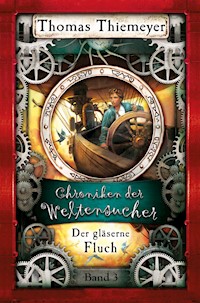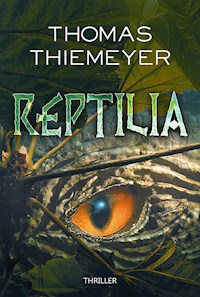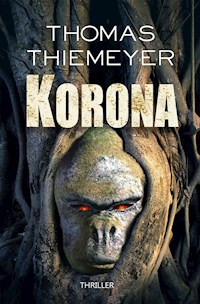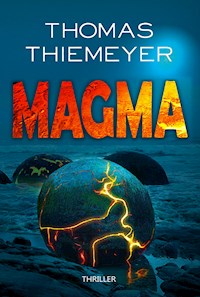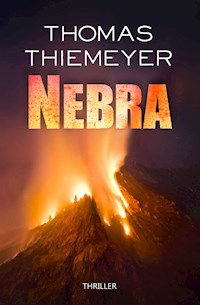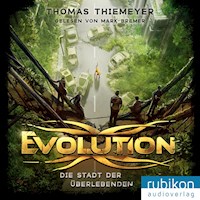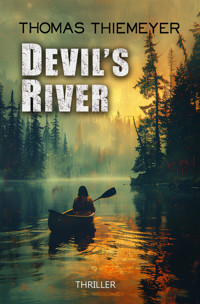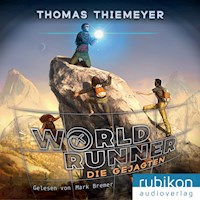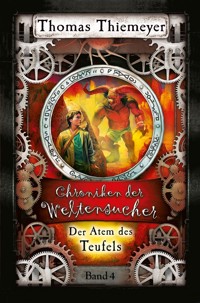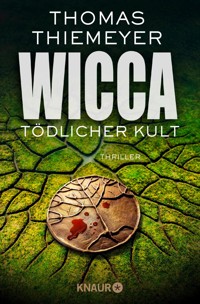
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Hannah Peters
- Sprache: Deutsch
Hollywoodreife Action trifft uralte Mythen – perfektes Lesefutter für alle Fans von Science-Thrillern mit mystischem Touch: Archäologin Hannah Peters wird von einer Freundin um Hilfe gebeten: Leslie Rickert ist einem uralten Hexen-Kult auf der Spur, der für das Verschwinden mehrerer Jugendlicher verantwortlich sein könnte. Ihre Recherchen führen die beiden Frauen über die berühmte Felsenstadt Petra in Jordanien und die dort wurzelnde Sage vom Baum des Lebens bis an die Küste Südenglands, wo vor Jahrhunderten ein Samen jenes mythischen Baumes gepflanzt worden sein soll. Hannah und Leslie können nicht ahnen, dass nicht nur die Anhängers des Wicca-Kultes über Leichen gehen würden, um ihr Geheimnis zu wahren - sondern auch ein Wesen, für das die Wissenschaft nicht einmal einen Namen hat. Bestseller-Autor Thomas Thiemeyer legt seinen neuen Thriller mit Hannah Peters vor, eine gnadenlos spannende Mischung aus Fakten, Mythen, Action und Abenteuer. Entdecken Sie auch die anderen Abenteuer-Romane um Archäologin Hannah Peters: - »Nebra« - »Valhalla« - »Babylon«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 583
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Thomas Thiemeyer
Wicca – Tödlicher Kult
Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Archäologin Hannah Peters wird von einer Freundin um Hilfe gebeten: Leslie Rickert ist einem uralten Hexen-Kult auf der Spur, der für das Verschwinden mehrerer Jugendlicher verantwortlich sein könnte. Ihre Recherchen führen die beiden Frauen über die berühmte Felsenstadt Petra in Jordanien und die dort wurzelnde Sage vom Baum des Lebens bis an die Küste Südenglands, wo vor Jahrhunderten ein Samen jenes mythischen Baumes gepflanzt worden sein soll.
Hannah und Leslie können nicht ahnen, dass nicht nur die Anhänger des Wicca-Kultes über Leichen gehen würden, um ihr Geheimnis zu wahren – sondern auch ein Wesen, für das die Wissenschaft nicht einmal einen Namen hat …
Inhaltsübersicht
Teil 1
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
Teil 2
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
Teil 3
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
Quellen
»Gott, der Herr, ließ aus dem Ackerboden allerlei Bäume wachsen. Verlockend anzusehen und mit köstlichen Früchten. In der Mitte des Gartens aber den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse.«
Genesis 2,9
»Dieser Film ist wie ein Baum. Du kannst ihn abhacken, aber das treibt ihn nur zu noch mehr Wachstum an.«
Anthony Shaffer, Verfasser von Theaterstücken und Drehbuchautor von »The Wicker Man«
Teil 1
Der Tag der Geburt
Prolog
Straße von Gibraltar, 117 nach Christus …
Das römische Handelsschiff pflügte durch die See wie eine betrunkene Schankmagd. Es rollte, schlingerte und legte sich dabei bedenklich zur Seite. Gischt spritzte über die Reling, landete auf dem Deck und floss schäumend und gurgelnd durch die Spundlöcher wieder ab. Der Wind, der von achtern über sie hinwegpeitschte, hatte die Corbita auf einen Kurs geschickt, der geradewegs auf die hochgepeitschten Wogen des Atlantiks zielte.
Die Aurora erzitterte unter dem Ansturm der Elemente. Unablässig krachten die Brecher gegen die Außenwände. Donner rollte über den Himmel, brach sich an den Wellen, betäubte die Ohren. Vereinzelt zuckten Blitze auf, die die Wolken von innen heraus zum Glühen brachten.
Präfekt Claudius Metellus hielt den Mast umklammert. Salz brannte in seinen Augen. Auf seiner Zunge lag der Geschmack von Meerwasser. Ein Unwetter wie dieses hatte er noch nicht erlebt, weder an Land noch auf hoher See. Es war, als habe die Unterwelt ihre Pforten geöffnet und drohe alles zu verschlingen.
Der Senatsbeauftragte für die südlichen Provinzen Britannias starrte nach vorn in die aufgewühlte See. Jenseits des Bugspriets hatte das Wasser eine ungesunde Farbe angenommen. Waren die Wogen des Mare Internum noch grau gewesen, schimmerte der Oceanus Atlanticus in den Farben von Erbrochenem.
Schwefelgelbe Wolken rasten über den Himmel. Der Wind war erfüllt vom Geschrei der Furien. Kreischend zerrten sie an der Takelage, peitschten die Taue und ließen die hölzernen Blöcke wie Tischlerwerkzeuge gegeneinanderschlagen.
Vor ihnen rückte die Meerenge unaufhaltsam auf sie zu. Hin und wieder rissen die Wolken auf und erlaubten einen Blick auf die turmhohen Felsen von Gibraltar. Claudius Metellus schaute in das Gesicht des wettergegerbten Kapitäns und wusste, dass sie in Schwierigkeiten waren. Aber warum wendete er nicht? Warum ließ er keine geschützte Bucht ansteuern? Dies war ein Handelsschiff, keine Trireme. Dreißig Meter lang und zehn Meter breit, eine Nussschale angesichts der Gewalten, die auf sie einstürmten.
Schreie drangen an sein Ohr. Er meinte zu hören, dass es unter Deck zu Wassereinbrüchen gekommen war.
Hieß das, sie sanken?
»Kapitän, wir müssen abbrechen, es hat keinen Sinn«, brüllte er gegen den Sturm. »Geben Sie Befehl, das Schiff in sichere Gewässer zu manövrieren, hören Sie? Ich zahle für diesen Transport. Ich verlange von Ihnen, dass Sie tun, was ich sage.«
»Abbrechen? Wie stellen Sie sich das vor?«
»Keine Ahnung, Sie sind der Kapitän. Wenden und Land ansteuern, würde ich sagen.«
Der Grieche schüttelte den Kopf. »Dafür ist es zu spät. Uns bleibt nichts anderes übrig, als den Kurs zu halten und die Meerenge zu passieren. Beten Sie zu Ihren Göttern, dass es dahinter besser wird.«
»Die Wogen werden uns zerschmettern«, erwiderte Claudius. »Wir werden sterben, wenn wir nicht schleunigst anlanden.«
»Sie sind kein Seemann, Sie können das nicht wissen. Wenn wir uns jetzt quer zum Wind stellen, werden wir kentern. Sehen Sie sich die Wellen an. Die Farbe dieses Wassers. Schauen Sie, wie die Gischt sich an den Wellenkämmen bricht. Das bedeutet, dass der Wind weiter zunehmen wird.« Er deutete in die giftig grünen Wogen. »Sehen Sie diese Wellen? Die maximal vertretbare Höhe für eine Halse beträgt zehn Fuß. Diese Brecher sind fünfzehn hoch. Und sie werden höher. Hinzu kommt der Wind. Sollten wir Pech haben und einen Wellenkamm erwischen, kippen wir unweigerlich um. Unser Glück ist der geringe Ballast im Kielraum. Er lässt uns weit oben schwimmen. Andere Schiffe wären längst vollgelaufen. Der Nachteil ist, dass das Schiff schneller kentert, wenn es von einer Böe erfasst wird. Selbst wenn wir die Segel reffen würden, böte das keine Garantie. Also bleibt nur, den Kurs zu halten und sich vom Wind durch die Gefahrenzone peitschen zu lassen.«
»Dann können wir nichts tun?«
»Doch«, schrie der Kapitän. »Beten. Zu Ihren Göttern, Ihren Ahnen, wem auch immer. Vielleicht könnte ja auch dieses besondere Frachtgut helfen, das Sie mit an Bord gebracht haben. Ich hörte, es besäße wundersame Kräfte. Vielleicht ist es an der Zeit für etwas Magie.«
Wieder zuckte ein Blitz auf. Gerade stieg ein Brecher über die Reling, landete mit einem Krachen auf dem Oberdeck und spritzte Gischt in alle Richtungen. Weiße Schlieren zogen über die Planken, machten das Holz rutschig.
Claudius löste die Hände vom Mast. Die Worte des Kapitäns hatten seinen Entschluss bekräftigt. Es führte kein Weg daran vorbei.
Als der Kapitän ihn ansah, schüttelte er den Kopf. »Halten Sie sich gefälligst fest, Präfekt, Sie werden sonst noch über Bord gespült.«
Claudius beachtete ihn nicht. Er mochte kein junger Mann mehr sein, er war aber durchtrainiert genug, um das zu tun, was getan werden musste. Die zehn Jahre bei den Prätorianern, den Elitetruppen des Kaisers, hatten ihre Spuren hinterlassen. Dort hatte er gelernt, wie man überlebte. Mochte seine Arbeit sich inzwischen vornehmlich an Schreibtischen abspielen, so wusste er doch um den Wert eines regelmäßigen Trainings. Ausdauer- und Kampfsport. Wöchentlich fünf bis sechs Stunden Minimum. Der Umgang mit der Waffe hielt seinen Körper straff und den Geist wach.
Ein neuer Brecher kam über den Bug geschossen und flutete das Oberdeck. Claudius hechtete mit drei großen Schritten in Richtung Reling und klammerte sich dort fest.
Brüllende und gurgelnde Wassermassen schossen über die Planken und rissen ihm die Füße unter dem Leib weg. Im letzten Moment gelang es ihm, eines der Taue zu packen und sich festzuhalten. Er schlang es um seinen Unterarm und wartete den Ansturm der Elemente ab. Die Aurora sackte mit dem Bug nach unten und beruhigte sich. Das war der Augenblick, auf den er gewartet hatte.
»Kommen Sie, Kapitän. Ich brauche Sie unter Deck.«
Der Grieche sah ihn verständnislos an. »Was wollen Sie denn da?«
»Ich will, dass Sie mich begleiten. Schnell, wir haben nur wenig Zeit bis zur nächsten Welle.«
Heftiges Kopfschütteln. »Ausgeschlossen! Ich kann meinen Posten nicht verlassen.«
»Es sind nur ein paar Minuten. Sie werden bald wieder hier oben sein. Ich bestehe darauf!«
Der Kapitän schien mit sich zu ringen. Dann brüllte er seinem Steuermann einen Befehl zu und verließ seinen Posten.
»Wehe, es ist nicht wichtig«, schrie er.
»Ich kann die Entscheidung nicht allein treffen.«
»Welche Entscheidung?«
»Die Frage, auf welches Ihrer Besatzungsmitglieder wir am ehesten verzichten können.«
Der Kielraum stand eine Handbreit unter Wasser. Claudius Metellus watete durch die schwappende Brühe auf ein riesiges, hochkant stehendes Fass zu. Es hatte früher mal zweitausend Liter Wein enthalten. Der Deckel war entfernt worden und der bauchige Leib bis zum Rand mit Erde gefüllt. Dutzende von Ölfeuern spendeten gleichmäßiges Licht.
Zuerst hatte der Kapitän Einwände gehabt wegen der offenen Flammen, doch nachdem Claudius ihm versichert hatte, die besten und zuverlässigsten Lampen zu verwenden, hatte er nachgegeben. Wahrscheinlich hatte der fürstliche Aufschlag, den Claudius zu zahlen bereit war, den Ausschlag gegeben. Jedenfalls war das Fass jetzt an Bord, und Claudius würde alles tun, um es vor dem Untergang zu bewahren – selbst um den Preis eines Menschenlebens.
Sorgenvoll blickte er auf das Wasser, das stetig von der Decke tropfte. Die Lampen durften nicht ausgehen, das hatte er den Matrosen eingeschärft. Deswegen wurden sie ständig überwacht. Öl musste nachgefüllt werden, Dochte gereinigt und die verspiegelten Aufsätze geputzt. Im Kielraum herrschte beständige Helligkeit. Zumindest in der Theorie. Doch als sie runterkamen, brannte nur noch eine Lampe. Der Junge, der dafür zuständig war, lag in seiner Hängematte und schlief wie ein Stein. So tief war er in seinen Traum gesunken, dass er nicht mal den Sturm bemerkt hatte.
Claudius entzündete die Lampen neu, justierte hie und da einen der Reflektoren und presste die Lippen zusammen. Verdammte Schlamperei! Er versetzte dem Jungen einen Hieb. »Aufwachen, du Tölpel. Was fällt dir ein, einzuschlafen?«
Der Junge zuckte empor und starrte ihn mit weit aufgerissenen Augen an. Der Kapitän versetzte ihm einen zusätzlichen Tritt, der ihn endgültig aus der Hängematte schleuderte.
Wie ein getretener Hund fiel der dunkelhäutige Knabe vor ihnen auf die Knie und brabbelte in einer Sprache, die Claudius nicht verstand.
»Du sollst dich um die Lampen kümmern«, brüllte der Kapitän. »Ich habe dir schon hundertmal gesagt, dass du während der Arbeit nicht schlafen darfst.« Er wiederholte den Satz in der Sprache des Knaben.
Der Junge sprang auf, spurtete los und begann sofort damit, die Lampen zu kontrollieren.
»Bitte entschuldigt, Präfekt«, sagte der Kapitän. »Das hätte nicht passieren dürfen. Ich habe ihm extra eingeschärft, seine Pflichten nicht zu vernachlässigen. Aber diese Nordafrikaner neigen zum Müßiggang. Ständig muss man hinter ihnen her sein. Ich könnte Ihnen Geschichten erzählen, bei denen Sie aus dem Kopfschütteln nicht mehr rauskämen. Es gab da mal einen Fall, bei dem ich …«
»Schweigen Sie!« Claudius wandte sich seinem Heiligtum zu. Das Fass beherbergte den größten Schatz, den er besaß. Kein Silber, kein Gold oder Edelsteine. Stattdessen eine Pflanze, genauer gesagt, ein Baum.
Er war nicht groß, nur einen guten Meter hoch, aber er verbreitete eine Aura, die mit Worten schwer zu fassen war. Claudius glaubte, den betörenden Duft von Weihrauch und Myrrhe wahrzunehmen. Auch schien der Baum das Tosen des Sturms zu unterdrücken. Stattdessen wurde der Kielraum von leisem Klingeln erfüllt, das sich anhörte, als würden Hunderte winziger Metallplättchen gegeneinanderschlagen.
Er wusste nicht, ob das Geräusch eine Einbildung war oder ob der Baum tatsächlich solche Laute von sich gab. Dass er sie vernahm, war unbestritten. Jeder, der diesen Baum gesehen hatte, konnte bestätigen, dass die Laute zu hören waren. Und doch – wenn man später bei einem Glas Wein beisammensaß, war den meisten, als hätten sie sich den Duft und den Klang bloß eingebildet. Als wären sie nur eine Erinnerung oder ein Traum.
Der Stamm ähnelte dem einer alten Olive. Knorrig, hager und krumm. Wie der Leib eines alten Mannes, aber mit glatter, silberheller Haut. Der Setzling war gerade mal ein Jahr alt. Er wuchs ungeheuer schnell. Die Rinde schimmerte wie eine Rüstung. Er kam aus einem fernen Reich im Osten, aus einer Gegend, in die noch kein Römer jemals seinen Fuß gesetzt hatte. Die Rinde war an vielen Stellen aufgeplatzt und erlaubte einen Blick auf die tiefer liegenden Schichten. Dort schimmerte das junge Holz in tiefem, blutigem Rot.
Claudius bemerkte, dass sich ein kleines Stück der Rinde zu lösen begann. Er brach es ab, steckte es in den Mund und begann, darauf zu kauen. Es schmeckte bitter. Ein Schauer lief ihm über den Rücken. Was er zu tun gedachte, bereitete ihm keine Freude.
»Kapitän.«
»Ja?«
»Worüber wir sprachen …«
»…«
»Ich sagte Ihnen, dass es geschehen könnte. Ich hatte Sie vorgewarnt, und Sie versicherten mir, es stelle kein Problem dar.«
»Da wusste ich ja nicht, was Sie damit meinten. Um ehrlich zu sein, hielt ich es für einen Scherz.«
»Einen Scherz? Sehe ich aus, als würde ich scherzen?«
Im Blick des Griechen lag eine Mischung aus Wut und Verzweiflung.
»Die Sache muss erledigt werden, und zwar schnell«, drang Claudius auf den Mann ein. »Ehe dieser verdammte Kahn in hunderttausend Teile zerbricht.«
»Ich verstehe nicht«, stammelte der Kapitän. »Wie könnte ein solches Opfer irgendetwas bewirken? Dies ist doch ein gewöhnlicher Baum.«
»Hören Sie auf zu lamentieren, und sagen Sie mir endlich, für wen Sie sich entschieden haben. Und tun Sie nicht so, als glaubten Sie, dass dies ein gewöhnlicher Baum sei. Sie wissen, welche Kräfte er besitzt. Ich habe Sie beobachtet, wie Sie um ihn herumgeschlichen sind, wie Sie ihn berührt und mit ihm geredet haben.«
»Wegen der Legenden …«
»Wegen der Legenden, genau. Und weil Sie wissen, dass sie der Wahrheit entsprechen. Ich bin der Hüter des Baumes. Wählen Sie ein Opfer, oder es wird Ihr Blut sein, das diese Erde benetzt.« Der Knauf seines Dolches, in Form einer gewundenen Schlange, fühlte sich an, als wäre er lebendig.
Der Kapitän erbleichte. »Bei den Göttern. Gibt es keinen anderen Weg?«
Claudius schüttelte den Kopf. »Beten, haben Sie gesagt. Das hier ist wirkungsvoller. Also, was ist? Ich bin bereit, noch einen Aureus draufzulegen, damit Ihnen die Entscheidung leichter fällt.«
Die Augen des Kapitäns wurden schmaler. »Zehn …«
»Fünf.«
»So sei es.«
»Dann beeilen Sie sich, Mann. Wen können Sie entbehren?«
Der Kapitän schluckte, dann deutete er auf den Knaben.
Claudius drehte den Kopf. Der Junge hockte wie ein verschrecktes Reh im hinteren Teil des Kielraumes. Er schien nicht zu verstehen, worüber geredet wurde. Zum Glück. Vermutlich wäre er sonst schreiend davongerannt. Claudius spürte ein kaltes Zerren in seinen Eingeweiden. Ein Kind hatte er bisher noch nicht geopfert. Bettler, Dirnen, Sklaven, ja. Aber einen Knaben? Andererseits war ihre Lage prekär. Und drastische Situationen erforderten nun mal drastische Maßnahmen. »Sind Sie sicher, dass Sie keinen anderen entbehren können? Einen Alten oder Kranken?«
Der Grieche schüttelte den Kopf. »Die Mannschaft segelt seit Jahren zusammen. Wenn ich einen von ihnen nehme, verliere ich ihr Vertrauen. Im schlimmsten Fall kommt es zur Meuterei. Ihn habe ich aus Mitleid mitgenommen. Wegen seiner Mutter …«
Claudius verzichtete auf weitere Informationen. Es war nicht gut, allzu viel über die Opfer zu wissen. Wenn der Kapitän der Meinung war, er könne auf ihn verzichten, war das seine Entscheidung. Das flaue Gefühl blieb.
Claudius musste sich zwingen, daran zu denken, dass der Junge sein Schicksal selbst bestimmt hatte. Seine Fahrlässigkeit war ihm zum Verhängnis geworden. Zu was war ein Schiffsjunge nütze, der seine Aufgaben nicht bewältigte und stattdessen schlief? Der Gedanke, dass der Knabe mit seinem Leben das aller anderen zu retten vermochte, war das einzig Tröstliche in dieser Situation.
»Gut«, sagte Claudius, doch seine Stimme klang rau und heiser. Er hatte einen Kloß im Hals, der nicht verschwinden wollte. »Bringen Sie ihn her zu mir.«
Der Kapitän ging zu dem Knaben hinüber, packte ihn am Arm und zerrte ihn hinter sich her. Claudius versuchte, die weit aufgerissenen Augen und das angstvolle Stöhnen auszublenden. »Gut so«, sagte er. »Hierher ans Fass. Richten Sie seine Aufmerksamkeit auf den Baum. Lassen Sie ihn die Rinde berühren.«
Der Kapitän sagte etwas in der unbekannten Sprache des Jungen und deutete auf die Pflanze. Heftiges Kopfschütteln war die Antwort. Der Kapitän gab ihm einen Klaps und wiederholte seine Aufforderung.
Widerwillig und unter Zögern befolgte der Junge die Anweisung. Er streckte den Arm aus und näherte sich mit den Fingerspitzen den Blättern. Ein leises Klingeln ertönte.
Die Züge des Jungen entspannten sich. Verwunderung löste die Furcht ab. Die Angst wich aus seinem Gesicht, und er wurde zutraulicher. Er spürte, dass er vor dem Baum nichts zu befürchten hatte. Als einer der Äste sanft seine Haut streichelte, lächelte er. Das war der Moment, auf den Claudius gewartet hatte. Mit einer schnellen Bewegung trat er hinter den Knaben, legte die Hand auf dessen Stirn und bog den Kopf nach hinten. Die Klinge funkelte wie flüssiges Gold.
1
Heute …
Die Luft war zum Schneiden dick. Noch etwas dicker, und man hätte sie aufs Brot schmieren können. Wasser tropfte von den Blättern der langstieligen Epiphyten und platschte auf den regendurchweichten Boden. Meterlange Lianen tasteten wie Finger durch die Schwaden. Der Boden war knöcheltief mit abgestorbenen Blättern und Rindenstücken bedeckt. An schmalen Stellen wurde der Weg von Tümpeln und Rinnsalen versperrt, denen man besser auswich. Nicht, weil man sich dort nasse Füße holte, sondern weil die fingerdicken Blutegel, die hier hausten, nur darauf warteten, dass ein unvorsichtiger Wanderer seinen Fuß in ihr Revier setzte. Das Blätterdach war erfüllt von den Rufen tropischer Vögel, von denen es hier, im Südosten von Honduras, nur so wimmelte.
Der Schacht war schmal. Nicht mal einen Meter breit. Was sie dort unten erwartete, ließ sich schwer abschätzen. Sie hatte drei Leuchtstäbe hineinfallen lassen, doch die warfen mehr Fragen auf, als sie beantworteten. Blieb nur ein Weg, um wirklich sicherzugehen.
Hannah wischte den Schweiß von ihrer Stirn. Dutzende toter Zirbelmücken klebten auf ihrer Haut. Ein Teppich winziger Leichen, der zu dicht war, um ihn vollständig zu entfernen.
»Ich denke, wir müssen da runter«, sagte sie. »Wir müssen uns die Antworten vor Ort holen, ehe andere sie uns vor der Nase wegschnappen.«
»Willst du denn nicht lieber warten?« Enrique sah sie mit großen Augen an. Er war fünfundzwanzig Jahre, Student der Archäologie und seit zwei Wochen Hannahs Assistent. Ein netter Bursche, wenn auch zuweilen etwas obrigkeitshörig. Die Angst, wegen irgendeines Verstoßes einen Rüffel zu kassieren, war größer als sein Jagdfieber. Das musste anders werden, wenn er ein Vollblutarchäologe wie Hannah werden wollte.
Faktisch war sie im Camp diejenige mit den meisten Jahren aktiver Feldforschung auf dem Buckel. Und mit den meisten Entdeckungen – auch wenn viele davon nie bekannt geworden waren. Der Kreis, der um ihre Erfolge wusste, war klein, aber erlaucht. Einzelpersonen gehörten dazu, hin und wieder auch staatliche Sicherheitsorgane und Geheimdienste. Aber weder hatte National Geographic über das Valhalla-Projekt auf Spitzbergen berichtet, noch war jemals ihre Erkundungstour zum Medusenkult im Niger bekannt geworden. Es gab keine Berichte über die Zerstörung der Himmelsscheibe von Nebra oder die Erforschung des Turmbaus zu Babel. Alle diese Projekte waren im Nachhinein von Hannahs Auftraggebern als topsecret klassifiziert worden. Vermutlich, weil man bei Stromberg Enterprises der Meinung war, dass die Schlussfolgerungen zu beunruhigend wären, als dass sie einer breiten Öffentlichkeit zugemutet werden konnten. Wissen um dunkle Geheimnisse und tiefe Mysterien.
Doch Hannah sehnte sich nicht nach Öffentlichkeit, sie gierte nicht nach den Titelseiten der einschlägigen Fachzeitschriften. Das taten nur Idioten. Das Wichtigste war, dass sie immer noch lebte und sich bester Gesundheit erfreute. Weder die alten Götter noch Flüche oder Widersacher hatten ihr bisher etwas anhaben können – ihr, ihrer Familie und der handverlesenen Gruppe von Menschen, die ihr etwas bedeutete.
»Ich will auf keinen Fall länger warten«, sagte sie. »Keine Ahnung, wann Chávez mit dem Rest des Teams zurückkehrt. Ich habe keine Lust, einen Wassereinbruch zu riskieren. Der Wetterbericht hat für heute heftige Regenfälle angekündigt.« Sie stemmte die Hände in die Hüften. »Ich denke, ich werde es riskieren. Eine kleine Sondierungstour wird schon kein Problem sein. Kommst du mit?« Die Frage war rein rhetorisch. Sie wusste, dass Enrique begierig darauf war, hinunterzusteigen. Welcher junge Abenteurer konnte bei einer solchen Gelegenheit widerstehen? Mit seinem sandfarbenen Oberhemd, den hochgekrempelten Ärmeln, seiner olivfarbenen Cargohose und dem in den Nacken geschobenen Fedora sah er ein bisschen aus wie der junge Indiana Jones. Dabei taugte der berühmte Filmheld nur bedingt als Vorbild. Bei der Art von Feldforschung, die in diesen Filmen betrieben wurde, sträubte sich jedem professionellen Archäologen vor Entsetzen das Nackenfell. Echte Altertumsforscher gingen ihrer Arbeit nicht mit Stemmeisen und Dynamit nach, sie walzten nicht ganze Fundorte mit Panzern platt. Spatel, Pinsel und Lupe zählten zu den bevorzugten Arbeitswerkzeugen. Abgesehen davon, dass es nicht eine Sache weniger Stunden war, wie die Filme suggerierten, sondern wochen- und monatelange Kleinarbeit. Mitunter dauerte es Jahre. Nur selten bot sich die Gelegenheit für ein Abenteuer wie dieses. Doch wenn es dann anklopfte, war man schön blöd, sich nicht darauf einzulassen.
»Ob ich … aber klar. Was soll ich tun?«
»Hol die Gurte.«
»Okay.« Er rannte los, wobei er über seine Schulter rief: »Fang ja nicht ohne mich an, hörst du?«
Hannah lächelte. Er erwartete doch wohl nicht etwa, dass sie ohne Sicherungssystem in diesen Schacht kletterte? Gewiss, körperlich war sie fit. Sie achtete auf ihre Ernährung und legte täglich ein paar Krafteinheiten und Yogaübungen ein. Aber sie war keine zwanzig mehr. Den Stunt, allein in ein antikes Bauwerk einzusteigen, hätte sie vor zwei Jahrzehnten vielleicht in Erwägung gezogen, heute war sie klüger. Und vorsichtiger. Zumal die Schwüle in diesen Breitengraden den Kreislauf ordentlich in den Keller drückte.
Sie zog ihr Stofftuch heraus und wischte den Schweiß aus dem Gesicht.
Im Osten des zentralamerikanischen Staates herrschte das ganze Jahr über tropisches Klima. Temperaturen von sechsundzwanzig Grad im Jahresmittel und ganzjährig hohe Niederschläge. Honduras war ein schwieriges Arbeitsfeld. Fest in der Hand der Drogenbarone, wurde das Land von Kriminalität, Korruption und unfähigen Bürokraten stranguliert. San Pedro Sula galt als eine der brutalsten Städte weltweit, mit einer Pro-Kopf-Mordrate, die die anderer Metropolen in den Schatten stellte. Hier eine Forschungsgenehmigung zu erwirken, war beinahe unmöglich, und ohne bewaffneten Begleitschutz wagte sich niemand ins Gelände.
Hannah arbeitete zum Glück nicht auf eigene Faust. In ihrem Rücken stand ein weltweit operierender Geldgeber, der erfahren darin war, bürokratische Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Man musste wissen, wen es zu schmieren galt und wie man Schwierigkeiten mit der Polizei oder Banditen aus dem Weg ging. Stromberg Enterprises verfügte über diese Erfahrung. Wobei Geld allein wertlos war. Kontakte musste man besitzen. Kontakte und den richtigen Riecher für prestigeträchtige Fundorte. Ein Dutzend Wissenschaftler aus aller Welt hatten sich in La Mosquitia eingefunden, um im größten zusammenhängenden Regenwaldgebiet Zentralamerikas ungestört zu forschen. Und die Zeichen standen gut. Was sie in nur kurzer Zeit ausgebuddelt hatten, war nicht weniger als eine wissenschaftliche Sensation. Eine versunkene Stadt. Eine unbekannte Zivilisation. Eine Kultur, von der man bisher so gut wie nichts wusste.
Und sie hatten gerade mal an der Oberfläche gekratzt.
Enrique kam zurückgerannt, in der Hand ein Nylonseil, Klettergurte sowie Bodenanker und Hammer. Der Schweiß lief ihm vom Gesicht. Er hatte es geschafft, zwei Plastikwasserflaschen in den Hosenbund zu stopfen, von denen er eine Hannah zuwarf. Sie fischte sie aus der Luft, öffnete sie und nahm einen Schluck.
Die Ruinen waren im Mai 2012 von einer Cessna-337 Skymaster aus entdeckt worden. An Bord befand sich eines der fortschrittlichsten Instrumente zur Vermessung und Kartografierung des Dschungelbodens. Sein Name: LIDAR, die Kurzform von Light Detection and Ranging. Ein millionenteures Stück Equipment, das in der Lage war, unter das dichte Blätterdach des Dschungels zu schauen und hochauflösende Bilder von dort zu senden. Das System war seit den Achtzigern im Einsatz – vorzugsweise in den Händen von Geologen, Stadtplanern und Ingenieuren. Dank der technischen Verbesserungen der letzten zwanzig Jahre war es in den Fokus der Archäologen gerückt. 1997 hatten Wissenschaftler des Jet Propulsion Laboratory in Pasadena beim Zusammensetzen einiger Satellitenbilder merkwürdige rechteckige und gebogene Formen unter dem Blätterdach des mittelamerikanischen Dschungels entdeckt. Zuerst hatten sie vermutet, es könne sich um natürliche Gesteinsstrukturen handeln – immerhin hatten frühere Expeditionen in diesem Gebiet nichts zutage gefördert. Doch dann waren ihnen Zweifel gekommen. Eine Bodenexkursion hätte Klarheit bringen können, jedoch wäre sie zu so einem frühen Zeitpunkt umständlich, teuer und sehr gefährlich gewesen. Der Dschungel war zu dicht, zu unwirtlich und zu feindlich, als dass man einfach aufs Geratewohl loszog.
Achtzigtausend Quadratkilometer grüne Hölle umgaben den Fundort. Eine Durchquerung dieser Bergregion voller Flüsse, Sümpfe und gefährlicher Tiere war zu Fuß so gut wie ausgeschlossen. Portal del Infierno, Tor zur Hölle, so nennen es die Einheimischen, und das nicht ohne Grund. Hueitapalan ist tatsächlich einer der letzten unentdeckten Orte auf diesem Planeten und Ciudad Blanca, die Stadt des Affenkönigs, ihr Kronjuwel.
Hannah legte die Gurte an. Sie hängte das Bremssystem ins Führungsseil und prüfte die Zugfestigkeit der Bodenanker. Alles machte einen stabilen Eindruck.
»Schön«, sagte sie. »Dann wollen wir mal. Sobald ich unten bin, kommst du nach, einverstanden?«
Enrique blickte in den schwarzen Abgrund. »Glaubst du nicht, dass Chávez sauer sein wird, wenn er erfährt, dass wir ohne ihn runtergestiegen sind? Er ist ziemlich pingelig.« Da war er wieder, dieser sorgenvolle Unterton.
»Er ist nur dann pingelig, wenn er befürchtet, nicht gut in Szene gesetzt zu werden. Deswegen hat er das Filmteam instruiert, ihn auf Schritt und Tritt zu begleiten. Pech für sie. Wären sie hier, hätten sie den Moment dokumentieren können.«
»Er wird ausrasten …«
»Nur, wenn er davon erfährt. Wir müssen es ihm ja nicht erzählen, oder?« Sie zwinkerte ihm zu.
»Er wird es rausbekommen, so oder so.«
»Dann ist es auch egal. Das ist meine Entdeckung. Ich habe das Recht der Ersterkundung. Komm schon, lass uns anfangen.«
Hannah schaltete ihre Stirnlampe ein, strich die Handschuhe glatt und federte in den Schuhen. Das Gefühl war berauschend.
Der Reiz des Unbekannten, der Atem der Zeit – nichts auf der Welt war damit zu vergleichen. Nicht mal guter Sex.
Sie setzte sich an den Rand der Öffnung, stemmte ihre Beine in das feuchte Mauerwerk, atmete tief ein und ließ sich an dem Führungsseil hinabgleiten. Ein kurzer Ruck, dann griff das automatische Bremssystem.
Die ersten Momente verursachten immer Herzklopfen. Würde das Seil halten? War die Bremsautomatik in Ordnung? Hielten die Bodenanker? Gewiss, zur Not war Enrique da. Aber ob er ihren Fall stoppen könnte, wenn etwas schiefging, war fraglich.
Hannah berührte die Steine. Das Mauerwerk war alt. Ihr Team hatte Hueitapalan auf einen Zeitraum zwischen 1000 bis 1500 nach Christus datiert. Ausgangspunkt für diese Überlegungen waren die zweihundert Skulpturen, rituellen Steingefäße, Scherben und Artefakte, die sie gefunden hatten und die sich stark von denen der Maya unterschieden. Sie waren auf Leopardenköpfe gestoßen, auf Wesen, halb Mensch, halb Geier, sowie Gottheiten, die Affen ähnelten. Und da war nicht nur diese eine Stadt. Neunzehn prähistorische Siedlungen waren von LIDAR entdeckt worden. Erschaffen von einer Kultur, über die fast nichts bekannt war. Hannah war überzeugt, dass dies nicht die Siedlung irgendeines drittklassigen Stammeshäuptlings war. Es waren die Überreste einer versunkenen Zivilisation.
Über die Abdeckplatte war sie gestolpert, als sie ihr Fundgebiet heute Morgen erweitert hatte. Das Ding war unter dem Bodenbewuchs gut verborgen gewesen, sodass ihr linker Zeh schmerzhaften Kontakt damit gemacht hatte. Zum Glück trug sie festes Schuhwerk. Nicht nur, weil man sich hier leicht die Füße umknicken konnte, sondern auch, weil dieser Teil Mittelamerikas die Heimat einer der giftigsten und aggressivsten Schlangenarten der Welt war, der Lanzenotter Barba amarilla. Einmal gebissen, blieben einem fünf Minuten, um sich von dem betroffenen Körperteil zu verabschieden. Und Hannah liebte ihre Arme und Beine. Es wäre bedauernswert, darauf verzichten zu müssen.
Die Abdeckplatte war außergewöhnlich. Offenbar war sie Teil einer wesentlich größeren Struktur, eines Tempels oder einer Pyramide vielleicht. Hannah spürte, dass dies nur die Spitze des Eisbergs war. Neben der Hauptplatte hatte sie weitere Steinplatten mit markanten, konischen Vertiefungen gefunden. Rituelle Steine? In diesem Fall hätte hier früher ein Richtblock gestanden, und die Kerben, die seitlich in die Platte eingeritzt worden waren, wären Blutrinnen. Doch das war Spekulation. Weder gab es Opfersteine noch Obsidianklingen oder andere Gegenstände, die ihre These untermauert hätten. Nur diesen Schacht.
Sie löste die Bremse und ließ sich weiter hinabgleiten. Die Luft roch feucht und abgestanden. Wie ein alter Blumentopf. Moose und Flechten bedeckten die Steine. Die Fugen enthielten keinen Mörtel. Die Granitbrocken waren passgenau aufeinandergelegt worden. Eine Meisterleistung der Architektur. Noch immer waren sich die Wissenschaftler nicht einig, mit welchen Werkzeugen die prähistorischen Kulturen diesen harten Granit bearbeitet hatten. Doch selbst mit einem Laserschneider hätte die Bautätigkeit Jahre oder Jahrzehnte gedauert.
Wasser tropfte von den Wänden herab und ließ die Oberfläche fettig glänzen. Im Licht ihrer Stirnlampe erkannte Hannah Symbole auf den Felsblöcken. Im frontalen Licht der Lampe verschwanden die Konturen. Hannah nahm sie aus der Stirnhalterung und hielt sie in flachem Winkel gegen das Relief.
»Alles okay, Hannah?« Enriques Stimme hallte als Echo von oben herab.
»Ja, alles okay.«
»Du hast so merkwürdige Laute von dir gegeben.«
»Es war … ach, nichts. Nur eine dieser Jaguarfratzen. Du wirst sie sehen, wenn du runterkommst. Aber erschreck nicht, sie ist ziemlich beeindruckend.«
Sie klickte die Lampe zurück in die Halterung und setzte den Abstieg fort. Bildete sie sich das ein, oder sah dieser Jaguar besonders dämonisch aus? Seine Zähne ähnelten weniger denen einer Raubkatze als eines Hais.
Unter sich sah sie die Leuchtstäbe schimmern. Der Boden war nicht mehr fern. Mit jedem Meter, den sie zurücklegte, wurde die Luft kühler. Sie ärgerte sich, dass sie keine Jacke mitgenommen hatte. Dann berührten ihre Füße den Boden, und sie fand festen Halt. Sie klinkte die Führungsschiene aus und ruckte am Seil.
»Kannst kommen«, rief sie. »Ich bin unten.«
Enrique ließ sich das nicht zweimal sagen. Mit einer geschmeidigen Bewegung kletterte er in den Schacht und begann, am Seil herunterzurutschen. Hannah nutzte die Zeit zur Orientierung. Das Licht ihrer Lampe enthüllte faustgroße Steine, die mit einer glitschigen Schicht aus Algen und Moos überwuchert waren. Rechts von ihr zweigte ein niedriger Stollen ab. Er verlief tief unter der Erde und schien am Ende in ein tonnenartiges Gewölbe zu münden. Rätselhaft.
Irgendetwas stimmte nicht mit dem Raum am Ende des Tunnels. Er schickte das Licht ihrer Stirnlampe auf bemerkenswerte Weise zurück. Es verhielt sich nicht, wie sie es gewohnt war. Was das Besondere daran war, konnte sie nicht ergründen. Noch nicht.
Ein Surren ertönte.
Hannah trat einen Schritt zur Seite und machte Platz für Enrique, der von oben herabgeschwebt kam.
»Pass ein bisschen auf«, sagte sie, »der Untergrund ist rutschig.«
»So wie der ganze Schacht«, sagte er. »Der Jaguar ist der Hammer, findest du nicht? Der schönste, den wir bisher gefunden haben.«
»Der schönste und der unheimlichste.« Sie deutete voraus in die Dunkelheit. »Siehst du das da vorn? Sieht aus, als wären dort kleine Lichter.«
»Was ist das …?«
»Keine Ahnung, lass uns nachsehen.« Sie zog den Kopf ein und betrat den niedrigen Stollen. Eine dünne Nebelschicht lag über dem Boden. Das Licht ihrer Lampe schnitt hindurch wie heißer Stahl durch Butter. Je weiter sie vorrückte, desto verwirrender wurden die Lichtverhältnisse. Normalerweise waren alte Steine dunkel. Vor allem solche, die feucht und überwuchert waren. Diese nicht.
Das Licht ihrer Lampe wurde dutzendfach zurückgeworfen. Tatsächlich hatte es den Anschein, als würden sie viele kleine Lichter sehen, die zu ihnen herüberleuchteten. Das war natürlich Unsinn. Hier unten leuchtete nichts, bestenfalls wurde es reflektiert. Aber wovon?
Hannah spürte ein Knirschen unter ihren Schuhen. Sie blieb stehen, beugte sich vor und hob etwas auf. Das Licht ihrer Lampe enthüllte ein längliches, stabförmiges Gebilde.
»Sieh mal«, sagte sie. »Nicht erschrecken, es sind Knochen. Hier ist alles voll davon. Pass auf, wo du hintrittst.«
»Alter …« Enrique beugte sich ebenfalls vor. Der Knochen, den er aufgehoben hatte, war deutlich größer. »Ziemlich verwittert«, murmelte er. »Was meinst du, ist das ein Tapir?«
Sie schüttelte den Kopf. »Es sind Menschenknochen.« Sie leuchtete nach links. Gegen die Wand waren Schädel gestapelt. Töpferwaren und Steinskulpturen standen ebenfalls dort. Sehr ähnlich denen, die sie oben gefunden hatten. Daneben Schmuck aus Jade und Muscheln sowie Obsidianmesser. Alles wunderschön erhalten. Enrique sah sich ehrfürchtig um.
»El mundo infierno«, murmelte er. »Die Unterwelt. Die Heimstatt der Toten.«
»Sieht ganz so aus«, sagte Hannah. »Würde mich nicht wundern, wenn wir beim Weitergehen auf die Grundmauern eines Tempels oder einer Pyramide träfen.«
»LIDAR hat nichts dergleichen angezeigt …«
»Vermutlich wurde das Gebäude während der letzten Jahrhunderte dem Erdboden gleichgemacht. Wäre nicht das erste Mal. Sieh dir das Deckengewölbe an.« Hannah strich über das Gestein. Eine glitzernde Schicht bedeckte die Zeigefingerkuppe. »Metallstaub. Zermahlener Pyrit. Ich habe so etwas früher schon gesehen. In Teotihuacán.« Sie strich den Staub an ihrer Hose ab.
»Aber das liegt tausend Kilometer entfernt, im Hochland von Mexiko.«
»Trotzdem scheint es Parallelen zu geben. Die Decke symbolisiert den Sternenhimmel, siehst du? Achte auf die kleinen, glitzernden Steine.« Hannah ging langsam weiter, während sie ihre Lampe über das Deckengewölbe wandern ließ. Es funkelte wie in einer sternklaren Nacht. »Bei Fackelschein dürfte der Effekt noch viel beeindruckender sein«, sagte sie. »Das Zucken der Flammen wird die Sterne erst richtig funkeln lassen.« Sie wagte kaum zu atmen. »Ich bin inzwischen überzeugt davon, dass wir hier einen der zentralen Bestattungsplätze der Stadt gefunden haben.«
»Glaubst du, dass dies die Knochen hochgestellter Persönlichkeiten sind?«
»Diese?« Hannah ließ das Licht über dem Boden kreisen. »Nein. Die Gräber der Oberen werden wir vermutlich weiter vorn finden. Sie werden üblicherweise in Wandnischen beigesetzt.«
Enrique sah sie verständnislos an. Plötzlich klärte sich sein Blick. »Oh, dann sind das …?«
»Hinrichtungsopfer, ja.« Sie sah ihren Begleiter amüsiert an. Sein Entsetzen schien nicht gespielt zu sein. »Komm schon, tu nicht so erstaunt. Die meisten meso- und südamerikanischen Hochkulturen brachten Menschenopfer, das solltest du eigentlich wissen.«
»Aber es sind so viele …«
Hannah nickte. »Sie wurden bevorzugt aus den Reihen der Spieler gewählt. Manchmal waren es ganze Mannschaften.«
Ullamaliztli war eine historisch überlieferte Ballsportart der alten Hochkulturen. Nicht selten waren die Verlierer im Anschluss getötet worden. Mit Seilen fest zusammengeschnürt, stieß man sie die Stufen der Pyramiden hinunter, bis sie tot waren.
»Barbarisch«, murmelte Enrique. »Stell dir mal vor, man würde das heute machen. Niemand würde mehr Fußballspieler werden wollen.«
Hannah lächelte. »Damals war vieles anders. Einige meiner Kollegen sind der Meinung, dass es nicht die Verlierer waren, die geopfert wurden, sondern die Gewinner. Und dass es ein freiwilliger Akt war.«
»Im Ernst?«
Hannah nickte. »Die Maya sahen den Tod nicht als das Ende an. Für sie war es der Übergang in eine andere Welt. Wenn du tapfer gespielt und gewonnen hast, war das der beste Moment, um den Göttern gegenüberzutreten. Es war eine Ehre, keine Strafe.«
»Na ja, da kann ich mir was Angenehmeres vorstellen.« Enrique ließ seine Lampe über die Knochen kreisen. »Aber das sind keine Maya. Hast du irgendwo Schriftzeichen gefunden?«
»Nada«, sagte Hannah. »Noch ein Indiz dafür, dass zwischen Teotihuacán und Hueitapalan eine Verbindung bestanden haben könnte.« Seufzend sah sie sich um. So gerne sie auch geblieben wäre, sie wusste, dass die Zeit gekommen war, zu gehen. »Machen wir uns auf den Rückweg«, sagte sie. »Chávez dürfte bald zurück sein, und ich habe keine Lust, ihm in die Arme zu laufen. Wir müssen unser Schicksal ja nicht herausfordern.«
Enrique lächelte erleichtert.
2
Wenn man an Schicksal glaubt, darf man getrost davon ausgehen, dass es sich gegen einen wendet. Hannah spürte, dass es auch diesmal so sein würde. Es lag etwas in der Luft, und das war nicht das Wetter.
Dass Chávez sie herbeizitierte, ließ Übles ahnen. Vermutlich ging es um ihren Alleingang heute früh. Das Mindeste, was sie zu befürchten hatte, war ein Anschiss. Aber sie war kein kleines Kind mehr und musste sich nicht für jede Entscheidung rechtfertigen. Sie war allerdings gespannt zu erfahren, was er zu sagen hatte.
Als sie vor seinem Zelt eintraf, war die Sonne verschwunden. Mächtige Wolken bedeckten den abendlichen Himmel. Fern am Horizont zuckten Blitze auf. Das hieß, es würde wieder bis zum Morgengrauen regnen. Die Hoffnung auf eine erholsame Nachtruhe konnte sie somit aufgeben. Was sie in all den Jahren nicht gelernt hatte, war, bei Blitz und Donner zu schlafen.
Sie versuchte, sich zu sammeln, dann erhob sie ihre Stimme und rief: »Klopf, klopf.«
»Hannah? Kommen Sie rein. Und machen Sie hinter sich wieder zu.«
Professor Alfonso Chávez vom Institut für nationale Anthropologie und Geschichte saß hinter einem großen Klapptisch und nippte an seinem Kaffee. Neben ihm stand Lance Abercrombie, pensionierter Soldat und Urwaldexperte. Hannah wusste nicht viel über ihn, nur, dass er früher der Coldstream-Garde angehört hatte und ein hohes Tier in der britischen Eliteeinheit SAS war. Ein verschlossener Mann, der die meiste Zeit mit seinen Kameraden verbrachte und selten in Erscheinung trat. Er mischte sich nicht in ihre Forschung ein, war aber zur Stelle, sobald Not am Mann war. Entweder, wenn unerwünschte Gäste Zutritt zum Camp verlangten, oder aber, wenn jemand das Lager verlassen wollte. Das betraf vor allem Besuche in Catacamas, einer Stadt, die von Drogenbaronen beherrscht wurde. Ein echtes Drecksloch.
Honduras war politisch zu instabil, um die Forschung allein den Professoren und Studenten zu überlassen. Die Expedition stand de facto unter militärischer Leitung. Dass Abercrombie hier war, bedeutete nichts Gutes.
Sie nickte kurz. »Gentlemen.«
»Nehmen Sie Platz.« Chávez wies auf einen klapprigen Campingstuhl. Das Lager war provisorisch. Sie erwarteten besseres Equipment binnen des nächsten Monats. Wann es tatsächlich eintreffen würde, stand in den Sternen. Sie konnten von Glück sagen, dass die Nahrungsmittel noch nicht rationiert worden waren.
Chávez faltete die Hände und sah sie an. Der Chefarchäologe der Nationalen Autonomen Universität von Honduras wirkte gealtert. Mit seinen fünfundfünfzig Jahren sah er aus wie Hannahs Vater, der deutlich älter war. Das Haar war an den Schläfen vorzeitig ergraut, und das Ziegenbärtchen wirkte struppig. Die tiefen Tränensäcke hinter den Brillengläsern ließen ihn müde aussehen. Sie gaben Zeugnis von den schwierigen Arbeitsverhältnissen. Die Last drückte die Schultern des Professors nach unten. Irgendetwas war geschehen, das spürte Hannah.
»Schlechte Nachrichten«, sagte er.
Aha, dachte sie. Ihre kleine Erkundungstour heute Morgen war aufgeflogen. Sie beschloss, den Stier bei den Hörnern zu packen. »Wegen der Sache in der Grabkammer … ich kann das erklären. Es war eine erste Sondierung. Wir haben kaum einen Fuß hineingesetzt. Enrique hat nichts damit zu tun, es war meine Entscheidung.«
Chávez runzelte die Stirn. »Grabkammer?«
»Ja. Deswegen haben Sie mich doch kommen lassen, oder?«
Er schüttelte den Kopf. »Ich habe Wichtigeres zu tun, als mich über ein paar kleine Insubordinationen aufzuregen. Natürlich war es falsch, dass Sie allein losgezogen sind, aber das wissen Sie ja selbst. Ihr Ruf als Archäologin ist hervorragend. Ich darf wohl davon ausgehen, dass Sie achtsam vorgegangen sind?«
»Worauf Sie sich verlassen können.«
Er sortierte fahrig seine Unterlagen. »Wie geht es Ihrem Mann und Ihrer Tochter? Sind beide wohlauf?«
Hannah runzelte die Stirn. Das Gespräch nahm eine unerwartete Wendung. »Ja, sind sie«, antwortete sie verwirrt. »Ich sprach gestern mit ihnen via Skype. Sie sind im Mittelmeer unterwegs. Eine Tauchexpedition vor Korsika.«
»Schön, schön.« Chávez klopfte die Ränder der Akten gerade und legte sie dann in sein Ablagefach. »Wunderbare Gegend, Korsika. Überhaupt das Mittelmeer. Warm und friedlich.«
»Wie man’s nimmt. Die Flüchtlingskrise ist noch lange nicht ausgestanden.« Sie legte den Kopf schief. »Wollen Sie mir nicht endlich sagen, was los ist? Warum haben Sie mich rufen lassen?«
Zum ersten Mal, seit sie das Zelt betreten hatte, sah er ihr direkt in die Augen. »Wir werden unser Lager räumen müssen, Hannah. Dieses und alle anderen. Die Forschungen an der Weißen Stadt werden auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.«
»Das Lager räumen? Ich verstehe nicht …«
»Ja, haben Sie denn die Nachrichten nicht verfolgt?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Oh, dann wird Sie das kalt erwischen. Wir sind heute Morgen losgefahren, um die Lage zu sondieren. Es ist weit schlimmer als vermutet. In Tegucigalpa gab es massive Ausschreitungen. Die Ausgangssperre wurde gebrochen, es kam zu Plünderungen und Zerstörungen. Der Versuch des Militärs, die Lage unter Kontrolle zu bringen, scheiterte, und es gab Dutzende von Toten. Die Zeichen stehen auf Bürgerkrieg, Hannah.«
»Um Gottes willen …«
Hannah wusste, dass die Präsidentschaftswahl wegen massiver Wahlfälschungsvorwürfe international schwer unter Beschuss stand. Als Folge der Proteste hatte man eine Ausgangssperre verhängt, die auf unbestimmte Zeit verlängert worden war. Der Oppositionskandidat, der die grassierende Korruption und Gewalt bekämpfen wollte, hatte während der Auszählung lange Zeit in Führung gelegen, teilweise mit knapp zehn Prozentpunkten. Dann war etwas Unerklärliches geschehen, was auf eine Manipulation hindeutete. Die Veröffentlichung des Endergebnisses wurde nach hinten geschoben. Weiter und weiter. Auf Nachfrage hieß es, dass Hunderte von Wahlurnen geöffnet und nachgezählt werden mussten. Als dann das amtliche Endergebnis präsentiert wurde, führte der Amtsinhaber plötzlich wieder, und zwar mit deutlichem Abstand.
Die Abwahl des derzeitigen Präsidenten war eine der Hauptbedingungen der Organisation Amerikanischer Staaten gewesen, um Honduras in ihre Reihen aufzunehmen. Doch davon war Honduras jetzt weiter entfernt denn je.
»Das Land wird gerade systematisch abgeriegelt«, fuhr Chávez fort. »Die internationalen Flughäfen werden in achtundvierzig Stunden geschlossen. Sämtliche UNO-Staaten haben ihre Botschaften dichtgemacht und die Diplomaten abgezogen. Die Lage ist ernst. Ich verstehe Ihre Enttäuschung, Hannah, aber wir werden das Feld räumen und erst wiederkehren, wenn sich die Lage beruhigt hat.«
»Und wann wird das sein?«
Chávez zuckte die Schultern.
Hannah sackte in sich zusammen. Sie hatte gewusst, dass die Lage schlimm war, nicht aber, dass es so düster aussah. Vielleicht hätte sie mal aufmerksamer die Nachrichten verfolgen sollen. Etwas, das sie ungern tat. Vor allem in diesen postfaktischen Zeiten. Wer wusste schon, welche Meldungen echt waren und welche gefakt? »Das ist furchtbar«, sagte sie. »Unsere ganze Arbeit …«
»Die wird auf uns warten, bis wir zurückkehren«, sagte Chávez.
»Falls Sie zurückkehren.« Abercrombie, der die ganze Zeit über still hinter den Professor gestanden hatte, räusperte sich. »Ich habe die Order ausgegeben, zu packen und alles abfahrbereit zu machen. Morgen früh um sechs Uhr werden wir verschwinden.«
Hannah blickte auf ihre Uhr. »Das sind zwölf Stunden. Sie machen Witze. Was ist mit den Fundstellen? Die müssen geschützt werden. So viele Abdeckplanen, wie dafür nötig wären, haben wir nicht. Wir müssten losfahren und neue besorgen.«
»Um die Fundstellen müssen Sie sich keine Sorgen machen«, erklärte Chávez. »Sie haben tausend Jahre der Witterung getrotzt, sie werden ein paar weitere Jahre überstehen. Wir werden sie lassen, wie sie sind. Bei den Scherben, den Knochen und Skulpturen werden wir eine Ausnahme machen und sie mit Planen abdecken. Sie dürfen sich gerne den Arbeiten anschließen, wenn Sie die Zeit erübrigen können.«
»Aber zuerst packen Sie Ihre Sachen«, warf Abercrombie ein. »Wie gesagt, um sechs Uhr früh geht’s los. Denken Sie daran, dass Sie Ihren Pass griffbereit haben und persönliche Gegenstände am Leib tragen. Laptops, Geld, Visa. Wir werden keine Zeit haben, zurückzukehren. Professor Chávez, das war’s erst mal von meiner Seite, ich muss wieder los. Nicht vergessen: Der Zeitplan muss strikt eingehalten werden.« Er tippte einen militärischen Gruß an die Stirn und verließ das Zelt.
Hannah schwieg. Es sah so aus, als wäre sie arbeitslos. Zwei Monate hatte sie hierfür veranschlagt, jetzt stand sie ohne Job da.
Chávez sah sie mitfühlend an. Er schien zu wissen, was in ihr vorging. »Was werden Sie tun? Zu Ihrer Familie reisen?«
»Vielleicht.« Sie hatte einen metallischen Geschmack auf der Zunge. »Oder ich kehre nach Messene zurück. Die Arbeiten dort sind noch lange nicht abgeschlossen. Ich glaube, übergangsweise könnte ich dort hingehen. Außerdem ist es ein wunderschöner Ort.«
»Machen Sie das.« Chávez nickte. »Der Peloponnes ist zauberhaft. Ich wünschte, ich könnte Sie begleiten. Leider bin ich gezwungen, hierzubleiben. Ich muss zurück an die Universität und retten, was zu retten ist.« Er seufzte und stand auf. »Ach ja, ehe ich es vergesse: Sie haben eine Nachricht erhalten. Melanie teilte mir mit, dass da etwas für Sie über den Äther gegangen ist. Eine private Botschaft.«
»Privat?« Nur eine Handvoll Menschen besaßen Hannahs Nummer. Von denen, die ihr spontan einfielen, kam nur John infrage.
»Am besten, Sie gehen selbst rüber und erkundigen sich. Beeilen Sie sich. Wenn Sie Glück haben, wurden die Geräte noch nicht abgebaut.«
3
Hannah verließ das Zelt und eilte mit eingezogenem Kopf durch das Lager. Der Regen fiel jetzt stärker. Überall wurde hektisch gearbeitet. Es herrschte eine schweigsame und verbissene Stimmung. Niemand redete, von Lachen oder Gesang ganz zu schweigen. Irgendwo plärrte ein Radio die neuesten Nachrichten.
Auf dem Weg zum Funkerzelt traf sie Enrique. Er wirkte vollkommen aufgelöst.
»Da bist du ja«, rief er, »ich habe dich überall gesucht. Hast du es mitbekommen?«
»Gerade eben, Chávez und Abercrombie haben es mir erzählt. So ein verdammter Mist.«
Er schüttelte den Kopf. »Bürgerkrieg, ich fasse es nicht …«
»Es war schon vorher nicht einfach, aber jetzt schlittert das Land vollends in die Katastrophe. Zum Verrücktwerden ist das. Es passiert gerade überall auf der Welt. Irak, Syrien, Libyen, der Jemen – sieh dich nur um. Heute noch Leuchtturm der Zivilisation, morgen der Abgrund. Nirgendwo kann man mehr ungestört arbeiten. Als würde ein Fluch über der Archäologie liegen. Aber ich habe keine Zeit, mich darüber auszulassen. Ich muss zu Melanie. Anscheinend ist da eine Nachricht für mich eingegangen.«
»Was dagegen, wenn ich mitkomme?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Dann los.«
Im Funkerzelt angekommen, musste Hannah sich erst mal sortieren. Chávez hatte nicht übertrieben. Es wurde fieberhaft am Abbau gearbeitet. Computer, Kameras, Sende- und Empfangseinrichtungen, Antennen – all das musste zerlegt und verstaut werden. Tausende von Dollars verschwanden in Alukisten, wurden verfrachtet und außer Landes gebracht. Zum Transport würden sie geländegängige Fahrzeuge benötigen. Vorausgesetzt, ihnen wurden keine Hubschrauber zur Verfügung gestellt. Aber Hannah bezweifelte, dass das Militär im Moment Kapazitäten übrig hatte.
Melanie war im hinteren Teil des Zeltes und rollte Leitungen mit Kabelbindern zusammen. Die Luft war stickig.
»Hi, Mellie«, rief Hannah und manövrierte um den Hindernisparcours aus Computern und Sendeeinrichtungen herum. »Chávez hat mir gesagt, du hättest etwas für mich.«
Melanies Wangen waren gerötet. Auf ihrer Stirn stand der Schweiß. »Ja, richtig. Da ist vorhin etwas in deinem Postfach gelandet. Ich habe mir erlaubt, dir ein Back-up zu ziehen. Ist auf dem Stick hier.« Sie wühlte in ihrer Hosentasche und reichte Hannah den Datenträger. »Die Antenne ist bereits abgebaut, vorerst wirst du wohl nicht darauf antworten können. Ich hoffe, es ist nichts Dringendes.«
»Das hoffe ich auch.« Hannah starrte auf den daumennagelgroßen Chip. Sie würde sich die Nachricht gleich auf ihrem Laptop ansehen. »Konntest du den Absender identifizieren?«
»Es war jedenfalls nicht John, falls du darauf gehofft hast.« Mellie lächelte traurig. »Irgendeine Frau. Aber ich habe den Namen nicht lesen können.«
»Macht nichts. Danke für alles. Wenn ihr Hilfe braucht, sagt Bescheid. Ich bin drüben in meinem Zelt und mache dort klar Schiff.«
Hannah verabschiedete sich von Mellie und Enrique und ging zu ihrem Zelt. Missmutig starrte sie nach oben. Packen bei Regen war die reinste Sauerei.
Ihr Zelt stand an der Südseite des Camps unter den ausladenden Ästen eines Gummibaums. Eigentlich ein sehr schöner Platz. Die Blätter spendeten tagsüber Schatten und lenkten bei Unwettern den Regen zur Seite ab. Inzwischen aber waren die Schleusen voll geöffnet, da halfen auch die Blätter nichts mehr. Die imprägnierte Außenhaut ihres Zeltes schimmerte wie nasser Asphalt.
Hannah eilte ins schützende Innere und schüttelte ihr Haar. Wassertropfen stoben aus ihren braunen Locken. Sie nahm die Brille ab und trocknete sie an einem Zipfel ihres T-Shirts. Auf ihrem Schreibtisch saß Rango, ihr kleiner Freund. Mit goldgesprenkelten Augen sah der Gecko sie an. Seit zwei Wochen leistete er ihr Gesellschaft. Da er keinerlei Anzeichen zeigte, diese hart erkämpfte Stellung aufzugeben, ließ Hannah ihn gewähren. Immerhin hielt er ihr Mücken und anderes Ungeziefer vom Leib.
Als sie ihren Laptop auf den Tisch stellte, zischte Rango ab, wuselte die Innenseite des Zelts hinauf, bis er unter dem First war, und versteckte sich in der dunkelsten Ecke. Hannah sah seine Augen im kalten Licht der LED-Lampe schimmern.
»Sorry, kleiner Freund, ich muss dich leider verlassen. Unsere gemeinsamen Nächte sind gezählt. Ab jetzt wirst du den Gürtel wieder enger schnallen müssen. Die Zeiten, in denen du dich nur neben dem Licht zu postieren und das Mäulchen aufzumachen brauchtest, sind vorbei. Das Schlaraffenland hat geschlossen.«
Sie klappte ihren Laptop auf. Der Anblick des chaotischen, unaufgeräumten Zeltes erfüllte sie mit Sorge. Sie würde Stunden brauchen, bis sie das alles sortiert und verpackt hatte. Ob sie da überhaupt Schlaf finden würde, stand in den Sternen.
Das Camp, die Leute und diese Umgebung waren ihr während der letzten Wochen ans Herz gewachsen. Es würde ihr schwerfallen, all das aufzugeben. Allerdings verlieh der Gedanke an Leni und John ihr Kraft. »Ich komme zurück, meine Liebsten«, flüsterte sie.
Endlich war das System hochgefahren. Sie steckte den Stick ein und klickte sich durch das archivierte Postfach. Da war die Datei. Eine Videoaufzeichnung, etwa zwanzig Megabyte groß. Eingegangen um kurz nach elf. Der Zeitpunkt, zu dem sie mit Enrique unten in der Grabkammer gewesen war. Sie zog sich einen Stuhl heran, startete das Programm und schob die Brille ein Stückchen nach hinten.
Das Gesicht einer Frau tauchte auf. Das Bild war verwackelt, aber Hannah erkannte sie sofort. Überrascht hob sie die Brauen.
»Leslie?«
Hannah war Leslie Rickert vor zwei Jahren in der Wüste Nordiraks begegnet. Ihr Team hatte die britische Reporterin und einen amerikanischen Lieutenant am Straßenrand aufgegabelt und sie in ihrem Konvoi mitgenommen. Die beiden waren auf der Flucht vor der Terrormiliz Islamischer Staat gewesen, der sie mit knapper Not entkommen waren. Was sie gemeinsam erlebt hatten, war in keinerlei Reportagen oder Fachmagazinen aufgetaucht, sondern verstaubte tief in irgendwelchen Geheimakten. Leslie war eine gute Bekannte, aber definitiv niemand, dem sie ihre Privatnummer geben würde. Hannah hatte ewig nichts von ihr gehört und sich bereits gefragt, ob Leslie wohl bei einem ihrer waghalsigen Auslandseinsätze ums Leben gekommen war. Doch allem Anschein nach war die Sorge unbegründet. Leslie schien wohlauf zu sein. Braun gebrannt, mit hellen, wachen Augen und einem breiten Grinsen.
»Grüß dich, Hannah. Überrascht, mich zu sehen? Ich würde es dir nicht verübeln. Ist ganz schön lange her. Wie geht es dir, alles wohlauf? Schade, dass du nicht da bist, um live mit mir zu quatschen. Ich hoffe, deine Mailbox ist groß genug, sonst ist meine Nachricht für die Katz.«
Hannah justierte ein wenig an der Bildschirmeinstellung, bis die Kontraste nicht mehr ganz so hart waren.
Leslie saß in einem Raum, der wie ein altes Kino aussah. Ein Filmprojektor war im Hintergrund zu sehen. Merkwürdige Umgebung.
»Ich habe übrigens oft an unsere gemeinsamen Abenteuer gedacht«, fuhr Leslie fort. »Ein paarmal habe ich versucht, mit dir Kontakt aufzunehmen, doch du bist schwerer zu erreichen als der Maharadscha von Eschnapur. Es hat mich eine Menge Vitamin B und Überzeugungsarbeit gekostet, deine Nummer zu bekommen. Irgendwann bin ich bei John gelandet. Er war so nett, mir deine Kontaktdaten zu geben. Du fragst dich bestimmt, warum ich mir so viel Mühe mache, dich in deinem sumpfigen Nest in Mittelamerika aufzustöbern. Am liebsten wäre ich ja selbst vorbeigekommen, aber das erschien mir zu übertrieben. Honduras liegt nicht gerade um die Ecke. Außerdem dachte ich, es wäre klüger, erst mal die Lage zu sondieren. Vielleicht entpuppt sich das Ganze ja als Hoax.«
»Komm zum Punkt, Leslie.« Hannah trommelte mit den Fingern auf den Tisch. Die Datei war bereits zu einem Viertel abgelaufen. Hannah öffnete eine Flasche Wasser und legte die Füße auf den Tisch. Die Reporterin hatte nicht übertrieben. Es würde dauern.
»Wie du weißt, habe ich lange im Ausland gelebt. Vor einem Jahr ist mein Vertrag mit der BBC ausgelaufen, und ich musste mich nach einem neuen Betätigungsfeld umsehen. Mir tut’s nicht leid, dass ich von dort weg bin. Zwei Jahre im Irak sind weiß Gott genug. Ich beschloss, erst mal nach England zurückzukehren, meine Familie und alte Freunde zu besuchen und ein bisschen runterzukommen. Wie du dir denken kannst, ist mir das nur zum Teil gelungen.« Sie grinste schief in die Kamera. »Bereits nach drei Wochen war ich an einer neuen Sache dran. Oder vielmehr an einer alten. Ich hatte dieses Thema kurz vor der Jahrtausendwende auf dem Schirm, es dann aber aufgrund meiner vielen Auslandseinsätze aus den Augen verloren. Ich dachte: Schau doch mal, was sich in der Zwischenzeit getan hat. Und, bingo. Die alte Spur war noch heiß. Genauer gesagt, war sie nie wirklich abgekühlt. Warum kein anderer sich dieser Sache angenommen hat, weiß ich nicht. Entweder hatten die alle Tomaten auf den Augen, oder ich bilde mir das ein. Was ich nicht glaube. Vor allem nicht im Hinblick auf die aktuellen Ereignisse.«
Hannah nippte an ihrem Wasser. Leslie redete um den heißen Brei herum, das war offensichtlich. Sie verlor sich in Floskeln und Andeutungen. Das passte überhaupt nicht zu ihr.
Im Irak hatte Hannah die Reporterin als jemanden kennengelernt, der kein Risiko scheute und Klartext redete. Leslie hatte mit einem Kommandanten der Terrormiliz über Politik gestritten und ihn, nach eigenen Angaben, mehr als einmal beleidigt. Das wollte schon etwas heißen.
»… Sekte, über die ich recherchiert habe. Sie …«
Hannah hielt inne. In Gedanken war sie abgeschweift. Sie drückte den Pausenknopf und spulte zurück.
»… wie du weißt, habe ich vor einiger Zeit einen Bericht zum Thema Geheimbünde, Sekten und Satanisten gedreht. Vornehmlich in Großbritannien, aber auch auf dem europäischen Festland. Speziell ging es um den Order of Nine Angles und den Temple of The Black Light. Zwei britische Satanistenkulte, die behaupteten, ihren Ursprung im Sonnenkult von Albion zu haben. Sie beschreiben ein Ritual, bei dem neun Tropfen Blut aus dem linken Daumen geopfert werden, um die Kontur der Form Liliths als Enneagramm nachzuzeichnen. Die Zahl Neun hat bei beiden eine große Bedeutung, sowohl als Zahl des Egos als auch des Teufels. Beide Vereinigungen wurden im Anschluss an unseren Film verboten. Interessanterweise bin ich während meiner Recherchen auf ein neues Mysterium gestoßen. Ein viel größeres, als ich zunächst vermutet hatte. Offenbar reicht es bis in die höchsten Kreise. Moment, ich möchte dir etwas zeigen …« Sie raschelte in ihren Unterlagen.
Hannah fand, dass Leslie konfus wirkte. Satanisten, Geheimkulte? Wie es schien, hatte sich die Reporterin ordentlich verzettelt.
»Hier«, sagte Leslie kurzatmig und hielt Hannah ein grobkörniges Schwarz-Weiß-Foto entgegen. »Das ist es. Sorry für die schlechte Qualität, das Bild wurde hochvergrößert. Es ist ein Ausschnitt aus einer Szene, die 1972 für einen Spielfilm gedreht wurde. Ein Film, der in unmittelbarem Zusammenhang zu meinem Fall zu stehen scheint. Als ich das sah, musste ich sofort an dich denken.« Sie hielt das Bild nah an die Kamera. Hannah nahm die Füße vom Tisch und rutschte näher an den Monitor heran. Sie tippte auf Pause, damit sie genug Zeit hatte, die Aufnahme zu studieren.
Zu erkennen war ein Steinblock, um den halbkreisförmig ein paar Menschen standen. Sie hielten Fackeln in den Händen und waren kostümiert. Hannah empfand ein Gefühl der Beklommenheit, als sie die Figuren näher in Augenschein nahm. Sie trugen weite Umhänge und unterschiedliche Tiermasken – Ziegen, Kühe, Schweine und Esel. Die Form der Masken wirkte weder asiatisch noch amerikanisch oder afrikanisch. Sie sahen eher europäisch aus. Ähnlich den Hexenmasken, wie sie in Süddeutschland zum Fasching getragen wurden. Die Anwesenden versteckten ihre Gesichter unter weiten Kapuzen, die Hannah an die Heilige Inquisition erinnerten. Eine makaber aussehende Gesellschaft.
Der Steinklotz war mit einer Vielzahl von Bildsymbolen verziert, deren Wurzeln eindeutig im mediterranen Raum oder Mittleren Osten verortet waren. Wenn das eine Filmrequisite war, so hatten die Bühnenbildner ganze Arbeit geleistet. Das Ding wirkte verdammt echt. Gewiss, Hannah war keine Expertin, doch sie bildete sich ein, eine einfache Replik von der echten Sache unterscheiden zu können. Mit hundertprozentiger Sicherheit konnte man das erst sagen, wenn man es leibhaftig vor sich hatte. Das Komische war, dass Hannah das Gefühl hatte, das Ding schon einmal gesehen zu haben. Vor langer Zeit, an einem weit entfernten Ort. Aber sie kam nicht darauf, wo das gewesen sein könnte.
Die schlechte Bildauflösung wurde durch Heranzoomen nicht besser, also spielte sie das Video weiter ab.
»… du kannst erkennen, dass die Truhe ziemlich alt ist«, fuhr Leslie fort. »Die Gravuren sind starker Verwitterung ausgesetzt gewesen, aber ein Symbol ist recht gut erhalten. Warte, ich zeige es dir.« Sie zog ein zweites Bild hervor. »Würde mich brennend interessieren, was du davon hältst.«
Hannah drückte den Pausenknopf.
Zu sehen war ein Baum mit Früchten, der von zwei Steinböcken eingerahmt wurde. An seinen Wurzeln hatte der Bildhauer Wellen eingraviert, die Wasser symbolisierten. Über dem Wipfel prangten sternförmige Blütensymbole.
Jetzt erinnerte Hannah sich. Kein Zweifel, das Bild stellte einen Gaokerena dar, einen Lebensbaum. Er existierte vor allem in der persischen Mythologie. In Nimrud hatte sie Ähnliches gesehen, ehe dort alles vom IS zerstört worden war. Die Äste und Zweige waren gewunden, der Stamm glatt und ebenmäßig. Ein beliebtes Motiv auf Grabplatten oder Basreliefs. Während der Baum persisch zu sein schien, waren die Blüten und das Wasser in ihrer Ausgestaltung griechisch oder römisch. Eine Mischung verschiedener Stilrichtungen, die eine eindeutige Zuordnung schwierig machte.
Hannah runzelte die Stirn. Der Baum des Lebens war ein Symbol, das sich durch alle Weltkulturen zog. Seien es die Ägypter, die Inder, die Germanen, die Griechen, Hebräer oder Maya – überall stand der Baum für Fruchtbarkeit und Schöpfung. Warum er in einem Ausschnitt eines Films der 70er-Jahre zu sehen war, entzog sich allerdings ihrem Verständnis. Aber wie gesagt: Sie war keine Filmexpertin.
Sie sah sich den Rest von Leslies Botschaft an, weitere Informationen gingen aber nicht daraus hervor. Weder ließ sich die Reporterin dazu herab, ihr zu erklären, an was sie gerade arbeitete, noch teilte sie ihr mit, warum dieses Symbol sie interessierte. Zu dumm, dass dies eine Aufzeichnung war, sie hätte Leslie gerne die eine oder andere Frage gestellt.
Sie lehnte sich zurück. Leslie hätte die Mühen, Hannah ausfindig zu machen, nicht auf sich genommen, wenn sie nicht überzeugt davon wäre, dass es wirklich wichtig war. Sie war keine enge Freundin, gewiss, aber doch jemand, den Hannah respektierte.
Ihr kam eine Idee.
Soweit ihr bekannt war, ging der Flug ohnehin über Heathrow. Was, wenn sie auf dem Weg zu Leni und John einen kleinen Zwischenstopp in London einlegte? Sie konnte sich am Flughafen mit Leslie treffen, einen Kaffee trinken und sich mit ihr unterhalten. Vielleicht könnte sie ihren Besuch auch auf ein oder zwei Tage ausdehnen. Das sonnige Südengland würde ihr helfen, die Enttäuschung von Honduras zu verarbeiten.
Sie klappte den Laptop zu.
Die Sache war beschlossen. Südengland also. Lange her, dass sie zuletzt da gewesen war.
4
Juraküste, Südengland …
Die junge Frau rannte und rannte. Sie wusste nicht, wer sie war, sie kannte weder ihre Herkunft noch ihren Namen. Alles, was ihr benebelter Verstand ihr zurief, war: Renn! Fort von den Feuern, den Gesängen und dem Tanz. Fort von den Menschen in ihren Kutten, den Masken und Drogen. Hinein in die Nacht.
Animalischer Schweißgeruch lag in der Luft. Ihr Mund war wie ausgetrocknet, ihre Zunge schmeckte Ammoniak.
Sie tauchte unter einem niedrig hängenden Ast hindurch. Ihre Lunge schrie nach Erlösung.
Sie glaubte, teuflische Augen in ihrem Rücken zu spüren. SIE sahen sie. SIE spürten sie. Wenn SIE sie in die Finger bekamen, war es vorbei.
Ihre nackten Füße flogen über die Walderde. Zum Glück war sie einigermaßen sportlich. Zweige, Äste, Wurzeln huschten an ihr vorbei. Von Zeit zu Zeit stieß sie gegen eine Wurzel oder einen Stein. Doch sie ignorierte den Schmerz und rannte weiter. Schreckhaft und voller Panik. Wie ein wildes Tier.
Vor ihr schälte sich eine seltsame Form aus der Dunkelheit. Das wenige Licht, das durch die Zweige fiel, ließ keine Deutung zu. War das eine Mauer?
Sie verlangsamte ihren Schritt. Großer Gott, es war wirklich eine Mauer. Vier Meter hoch. Mindestens. Aus groben Steinen geschichtet. Feucht und unbezwingbar.
Sie blieb stehen und starrte nach links und rechts in die Dunkelheit. Ein schluchzender Schrei entstieg ihrer Kehle. Der Laut klang seltsam und fremd in dieser Umgebung.
Für den Bruchteil einer Sekunde war sie unachtsam, stolperte und fiel hin. Ihr Gesicht tauchte in Blätter und feuchte Walderde.