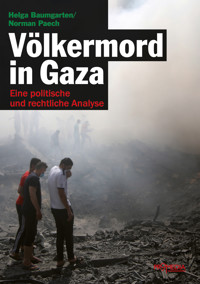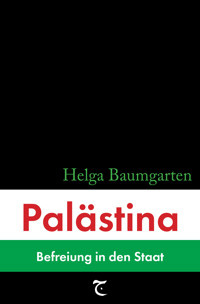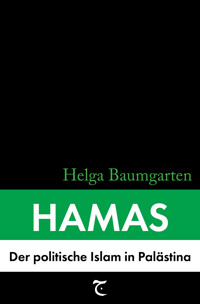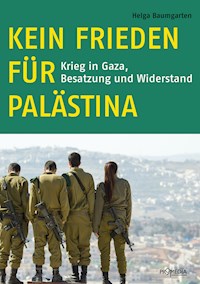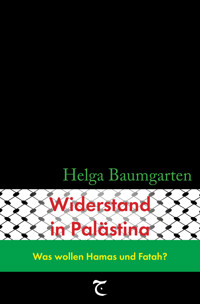
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gamila Basel
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Nahostkonflikt bleibt eine der drängendsten geopolitischen Fragen unserer Zeit. In diesem fundierten Werk analysiert Helga Baumgarten die historischen Wurzeln, die politischen Entwicklungen und die Dynamiken von Besatzung und Widerstand in Palästina. Mit einem erweiterten und aktualisierten Inhalt bietet das Buch eine tiefgehende Einordnung der aktuellen Ereignisse sowie mögliche Perspektiven für die Zukunft. Ein unverzichtbarer Beitrag für alle, die die Hintergründe dieses Konflikts verstehen wollen.I
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Helga Baumgarten
Widerstand in Palästina
Was wollen Hamas und Fatah?
Gamila Basel
Impressum
Erschienen bei Gamila Verlag, Basel, Schweiz
April 2025
© Helga Baumgarten
Erstveröffentlichung 2013 im Herder Verlag, Freiburg im Breisgau, als «Kampf um Palästina – Was wollen Hamas und Fatah?»
Satz & Covergestaltung: Enso Aellig
ISBN: 9783759262394
Inhaltsverzeichnis
Vorwort der Autorin zur Neuauflage 2025
Die Palästinafrage und kein Ende – Einleitung
I. «Terror»-Gruppen oder Befreiungsorganisationen? Die Ursprünge von Fatah und Hamas
Einleitung
Die Geschichte der Fatah
Die Geschichte der Hamas
II. Diplomatie oder Befreiungskampf? Der Konflikt zwischen Fatah und Hamas
Einleitung
Die erste Intifada und die Folgen
Der Osloer Verhandlungsprozess vom Weißen Haus bis Camp David
Die zweite Intifada und das Scheitern Oslos
III. Teilung als Lösung? Die Entwicklungen im Gazastreifen und der West Bank
Einleitung
Wahlen, 2004 bis 2006
Bruch und Teilung
Endnoten
Literatur
Anhang A: Eine kritische Analyse der palästinensischen Hamas
Einleitung
1. Wann, warum und wie wurde Hamas gegründet?
2. Ziele und Programme von Hamas
3. 2017: Neues Grundsatzprogramm
4. Die Hamas und Widerstand: politischer und bewaffneter Widerstand
5. Hamas am 7. Oktober 2023
Israel, der lange Krieg gegen Gaza und der 7. Oktober
Schluss
Anhang B: Hamas-Charta 2017
Danksagung
Vorwort der Autorin zur Neuauflage 2025
11 Jahre nach Erscheinen dieses Buches, damals unter dem Titel «Kampf um Palästina. Was wollen Fatah und Hamas?», ist nun endlich eine Neuauflage beim Basler Gamila-Verlag möglich geworden. Darüber freue ich mich riesig und möchte mich herzlich bedanken. Viele Leser des Buches haben den Herder-Verlag schon 2014/2015 aufgefordert, eine aktualisierte Fassung herauszubringen. Auch ich habe den Verlag gleich nach dem verheerenden Krieg von 2014 darauf angesprochen, bin aber leider abschlägig beschieden worden.
Inzwischen ist 2021 mein neuestes Buch «Kein Frieden für Palästina» erschienen, das den Krieg von 2021 zum Anlass nimmt, Palästina unter dem Aspekt des «langen Krieges gegen Gaza» und des Widerstandes gegen die Besatzung in Ost-Jerusalem und in der Westbank zu analysieren.
Damit ist jedoch eine Neuauflage dieser Arbeit von 2013 nicht vom Tisch. Ganz im Gegenteil. Die in diesem Buch unternommene Analyse zur Geschichte von Fatah und Hamas, zum Konflikt zwischen den beiden zentralen palästinensischen Organisationen, zu den Wahlen 2004 bis 2006 (Lokalwahlen, Präsidentschaftswahlen und schließlich Parlamentswahlen) und schließlich und nicht zuletzt zur israelischen «Politik» von 1948 bis heute gegenüber den Palästinensern, sprich zu Unterdrückung, Besatzung und Siedlerkolonialismus, kann unverändert stehen bleiben.
Die einzige Ergänzung, die mir sinnvoll erscheint, ist am Schluss der Verweis auf den Namen des Jungen aus Gaza, der die Palästinenser mit seiner Stimme, seinem Charme und seinem Charisma vereinte: Mohammad Assaf. Und den Abschluss bildet nun das Lied meines verstorbenen Mannes Mustafa al-Kurd aus der Zeit der ersten Intifada:
«Frag nicht nach meiner Partei Frag nicht nach meiner Religion Staub bin ich von diesem Land Ich bin ein Araber Palästinas»
Helga Baumgarten
Jerusalem, August 2024
Die Palästinafrage und kein Ende – Einleitung
Seit Jahrzehnten fordern die Palästinenser das Ende der Besatzung und ihre Befreiung im Rahmen eines unabhängigen palästinensischen Staates. Spätestens seit den Osloer Verträgen von 1993 unterstützt die internationale Gemeinschaft dieses Ziel und die Lösung des Konfliktes um Palästina im Rahmen einer Zweistaatenlösung. Bis heute haben die Palästinenser keine Fortschritte erzielt. Im Gegenteil, während sie bis in die Achtzigerjahre von der PLO vertreten wurden, sind sie heute zweigeteilt in Fatah und Hamas, in West Bank und Gazastreifen.
Den entscheidenden Hintergrund dafür, der allzu oft übersehen wird, bildet die seit 1967 andauernde israelische Besatzung. Sie ermöglicht und fördert einen Prozess kolonialistischer Besiedlung, der gerade heute nachdrücklich intensiviert wird – trotz scharfer Kritik sowohl aus Europa als auch aus den USA. Die neue, extrem rechtslastige israelische Regierung unter Benjamin Netanyahu zeigt keine Bereitschaft zu Verhandlungen über die Beendigung der Besatzung und die Errichtung eines souveränen palästinensischen Staates. Die Teilung der palästinensischen Gebiete, die der Konflikt zwischen Fatah und Hamas verschärfte, hatte Israel den Palästinensern schon 1991 oktroyiert und auch im Rahmen des Osloer Verhandlungsprozesses in den Neunzigerjahren nie aufgehoben, sondern vielmehr institutionalisiert. Inzwischen argumentiert die westliche Politik immer wieder, dass man den Palästinensern bei der Lösung des Konfliktes nicht helfen könne, solange sie nicht in der Lage seien, ihre eigenen Probleme zu lösen und sich auszusöhnen, um dann mit einer Stimme zu sprechen. Übersehen wird, dass man den Palästinensern auch nicht geholfen hat, als sie mit einer Stimme, der Stimme der PLO, sprachen.
Dieses Buch möchte einem politisch interessierten Leserpublikum Informationen und Analysen zur Beantwortung einer ganzen Reihe wichtiger Fragen bereitstellen, die sich tagtäglich im Anschluss an die neuesten Nachrichten und die aktuelle Berichterstattung aus der Region stellen. Beginnen möchte ich mit den Anfängen: Wer sind die Fatah und die Hamas, und wo liegen ihre historischen, politischen und ideologischen Ursprünge? Eine vollständige und umfassende Geschichte der beiden politischen Bewegungen zu schreiben, würde den Rahmen dieses Buches sprengen. Vielmehr sollen die wirklich relevanten Fragen zum tieferen Verständnis des aktuellen Konfliktes formuliert und beantwortet werden.
Was waren die Ziele der Fatah einerseits, der Hamas andererseits, und wie veränderten sich diese über die Jahre in sich neu herausbildenden politischen Kontexten? Welche Rolle spielte der Junikrieg 1967, und wie beeinflussten der Oktoberkrieg 1973 und schließlich die Camp-David-Verträge von 1978 das politische Programm der Fatah und der von ihr seit 1968/69 angeführten PLO?
Wann forderte die Fatah zum ersten Mal Unabhängigkeit für die Palästinenser und einen eigenen palästinensischen Staat, und wie veränderte sich diese Forderung inhaltlich seit Anfang der Siebzigerjahre weg von einem palästinensischen Staat anstelle des von den Palästinensern als illegitim betrachteten Staates Israel hin zu einer Zweistaatenlösung? Welche Rolle spielte dabei Yasir Arafat als dominierende Führungspersönlichkeit der palästinensischen Nationalbewegung, und welchen Einfluss hatte die Intifada, der palästinensische Aufstand gegen die israelische Besatzung seit 1987? Da eine Zweistaatenlösung heute weniger denn je als realistisch erscheint, soll gefragt werden, ob es darüber hinausweisende Lösungsansätze gibt.
1988, nach einem Jahr Intifada, schienen die Palästinenser unter der Führung von Arafat mit dem Beschluss des Palästinensischen Nationalrates, eine Zweistaatenlösung zu akzeptieren, an einem Höhepunkt ihrer politischen Entwicklung angekommen zu sein. Warum wurde diese damals realistische Lösung 1988 kategorisch von Israel abgelehnt? Wie erklärt sich die Entstehung der Hamas genau zu diesem Zeitpunkt, also zu Beginn der Intifada 1987 und zeitgleich mit der Bereitschaft der von der Fatah angeführten PLO, einen historischen Kompromiss zu akzeptieren? Was genau forderte die Hamas damals, und von wem wurde sie unterstützt? Wie haben sich die politischen Ziele der Hamas über die Jahre und Jahrzehnte hinweg verändert, und warum ist auch sie, ähnlich wie die Fatah, nach etwa zwanzig Jahren bei der Forderung nach einem palästinensischen Staat in den 1967 besetzten Gebieten angelangt?
In jedem Prozess der nationalen Befreiung, gerade auch im Kontext des Antikolonialismus, spielt die Frage der Strategie eine zentrale Rolle. In diesem Buch soll deshalb genau untersucht werden, wie die Fatah und die Hamas ihre Ziele erreichen wollten. Israels Weigerung, die Forderungen der Palästinenser als legitim zu betrachten, und der darauf aufbauende Versuch, die Palästinensische Nationalbewegung in allen ihren Teilen pauschal als Terrororganisation, oft noch mit dem Zusatz «antisemitisch», abzustempeln, ist gerade auch in Deutschland lange Zeit geteilt worden. Welche Rolle spielte dabei die Entscheidung der Fatah in den Sechzigerjahren für eine Strategie des bewaffneten Befreiungskampfes à la Vietnam, danach Ende der Achtzigerjahre das Auftreten der Hamas mit ihrem Ruf nach dem «jihad» im Sinne von bewaffnetem Widerstand, der sich religiös legitimierte? Wie wurde in Israel, aber auch hierzulande und überhaupt in Europa die Aufgabe des bewaffneten Kampfes seitens der Fatah und der PLO und die Option für Diplomatie und Politik aufgenommen, und warum ist Israel dennoch bis heute nicht bereit, eine Zweistaatenlösung umzusetzen? Ist es die Existenz der Hamas, die dies verhindert? Warum wurde die Bereitschaft der Hamas für einen palästinensischen Staat in den besetzten Gebieten, 2006 in ihrem Wahlprogramm und nach dem unerwarteten Wahlsieg in der Regierungserklärung klar ausgesprochen, nicht für ernst genommen und die Hamas damit als politischer Akteur akzeptiert, weder in Israel noch in Europa oder in den USA?
Bis heute bestimmt der Konflikt zwischen der nationalistischen Fatah und der von ihr kontrollierten PLO und der nationalreligiösen Hamas die palästinensische Politik. Warum und in welchem Kontext entstand und entwickelte sich dieser Konflikt? Vor allem aber ist zu fragen, warum er bis heute fast unlösbar erscheint und andauert, trotz immer neuer Versuche und Abmachungen, ihn zu beenden und zu einer Aussöhnung zu kommen, im Interesse der palästinensischen Gesellschaft mit ihrem Streben nach Freiheit und Unabhängigkeit.
Schließlich stellt sich gerade seit 2011 die Frage, wie sich der «Arabische Frühling» in Palästina auswirkte. Warum forderten die jungen palästinensischen Aktivisten, anders als ihre Altersgenossen in Tunesien und Ägypten, nicht «den Sturz des Regimes» bzw. im palästinensischen Fall der «Regimes» in Gaza und Ramallah, sondern vielmehr und sehr vehement die Aussöhnung zwischen Fatah und Hamas? Warum blieben auch sie erfolglos?
Angesichts der asymmetrischen Struktur des palästinensisch-israelischen Konflikts müssen die Politik und die Strategie Israels und wechselnder israelischer Regierungen im untersuchten Zeitraum von den Fünfzigerjahren bis heute immer als Hintergrund und gerade auch im Zusammenspiel mit den politisch-strategischen Entwicklungen der Palästinensischen Nationalbewegung, der Fatah wie der Hamas, in die Analyse mit einbezogen werden. Ohne den Einfluss der USA einerseits, Europas und der EU andererseits zu thematisieren, erscheint dies kaum möglich.
Die Lage in Israel/Palästina ist heute mehr denn je festgefahren. Eine Zweistaatenlösung ist nicht in Sicht, während gleichzeitig israelische Siedlungen erweitert werden. Das unverrückbar sich festsetzende und sich – im direkten wie im übertragenen Sinn – einbetonierende Besatzungsregime wird sowohl in Israel wie auch international zusehends nicht mehr als Besatzung verstanden und als solche kritisiert, abgelehnt und bekämpft. Man spricht vielmehr verharmlosend und irreführend von «Grenzkonflikten». Wie gehen die Palästinenser damit um, sowohl aufseiten der Fatah und der Hamas als auch innerhalb der palästinensischen Gesellschaft? Welche weiterführenden, alternativen Lösungsvorschläge diskutieren die Palästinenser heute, auch wieder aufseiten der Fatah und der Hamas wie überhaupt in der palästinensischen Gesellschaft? Können Israelis und Palästinenser als zwei Nationen mit verschiedenen nationalistischen Ideologien und unterschiedlichen Religionen, können Juden, Muslime und Christen in einem Staat als gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger zusammenleben? Ist also eine zukunftsweisende demokratische Lösung vorstellbar anstelle der Herrschaft eines Staates über eine andere Nation durch ein Besatzungsregime, anstelle der Beherrschung einer Nation durch eine andere, der Privilegierung einer Nation und einer Religion über eine andere Nation und über andere Religionen?
Teil I des Buches beschäftigt sich mit der Geschichte der Fatah von ihrer Gründung 1959 und ihrer Übernahme der PLO 1968/69 bis zur Unabhängigkeitserklärung 1988. Die Geschichte der Hamas wird verfolgt von ihrer Gründung zu Beginn der ersten Intifada im Dezember 1987 über ihre berühmt-berüchtigte Charta vom August 1988 bis zu ihrer kategorischen Ablehnung der Unabhängigkeitserklärung und der Zweistaatenlösung.
In Teil II wird der Konflikt zwischen Fatah und Hamas thematisiert und in drei Perioden analysiert:
– von der ersten Intifada 1987 bis zu den Madrider Verhandlungen 1991 bis 1993, also von der Entscheidung der Fatah für eine politisch-diplomatische Strategie und eine Zweistaatenlösung und der Ablehnung der Hamas dieser Strategie und dieser Lösung.
– von der Unterzeichnung der Osloer Prinzipienerklärung im Weißen Haus in Washington 1993 durch Yasir Arafat und Mahmud Abbas über die langen Jahre des erfolglosen und für die Palästinenser frustrierenden Osloer Verhandlungsprozesses hin bis zum Scheitern des zweiten Camp-David-Gipfels 2000 sowie vom Widerstand der Hamas gegen diesen Verhandlungsprozess und gegen das «System Oslo», von der verhängnisvollen Aufnahme von Selbstmordattentaten durch die Hamas nach dem Massaker in der Ibrahim-Moschee 1994, die erst 1997 gestoppt wurden, bis zur Rückbesinnung unter der Ägide von Scheich Ahmad Yassin auf die ursprünglichen Ziele der Hamas als einer nationalreligiösen Bewegung 1997 und danach.
– vom Scheitern Oslos nach dem Gipfel in Camp David im Juli 2000, dem Beginn der zweiten Intifada und dem Abgleiten in eine verheerende Gewaltspirale bis zum Tod der beiden historischen Führer von Fatah und Hamas, also von Yasir Arafat und Scheich Ahmad Yassin im Frühjahr bzw. im Herbst 2004.
Im dritten Teil werden die Wahlen in Palästina untersucht von den Lokalwahlen 2004 bis 2005 über die Präsidentenwahlen im Januar 2005 bis zu den Parlamentswahlen im Januar 2006. Der Wahlsieg der Hamas und seine Folgen werden ebenso analysiert wie die daraus letztendlich resultierende Teilung, die bis heute andauert. Abschließend wird nach den Gründen für das Andauern des Konfliktes und nach dem Ausbleiben nachhaltiger Wirkungen des Arabischen Frühlings auf Palästina gefragt.
Der Schlussteil schlägt den Bogen zurück zum Anfang des Buches, wenn die israelische Politik heute analysiert wird mit ihrer Weigerung, die West Bank an die Palästinenser zurückzugeben und die Besatzung zu beenden, und mit ihrem Bestehen auf Intensivierung des Siedlerkolonialismus. Auf diesem Hintergrund wird abschließend gefragt, wie sich die beiden palästinensischen Bewegungen Fatah und Hamas dieser Herausforderung stellen und welche Antworten sie bereithalten und wie sich die internationale Gemeinschaft dazu verhält.
Ziel dieser Arbeit ist es nicht nur, mit Hintergrundinformationen und politischen Analysen zu informieren und aufzuklären. Denn noch immer dominieren viel zu viele Vorurteile die öffentliche Diskussion, gerade über den israelisch-palästinensischen Konflikt und insbesondere über die Palästinenser und ihre politischen Vertreter. Diese Vorurteile sollen hier angesprochen und, so hoffe ich, gründlich widerlegt werden, auch wenn Einstein einmal gemeint hat, dass es einfacher ist, ein Atom zu spalten, als ein Vorurteil zu zerstören.
Das historische Palästina ist der Ort, an dem Wunder passiert sind. Wunder sind gerade heute wieder notwendig, damit die verheerende Besatzung und Dominierung Israels über die Palästinenser beendet wird, die letztlich für beide Seiten dieses so asymmetrischen Konfliktes so verhängnisvoll ist.
I. «Terror»-Gruppen oder Befreiungsorganisationen? Die Ursprünge von Fatah und Hamas
Einleitung
Wo liegen die Ursprünge der Fatah und der Hamas, und wie haben sie sich über verschiedene historisch-politische Perioden und in Reaktion auf immer neue politische Herausforderungen entwickelt? Diese Fragen werden uns im ersten Kapitel dieses Buchs beschäftigen. Der erste Teil dieses Kapitels widmet sich der Geschichte der Fatah, also der politischen Bewegung, die die palästinensische politische Bühne von 1968 bis 1988 dominierte. Eingeleitet wird dies durch eine kurze Nachzeichnung der ersten Jahre der Fatah, angefangen mit ihrer Gründung in Kuwait 1959 und den ersten Guerilla-Angriffen 1965 auf Israel, bis hin zur Übernahme der PLO, der Palästinensischen Befreiungsorganisation, Anfang 1969.1
Die Frage, warum und wie die Fatah sich für eine Zweistaatenlösung entschied und warum und wie sie vom bewaffneten Kampf gegen Israel zur Diplomatie schwenkte, also zu dem Versuch, eine Lösung des Konfliktes durch Verhandlungen zu erreichen, steht im Mittelpunkt des Hauptteils. Als Höhepunkt und Abschluss dieses Teils wird die Proklamation eines palästinensischen Staates in den von Israel seit 1967 besetzen Gebieten mit Jerusalem als Hauptstadt analysiert, die der Palästinensische Nationalrat im November 1988 einstimmig unterstützte.
Keine Geschichte der Fatah und der Palästinensischen Nationalbewegung kann geschrieben werden, ohne die Person von Yasir Arafat in den Mittelpunkt zu stellen. Yasir Arafat ist sicher der wichtigste Mann in der Gruppe von Palästinensern, die 1959 in Kuwait die Fatah gegründet haben. Seine Person ist aufs Engste verknüpft mit der Entwicklung der Fatah und deren wichtigsten programmatischen Veränderungen. Zweifellos hat er in dem langen Prozess zwischen 1973/74 und 1988 eine zentrale Rolle gespielt, an dessen Ende die Fatah und die PLO einen palästinensischen Kleinstaat in friedlicher Koexistenz mit Israel akzeptierten. Nur er war in der Lage, im Palästinensischen Nationalrat, dem palästinensischen Parlament im Exil, auf dessen Sitzung in Algier im November 1988 einen Konsens aller Mitglieder der PLO für diesen Staat zu erreichen und damit einen als historisch anzuerkennenden Verzicht auf den größeren Teil des historischen Palästina, in dem 1948 der Staat Israel errichtet worden war.
Schließlich wird die Ideologie der Fatah analysiert, die sich im Kontext der antikolonialen nationalen Befreiungsbewegungen herausgebildet hatte und sich an historischen Vorbildern wie Kuba, Algerien und Vietnam, aber auch China orientierte. In Algerien wurde das erste Büro der Fatah eröffnet, und China war eines der ersten Länder, dem eine Delegation der Fatah einen Besuch abstattete, um Unterstützung für den palästinensischen Befreiungskampf zu fordern.
Im Zentrum des zweiten Teils dieses ersten Kapitels steht die Geschichte der Hamas bis 1988, die zuerst und vor allem eine Geschichte des palästinensischen Zweigs der Muslimbruderschaft ist. Dieser Zweig entstand Mitte der Vierzigerjahre mit Zentren in verschiedenen palästinensischen Städten. Nach der Staatsgründung Israels und der Aufteilung von Rest-Palästina in einen von Ägypten kontrollierten Gazastreifen und ein von Jordanien schließlich annektiertes Westjordanland (heute wird vorzugsweise der englische Begriff West Bank benutzt, der eine wörtliche Übersetzung des arabischen Namens ist) entwickelten sich die beiden Zweige der palästinensischen Muslimbruderschaft entsprechend der Politik in Ägypten und in Jordanien. Das Ägypten Nassers verfolgte die Muslimbruderschaft und drängte sie in den Untergrund, König Husains Jordanien erkannte die Muslimbruderschaft an, legalisierte sie und akzeptierte sie als Akteur in der jordanischen Politik.2
Das 1967 errichtete israelische Besatzungsregime vereinte die West Bank und den Gazastreifen und brachte damit beide Zweige der Muslimbruderschaft wieder zusammen. Die israelische Besatzung gewährte den Muslimbrüdern alle Freiheit für deren religiöse Arbeit bis in die Mitte der Achtzigerjahre.
Als sich die Muslimbrüder in Gaza in einem längeren Prozess von der religiösen Arbeit weg und hin zur politischen Aktivität entwickelten, sollte sich das ändern. Aber bis in die ersten Monate der palästinensischen Intifada 1987/88 ließ die israelische Armee die Muslimbrüder und ab Dezember 1987 die Hamas relativ frei und ungehindert agieren.
Im Mittelpunkt dieses Teils steht die Frage nach den Zielen der Muslimbruderschaft und nach denen der Hamas, die im Dezember 1987, in der ersten Woche der palästinensischen Intifada, gegründet wurde. Thematisiert wird der Zusammenhang zwischen Ideologie und Programm der Muslimbruderschaft, die 1928 in Ägypten gegründet wurde und sich von dort über die Nachbarländer verbreitete, und der Hamas, die im Gazastreifen von den Führern der palästinensischen Muslimbruderschaft gegründet wurde.
Höhepunkt der Darstellung wird die Auseinandersetzung zwischen Hamas und Fatah über die Entscheidung des Nationalrates in Algier für einen palästinensischen Kleinstaat sein, den die Hamas kategorisch ablehnte.
Eine Geschichte der palästinensischen Muslimbruderschaft oder der Hamas wäre unvollständig ohne einen näheren Blick auf die zentrale Gründergestalt der Hamas, Scheich Ahmad Yassin, zu werfen. Scheich Ahmad Yassin hat die Politik der palästinensischen Muslimbrüder, vor allem aber der Hamas, nachdrücklich geprägt und bis zu seiner Ermordung durch einen israelischen Raketenangriff im Frühjahr 2004 bestimmt.
Ähnlich wie Yasir Arafat in der Fatah zeichnet Scheich Ahmad Yassin dafür verantwortlich, dass die Hamas in einem mit den Veränderungen innerhalb der Fatah vergleichbar langen Prozess3 von dem Ziel der Beseitigung Israels abrückte und sich für einen palästinensischen Staat in den besetzten Gebieten entschied, allerdings, und im Unterschied zur PLO unter Arafats Fatah, ohne die Anerkennung Israels.
Die Ideologie der Hamas ist, ebenfalls in klarem Kontrast zur Fatah, zuerst und vor allem religiös geprägt. Sie sieht die Lösung aller Probleme im und durch den Islam. Allerdings ist die Hamas mit ihrem ausgeprägten politischen Pragmatismus durchaus vergleichbar mit der Fatah und der Politik Arafats. Wenn wir die Fatah als palästinensisch-nationalistisch definieren, dann ist die Definition «nationalreligiöse» Hamas sicher die passendste. Schließlich weist dieser Begriff sofort auf das israelische Gegenstück zur Hamas, die Siedlerbewegung und ihre ebenfalls nationalreligiöse Ausrichtung sowie ihren politischen Maximalismus, jedoch ohne den Pragmatismus der Hamas.
Die Geschichte der Fatah
Unter dem Decknamen al-Asifa (Der Sturm) begann die Fatah ab dem Januar 1965 ihre ersten Guerilla-Angriffe gegen Israel, u. a. mit Bombenanschlägen gegen das im Bau stehende neue israelische Bewässerungssystem, durch das Wasser aus dem See Genezareth ins zentrale Israel gepumpt werden sollte. In der pro-nasseristischen Presse der Zeit wurden die Hintermänner dieser Aktion als Agenten der CENTO (regionales Pendant zur NATO) denunziert. Denn arabische Nationalisten und Anhänger Nassers befürchteten, dass Israel derartige Anschläge als Vorwand für einen militärischen Gegenschlag gegen Ägypten benutzen würde. Nur die USA, denen Nassers dominante regionale Führungsstellung schon lange ein Dorn im Auge war, konnten dahinterstecken.
Für Israel war al-Asifa schlicht eine neue arabische Terrororganisation. Jeder Grenzübergang palästinensischer Vertriebener und Flüchtlinge seit 1948 und jeder bewaffnete Übergriff an der Grenze zu Israel war seitdem als Terroraktion denunziert worden. Gleichzeitig attackierte Israel die Aktion als antisemitisch und stellte damit diesen Angriff in die lange Traditionslinie einer Polemik, die einen Bogen schlug von Hajj Amin Al-Husaini, dem palästinensischen nationalistischen Führer aus der Mandatszeit, der ins Nazi-Deutschland geflüchtet und dort mit der Nazi-Führung kollaboriert hatte, bis zu al-Asifa.
Wer waren die Leute, die sich hinter al-Asifa bzw. hinter der Fatah verbargen?
1948, in dem Jahr, als der Staat Israel auf der Basis eines UN-Beschlusses gegründet wurde, wurden etwa eine Dreiviertelmillion Palästinenser aus dem Gebiet des neuen Staates durch die Haganah, aus der die israelische Armee entstand, sowie durch verschiedene kleinere jüdische bewaffnete Gruppen mit Waffengewalt vertrieben. Viele Palästinenser flüchteten vor der Gewalt der kriegerischen Auseinandersetzungen in die angrenzenden arabischen Staaten. Die ersten Jahre des Flüchtlingsdaseins waren dominiert von der Hoffnung auf baldige Rückkehr. Im Verlauf der Fünfzigerjahre wurde jedoch deutlich, dass daran nicht zu denken war. Politisch bewusste junge Menschen erkannten, dass ohne ein aktives Engagement im Rahmen neuer politischer Organisationen keine Änderungen zu erwarten waren. Viele engagierten sich innerhalb der Bewegung der Arabischen Nationalisten, die in Beirut Anfang der Fünfzigerjahre entstand. Sie erhoben den ägyptischen Präsidenten Jamal Abdel Nasser zum Nationalhelden, der Palästina durch einen panarabischen Militärschlag befreien sollte, weshalb sie auf ihn alle ihre Hoffnungen setzten.
Andere junge Palästinenser waren nach dem Abschluss von Schule und Studium in die Golfstaaten migriert, um dort Arbeit zu finden. Die sich rapide entwickelnde Erdölwirtschaft bot Arbeitsplätze für alle Interessierten, nicht nur für Arbeiter, sondern gerade auch für junge Ingenieure, Lehrer und Verwaltungsfachleute mit einem Universitätsdiplom. Aus Saudi-Arabien, Katar und v. a. Kuwait mussten sie mitverfolgen, wie der neu gegründete Staat Israel sich entwickelte, während die Palästinenser in den Flüchtlingslagern rund um Israel oder in der Arbeitsmigration im Golf ohne jede Perspektive lebten. Als die israelische Regierung ihre Pläne zum Bau eines landesweiten Bewässerungssystems publik machte, in dessen Rohren und Kanälen Wasser aus dem See Genezareth abgepumpt wurde, brachte dies den Wendepunkt für die jungen Migranten im Golf. Sie befürchteten, dass Israel nun Tausende neuer Einwanderer würde aufnehmen können, und meinten deshalb, dass sie jetzt handeln mussten, um den Palästinensern eine politische Zukunftsperspektive in ihrem Heimatland zu erhalten.
Zwei Gründungsgeschichten werden innerhalb der Fatah überliefert. Die erste und einflussreichere, vor deren Hintergrund die Gründung Fatahs jedes Jahr am 1. Januar gefeiert wird, ist oben angeführt: die Aufnahme des bewaffneten Kampfes gegen Israel im Januar 1965. Die zweite, die nur in der Literatur über die Fatah und in den Erinnerungen ihrer Gründer und politischen Führer zu finden ist, hat ihren Schauplatz in Kuwait im Jahre 1959. Dort soll sich eine Gruppe von jungen palästinensischen Arbeitsmigranten getroffen haben, unter anderem angeführt vom Ingenieur Yasir Arafat, um eine neue politische Bewegung zu gründen. Sie setzten auf einen erst noch zu verbreitenden palästinensischen Nationalismus, auf ein «Palästina zuerst», gegen den in der arabischen Welt hegemonialen arabischen Nationalismus, der seit Mitte der Fünfzigerjahre unter der Führung des ägyptischen Präsidenten Jamal Abdel Nasser stand und der die Einheit der arabischen Staaten als Vorbedingung für die Befreiung Palästinas forderte.
Dies erklärt auch, warum die Gründung in Kuwait stattfand, an der Peripherie der vom arabischen Nationalismus dominierten Region von Ägypten bis zum Irak. Denn nur dort war es problemlos möglich, Gegenentwürfe zu Nassers Nationalismus zu entwickeln. Die neue Bewegung nannte sich Fatah – Bewegung zur Befreiung Palästinas (harakat at-tahrir al-filastini, später harakat at-tahrir al-watani al-filastini, also Nationalbewegung zur Befreiung Palästinas). Ihre erste und zentrale Aufgabe für die kommenden Jahre war es, die Palästinenser in der Diaspora für den palästinensischen Nationalismus zu mobilisieren. Ihr wichtigster Konkurrent waren die arabischen Nationalisten, allen voran die Bewegung der Arabischen Nationalisten, angeführt vom Palästinenser Dr. George Habash, sowie andere arabisch-nationalistische Organisationen verschiedenster Prägung (Baath-Partei, Syrische Nationalisten der SSNP etc.). Vor allem aber standen sie in direkter Konkurrenz zu Jamal Abdel Nasser, dem Symbol des arabischen Nationalismus.
Im Gegensatz zu Nassers Aufruf zur Herstellung der arabischen Einheit als Vorbedingung für die Befreiung Palästinas setzten sie auf die besondere palästinensische Identität und forderten in letzter Konsequenz einen palästinensischen Staat. Mit der Strategie des bewaffneten Kampfes bzw. einem nationalen Befreiungskampf à la Algerien, Kuba, China und Vietnam, angeführt von Palästinensern, wollten sie dies durchsetzen. Allerdings ist in Interviews mit führenden Fatah-Strategen auch zu lesen, das wichtigste Ziel der Guerilla-Angriffe gegen Israel sei gewesen, die arabischen Staaten mit ihren regulären Armeen regelrecht in die Konfrontation mit Israel zu zwingen.
Damit stellte sich die junge Fatah-Bewegung von Anfang an, also seit ihrer Gründung 1958/59 bzw. seit 1965, als die ersten Guerilla-Angriffe gegen Israel durchgeführt wurden, in den zeitgenössischen historisch-politischen Kontext der nationalen Befreiungsbewegungen, die mit ihrem Erfolg und ihrer Unabhängigkeit – von China über Kuba und Algerien bis zuletzt in Vietnam – dem Zeitalter des Kolonialismus ein Ende setzten. Ihre Tragödie sollte nicht zuletzt Resultat ihrer historischen «Verspätung» sein. Als die Palästinenser Ende der Sechziger-/Anfang der Siebzigerjahre ihren «Befreiungskampf» tatsächlich aufnahmen, ging der Vietnamkrieg mit dem Abzug der amerikanischen Truppen aus Südvietnam zu Ende. Damit hatte eine neue historische Periode begonnen, in der für nationale Befreiungsbewegungen und Guerillakriege kein Platz und international auch kein Verständnis mehr bestand. Hätte die Fatah ihren Befreiungskampf fünfzehn Jahre früher begonnen, hätte die palästinensische Geschichte vielleicht einen anderen Verlauf genommen.
Aber dessen waren sich die jungen politischen Führer der Fatah, allen voran Yasir Arafat, nicht bewusst. Sie waren vielmehr davon überzeugt, mit ihrem politisch-militärischen Kurs Palästina befreien und dem Flüchtlingsdasein der Palästinenser ein Ende bereiten zu können.
In den Anfangsjahren der jungen Bewegung von 1958/59 bis Ende 1964, aber auch nach Aufnahme des «bewaffneten Kampfes» gegen Israel im Januar 1965 war ihr kaum Erfolg beschieden, und sie konnte nur sehr wenige Palästinenser für sich und ihre Ziele gewinnen. Die meisten Palästinenser sahen den arabischen Nationalismus, die Herstellung der arabischen Einheit und die Unterstützung des ägyptischen Präsidenten Nasser als den einzig sinnvollen Weg, um das Palästina der Periode vor 1947/48 wiederherzustellen und die Rückkehr der Flüchtlinge zu ermöglichen. Fatah konnte Unterstützung vor allem in den Golfstaaten und unter palästinensischen Studenten in Europa mobilisieren, also dort, wo Nasser kaum Einfluss ausübte.
Die ersten Guerilla-Operationen gegen Israel durch al-Asifa/Fatah änderten daran relativ wenig. Zwar entwickelte sich eine erste innerpalästinensische Diskussion um die beste Strategie zur palästinensischen Befreiung zwischen den arabischen und den palästinensischen Nationalisten in den Seiten von Filastin (Palästina), einer von dem palästinensischen arabisch-nationalistisch eingestellten Schriftsteller Ghassan Kanafani herausgegebenen Beilage zur nasseristischen Beiruter Tageszeitung al-Muharrir. Aber dies blieb eine Diskussion zwischen Militanten ohne Auswirkung auf die breitere Gesellschaft.
Erst der Junikrieg Israels gegen Ägypten, Syrien und Jordanien und die israelische Besatzung all der Teile des historischen Palästina, die Israel 1948 nicht hatte erobern können (oder wollen) bzw. die im UN-Teilungsplan von 1947 für einen palästinensischen Staat vorgesehen waren, schufen eine neue Situation. Vor dem Hintergrund dieser völlig neuen Realität nahm die Entwicklung der Fatah einen quantitativen und qualitativen Sprung nach vorn.
Die Auseinandersetzung um den besten Kurs zur Befreiung Palästinas zwischen arabischen Nationalisten, die auf einen von Ägypten unter Nasser geführten konventionellen Krieg setzten, und den jungen Fatah-Aktivisten, die im Alleingang den bewaffneten nationalen Befreiungskampf zu praktizieren versuchten, war das eine Thema, das die Jahre vor dem Junikrieg 1967 dominierte. Die zweite Auseinandersetzung drehte sich um die Frage, wer die Palästinenser repräsentiere.
Mit der Gründung der Palästinensischen Befreiungsorganisation PLO, die 1964 ihre konstituierende Sitzung in Jerusalem abhielt, war Nasser den jungen palästinensischen Nationalisten zuvorgekommen. Die Palästinenser im Westjordanland und in der Diaspora nahmen die PLO, deren Gründung Nasser initiiert und die er letztlich auch ermöglicht hatte, grundsätzlich positiv auf. Sie erhielt als neue offizielle Vertretung der Palästinenser breite Unterstützung. Alle Diasporagemeinden schickten ihre Vertreter zu den ersten Sitzungen der PLO, und auch eine kleine Gruppe von Fatah-Gründern sah sich genötigt, ebenfalls zur Gründungsversammlung zu kommen.
Großes Vertrauen brachten sie der PLO und ihrem ersten Vorsitzenden Ahmad Shuqairi aber nicht entgegen. In ihren Augen setzte die PLO lediglich die Politik aller arabischen Regierungen seit 1948 fort, eine Politik der leeren Worte, der keine Taten folgten. Fatah dagegen wollte Taten sehen. Nicht zuletzt in direkter Reaktion auf die Gründung der PLO begannen Fatah-Aktivisten Anfang 1965 mit Guerilla-Angriffen gegen Israel.
Genauso wenig aber, wie sie sich in der breiten Bevölkerung mit ihrem Appell zum Guerillakrieg hatten durchsetzen können, gelang es den jungen Fatah-Gründern, einen Gegenpol zur PLO und ihrer enormen Anziehungskraft zu bilden. Schließlich stand hier eine Institution, die der ägyptische Präsident als Repräsentant und Symbolfigur des arabischen Nationalismus unterstützte, gegen eine eher obskure Organisation unter Führung völlig unbekannter junger Leute. Auch das sollte sich nach dem Junikrieg 1967 grundsätzlich ändern.
Der Junikrieg 1967 und die Folgen
Im Junikrieg 1967 besiegte die israelische Armee alle Armeen der arabischen Anrainerstaaten vernichtend und fügte damit vor allem dem ägyptischen Präsidenten Nasser eine Niederlage von so verheerenden Ausmaßen zu, dass er sich nicht mehr von ihr erholen konnte. Die West Bank mit Ost-Jerusalem inklusive der Jerusalemer Altstadt und der Gazastreifen wurden von der israelischen Armee besetzt. Seitdem kontrolliert Israel das gesamte historische Palästina aus der Periode vor 1948.
Für die gesamte arabische Region schuf dies eine völlig neue Situation. Der arabische Nationalismus, angeführt von Nassers Ägypten, war als Ideologie und politisches Programm nachhaltig angeschlagen und hinterließ eine große ideologisch-programmatische Leere. Mit der Besetzung der West Bank und des Gazastreifens waren die Palästinenser vor völlig neue Herausforderungen gestellt, auf die niemand vorbereitet war, da man eine solche Entwicklung nie für möglich gehalten, geschweige denn vorausgesehen hatte. Die Palästinenser hatten vielmehr gehofft, dass die arabische Nation, angeführt von Nasser, dem «Spuk» Israel bald ein Ende setzen und die Rückkehr aller Vertriebenen und Flüchtlinge in ihre Heimat ermöglichen würde.
Für Yasir Arafat, den rührigsten Aktivisten der jungen Fatah, stellten sich jedoch keine Fragen. Für ihn musste der palästinensische Befreiungskampf, so wie ihn die Fatah 1965 aufgenommen hatte, sofort in die neu besetzten Gebiete hineingetragen werden. Anstelle des arabischen Nationalismus war nun die Zeit des palästinensischen Nationalismus gekommen. Und von jetzt an sollten palästinensische Freiheitskämpfer, ähnlich wie ihre Vorläufer in Algerien oder ihre Vorbilder in Kuba und Vietnam, um die Befreiung Palästinas kämpfen, ohne darauf warten zu müssen, dass die regulären arabischen Armeen zum Krieg gegen Israel bereit wären.
Der Versuch der Fatah, angeführt von Arafat persönlich, in der West Bank eine revolutionäre Basis nach dem Beispiel Chinas oder Vietnams aufzubauen, scheiterte innerhalb weniger Wochen. Arafat gelang es aber, seiner bevorstehenden Verhaftung zu entkommen und nach Jordanien zu flüchten. Dort führte er seinen aktionistischen Kurs unbeirrt fort. Die Fatah konzentrierte alle ihre Aktivitäten aufs Jordantal, wohin junge Palästinenser aus der ganzen Welt strömten, um sich auf den Guerillakampf gegen Israel vorzubereiten, meist nach nur kurzen Trainingskursen in Algerien, Syrien oder Ägypten.
Die israelische Armee wollte diesem Treiben nicht tatenlos zuschauen. Man war im Militär optimistisch, dass nach dem Zerschlagen jeglicher Ansätze zu Widerstand in den neu besetzten Gebieten innerhalb weniger Monate auch die sich neu formierende Guerillabewegung in Jordanien im Rahmen eines groß angelegten Angriffs endgültig besiegt werden könne. Nach ihrem unangefochtenen Sieg gegen die arabischen Armeen erwarteten die israelischen Militärs keine Gegenwehr von den palästinensischen Freischärlern.
Die «Schlacht von Karama», wie sie von den Palästinensern genannt wird, nahm aber einen anderen Verlauf. Die jordanische Armee hatte die Palästinenser von dem unmittelbar bevorstehenden israelischen Angriff informiert. Sich selbst hatte sie in Stellung gebracht, um mit schwerer Artillerie den israelischen Vormarsch zu stoppen. Der Widerstand der jungen palästinensischen Guerilleros, die sich zum Teil mit bloßem Körper oder mit einfachen Panzerfäusten den anrollenden Panzern in den Weg stellten, war die große Überraschung für die israelische Armee. Entscheidend für den Verlauf der «Schlacht» sollte aber das Eingreifen der jordanischen Artillerie werden, die die israelische Armee schließlich zum Rückzug zwang: 28 Tote, 70 Verletzte, zerstörte und in Karama zurückgelassene Panzer. – Karama hatte den Mythos einer unschlagbaren israelischen Armee in der arabischen Gesellschaft nachhaltig ins Wanken gebracht. Dafür war es kaum von Interesse, dass die Palästinenser wesentlich höhere Verluste erlitten hatten als die israelischen Angreifer, mit über hundert Toten, also etwa einem Drittel der in Karama stationierten Guerilleros.
Der Fatah verhalf diese Schlacht zu einem ersten großen Erfolg und machte sie innerhalb eines Tages zum wichtigsten Akteur auf der Bühne der palästinensischen und arabischen Politik. Der palästinensische Guerillero oder fida’i trat an die Stelle des bisherigen Helden der arabischen Welt, Jamal Abdel Nasser.
Fatah-Führer Abu Iyad erinnert sich:
«Die Schlacht von Karama wurde in der gesamten arabischen Welt als glänzender Sieg gefeiert, und um unsere Heldentaten wurden Legenden gewoben… Die palästinensischen Volksmassen tobten vor Begeisterung. Seit Jahrzehnten hatte man sie verhöhnt und gedemütigt. Der Sieg von Karama (Karama, also der Ortsname des Dorfes und Flüchtlingslagers im Jordantal, ist zu übersetzen mit «Würde», «Ehre», HB), für sie der erste Schritt zur Befreiung, erfüllt sie nun mit Stolz. Zu Tausenden… wollten die Jungen ebenso wie die Alten Fatah beitreten.»4
Sein Mitstreiter Abu Jihad beschreibt aus der Erinnerung eine Szene in Jordanien direkt im Anschluss an die Schlacht:
«Einen Tag nach der Schlacht saßen wir im Schatten einiger Bäume am Stadtrand von as-Salt (jordanische Stadt in den Bergen oberhalb von Karama, HB). Vor uns wuchsen die Schlangen der Freiwilligen, die sich der Revolution (also der Fatah, die sich abwechselnd als Fatah oder seit Karama als «Revolution» bezeichnete, HB) anschließen wollten. Von morgens sieben bis abends acht Uhr nahmen wir Aufnahmeanträge entgegen.»5
Selbst der jordanische König Husain ließ sich nach Karama zu dem Ausspruch hinreißen: «Wir werden alle Fida’iyun (Fedayin) sein.»6
Den Entschluss, sich dem Angriff der israelischen Armee ungeachtet aller Guerillaregeln entgegenzustellen und den direkten Kampf aufzunehmen, hatte Yasir Arafat gefasst. Mit einer Rede vor den etwa 300 Guerilleros in Karama legte er den Grundstein für den politischen Durchbruch der Fatah: «Die arabische Nation blickt auf uns. Wir müssen unsere Verantwortung als Männer auf uns nehmen, mit Mut und Würde. Wir müssen den Begriff des Standhaltens in dieser Nation wieder zum Leben erwecken. Wir müssen den Mythos von der unbesiegbaren israelischen Armee ein für alle Mal zerstören.»7
Arafat hatte damit eine zutiefst politische Entscheidung getroffen und sich als Politiker, nicht als Militär erwiesen und eben damit ein potenziell vorzeitiges Ende des palästinensischen Widerstandes verhindert. Infolge der Überbetonung der mobilisatorischen Rolle des bewaffneten Kampfes gab es innerhalb der Fatah und innerhalb des gesamten palästinensischen Widerstandes in dieser Periode keine grundsätzliche Debatte über dessen Sinn und Zweck. Keiner fragte, inwieweit und ob überhaupt diese Strategie die Palästinenser ihrem Ziel der Befreiung näher bringen würde. Auch das Scheitern der Aufnahme des bewaffneten Kampfes 1967 in der von Israel besetzten West Bank wurde nie auch nur ansatzweise kritisch analysiert. Man optierte stattdessen für weitgehend unreflektierten Aktionismus.
Nach Karama wurde die Fatah zur führenden Bewegung innerhalb der palästinensischen Nationalbewegung, die sich seitdem vorzugsweise «palästinensischer Widerstand» nannte. Arafat wiederum wurde zum offiziellen Sprecher der Fatah ernannt, nicht zuletzt infolge seiner historisch zu nennenden Entscheidung. Innerhalb kurzer Zeit übernahm er in einem weiteren Schritt die Führung der Fatah und wurde in dieser Position auch von allen Gründern anerkannt. Die Wahl zum Vorsitzenden des Exekutivkomitees der PLO im Februar 1969, knapp ein Jahr nach Karama, stellte Arafat an die Spitze der neuen palästinensischen Nationalbewegung, des palästinensischen Widerstandes. Damit führte er nicht nur die inzwischen größte und wichtigste palästinensische Bewegung, Fatah, an, sondern auch die PLO, die allgemein anerkannte offizielle Vertretung der Palästinenser. In knapp fünf Jahren war es der Fatah, jener obskuren kleinen Bewegung aus Kuwait, deren Vertreter bei der Gründungsversammlung der PLO in Jerusalem keiner beachtet hatte, gelungen, die Führung der PLO zu übernehmen und eine neue Ära in der Politik des palästinensischen Nationalismus zu beginnen und zu bestimmen.
Die palästinensische Nationalcharta von 1964 wurde 1968 geändert durch Einfügung eines entscheidenden neuen Absatzes in Artikel 9: «Der bewaffnete Kampf ist der einzige Weg zur Befreiung Palästinas.» Als politisches Ziel wurde «die vollständige Befreiung Palästinas» festgehalten.8
Für kurze Zeit vertrat die Fatah in den Jahren 1968/69 bis 1970/71 eine im damaligen zeitgenössischen politischen Kontext überraschende politische Lösung. Statt dem Entweder-Oder zwischen Israel und Palästina, also einem ausweglosen Nullsummenspiel, hatten junge Fatah-Aktivisten Anfang 1968, noch vor Karama, eine Vision entwickelt, die Palästinensern und jüdischen Israelis gleichermaßen eine Zukunft in einem gemeinsamen Staat ermöglichen sollte. Dieser Staat sollte ein demokratischer Staat für alle drei im Lande vertretenen Religionsgemeinschaften sein, also Muslime, Christen und Juden.
«Heute hat das arabische Volk von Palästina beschlossen, sein Schicksal in seine eigene Hand zu nehmen. Heute stellen sie mit Waffen und Mut ihre verlorene Würde wieder her. Morgen, nach einem langen und beharrlichen Kampf, … in dem viele Märtyrer fallen …, werden sie ihr geliebtes Vaterland wieder zum Leben erwecken. Fatah und das gesamte palästinensische Volk glauben an die Gerechtigkeit ihrer Sache und an ihren unausweichlichen Erfolg. Sie wissen auch, dass an diesem Tag die Flagge Palästinas über einem befreiten, demokratischen und friedlichen Land wehen wird, dass dann eine neue Ära beginnt, in der palästinensische Juden wieder Seite an Seite leben werden mit den ursprünglichen Besitzern dieses Landes, den arabischen Palästinensern.»9
Die Reaktion aus Israel war schroff ablehnend. Und auch in der palästinensischen Gesellschaft stieß diese Idee kaum auf Unterstützung. Wie die israelische Regierung auf einem jüdischen Israel bestand, so wollten die meisten Palästinenser ein palästinensisches Palästina ohne jüdische Israelis. Spätestens Anfang der Siebzigerjahre war vom Programm des (säkularen) demokratischen Staates kaum mehr die Rede.
In den darauffolgenden zwanzig Jahren zwischen 1968/69 und 1988 sollte sich die Politik der Fatah und der von ihr durch Yasir Arafat angeführten PLO grundlegend ändern. Ging es 1968/69 noch um die vollständige Befreiung Palästinas und damit um die Errichtung eines palästinensischen Staates an der Stelle von Israel, wurde ab 1988 ein palästinensischer Kleinstaat in friedlicher Koexistenz mit Israel als politisches Ziel der Palästinenser festgelegt. Setzte man 1968/69 den bewaffneten Kampf als einzig mögliche Strategie zur Befreiung fest, dominierten spätestens ab 1988 Diplomatie und Politik.
Wie konnte es zu diesen grundlegenden Änderungen kommen, und wer setzte sie durch?
Die langen Jahre bis 1988 waren bestimmt von immer neuen militärischen Auseinandersetzungen und immer neuen Niederlagen der Palästinenser, angeführt von der Fatah unter Yasir Arafat. Worum ging es dabei?
Die schlichte Präsenz des palästinensischen Widerstandes in den verschiedenen arabischen Staaten rund um Israel, also in Jordanien, Syrien und im Libanon, musste zu massiven Konflikten führen. Schließlich stellte die Präsenz und Aktivität von Hunderten, ja Tausenden von bewaffneten palästinensischen Kämpfern die Souveränität dieser Staaten infrage, da sie das staatliche Gewaltmonopol effektiv außer Kraft setzten. Selbst wenn die Fatah in der Lage gewesen wäre, das von ihr theoretisch vertretene Prinzip der Nichteinmischung in die Angelegenheiten der Staaten, die sie aufgenommen hatten, auch praktisch durchzusetzen, wären Konflikte unausweichlich gewesen.
Diese Konflikte müssen hier in der gebotenen Kürze dargestellt und analysiert werden, um den Strategie- und Politikwechsel der Fatah zu verstehen.
Der «Schwarze September» und die endgültige Vertreibung des Widerstandes aus Jordanien (1970 –71)
Das angesprochene Dilemma führte zu den schweren militärischen Zusammenstößen zwischen der jordanischen Armee und den palästinensischen Freischärlern im September 1970, die als «Schwarzer September» in die Geschichte eingingen. Die demografisch-politische Situation im haschemitischen Königreich Jordanien war sehr kompliziert. Nach inoffiziellen Schätzungen lebten dort seit 1948 mehr Palästinenser als Jordanier. 1948 waren sie in einer ersten Flüchtlingswelle nach Jordanien gekommen, davon etwa 250 000 in die West Bank und über 70 000 nach Transjordanien östlich des Jordanflusses. Nach der Annexion der West Bank durch Jordanien 1950 wurden alle Palästinenser zu jordanischen Staatsbürgern erklärt. 1967 kam infolge des Junikrieges eine zweite Flüchtlingswelle mit ungefähr 250 000 Palästinensern über den Jordanfluss ins Land.
Das forderte von den politischen Führern der Palästinenser, an erster Stelle von Yasir Arafat, eine ständige Gratwanderung. Nur mit sehr großem politischem und diplomatischen Geschick und feinstem Gespür für die jeweilige Situation hätte die Fatah an ihrem Ziel festhalten können, den Widerstand aufzubauen, ohne die haschemitische Monarchie unter König Husain zu provozieren. Zwei Aspekte der Wirklichkeit des Widerstandes in Jordanien verhinderten dies schon im Ansatz. Die palästinensischen Freischärler in Jordanien waren keineswegs als militärische Truppe organisiert, sondern bildeten eher eine bunte Ansammlung bewaffneter Verbände ohne ein klares zentrales Kommando. Eine vollständige Kontrolle des Widerstands konnte die Fatah-Führung deshalb in diesem Zeitraum wohl nie etablieren. Ihr fehlten sowohl die Erfahrung, das Know-how als auch der institutionelle Rahmen und damit einhergehend die notwendige Machtposition. Erschwerend kam hinzu, dass die palästinensische Linke, auch wenn sie nur eine kleine Minderheit repräsentierte, den Sturz der haschemitischen Monarchie anstrebte. Einige ihrer Führer lebten in der Illusion, in Jordanien ein palästinensisches Hanoi schaffen zu können.
Die direkte Provokation ging 1970 von der linken PFLP (Volksfront für die Befreiung Palästinas) unter George Habash aus. In einer groß angelegten Operation entführten ihre Aktivisten mehrere Flugzeuge internationaler Fluggesellschaften, die bei Amman zur Landung gezwungen und dort gesprengt wurden, nachdem Passagiere und Besatzung die Flugzeuge verlassen hatten und in Sicherheit gebracht worden waren.
König Husain entschied sich für einen Frontalangriff gegen den gesamten palästinensischen Widerstand. Tausende von Opfern waren die Folge, vor allem in der Zivilbevölkerung in den großen palästinensischen Flüchtlingslagern außerhalb von Amman. Die überlegene jordanische Armee mit mindestens 65 000 Soldaten schlug die Fedayin, die über höchstens 15 000 bis 20 000 Bewaffnete verfügten, vernichtend. Sie wurden zunächst in den Norden Jordaniens vertrieben. Im Juni 1971 folgte dann in Ajlun ein weiterer Schlag der Armee gegen den Widerstand und dessen Abzug aus Jordanien. In der historischen Erinnerung der Palästinenser leben diese Kämpfe weiter als «Schwarzer September».10
Der Versuch der Fatah, eine stabile Basis für den Guerillakampf gegen Israel aufzubauen, war damit gescheitert. Hani al-Hasan, Mitglied der Führungselite der Fatah, bemerkt rückblickend: «Ich glaube, wir haben Jordanien verloren, weil Arafat sich weigerte, die Linken zur Disziplin zu rufen … Als wir uns für einen politischen Kurs entschieden hatten, nämlich die Zusammenarbeit mit König Husain, hätten wir alle disziplinieren und bestrafen müssen, die diesen Kurs nicht akzeptierten und die einen Waffenstillstand nach dem anderen brachen, den wir gerade mit dem König ausgehandelt hatten.»11
Arafat aber hatte als klassischer Konsenspolitiker auf Ausgleich und Kooptation gesetzt.