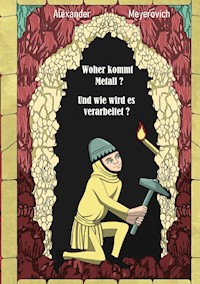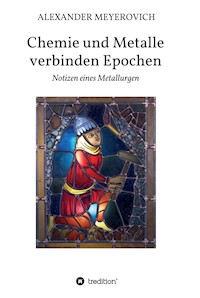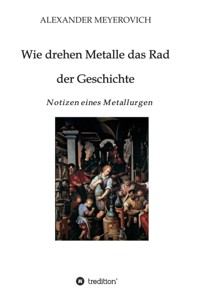
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Ein Interesse an Denkmalen der Vergangenheit ist ein charakteristisches Merkmal unserer Zeit. Dazu gehören die metallischen Artefakte, die bei archäologischen Ausgrabungen gefunden werden. Jedes von ihnen kann viel vom Alltagsleben der Menschen und den Ereignissen, dessen Zeitgenosse es war, erzählen. In diesem ersten Buch einer Sachbuchserie berichtet Alexander Meyerovich voller Leidenschaft für Kultur und Technik über die Geschichte von Metallen und ihre Wirkung auf Interpretationen der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft. "Die Alten Kulturen besser zu kennen" schreibt der Autor "bedeutet Raphael, Goethe und Mozart besser zu verstehen und letzten Endes sich selbst".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Alexander Meyerovich
Wie drehen Metalle das Rad der Geschichte
Notizen eines Metallurgen
Über den Autor
Dr. Alexander Meyerovich, Jahrgang 1953, studierte anorganische Chemie und Hydrometallurgie der Buntmetalle an der Moskauer Staatlichen Universität für Stahl und Legierungen – MISiS (Nationale Universität Wissenschaft und Technologie MISiS in Moskau) und promovierte dort auf dem Gebiet der Hydrometallurgie der Edelmetalle. Nach der Promotion arbeitete er als Laborleiter und Leiter der Wissenschaftler am Staatlichen Institut für Edelmetalle in Moskau. 2000 nahm Dr. Meyerovich als Gastwissenschaftler eine Forschungstätigkeit am Anorganischen Chemie Institut der UNI Frankfurt am Main an. Von 2005 bis 2017 war er sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland als Entwicklungsleiter und Leiter der Chemielabor / Forschungslabor Metallisierung bei einem internationalen Unternehmen tätig. Seit 2017 ist er ein freier Fachberater und Entwickler im Bereich Oberflächentechnik. Die Ergebnisse seiner wissenschaftlichen Arbeiten finden sich in mehr als 100 wissenschaftlich-technischen Veröffentlichungen in den Fachzeitschriften und –büchern und über 20 Patenteinreichungen. Er ist Autor erfolgreicher populärwissenschaftlicher Artikel.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort und Danksagung
Archäochemie und Metalle in den archäologischen Funden
Bronze macht Epoche
Seevölker und Eisenkultur des Nahen Ostens
Auf den Spuren von Blei
Etwas Unerwartetes über das Goldene Vlies
Die Entwicklung der Goldindustrie in Russland
Die Geschichte des Blattgoldes in der menschlichen Zivilisation
Quellennachweis und Literaturverzeichnis
Haftungsausschluss
Vorwort und Danksagung
In den letzten Jahrzehnten ist neben der Suche nach bedeutenden Palästen und Kunstschätzen immer die Untersuchung der Metallartefakte und deren Herkunft bedeutender geworden. Mittels einer Anwendung naturwissenschaftlicher Methoden in der Archäologie können ganz neue Zusammenhänge aufgezeigt und die älteren Spuren der Vergangenheit interpretiert werden. Die Analyse der Metallartefakte geben Hinweise auf die Herkunft der Metalle und ermöglichen Rückschlüsse auf frühere Handelsrouten. Die Entwicklung der Metallurgie beeinflusste die Gesellschaft, während sich gleichzeitig die sich verändernde Gesellschaft auf die Weiterentwicklung der Metallurgie auswirkte.
Obwohl dieses Buch auf einer Vielzahl von Recherchen basiert, hat es keinen Anspruch auf rein wissenschaftliche Abhandlungen. Für den Autor ist das Buch eine Geschichte. Die historischen und archäologischen Daten sind oft wenig aussagekräftig um die Fakten zu interpretieren und einen Sinn zu ergeben. Bringt man aber Fakten in einer Geschichte über die Welt, in der wir leben unter und die von Mitgefühl oder Herrschaft erzählt oder vielleicht von beidem dann kann man anfangen sinnvoll über Chemie und Metalle in der menschlichen Kultur zu reden.
Der britische Historiker und Archäologe Robin George Collingwood definierte die Geschichtsschreibung als ein „Schere und Kleber“ - Verfahren und schlägt den Historikern vor, sich nicht nur auf direkte Quellen, sondern auch auf indirekte Daten zu stützen. Deswegen versuchte der Autor dieser Arbeit in seinen historischen Beschreibungen unter Verwendung einer Methode der „historischen Kriminalistik“ von Wiedererzählungen der bekannten Literaturquellen abzusehen.
Der Autor hatte auch den Gedanken, dass das Buch nicht nur die Geschichte, die mit Chemie und Metallen verbunden sind zu erhalten. Es soll auch das Hintergrundwissen liefern, welches zum Verständnis notwendig ist. Deswegen ist dieses Buch nicht chronologisch, sondern thematisch gegliedert. Die Motivation, die Museen und Ausgrabungen zu besichtigen und auch die entsprechenden Fachliteraturen zu lesen, war beim Autor aus privatem Interesse zu alten Kulturen und den Schnittstellen zwischen Archäologie und Metallurgie ausschlaggebend.
Einige Bereiche dieses Buches wurden schon in der Zeitschrift „Industrie & Archäologie“ (Schweiz) unter Redaktion von Oskar Baldinger († 2015) publiziert. Ihm bin ich sehr dankbar für seine Freundschaft, überaus hilfreiche Diskussionen und seine kenntnisreichen Kommentare.
Danke an Herrn Frank Wittwer für die Zusammenarbeit in einigen Kapiteln und seine hilfreichen Kommentare zu Passagen des Buches. Danke Herrn Andy Adam, der mich in hervorragender Weise mit Diskussionen über einzelne Kapitel der Bibel unterstützte.
Ein besonderes Dankeschön an Frau Edeltrudis Taibner. Sie unterstützte mich in hervorragender Weise und hat mit ihren Fragen und Vorschlägen dafür gesorgt, dass dieses Buch die finale Reife erhalten hat; danke auch für professionelle Hilfe bei der Vorbereitung des Manuskripts für die Drucklegung.
Archäochemie und Metalle in archäologischen Funden
(Zusammenfassung einiger Aspekte)
„Wer nichts als Chemie versteht versteht auch die nicht recht“.
Georg Christoph Lichtenberg (1742 - 1799), deutscher Physiker
Die Chemie hilft die archäologischen Funde und Befunde mit chemischem Allgemeinwissen und Kenntnissen aus chemischer Verfahrenstechnik, Labortechnik, sowie Werkstoffkunde zu untersuchen und zu interpretieren. Sie versucht die Herkunft und das Alter zu erklären, und ebenso ihre Herstellung und Funktion zu verstehen. Repliken werden hergestellt, um damit zu arbeiten und so die alten Prozesse verständlich zu machen. Es geht unter anderem um die Echtheit von Fund- und Museumsstücken, Herstellungs- und Bearbeitungstechnologien, die Verbreitung von Metallfunden und um Umweltbedingungen in historischen Zeiten.
Meist waren Anlässe, Funde aus archäologischen Quellen zu begutachten mit viel Essen und Trinken verbunden. Kostbare Geschenke wechselten den Besitzer. Schätze, wie zum Beispiel Gefäße, Glasperlen oder verzierte Knochenkämme konnten die Forscher in den Fundamentgräben freilegen. Sie stießen auf ein Schmuckstück, das einst ein Pferdegeschirr zierte. Der seltene Fund gelangte bereits zerbrochen in den Boden und deutet darauf hin, dass die vorchristliche Kultur der Angelsachsen in der germanischen Provinz vor allem eine Kriegerkultur war, zu deren Ideal das Pferd gehörte. Ähnliche Schmuckstücke kannte man bisher nur aus Grä bern der angelsächsischen Elite finden. Ersten Datierungen zufolge wurde es zwischen 525 und 575 n. Chr. gefertigt.
Gold von Troja. Sauciere mit zwei Öffnungen. Gold, 2600-2450 v. Chr. Puschkin-Museum, Moskau.
Fragment einer Maske aus Gold, 50-395 n. Chr. Zypernmuseum, Nikosia.
Einen weiteren beeindruckenden Fund bildet ein rund 1500 Jahre altes „Maniküre-Set“, bestehend aus drei Bronzestiften an einem Drahtring. Die Forscher vermuten, dass sie als Pinzette oder zur Reinigung von Fingernägeln und Ohren benutzt wurden.
Wie damals, so steht auch heute die Materialanalyse am Anfang der Untersuchungen eines neugefundenen Objektes. Detaillierte Informationen über Werkstoffe und Techniken können dann, ähnlich wie Form- und Stilmerkmale, zur Bestimmung von Herkunft und Herstellungszeit gewonnen werden. Außerdem wird die soziale, wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation zur Zeit der Herstellung der Objekte ersichtlich. So kann oft ein recht zuverlässiges Bild vom Leben des Menschen in der Antike rekonstruiert werden.
Über die Anfänge der Metallurgie weiß man nämlich bis heute relativ wenig. Wie lernten die Menschen, Kupfer aus Erz zu gewinnen? Wie sind sie überhaupt auf diese Idee angekommen? Wie haben sie es geschafft, die Öfen auf 1083 Grad zu erhitzen, um den Schmelzpunkt des Kupfers zu erreichen? Wie musste eine Gesellschaft beschaffen sein, damit sie Kupfer auf diesem Niveau produzieren konnte? Und welche Rückwirkung hatte die Arbeit auf ebendiese Gesellschaften?
Die Metalle wurden in der Regel nicht als reine Metalle verwendet, so wie man sie aus ihren Erzen gewonnen hatte. Vielmehr wurden unterschiedliche Legierungen eingeschmolzen.
Etappe der Metallurgie
Jahre v. Christus
Erste gefundene Kupfergegenstände: Ahle, Stecknadeln, Perlen. Sie enthalten bis 0,8% Arsen, was für gediegenes Kupfer unmöglich ist.
- ca. 10. Jt., Çayönü, in Südostanatolien, am Rande des Taurus-Gebirges
Handwaren aus Kupfer: Perlen, Ringe,
Röhrchen, Schlacke von Schmelzen des Kupfererzes.
- 6400 - 5700, Provinz Konya in Anatolien (Türkei)
- 5900 - 5800
Kupfergegenstände, inkl. Messer, Spitzen usw.
- 5000, heutige Irak, Iran, Türkei
Kleines metallurgisches Werkstadt, Industrielle Kupferherstellung
- 4100, Tali-Iblis, Iran
Arsenhaltiges Kupfer (Arsenbronze)
- 4500, Tepe Yahya im Südosten des Iran
- 3000 im ganzen Nahen Osten, Region Mittelmeer, Deutschland, Russland (Maikop-Kultur)
Zinnbronze
Kupfer mit 2,5 bis 3% Zinn
- 3600, Ban Tschiang, Thailand
- 3000 im ganzen Nahen Osten
So kommt es bei der Beschreibung von Metallobjekten darauf an, die Art des Metalls genau anzugeben um die genaue Zusammensetzung der Legierung zu bekommen.
Die Geschichte der Metallurgieentwicklung ist ein Weg zur Legierungsverbesserung, wie z. Beispiel von Verwendung des Kupfers bis zur Bronze.
Die ältesten Zeugnisse der menschlichen Nutzung von Kupfer sind Funde in vorkeramischer Jungsteinzeit Siedlungsplatz Çayönü - eine bedeutende archäologische Fundstätte in Südostanatolien, am Rande des Taurus-Gebirges. Wie das Radiokohlenstoffverfahren für die Datierung der metallischen Gegenstände, die in den Schichten des Hügels gefunden wurden, ergeben hat, handelt es sich um das 10. Jahrtausend v. Chr. Gefunden wurden drahtige Stecknadeln, quadratische Ahle, Bohrer, Perlen und die „Halbprodukte'' aus Kupfer. Außer metallischen Perlen wurden Malachitperlen gefunden. Die Archäologen vermuten, dass alle metallischen Gegenstände aus dem gediegenen Kupfer hergestellt wurden. Allerdings zeigte eine Spektralanalyse der Ahle rund 0,8% Arsen, was einige Zweifel über die gediegene Herkunft des Kupfers nährte. Die Siedlung Çayönü lag in direkter Nähe der reichen Kupferlagerstätte in Anatolien - Ergani Maden, die möglicherweise das Zentrum der Kupferversorgung war. Die Frage, welche Kupferart für die gefundenen Gegenstände in Çayönü benutzt wurde, ist noch in der Diskussion.
Der älteste Kupfergegenstand in Südmesopotamien ist eine Lanzenspitze, die in Ura, in den Schichten aus dem 4. Jt. v. Chr. gefunden wurde. Die chemische Analyse der Spitze zeigte 99,7% Kupfer, 0,16% Arsen, 0,12% Zink und 0,01% Eisen.
In Zentraleuropa wurde Kupfer nicht früher als im 3. Jahrtausend v. Chr. benutzt. Eine flächige, primitive Form einer Kupferaxt, die in Horné Lefantovce in der West Slowakei gefunden wurde, wurde gegen Mitte des 3. Jts. v. Chr. datiert. Nach der Spektralanalyse enthält die Axt außer Kupfer noch 0,1% Arsen, 0,35% Antimon und kleine Mengen anderer Elemente. Das spricht dafür, dass die Axt aus keinem gediegenen Kupfer hergestellt wurde. Es ist denkbar, dass Kupfer nach einem Reduktionsschmelzen aus den Kupfererzen hergestellt wurde.
Antike Lego: Rekonstruktion eines Wildschweines. Bronze, 1. Jh. v. Chr. Archäologisches Museum, Nizza.
Die neuesten Untersuchungen mittels der chemischen- und Spektralanalysen zeigten, dass die vielen Kupfergegenstände, die in verschiedenen Regionen der Alten Welt gefunden wurden, aus Kupfer-Arsen-Legierungen hergestellt waren.
Aus zwei urartäischen Tempelschätzen des 9. bis 8. Jahrhunderts v. Chr. wurden zunächst 43 Gegenstände jeweils an einem Messpunkt analysiert. Elf Achsnägel aus Kupferlegierung und teilweise aus Eisen wurden vorgestellt und eingehend untersucht.
Vertrag zwischen dem König Stasikypros und der Stadt Idalion. Platte aus Bronze. Persien Periode, 470 v. Chr. Zypernmuseum, Nikosia.
Die große Varianz von insgesamt 81 quantitativen Analysen an den Achsnägeln wird durch eine statistische Fehlerrechnung beschrieben bzw. erklärt. Es wird nachgewiesen, dass die Heterogenität der patinierten Oberflächen der Kupferlegierungen zu fehlerhaften Ergebnissen führt, wenn Analysen lediglich an einem Punkt durchgeführt werden. Für eine quantitative, schlüssige Beurteilung der Zusammensetzung einer patinierten Kupferlegierung sind immer Bestimmungen an mehreren Punkten des zu analysierenden Objekts notwendig. Bei der Bewertung der dann erhaltenen Resultate ist außerdem die differenzierte, korrosive Beeinflussung der verschiedenen Legierungselemente zu berücksichtigen. Ein so erzieltes Ergebnis der Metallanalyse ist auch dann nur eine Annäherung, die jedoch dem wahren Wert weitgehend entsprechen wird. Auf jeden Fall wird sie für die Erkenntnis wertvoller als eine „exakte“ Angabe sein, die nur für einen zufälligen Punkt und dessen zufälligen Korrosionszustand am patinierten Objekt gilt.
Aus den so erhaltenen Einsichten werden – auch unter Einbeziehung der in der Literatur publizierten analytischen Ergebnisse – Schlüsse gezogen: Die urartäische Metallurgie hat spezifische Eigenheiten: Es wurden drei Kupferlegierungstypen mit einem Zinkgehalt bis zu 8% Zink entwickelt. Auch solche Kupferlegierungen, wie Bleibronze, Kupfer mit und ohne Arsen/ Antimonanteil, zinnarme Kupferlegierung - die Legierungen enthalten häufig geringe Zinngehalte - die in zeitlicher oder räumlicher Nähe fast nie auftreten.
Für spezielle Zwecke wählte der urartäische Metallhandwerker oft besondere Legierungen aus: die Stangen der Achsnägel und die Knöpfe unterschieden sich bei den angewandten Legierungen. Genauso waren z.B. die Möbelbauteile aus goldähnlicher, also höherwertiger Farbe, Legierungen mit Zink. Die Gefäße wurden aus einer zinkfreien Kupferlegierung hergestellt, bei welcher der Messinggeruch entfällt. Hier geht es um arsen- bzw. antimonhaltiges Kupfer mit einem relativ hohen Gehalt der Legierungskomponenten. Es ist metallurgisch nicht sinnvoll, aber wohl aus der Verfügbarkeit der entsprechenden Abbauerze zu erklären. Später wurde zum Kupfer in fast allen Fällen ausreichend Zinn zugesetzt.
An einem urartäischen Möbelbeschlag, der neben Kupfer noch 7% Zinn, 4% Zink, 0,7% Blei sowie Spuren von Arsen, Antimon und Silber enthält, wurden etwa 80 Analysen (vier Flächen, korrodiert, entpatiniert, richtungs- und lageabhängig, scharf abgeschliffen) ausgeführt.
Analysen der Patina eines korrodierten Kupfergegenstandes geben nur ein annäherndes Bild zur Zusammensetzung dieser Legierung. Deutliche Differenzierungen von Metallgehalten in der Patinafläche sind vom einen Punkt zum anderen Punkt für Blei, Zinn und Zink und damit auch für Kupfer nachgewiesen. Punktuelle Einzelanalysen sind daher häufig wertlos. Auch nach der chemischen Entfernung der Korrosionsprodukte sind Analysen der entpatinierten Metalloberfläche nicht repräsentativ. Erst eine Entfernung auch der obersten Metallschicht oder ein Bohren in die Tiefe der Legierungen führt tendenziell zu „richtigen“ Analysen. Analysen-Ergebnisse sind nur dann zu bewerten, wenn die Art und Weise der Probenahme bzw. der Status der Oberfläche mit beschrieben wird. So lassen sich Analysen von Bohrspänen nur sehr beschränkt mit Analysen von Oberflächen vergleichen.
Die Eitelkeit der Analytiker darf nicht geschont werden, da sonst Fehlschlüsse bei den Auswertenden - Archäologen und Naturwissenschaftlern - gezogen werden; es müssen immer mehrere Analysen durchgeführt und auch weit auseinander liegende Ergebnisse eines Objekts publiziert werden. Die starke Differenzierung des Elementgehaltes in und auf demselben Gegenstand, die durch die Korrosion bewirkt wird, muss immer berücksichtigt werden.
Metallanalysen, die mit den oben genannten Differenzierungen bewertet werden, waren und sind für die Metallurgie des Altertums, für die antike Handwerkstechnik, für die Geschichte des Handels usw. trotzdem von großer Bedeutung. Kritische Archäologen haben schon immer der scheinbar großen Genauigkeit der naturwissenschaftlichen Analytiker misstraut und beurteilen sie jetzt vielleicht noch skeptischer. Archäologisch relevante Bewertungen von Analysen erfordern meist keine große Messgenauigkeit, auch wenn diese analytisch möglich wäre: Treffende Aussagen sind dann möglich, wenn die Heterogenität sowie die Anreicherung und Verarmung der korrodierten Metalle und ihrer Patina vom Auswertenden berücksichtigt werden.
Urartäische Kupferlegierungen heben sich von jenen ihrer Umwelt dadurch ab, dass sie oft stark legiert sind, wobei sie nicht nur das sonst übliche Zinn, sondern auch Arsen, Antimon, Blei und erstaunlicherweise Zink enthalten. Die dafür in Frage kommenden Erze im östlichen und nordöstlichen Anatolien werden benannt und zu den Legierungen in Beziehung gesetzt. Die offensichtliche Experimentierfreude und Geschicklichkeit der urartäischen Metallhandwerker und die Vielfalt der zur Verfügung stehenden Erze begründeten die „Wiege der Metallurgie“ des Nahen Ostens im Urartäischen Reich.
Maske von Silenos. Bronze, 1. Jh. v. Chr. Archäologisches Museum, Nizza.
Bronze. Salamis, Tromb 79, 8. Jh. v. Chr. Zypernmuseum, Nikosia.
Analysen von Korrosionsprodukten geben zwar einen Hinweis auf das ursprüngliche Metall; erst die Kenntnis des spezifischen Korrosionsverhaltens der verschiedenen Legierungsbestandteile, die aus mehreren Analysen der differenzierten Korrosionsprodukte abzuleiten ist, lässt entsprechende Rückschlüsse zu. Eine Untersuchung eines Helmes aus Urartu erlaubte, durch die Analysen des korrodierten Metalls, die ursprüngliche Zusammensetzung der Legierung zu ermitteln. Die Bronzeteile des Helmes bestanden alle aus einer Legierung mit 69,4% Kupfer, 16,8% Zinn, 8,9% Blei, 2,5% Arsen, 1,8% Antimon und 0,6% Silber. Die von grünen bis mehrfarbigen Korrosionsprodukte (Patina) waren chemisch durch das zunehmende Auslaugen des Kupfers sehr gut zu unterscheiden.
Die Gegenstände aus arsenhaltigem Kupfer wurden auch in Deutschland, Spanien, Portugal und in Russland in den Denkmalen des 3. Jahrtausends v. Chr. gefunden. In den Regionen, wo es keine Vorkommen von Zinnerz gab, stellte man bis zum Anfang des 1. Jahrtausends v. Chr. große Mengen des arsenhaltigen Kupfers her.
Die Kelten konzentrierten ihre Kräfte nicht nur auf das Kriegshandwerk. Sie entfalteten Fähigkeiten in der Metallbearbeitung und wurden darin zu Meistern.
Eine Eberstatue, die in ihre Einzelteile zerlegt war, wurde in der de Soulac-sur-Mer nahe der Gironde-Mündung gefunden. Der Fund gilt als spätkeltisches Feldzeichen und besteht aus Kupferlegierung, die sehr unterschiedlich gelb und rot gefärbt war. Die Einzelteile wurden jeweils mittels des Röntgenfluoreszenzverfahrens analysiert: Auffällige Differenzierungen wurden als eine Entzinkung des Messings nachgewiesen. Die ursprüngliche gelbe Messinglegierung mit etwa 22% Zink (Zinn, Antimon, Arsen, Blei und Silber durchweg weniger als 0,5%) verliert in der marinen Umgebung je nach Lage bis zu 15% des Zinks und wird dabei zunehmend rotfarbiger.
Die Analyse silbriger Reste auf der Oberfläche einer streifenverzierten bronzezeitlichen Dolchklinge sowie auf Dolchen aus Westfrankreich ergab auf einer Arsenbronze eine zusätzliche Arsenierung der Oberfläche, deren Technologie noch nicht geklärt ist.
Die röntgenfluoreszenzanalytische Untersuchung der beiden urnenfelderzeitlichen Bronzeräder sowie die technologische Beurteilung ergaben beeindruckende Hinweise zu den technischen Möglichkeiten der frühen Metallhandwerker: Im Verbundguss wurde mit verschiedenen Legierungen das eine Rad repariert, während das andere, ebenfalls kompliziert gebaute Rad in einem Guss hergestellt wurde. Eine Produktion in Ostfrankreich ist naheliegend.
Das Grab von Mušov stellt in den archäologischen Funden an der Wende der älteren zur jüngeren Römischen Kaiserzeit ein besonderes Kapitel dar. Im Grab wurden mehrere bronzene, aber auch prestigeträchtige silberne Gefäße und die charakteristischen Attribute der noblen sozialen Schicht der älteren Kaiserzeit gefunden.
Die runde Mittelscheibe eines Stuhlsporns aus dem germanischen Königsgrab von Mušov in Mähren und das runde Eckteil der Grundplatte eines zweiten Stuhlsporns bestehen aus Legierungen des gleichen Typs, jedoch verschieden starker Zulegierung. Die Vergoldung der beiden Sporne enthält etwa 7% Silber und von 0,5 bis eins Prozent Kupfer und ist damit von hohem Feingehalt. Die silberne Mittelscheibe des einen Sporns weist neben 10% Kupfer 0,5% Gold auf. Die schwarzen Beläge zwischen den verschiedenen Konstruktionselementen der Sporne stammen von Loten, die etwa zu 80% Zinn und 20% Blei bestehen.
Chemie hilft den Archäologen in der Erkennung der Fälschungen. Als römisch bezeichnete „ medizinische“ Instrumente (134 Kunsthandelsobjekte) werden aufgrund typologischer und ergologischer Merkmale vom Archäologen als Fälschungen bezeichnet. Nach einer röntgenfluoreszenzanalytischen Untersuchung der 16 Objekte wurde festgestellt, dass die Kupferlegierungen von 30 bis 40% Zink enthielten: Solches Messing ist aus römischen Beständen unbekannt. So wurde die Fälschung der Kunstobjekte nachgewiesen.
Geschirr und ein großer Servierlöffel (Trulla). Silber, 1. Jh. v. Chr.- 1. Jh. n. Chr. Archäologisches Museum, Neapel.
Schlangen-Armband. Gold, 1. Jh. n. Chr., Pompeji. Archäologisches Museum, Neapel.
Bei der Restaurierung römischer Gegenstände aus Eisen fiel auf, dass sich manchmal Kupfer- bzw. Messingüberzüge auf dem Eisen befinden. Der einwandfreie Nachweis muss gebührend berücksichtigt werden, da bei chemischen Entrostungen solche Überzüge verloren gehen. Man nimmt an, dass Eisen mit Buntmetall bedeckt wurde, um entweder eine bessere Wirkung oder eine Wertsteigerung zu erzielen. Die bessere Beständigkeit gegenüber der Korrosion dürfte jedoch den Ausschlag gegeben haben. So wurde die Rekonstruktion der Herstellung von Bronze- oder Messingüberzügen auf Eisen mit einfachsten Mitteln durchgeführt.
Der Bronzekessel war korrodiert und durch den Bodendruck in der Fundlage teilweise verbogen und zerbrochen. Die Oberfläche musste von der Korrosions- und Erdkruste behutsam gereinigt und die fehlenden Teile der Kesselwandung mit eingefärbtem Epoxidharz ergänzt werden. Nach den Röntgenaufnahmen der Teilpakete, technischen Untersuchungen und Analysen an Einzelteilen konnte man schließlich die aufwändige Restaurierung in Angriff nehmen. Der rekonstruierte Kessel stammte von Salamis (Zypern) aus dem 8. Jahrhundert v. Chr.
In Sipan in Peru wurden die Funde aus dem Fürstengrab, die aus der Moche-Kultur stammen, die vor den Inkas zwischen dem 3. bis 4. Jahrhundert existiert hat und aus 40 : 60 und 8 – 10 : 90 Gold-Kupfer-Legierungen, Silber-Kupfer-Legierung (40 : 60) und Kupfer mit wenigem Prozent Arsen bestanden, untersucht und restauriert. Diese Kultur erstreckte sich zwischen dem 1. und 7. Jh. n. Chr. entlang der Nordküste von Peru. Die Moche-Gesellschaft unterstützte viele begabte Handwerker, die sich auf Gold-, Silberund Bronzebearbeitung spezialisierten. Unter den zahlreichen kostbaren Objekten befanden sich Masken aus dünnem Kupferblech mit vielen Ablagerungen. Kupfer war praktisch vollständig korrodiert und äußerst brüchig. Aufgrund der in der bisherigen Restaurierungspraxis von unbekannten Legierungen mussten neue oder abgewandelte Methoden entwickelt werden. Zur Ausführung der Untersuchungen kamen die Methoden mit Ethylendiamintetraessigsäure und Thioharnstoff zur Lösung von Oxiden, Festigung mit Glasgewebe mit Epoxidharz, Reduktion von Oxyden mit Niederdruck–Wasserstoffplasma und mechanische Entfernung von Oxyden mit Mikro-Sandstrahl zum Einsatz.
22000 Objekte aus Kupfer oder dessen Legierungen wurden im Württembergischen Landesmuseum Stuttgart spektroskopisch untersucht und nach ihrer Zusammensetzung in 29 Gruppen eingeteilt. Probleme der Archäologie zum Produktionsort, zum Handel und zur zeitlichen Entwicklung der Legierungen wurden an Beispielen mit der zeitlichen und lokalen Verteilung der 29 Gruppen verglichen.
Auch 3300 Goldgegenstände, deren erstes Vorkommen im Donauraum, dann in Spanien und Siebenbürgen verfolgt wurde, lassen sich in 12 Gruppen statistisch einteilen. Das Beispiel der frühbronzezeitlichen Lunulae aus Irland (vereinzelt auch in Norddeutschland, Dänemark und entlang des Rheins) mit einem einheitlichen Gold zeigt positive Möglichkeiten für die Archäologie auf – andere Beispiele der zeitlichen und lokalen Zuordnung der „Gruppen“ sind noch ungeklärt.
Gold war ebenso wie Kupfer eines der ersten Metalle, die von Menschen im Alttag verwendet wurden. In Ägypten wurden die Golderzeugnisse in den Grabungen der Badari-Kultur (5000 - 3400 Jahre v. Chr.), entdeckt. Es waren aber jüngere als die dort gefundenen Kupfererzeugnisse. Übrigens handelt es sich um die ersten bearbeiteten Golderzeugnisse in der Welt.
Gediegenes Gold kommt in der Natur sehr selten in einer reinen Form vor. Die Hauptzulegierungen sind Silber, Kupfer, auch Eisen und einige andere Metalle. Wie die modernen Analysen zeigten, ist Silber einem Hauptlegierungselement im ägyptischen Naturgold. Der Silberanteil im Gold bewegt sich von 10 bis 30%, der Mittelwert beträgt ca. 15 – 18%. In der dynastischen Periode wurde schon Gold zusammen mit Silber und Kupfer geschmolzen, leider war diesen Schmelz nicht immer perfekt. Manchmal konnte man auf der Oberfläche der Golderzeugnisse die Silbereinflüsse in Form von hellen Flecken bemerken, wie zum Beispiel auf den Schmucken, der in ägyptischen Gräbern der XXI. - XXV. Dynastien (zwischen 1085 und 664 vor Christus) entdeckt wurde.
Die Ergebnisse der chemischen Analysen einiger alter ägyptischer Golderzeugnisse zeigen, dass Gold nicht immer raffiniert wurde. Bei alledem gibt es in alten ägyptischen Texten - zum Beispiel der XX. Dynastie (1200 - 1090 v. Chr.) - eine Erwähnung über zwei-, auch dreimalige Goldraffination. In den schriftlichen Quellen aus den Jahren 1090 - 945 v. Chr. wird hochkarätiges Gold erwähnt. Bereits im 2. Jh. v. Chr. wurde schon eine Goldraffination durchgeführt. Nach Agatharchides führte man im Alten Ägypten die Goldraffination ein Erhitzen des Goldes zusammen mit dem Blei, Zinn, Salz und Gerstenkleie durch. Es ist denkbar, dass in diesem Verfahren Silber vollständig extrahiert wurde, da es keine Information über ein gleichzeitiges Herausziehen gibt.
Goldfarbe hing hauptsächlich von den Anteilen solcher natürlichen oder künstlich gegebenen Legierungselemente wie Kupfer, Silber, Arsen, Zinn, Eisen ab. Unterschiedliche Goldfarbe und Legierungszusammensetzungen der Golderzeugnisse waren im Alten Ägypten charakteristisch. Alte Chemikern meinten, dass alle natürlichen Goldlegierungen nur die unterschiedliche Art des selben Goldes sind. Es wurden Golderzeugnisse mit ganz breitem Farbspektrum gefunden.
Gelbes Gold hat eine Zusammensetzung nahe reinem Gold und enthält kleine Silber, Kupfer oder andere Metallanteile. Graues Gold enthält einen höheren Silberanteil, der sich auf der Oberfläche des Erzeugnisses nach Jahrhunderten zum Silberchlorid umwandelt. Das Silberchlorid zersetzt sich selbst am Licht durch Erzeugen von feinkristallinem Silber. Diese Kristalline erzeugen auf der Oberfläche eine graue Farbe. Um Pinkfarbe des Goldes zu erhalten, wurde Gold mit kleinen Mengen von Eisen und Kupfer legiert.
Etwa 200 Analysen an drei Goldhalskragen aus Möne, Färjestaden und Ålleberg des 5. bis 6. Jahrhunderts sollen die technische Bewertung ihrer Herstellung erleichtern. Untersuchungen der chemischen Zusammensetzung der Legierungen von schwedischen Goldhalskragen weist eine relativ breite Streuung der Gold-, Silberund Kupferanteile auf. Es zeigt in allen vier Fällen auf, dass keine einheitliche Legierung für die jeweilige Gesamtheit eines Kragens verwendet wurde. Die einzelnen Teile eines Goldhalskragens, also die Miniaturverzierungen, die Ringe, die Scharnierteile usw. haben jedoch eine weitgehend in sich übereinstimmende Zusammensetzung. Für den speziellen technischen Zweck wurde die in ihren Eigenschaften vorteilhafteste Legierung verwendet. Am deutlichsten zeigt sich diese erstaunliche Beherrschung der Legierungstechnologie am Goldhalskragen von Färjestaden, der weiter dadurch auffällt, dass nur bei ihm primär gewonnenes Gold verwendet wurde.
Im Alltag kam Silber praktisch immer später als Kupfer oder Gold vor, in einigen Regionen kurz vor Eisen. Die ältesten Silbererzeugnisse wurden auf den Territorien Anatolien und Iran gefunden: im Iran (in Tappe Sialk) sind es Knöpfe aus der Zeit von 4800 bis 4500 v. Chr. und in Anatolien in Beycesultan ein Ring vom Ende des 5. Jahrtausendes v. Chr. Die Quellen des alten Silbers sind bis heute noch nicht bekannt. Es gibt aber eine Vermutung, dass es zum ersten Mal während einer zufälliger Kupellation des silberhaltigen Bleischmelzes stattfand. Die Kupellation ist ein Verfahren der Herausziehung von Gold und Silber aus Blei und ist schon seit 4000 v. Chr. bekannt. Ein überzeugender Nachweis der Silberherstellung aus den Bleierzen sind die Knöpfe aus dem dritten Jahrtausend vor Christus, die in Mahmatlar, in Süd Mesopotamien, gefunden wurden.
Unter den Archäologen und Historikern gibt es die Meinung, dass zum ersten Mal das Silber in Form von Silber-Gold-Legierung in die Hände der Menschen kam. Es bestätigte die Analysen der altägyptischen Silbererzeugnisse, die bis zu 38% Gold enthalten. Man mit höher Wahrscheinlichkeit sagen, dass im Altertum Silber meistens aus Blei-Silber-Erzen hergestellt wurde.
Die Ergebnisse der chemischen Analysen zeigen, dass Silber im Altertum oft eine Silber-Kupfer-Legierung mit ziemlich hohem Goldanteil war. Der erste, der eine systematische Untersuchung der Silbererzeugnisse machte, war der französische Chemiker M. Berthelot. Seine Analyse der Fragmente einer Vase von 7. Jh. v. Chr., die in Susa (Iran) gefunden wurde, zeigte, dass zwei Proben 65,27% und 64,14% Silber, enthielten. Außer Silber enthielt die erste Probe 2,95% Kupfer und 1,1% Gold. In der zweiten Probe befunden sich 63% Silber, 15,5% Kupfer, 0,34% Gold und 0,27% Eisenoxid.
Analysen der Silberfunde aus dem Alten Ägypten zeigten, dass sie aus einer Silber-Gold-Legierung (von eins bis 38% Gold) und Silber-Kupfer-Legierung (von 0 bis 8,9% Kupfer) bestanden.
Grabmaske. Silber. 675-625 v. Chr. Archäologisches Museum, Florenz.
Altes Silber aus Ura findet sich auch ohne Gold, aber mit einem niedrigen Kupfergehalt.
Die Materialbestimmung bei Tauschierungen auf frühmittelalterlichen Objekten (Silber, seltener Messing oder Bronze) sowie auf späthallstattzeitlichen Dolchen (5. Jh. v. Chr.- Kupfer und Silber, nur im Mittelmeerraum auch Gold) führt zu archäologisch interessanten Fragestellungen.
Silberkrug, teilvergoldet. Am Henkel Stierkopf und Silenskopf. 50.-10. v. Chr., Archäologisches Museum, Mainz.
Keramikverzierungen aus metallischem Zinn sind ebenso von Bedeutung wie die Rekonstruktion eines schwedischen Gürtelbeschlags, der nur noch als ein Paket aus Schichten von Silberoxiden auf einer Basis von Zinn und Blei gefunden wurde. Erst durch enge Zusammenarbeit des Analytikers mit dem Restaurator und dem Archäologen konnte der Gürtelbeschlag rekonstruiert werden. Studien zur Hartlötung und zur bis dato unbekannten Arsenierung von Bronze ergänzen die Arbeit.
Der Fund aus 33 Tellern und ovale Platten, den man Alemannen aus dem römischen Gallien zuschrieb, wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse untersucht. Es sollten sowohl die Zusammensetzungen der Basislegierung als auch die der metallischen Überzüge festgestellt werden. Zwei Fragmente wurden als zusammengehörig identifiziert. Ein Teller bestand aus Silber und fünf Teller aus einer Zinn-Blei-Legierung. Von den verbleibenden 26 Objekten, deren Basismetall eine Kupferlegierung war, erwies sich ein Teller als rundum versilbert, drei Teller und eine ovale Platte waren teilversilbert; 19 Gegenstände waren auf ihrer Innenseite mit Zinn und Blei überzogen, zwei Teller waren ohne Belag. Silber der Versilberungen war durchweg mit wenigen Prozent Gold versetzt, sodass eine sekundäre Verwendung des Silbers angenommen werden muss. In einem Fall wurde der metallische Überzug aus Silber mit Zinn und Blei kombiniert. Die Überzüge der Innenflächen aus Zinn und Blei – in sechs Fällen mit mehr als 84% Zinn - enthalten durchschnittlich 75% Zinn. Die Kupferlegierungen der 26 Teller und ovalen Platten (versilbert und mit Belägen aus Zinn-Blei-Legierung) lassen sich nach der Zusammensetzung in sechs Gruppen einordnen. Das Grundmuster der Legierungen ist in allen Fällen gleich. Nur bei einem Teller lässt sich höchstwahrscheinlich, bei drei weiteren Tellern vielleicht, eine andere Provenienz ableiten. Die Basislegierungen der teilversilberten Objekte sind sich sehr ähnlich. Ebenso gleichen sich vier der fünf Teller, welche nur aus Zinn-Blei-Legierung bestehen, in den Konzentrationen ihrer Metalle.
Zu den ältesten Bleigegenständen (Datierung zwischen 3900 und 3400 vor Christus), die in Ägypten gefunden wurden, gehören eine Statuette, auch ein Siphon mit einem Filter aus Tel-El-Amarli, wo im 3. Jahrtausend vor Christus ein Wasserleitungssystem existierte.
Blei wurde im 3. Jahrtausend v. Chr. breit in einer Form der Platten und Gefäße verwendet. Die Analyse eines in Südmesopotamien gefundenen Erzeugnisses zeigte, dass es sich hier um eine Blei-Zinn-Legierung mit der Zusammensetzung von 98,3% Blei und 1,3% Zinn handelte. Zinn wurde möglicherweise für eine Erhöhung der Legierungsfestigkeit geschmolzen.
Im Altertum wurden die unterschiedlichen Werkzeuge und Waffen aus Legierungen auf Basis von Kupfer und Blei hergestellt. Die Analyse eines Gegenstandes, der in Frankreich (Region Nantes) gefunden wurde und aus der späten Bronzezeit stammte, zeigte 36% Blei und nur 5% Zinn. Dieser höhere Bleianteil in der Legierung, aus welcher der gefundene Gegenstand hergestellt wurde, ist bis heute noch ungeklärt.
Antimon ist ein Metall, welches seit grauer Vorzeit bekannt ist. In alten schriftlichen Quellen wie z.B. in den Papyrus- oder Keilschrifttexten fehlt ein spezielles Symbol für die Antimonbezeichnung. Möglicherweise betrachtete man Antimon im 3. Jahrtausend v. Chr. als eine Bleiabart. Es ist auch denkbar, dass das metallische Antimon in Ägypten und Mesopotamien noch nicht sehr breit verarbeitet war: In beiden Regionen wurden einige Perlen und Fragmente einer Vase aus der Zeit von 2500 vor Christus aus dem Antimon gefunden. Die Analyse bestätigte, dass das Material der Vase grundsätzlich nur das Antimon und die Legierungselemente in Höhe von 0,57% enthielt.
Im Alten Ägypten und Mesopotamien wurden die antimonhaltigen Bronzen verwendet. Es besteht die Vermutung, dass das Material aus dem Kaukasus transportiert wurde, da in Ägypten und Mesopotamien keine Vorkommen von Antimonerzen waren.
Zinn ist das geheimnisvollste Metall des Altertums. Dieses Metall ist ein Bestandteil der Bronze, welche der Name der historischen Epoche gab. Das Geheimnis ist, dass es im Radius von ca. 2000 Kilometer vom Nahe Osten – dem Zentrum der Bronzeherstellung – überhaupt kein Zinn gab. Das Geheimnis ist auch, dass die Gegenstände aus Zinnbronze um 800 v. Chr. gleichzeitig in den Territorien von Spanien bis Thailand erschienen. In der Welt sind die folgenden nachgewiesenen Vorkommen von Zinn: Malaisen, Afghanistan, Spanien und England. Deutschland kann ausgeschlossen werden, da auf seinen Territorien die Zinngewinnung technologisch so kompliziert war, dass das bis zum Ende des 1. Jts. v. Chr. unmöglich war.
Das Geheimnis der Bronzeherstellung besteht darin, man muss die Zinneigenschaften erst einmal kennenlernen. Um die Zinneigenschaften kennen zu lernen, muss man mit dem Zinn Versuche durchführen. Um die Versuche durchzuführen, muss man Zinn zuerst kaufen, weil es im Nahen Osten keine eigenen Zinnvorkommen gibt.
Das bedeutet, dass man im Nahen Osten wusste, dass Zinn existiert und wusste, dass Zinn zusammen mit Kupfer zu Bronze geschmolzen werden konnte. Das bedeutet auch, dass die Alte Welt im 4. Jt. v. Chr. sehr eng miteinander verbunden war.
Ein Zinnerz oder ein Zinnoxid zusammen mit dem Kupfererz oder Kupfergegenständen und Holzkohle einzuschmelzen ist ein vereinfachtes Verfahren gegenüber der individuellen Zinnreduktion und weiterer Kupferzulegierung. Für diese Hypothese spricht eine Entdeckung von 16 kg des weißen Materials, man in einem Handelsschiff, das um 1200 v. Chr. am Ufer der Türkei gesunken war, gefunden hat. Mit der chemischen Analyse wurde festgestellt, dass dieses Material 14% Zinndioxid und 71% Calciumcarbonat enthielt. Es gibt aber unterschiedliche Meinungen: War es metallisches Zinn oder das Mineral Kassiterit nach Einwirkung von Meerwasser. Stärkere Gründe hat die zweite Hypothese, weil Zinnoxid im Altertum für die Geschirrglasur und die Perlen verwendet wurde. Die Zinnquellen befanden sich meistens in den Regionen, in denen man viele Artefakte aus Zinn-Kupfer-Legierungen fand, zum Beispiel im Iran und im Kaukasus. Jedoch, gemäß modernen geologischen Untersuchungen, gibt es im Iran keine Vorkommen von Zinnerzen.
Ein hoher Metallgehalt von Arsen, Antimon, Zinn, Nickel oder Blei erklärt sich auch durch eine chemische Zusammensetzung der Kupfererze, die in der alten Metallurgie verwendet wurden, und, in einigen Fällen eine Kupferschmelzung zusammen mit den Artefakten aus Bronze. Die unterschiedlichen Ursachen, die deren Zusammensetzung erklären, regen die Notwendigkeit einer Klassifikation der alten Bronzen an.
Eisen ist nicht ein so geheimnisvolles Metall wie Zinn. Trotzdem gibt es in seiner Geschichte einige Lücken. Die offizielle Wissenschaft vertritt die Meinung, dass seit 2000 Jahre v. Chr., als Eisen von den Hethitern benutzt wurde, erstmals die Herstellung von Gegenständen aus diesem Metall stattfand. Die industrielle Herstellung der Gegenstände aus Eisen wurde von den Hethitern und danach von den Philistern mit ihrem Eisenmonopol gefördert. Es ist aber auch bekannt, dass eine Eisenverbreitung erst seit 1000 – 800 Jahren v. Chr. angefangen hat. Das bedeutet, dass die Erfindung der Eisenherstellung ca. 800 Jahre geheimgehalten wurde. Die Bronzeproduktion wurde dagegen sofort in der ganzen antiken Welt bekannt.
In der wissenschaftlichen Geschichte gibt es keinen Nachweis für den Fakt der Funde eines Stemmeisens in der Siedlung Samarra in Irak, datiert um 5000 v. Christus. In Ägypten wurde Schmuck aus Meteoriteneisen gefunden, das bestätigte durch der Nickelgehalt von 4 bis 10%. Dieser Schmuck ist mehr als 5500 Jahr alt – es spricht nicht dafür, dass Eisen gewonnen, zeugt aber davon, dass Eisen bearbeitet wurde. In der Cheops-Pyramide wurde ein Eisenplättchen aus irdischem Eisen datiert nach dem Pyramidenalter um ca. 2500 vor Christus, gefunden. Wegen all der anomalen Befunde kann man sagen, dass Eisen entgegen der offiziellen Datierung viel früher produziert wurde.
Aufgrund der neuen metallographischen Analysen wurden die Eisenklingen aus Alaca Höyük um 2100 vor Christus, möglicherweise früher, aus irdischem Eisen hergestellt. Diese Schlussfolgerungen der Historiker decken sich mit den Bestätigungen aus assyrischen Keiltexten der Handelskolonie in Kleinasien im 3. - 2. Jahrtausend v. Chr. Diese Haupthandelsware bestand aus Kupfer, Silber und Zinn, die in dieser Region mit einem sehr hohen Technikniveau der Metallherstellung und -bearbeitung eingeführt wurde. Damit verbunden ist die frühe Entstehung des Handelskapitals. Assyrische Handelsleute gründeten auch spezielle Handelsvereine mit dem Ziel Eisen zu kaufen. Eisen kostete ca. 40 Mal mehr als Silber und auch etwa 5 bis 8 Mal mehr als Gold.
Helm. Eisen, Russland, 13.-14. Jh. n. Chr. Staatliches Historisches Museum, Moskau.
Schwerte. Eisen, Ananin Region, 9.-8. Jh. v. Chr. Staatliches Historisches Museum, Moskau.
Zu diesem Zeitpunkt wurden die ersten Versuche der Töpfer in der Antike vom Nahen Osten mit Eisenoxiden als Farbstoffe durchgeführt. Von Eisenoxiden hängt die Farbe des Tones (Beispiel graubraun) und der Keramikfarbe (rot bei Eisenoxidation, dunkel-grau oder schwarz bei der Eisenreduktion aus Oxiden) ab. Der maximale Farbeffekt wurde bei einer Temperatur von circa 900°C erreicht.
Es wurde festgestellt, dass in den Öfen von Metsamor und Argishtikhinili (Urartu) die Zugabe des Flussmittels inklusive 7% Knochenmischung aus den Calcium- und Phosphoroxide ergab, die zur Herstellung des zum Schmieden geeigneten Eisens führten. Der chemische Versuch bei 960°C bestätigt diesen Sachverhalt.
Viele Maßnahmen zur Erhaltung von archäologischen Funden haben sich über die technische Entwicklung verändert.
Für die Restaurierung- und Konservierungsmaßnahmen archäologischer Fundobjekte sind immer auch neue Materialien als Ergänzungen verwendet worden. Dies führte häufig zu nicht vorhersehbaren Veränderungen, nicht zuletzt weil sich Ergänzungen manchmal schneller als die Originalmaterialien veränderten. Aus ästhetischer und konservatorischer Sicht haben sie die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllt.
Heute will man deshalb derartige Eingriffe rückgängig machen und die Originalsubstanz, soweit noch vorhanden, so gut wie möglich konservieren. In Einzelfällen wird man mit äußerster Vorsicht und Zurückhaltung Materialien früherer Restaurierungen durch solche ersetzen, die den heutigen Erkenntnissen von Materialverträglichkeit, Haltbarkeit und Authentizität entsprechen. Von daher ist es äußerst wichtig, sich durch naturwissenschaftliche Untersuchungen genaue Kenntnis über frühere Restaurierungen zu verschaffen.
Die Röntgenfluoreszenzanalyse dient bei der Restaurierung sowohl der Beurteilung spezieller archäologischer Probleme als auch der Untersuchung von Objektserien weiträumiger regionaler und chronologischer Ausdehnung. Durch die enge Zusammenarbeit des Analytikers mit Restauratoren und Archäologen können die verschiedensten archäologischen Probleme gelöst werden.
Schwert, Spitze der Pike und Spitze der Lanze. Eisen,Andreev Kurgan.1.-2. Jh. n. Chr. Staatliches Historisches Museum, Moskau.
Die erweiterten typologischen Abgrenzungsmöglichkeiten werden wertend miteinander verglichen. Die Unterscheidung nach technischen Merkmalen ist schärfer als jene nach Form und Verzierung.
Schüssel. Silber, Vergoldung. Spätbronze Zeit, 1200-950 v. Chr. Zypernmuseum, Nikosia.
Anhand von Beispielen werden zur Echtheit, zur Materialverwendung, zur erstmaligen Verwendung bestimmter Materialien, zum ursprünglichen Erscheinungsbild von Objekten, zur Herkunft, Verbreitung und zur Zeit der Niederlegung von Funden Ergebnisse beschrieben.
Zur Definition des Riegseeschwertes werden 48 Riegseeschwerter aus Deutschland und Österreich untersucht. Die Röntgenuntersuchung, die zum Vergleich auch 13 Achtkantschwerter umfasst, ergibt deutliche Unterschiede in der technischen Gestaltung der beiden Schwerttypen. Alle Schwerter werden nach Fundort, Fundumständen, Form, Verzierung und technischem Aufbau (auf den Röntgenaufnahmen basierend) beschrieben und im Bild vorgestellt.
Die intensive gegenseitige Beeinflussung zwischen Riegsee- und Achtkantschwertern lassen sich verdeutlichen. Die allgemein verwendete Holste'sche Typographie des Riegseeschwertes wird überprüft, teilweise erweitert und durch technische Charakteristika ergänzt. Eine Gruppen-Gliederung, die primär nach technischen Merkmalen vorgenommen wird, ergibt gleichlaufende Differenzierungen in Form und Verzierung. Kennzeichnende Merkmale für sieben Gruppen werden festgelegt. Nur die Gruppe der Übergangsschwerter (zu den Achtkantschwertern) ist geographisch enger begrenzt. Eine chronologische Abfolge kann lediglich vermutet werden, da nur bei Schwertern einer Gruppe Beifunde vorliegen.