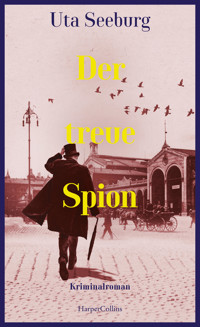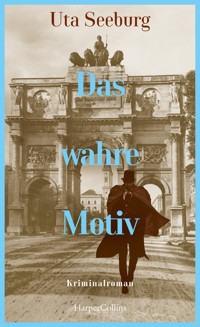9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wussten Sie, dass die Patrizier des alten Roms ein Faible dafür hatten, lebendige Vögel aus gebratenen Wildschweinen flattern zu lassen während sich die Gladiatoren aus dem Kolosseum vegan ernährten? Wie kam noch mal der Hering zum Bismarck? Und wurde das letzte Mammut wirklich 1951 in London verspeist? In Wie isst man ein Mammut? erzählt Uta Seeburg chronologisch und anhand von fünfzig Gerichten die Geschichte des Essens und damit des Menschen. Von gegrilltem Mammut und neolithischem Eintopf über das letzte Abendmahl, gebratenen Schwan, Wiener Schnitzel und Toast Hawaii bis zu Ferran Adris Ikone der Molekularküche Flüssige Olive: Jedes Kapitel beschreibt ein Gericht und erklärt, warum seine Erfindung einen historischen Schlüsselmoment markiert. Warum ist da vorher noch keiner drauf gekommen? Wie isst man ein Mammut? ist ein sehr unterhaltsames Buch, das beweist, dass Essen unglaublich viel über den Menschen verrät. ALEXANDRA VON BRAUNSCHWEIG, RUHR NACHRICHTEN
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Wussten Sie, dass man im alten Rom lebendige Vögel aus gebratenen Wildschweinen flattern ließ? Dass die Christen im Mittelalter ungefähr ein Drittel des Jahres fasten mussten? Und dass der Proviant des Kosmonauten Gagarin 1961 aus Schokoladensauce und püriertem Fleisch in Tuben bestand?
In ›Wie isst man ein Mammut?‹ erzählt Uta Seeburg chronologisch und anhand von fünfzig exemplarischen Gerichten Überraschendes, Kurioses und Wissenswertes aus der Kulinarik. Vom gegrillten Mammut bis zur Ikone der Molekularküche »Flüssige Olive«: Jedes Kapitel beschreibt ein Gericht und erklärt, warum seine Erfindung einen historischen Schlüsselmoment markiert. So berichtet Seeburg von den Bismarckjahren, in denen Köche ihre neueste Kreation vorzugsweise nach dem Kanzler benannten, und erklärt, warum Toast Hawaii symptomatisch für die Küche der Nachkriegszeit war. Geistreich, kenntnisreich und humorvoll zeigt sie, was die Menschen in unterschiedlichen Zeiten bewegte – und wie sich dies in ihren Speisen widerspiegelte.
© Inka Baron
Uta Seeburg arbeitete jahrelang als Redakteurin für die Zeitschrift ARCHITECTURAL DIGEST. Dort berichtete sie über Design und Reisen, verfasste zudem zahlreiche kulinarische Essays. Heute widmet sich die promovierte Literaturwissenschaftlerin und Autorin historischer Kriminalromane ganz dem Schreiben von Büchern. Auf ihrer interaktiven Webseite www.utaseeburg.de gibt sie Einblick in ihr Werk.
Uta Seeburg
WIE ISST MAN EIN
MAMMUT?
In 50Gerichten durch die Geschichte der Menschheit
E-Book 2023
© 2023 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagillustration: © Stephan Rehberg
Satz: mittelstadt 21, Vogtsburg-Burkheim
E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN E-Book 978-3-8321-8294-6
www.dumont-buchverlag.de
Meinen Eltern – stets hungrig nach Wissen, Geschichten und gutem Essen.
Gruß aus der Küche
Zugegeben, ich hatte es mir recht einfach vorgestellt: Mit diesem Buch wollte ich einen kulinarischen Spaziergang durch die Geschichte der Menschheit unternehmen, sozusagen mit dem Probierlöffel in der Hand – mal in Babylon in die Töpfe lugen, bei den Römern zu Tisch liegen, im Mittelalter eine heilende Suppe schlürfen, zum Abschluss dann vielleicht einen dekonstruierten Erbseneintopf der molekularen Küche degustieren. Jedes dieser Gerichte ist ein Kind seiner Zeit, sagt etwas darüber aus, was die Menschen einer bestimmten Epoche bewegt, worum ihre Gedanken kreisen – und was ihnen schmeckt.
Ziemlich schnell stellte ich fest, dass es bei diesem gemütlichen Spaziergang nicht bleiben kann. Der Löffel würde wohl auch in ziemlichen Untiefen fischen müssen. Denn das Thema Essen, zunächst mal ganz simpel des Menschen existenziellstes Bedürfnis, wird beim genaueren Hinsehen zum vielstimmigen Überraschungsmenü. Essen ist soziales Fundament und Gemeinschaft, in ihm liegen aber auch Macht und gnadenlose Hierarchie. Es ist eifersüchtig verteidigtes Nationalgut. Die Diskussion über Essen ist zunehmend politisiert, es kann sogar zum Mittel zivilen Ungehorsams werden. Die finstersten Kapitel der Menschheit fußen auf der Abwesenheit von Essen: Hungersnöte, auf die nicht selten Phasen exzessiven Schlemmens folgen. Essen ist natürlich Genuss, aber auch Erinnerung, Weltflucht und Nostalgie.
All diesen Phänomenen bin ich auf meiner kulinarischen Reise begegnet. Und freue mich nun, Ihnen dieses Buffet zu eröffnen. Bringen Sie Appetit mit!
UM 11.000V.CHR.
Gegrilltes Mammut, Nordamerika
Zwei Dinge braucht es für eine Küche: eine Hitzequelle und Geräte, mit denen man zerkleinern und zubereiten kann. Und dann muss noch jemand die Zutaten besorgen. Mit diesem scheinbar simplen Konzept ist dem Menschen seine erstaunliche Entwicklung gelungen: Jener unauffällige Schnorrer, der mit bang klopfendem Herzen hinter einem Busch kauert, während ein paar wilde Säbelzahnkatzen ein Bison reißen, gefolgt von den Hyänen, die noch die Reste vertilgen, bis dann endlich er zu den abgeknabberten Knochen huschen kann, die er mit seinem Faustkeil aufbricht, um das Mark auszuschlürfen, jenes wenig vielversprechende Geschöpf also kocht sich an die Spitze der Nahrungskette. (Wem das Auskratzen von Knochen irgendwie roh und archaisch erscheint, sei nur darauf hingewiesen, dass man heute noch bei gut sortierten Antiquitätenhändlern reizend ziselierte silberne Marklöffel finden kann, perfekt länglich geformt, um in jedes Eckchen des Knochens zu gelangen. Diese stammen beispielsweise aus vornehmen viktorianischen Herrenhäusern.)
Fairerweise muss zudem gesagt werden, dass Knochenmark ungewöhnlich proteinhaltig ist. Es sorgt dafür, dass das menschliche Gehirn ordentlich wächst, und diese wachsenden geistigen Kapazitäten lassen den Menschen immer komplexere Werkzeuge ersinnen und bringen ihn schließlich auf die Idee, das Feuer zu bändigen. Und voilà – es sind ein paar Hunderttausend Jahre vergangen – kann der Mensch Fleisch und Gemüse, das in rohem Zustand schwer verdaulich, ungenießbar und teilweise sogar giftig wäre, kochen, schmoren, braten und räuchern. Letztere Idee entsteht möglicherweise, nachdem man den einen oder anderen Wald niedergebrannt hat und danach ein paar Tierkadaver mit besonders intensivem Raucharoma einsammelt.
Vor rund zwanzigtausend Jahren dann sorgt die Eiszeit dafür, dass die Oberfläche jenes Meers, das man später Beringstraße nennt, dermaßen solide zufriert, dass ein besonders abenteuerlustiger Schlag Mensch auf den amerikanischen Kontinent gelangen kann. Diese Menschen entwickeln sich zu extrem erfolgreichen Jägern, deren unbekümmerte carnophile Einstellung vermutlich dafür sorgt, dass die Spezies der Mammuts, Hirschelche und Riesenfaultiere aussterben. Ihre Kultur ist nach dem ersten Fundort ihrer steinernen Speerspitzen benannt: Clovis.
Neben der schieren körperlichen Notwendigkeit der Nahrungsaufnahme hat Essen immer auch eine soziale Dimension, deren Kern sich von Epoche zu Epoche verändert. Mal steht das Miteinander bei Tisch im Vordergrund, mal zeigt man mit dem, was auf die eigene Tafel kommt, auf welcher Stufe der Gesellschaft man steht. In manchen Zeiten interessiert vor allem der Moment, in dem serviert wird, während eine andere Generation sich plötzlich hauptsächlich für das Kochen an sich interessiert, für all die schönen kleinen Momente, wenn Butter zischend zerläuft, dampfende Sauce hochkocht oder der Braten übergossen wird. Die kulinarischen Gedanken unserer Großwildjäger der Clovis-Kultur dürften hauptsächlich um all das, was noch davor kommt, kreisen, nämlich um das Aufspüren und Erlegen des Essens. Die Jagd eines Mammuts etwa erfordert Planung, Ortskenntnis – und viel Geduld. Die Clovis-Jäger suchen sich meist einen Hügel an einem Fluss oder einer Wasserquelle, von dem sie eine gute Aussicht haben, und harren dort aus, bis eine Mammutherde zum Trinken kommt. Während sie warten, beschäftigen sie sich oftmals damit, weitere tödliche Spitzen aus Feuerstein herzustellen. Diese sind nicht besonders groß, länglich und messerscharf. Manch einer ritzt zum Zeitvertreib auch mal ein dekoratives geometrisches Muster in einen Kieselstein oder eine hübsche Blume. Die Spitzen jedenfalls werden an leichten Wurfspeeren befestigt und, sobald sich die ersten unglücklichen Mammuts zeigen, auf diese geschleudert.
Ungemein vorteilhaft ist die leicht geriffelte Struktur der Spitzen, denn diese sorgt augenblicklich für starke Blutungen bei jedem Tier, egal wo es getroffen wird. Man braucht also kein brillanter Werfer zu sein, sondern muss auch hier wieder lediglich warten, bis das Mammut vom Blutverlust so benebelt ist, dass man näher herangehen und es endgültig töten kann. Danach werden die Kolosse noch vor Ort gemeinschaftlich zerlegt und abtransportiert, während der Flusslauf sich flammend rot färbt. Wie die Fleischstücke schließlich genau zubereitet werden, ob es vielleicht besonders köstliche Varianten gibt – geschmorte Mammutschulter an Wildkräutern und Früchten wäre doch denkbar –, lässt sich nicht mehr sagen. Auch wie so ein Mammut an sich eigentlich schmeckt, bleibt wohl ein ungeklärtes Geheimnis der Menschheitsgeschichte. Ein gewisser New Yorker Herrenclub nimmt jahrzehntelang für sich in Anspruch, im Jahre 1951 ein Stück im arktischen Eis konserviertes Mammutfleisch verspeist zu haben, doch dummerweise ergeben spätere DNA-Analysen, dass bei dem eiszeitlichen Dinner lediglich Suppenschildkröte serviert wurde.
Es steht aber zu vermuten, dass das Fleisch eher zäh ist, man wird es also etwas länger grillen müssen. Und vielleicht sitzen die Clovis-Menschen dabei ums Feuer, bearbeiten ihre neueste Robe aus Mammutfell und tauschen sich darüber aus, wie ihr Tag so war. Vertrauter Feierabend, durchweht vom Duft des langsam garenden Mammuts, der dafür sorgt, dass sich allseits bereits wohlig die Innenwände der Gaumen zusammenziehen. Bis sich die alle Zeiten überdauernde Frage stellt: Wann ist das Essen endlich fertig?
UM 5500V.CHR.
Getreidebrei und Einkornbrot, Mitteleuropa
Jahrtausendelang streift der Mensch durch Wälder und Savannen, erlegt die reichlich vorhandenen Tiere, sammelt und verzehrt, was in üppiger Ursprünglichkeit um ihn herum wächst. Hin und wieder einmal dürfte auch eine Handvoll wild gewachsenes Getreide dabei gewesen sein, und damit ist die Saat gesät. Seit dem Ende der letzten Eiszeit ist es wärmer geworden. Überall schießt das Getreide aus dem Boden, nach und nach beginnen die Menschen es zu ernten und zu verarbeiten, und schließlich bauen sie es im großen Stil an. Der Mensch nutzt hier seinen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Tieren, mit denen er um leicht zugängliches Essen konkurrieren muss: Er verlegt sich auf solche Nahrungsmittel wie Getreide, die roh ungenießbar sind und erst weiterverarbeitet werden müssen, bevor man etwas Essbares daraus zaubern kann. Aus vorübergehenden Lagern an einer besonders dichten Wiese werden Dörfer mit Feldern, die von Generation zu Generation mit immer mehr Akribie und schweißtreibender Anstrengung angelegt und bestellt werden. »Nicht wir haben den Weizen domestiziert, der Weizen hat uns domestiziert«, schreibt Yuval Noah Harari.1
An diesem Punkt der Geschichte dreht sich die ganze Existenz des Menschen ums Essen. Die Pflege, Kultivierung, Ernte und Verarbeitung seiner Nahrungsmittel bestimmen seinen gesamten Alltag. Sogar sein Haus ist zuallererst so konstruiert, dass es der Aufbewahrung und Zubereitung des Essens dient. Letztendlich ist es einfach eine bewohnbare Vorratskammer mit Kochstation. Eine typische jungsteinzeitliche Siedlung besteht aus mehreren lang gestreckten Häusern, die vielleicht einen kleinen Weiher säumen. Die Häuser sind recht groß, etwa zwanzig Meter lang, in jedem davon leben wohl bis zu dreißig Personen. Solch ein Haus hat ein kräftiges Gerippe aus Holzpfosten. Unermüdliche Hände haben Ruten geflochten, mit diesem Flechtwerk die Pfähle umspannt und dann alles mit grobem Lehm verputzt. Obendrauf ein Giebeldach, mit Schilfrohren gedeckt. Wie übergroße, schlaffe Hüte hängen diese Dächer fast bis zum Boden hinunter. Sonnenlicht fällt nur durch die offen stehende Tür an einem Ende des tunnelartigen Hauses.
Jedes dieser Häuser hat ein Herz aus Feuer: die Kochstelle. Sie liegt immer in der Mitte. Vermutlich sitzen die Bewohner des Hauses bei ihren Mahlzeiten um das Feuer herum. Die zum Allgemeinplatz gewordene Aussage, dass die Küche das Herz eines jeden Hauses sei, sie hat hier im Neolithikum, in den ersten Tagen menschlichen Wohnens, ihren Ursprung. Das Haus ist außerdem der trockenste Ort des Dorfes (und vermutlich auch der Ort, den man am besten im Blick und unter Kontrolle hat, sollten Getreidediebe durch die Siedlung streifen), deshalb gibt es mindestens einen Raum, in dem die Vorräte gelagert werden. Im offenen Zwischengeschoss unterm Dach lagert noch mehr, möglicherweise hängen hier auch büschelweise Kräuter zum Trocknen unter der Decke. Und wahrscheinlich ist unser Haus vollgestellt mit jener erstaunlichen Erfindung, die neben Pflanzenkultivierung und Sesshaftigkeit einen weiteren immensen zivilisatorischen Schub verantwortet: das Tongefäß. Die Krüge, Schüsseln und Amphoren sind von wundersamer Schönheit. Geschwungene Linien, konzentrisch angeordnete Tröpfchen und wellenartige Zacken wurden in den gebrannten Ton geritzt, Kreise und Spiralen in erdigen Farben zieren die gewölbten Bäuche der Schalen. Vor der Erfindung dieser Gefäße wurden Lebensmittel in Bodenlöchern und Körben aufbewahrt, wo sie entweder schnell verdarben oder von allerlei Getier gefressen wurden. Der Tontopf sorgt dafür, dass Vorräte in größeren Mengen angelegt werden können. Und natürlich ist richtiges Kochen erst möglich, seitdem es Töpfe gibt.
Mit seinem neuen Bauerndasein hat der Mensch seinen Lifestyle nicht wirklich verbessert. Vor allen Dingen, was seine Ernährung betrifft, hat er sich einer faden Einseitigkeit verschrieben, die zudem ein großes Risiko birgt. Sein Speiseplan sieht von nun an deutlich vegetarischer aus; es wird weniger gejagt, das Zeitalter der in der Nähe des Hauses lebenden Nutztiere hat begonnen. Es gibt also hin und wieder Fleisch vom Schwein, Rind, Schaf oder von der Ziege. Das wichtigste Nahrungsmittel aber ist der Weizen. Ein riesiges Wagnis. Denn auch wenn das Getreide von nun an gelagert werden kann, so reichen die Vorräte doch nicht, um eine verdorbene Ernte auszugleichen, und in diesem Fall drohen unbarmherzige Hungersnöte.
Heute allerdings herrscht eine festliche Stimmung im Dorf. Die Ernte ist gelungen, die Vorratskammern voll. Der Weizen – wir sprechen hier von sehr frühen Formen, die eben erst der ursprünglichen Wildheit entwachsen sind, nämlich Einkorn und Emmer – wird zunächst leicht geröstet, um ihn haltbarer zu machen. Dann folgt der mühsame Prozess des Mahlens mithilfe schwerer Reibsteine. Die Tage im Neolithikum sind geprägt vom Klang eines faustgroßen Steins, der über einen größeren flachen Stein gerieben wird, begleitet von dem monotonen hohen Klopfen, wenn beide aufeinanderprallen. Nach dem Mahlen müssen die Spelzen, also die Hüllen der einzelnen Körner, entfernt werden; eine weitere undankbare Plackerei, die der Mensch der landwirtschaftlichen Revolution zu verdanken hat. Das Brot aus Mehl und Wasser wird vermutlich in einem kuppelförmigen Lehmofen gebacken, der sich außerhalb des Hauses befindet. Über dem offenen Feuer der Kochstelle wurde derweil ein Topf platziert, in dem vermutlich eine Art Brei köchelt. Getreideeintöpfe werden den Menschen noch sehr lange begleiten. Die jungsteinzeitliche Variante ist vielleicht verfeinert mit Erbsen oder Linsen, auch im Wald wird noch saisonal gesammelt; Wildfrüchte, Pilze und Nüsse könnten sich auch in dem warmen Topf in der Mitte des Hauses finden.
Das Brot ist fertig, es sind flache, harte Fladen. Man muss sehr vorsichtig in dieses frisch gebackene Brot beißen, ansonsten könnte einem ein scharfer Schmerz ins Zahnfleisch schießen. Denn alle Spelzen werden so gut wie nie erwischt. Diese winzigen Dinger sind ungewöhnlich hart und spitz und können empfindliche Verletzungen im Mundraum verursachen – noch so ein Ärgernis des Neolithikums. Und so sinkt der Mensch nach etwa fünfunddreißig Jahren auf dieser Erde ins Grab. Er hat sein Leben lang hart gearbeitet und nicht besonders gut gegessen. Und doch ist er der Anfang von allem, was wir heute sind.
UM 1730V.CHR.
Lammeintopf mit Gerstenkuchen, Babylonien
Eines der ältesten niedergeschriebenen Kochrezepte der Menschheit lautet: »Lammeintopf. Fleisch wird verwendet. Bereite Wasser vor. Füge feinkörniges Salz, getrocknete Gerstenkuchen, Zwiebeln, persische Schalotte und Milch hinzu. Man zerkleinert und fügt Lauch und Knoblauch hinzu.« Um 1730 vor Christus werden diese Worte in akkadischer Keilschrift mithilfe eines Schilfgriffels in eine kleine Tafel aus Ton geritzt, mit einiger Wahrscheinlichkeit in der Stadt Babylon. Weich gibt der ungebrannte Ton unter der feinen Spitze des Griffels nach. Neben diesem Rezept werden noch weitere dokumentiert, es sind Anleitungen für die Zubereitung von Brühen, mehreren Eintöpfen und einem Hühnerkuchen, in dessen Innerem sich als Überraschung Fleisch befindet; insgesamt fünfundzwanzig Rezepte wird man in ferner Zukunft noch entziffern können. Diese kleinen beschrifteten Tafeln backt man zur Härtung, dabei färben sie sich leuchtend orange. In Archiven bewahrt man sie auf, ein uraltes schlummerndes Gedächtnis des Menschen, das irgendwann unter Trümmern und Erde verschwindet, bis es knapp viertausend Jahre später wieder ausgegraben wird.
Babylon ist zu dem Zeitpunkt, als der Lammeintopf schriftlich festgehalten wird, die größte Stadt der Welt. Ihre eng zusammenstehenden Häuser werden von einer gigantischen Stadtmauer umschlossen. Fremde wähnen sich im Innern der Metropole in einem Labyrinth, obwohl die Straßen schnurgerade gezogen sind. Doch die Häuserreihen sehen einander zum Verwechseln ähnlich, es sind glatte, fensterlose Fassaden, die ihr Innerstes vor fremden Blicken verbergen. Im Stadtkern ragt ein Turm scheinbar bis in den Himmel hinein, er besteht aus monumentalen Terrassen. Der Legende nach sollte dieser Turm noch höher werden, doch die Menschen, die ihn bauten, konnten sich nicht mehr verständigen, da ihre verschiedenen Sprachen für Verwirrung sorgten. Fest steht: Die Entstehung einer der ersten Großstädte der Welt muss eine schockartige Erfahrung sein. In dieser Begegnung mit dem leibhaftigen Chaos, dem Gefühl der Ohnmacht ob einer so schnell wachsenden Gesellschaft, liegt wiederum der Kern der vielleicht wichtigsten Erfindung der Menschheit: der Schrift. In Babylon und den weiteren sich schnell entwickelnden Stadtstaaten Mesopotamiens soll die Verschriftlichung der Welt für Ordnung sorgen.
Denn wie sonst soll man dieses stolze Babylon, diesen prachtvollen Moloch, in den Griff bekommen, wenn man ihn nicht verwaltet und Strukturen schafft, die man schriftlich festhält? Jedes Detail, das die neue urbane Gesellschaft ausmacht, muss dokumentiert werden, um es kontrollieren zu können. Die Erfindung der Schrift ist gleichzeitig die Geburtsstunde der Bürokratie. Zunächst ritzen die Schreiber Piktogramme in ihre Tontafeln. Eine Schale etwa steht für »Speise«. Eine Schale mit einem Kopf daneben bedeutet »essen«. Diese Piktogramme werden nicht nur in ihrer direkten Bezeichnung einer Sache verstanden, sondern auch als Laute gelesen. Daraus entstehen, da es praktisch und platzsparend ist, Lautzeichen. Die Schrift kann jetzt mittels ihrer Symbole das gesprochene Wort abbilden. Ein ungeheurer Akt der Abstraktion. Unsere babylonischen Rezepte sind bereits in solchen Lautzeichen im Ton verewigt.
Ein Großteil der erhaltenen Schriftzeugnisse der Babylonier sind Listen. Aufgelistet werden Waren, öffentliche Finanzen, die Mengen an aus vergorenem Gerstenbrot gebrautem Bier, die ein jeder Arbeiter erhält, die Anzahl und Ausmaße der Stadtmauern, Kultsockel, Straßen und Gebäude der Stadt. In diesem Sinne lesen sich auch die ersten uns bekannten Kochrezepte wie eine bloße Auflistung von Zutaten, deren Menge allerdings nicht weiter ausgeführt wird. Die wichtigsten Nahrungsmittel im mesopotamischen Raum sind Gerste, Sesam, Datteln und Bier (im Gegensatz zum syrisch-levantinischen Kulturkreis, wo vorrangig Weizen, Olivenöl, Feigen und Wein konsumiert werden). Die Babylonier beginnen sich außerdem für Milchprodukte zu interessieren, hauptsächlich für verschiedene Arten Käse vom Schaf. Letzteres wird auch zu Fleisch verarbeitet, außerdem bieten die zahlreichen Sümpfe eine Vielzahl Fische und Vögel. Auf den babylonischen Listen finden sich um die zweihundert Sorten Brot, sie werden aus Gerste und auch Emmer gebacken. Das Getreide wird nach wie vor mühsam von Hand mit Mahlsteinen zerstoßen und gerieben – allerdings hat man jetzt, den komplexeren Hierarchien städtischer Gesellschaften sei Dank, Gefangene, denen man diese undankbare Aufgabe übertragen kann.
Der Lammeintopf ist vermutlich für die Tafeln höherer Gesellschaftsschichten gedacht, darauf lässt die Vielfalt der Zutaten schließen. Er wird in einem großen Topf überm offenen Feuer zubereitet. Das Fleisch wird zunächst, so kann man es rekonstruieren, im Fett eines Schafsschwanzes gebraten. Nach und nach kommen Wasser und Milch hinzu, außerdem verschiedene Gewürze. Alles köchelt langsam vor sich hin. Den Gerstenkuchen krümelt man in den Eintopf, das sorgt für eine sämige Bindung.
Warum genau man diese Rezepte verschriftlicht, obwohl sie vermutlich allgemein bekannt sind und mündlich schon länger weitergegeben werden, darüber lässt sich nur mutmaßen. Offenbar erfasst die Schriftwut der Babylonier jeden Aspekt ihres vielschichtigen Alltags – wirklich alles soll aufgeschrieben werden. So heißt es auf der ersten Tafel der Stadtbeschreibung Babylons in einer weiteren Auflistung, die keine schillernde Facette der antiken Metropole auslässt: »Babylon – Sitz des Lebens! / Babylon – Macht der Himmel! / … Babylon – Stadt von Wahrheit und Gerechtigkeit! / Babylon – Stadt des Überflusses! / … Babylon – Stadt, deren Bewohner beständig feiern!« Auch hier wieder: Bewältigung einer überbordenden Vielfalt, indem man diese schriftlich fixiert. Die Rezepte sind möglicherweise Teil dieser Ordnungsstrategie. Dazu kommt: Schrift bedeutet auch Kollektivierung; dadurch, dass man alles niederschreibt und anordnet, entsteht eine in sich geschlossene städtische Gemeinschaft. Die Gerichte werden somit zum Allgemeingut erklärt: Essen, das wird sich noch zeigen, verfügt über eine massiv identitätsstiftende Kraft. Der Lammeintopf erinnert deutlich an den irakischen pacha, ein bis heute beliebtes Gericht, für das mehrere Teile vom Schaf gekocht und in etwa so zubereitet werden, wie es auf den Tontafeln geschrieben steht. Vorsichtig könnte man also in Hinblick auf den babylonischen Eintopf von einem ersten Nationalgericht sprechen. Einmal aufgeschrieben, hat es sich von diesem Moment an über Jahrtausende tradiert.
UM 1400V.CHR.
Mumifizierte Rinderrippchen, Ägypten
Ein verwinkeltes Haus, düster, aber angenehm kühl nach der sengenden Hitze draußen. Über den Räumen hängt eine Totenstille. Es riecht auf diffuse Art farblos, nach Sand und Staub. Das Haus besteht aus einer langen Zimmerflucht. Eine steile Treppe führt ins Souterrain, daran anschließend liegt ein langer, schlauchartiger Korridor. Am Ende dieses Tunnels stolpert man eine weitere Treppe hinunter, die in etwas führt, das an einen geräumigen Vorratskeller erinnert, vollgestopft mit Objekten, deren Umrisse sich allmählich in der Dunkelheit abzeichnen. Hinter diesem sonderbaren Depot öffnet sich unvermutet ein großer Raum, fast ein Saal, auch hier ist kein Platz verschenkt; wertvoll verzierte Truhen, Gefäße und Figuren, wohin man auch blickt, außerdem kostbare Sessel, mit vergoldeten Reliefs und Hieroglyphen geschmückt, sowie einige Betten. Den Mittelpunkt dieser bis unter die Decke aufgetürmten Schätze bilden die Särge der beiden Bewohner des Hauses. Wir befinden uns in der Grabkammer der Eheleute Juja und Tuja, vermutlich die Urgroßeltern des legendären Tutanchamun.
Irgendwo in diesem ganzen Durcheinander aus Grabbeigaben steht ein kleiner, ovaler Sarkophag. Darin ruht eine Mini-Mumie, länglich und sanft gebogen: ein paar Rinderrippen, fachmännisch mumifiziert. Dem einst saftigen Fleischstück wurde mithilfe von Salzen jegliche Feuchtigkeit entzogen, bevor man es sorgsam bandagiert hat. Das Tuch, mit dem die Speise umwickelt ist, wurde mit Pistazienharz behandelt, einer unermesslich teuren Substanz, mit der sonst nur mächtige Pharaonen für das Jenseits präpariert werden. Offenbar wollte jemand ganz sichergehen, dass die schmackhaften Rippchen auch wirklich den weiten Weg durch die Unterwelt überstehen.
Für die alten Ägypter ist der Tod lediglich der Start in ein neues Leben, eine Art optimierte Version des bisherigen irdischen Daseins, das nun endlich ewig währen wird. Allerdings müssen zunächst eine gefährliche Reise und das strenge Totengericht des Osiris überstanden werden, bevor dem Zutritt in die jenseitigen und glückseligen Iaru-Gefilde stattgegeben wird. Der neue Bewohner der Ewigkeit bringt all die Dinge, die er dort für seinen persönlichen Komfort benötigt, selbst mit. Während man in den meisten anderen Glaubensgemeinschaften allgemein davon ausgeht, dass man mit dem Eintritt ins Paradies automatisch Nutznießer einer Vollversorgung wird, hegen die Ägypter in diesem Punkt offenbar ein gewisses Misstrauen und laden ihre Gräber voll mit dem entsprechenden Gepäck für die letzte Reise. Alles Verderbliche, angefangen beim eigenen Körper, muss dabei perfekt konserviert sein, sonst kann man es nicht mitnehmen in die Ewigkeit. Deshalb also die Fleisch-Mumien. Manche liegen, wie die Rippchen, in eigenen Behältern, die dem Aussehen der jeweiligen zur letzten Ruhe gebetteten Speise nachempfunden sind. Im Grab des Inti aus der Zeit der sechsten Dynastie etwa findet sich ein Sarkophag in der Form eines Gänsebratens.
Allen Pharaonen werden Massen an Proviant in die Zimmer der hausartigen Gräber gelegt. Bei Tutanchamun weiß man von mehr als hundert Körben, gefüllt mit verschiedenen Getreiden und Brotlaiben, außerdem mit Früchten wie Maulbeerfeigen, Datteln, Melonen und Weintrauben (ob das Obst getrocknet, also länger haltbar gemacht worden ist, kann nicht mehr nachvollzogen werden). Des Weiteren bunkert der jung verschiedene Herrscher Honig und Wein. Und knapp fünfzig Holzkisten gefüllt mit mumifiziertem Fleisch und Geflügel – darunter allerlei kleine delikate Vögel sowie Enten und Gänse, wobei in manchen Fällen nur die üppigsten Stücke derselben einbalsamiert werden. Ähnlich ist es mit den Stücken vom Rind am Knochen, von denen ganz offenkundig nur die besten, fleischigsten Teile gewählt werden. Sehnige Rindsbeine etwa sucht man vergeblich. Schmorfleisch ist der Mumifizierung nicht würdig, ein schönes Karree dagegen schon. Auch Fisch, Schwein oder Schaf findet man nicht in den Grabkammern, es sind allesamt Produkte, die eher zur banalen Alltagskost des alten Ägyptens zählen. Bei der Wahl der Speisen für die Ewigkeit wird also ganz klar hierarchisiert, dabei geht es wohl zum einen um Exklusivität, aber eben auch um Geschmack.
In der fruchtbaren Region am Nil wachsen reichlich Emmer und Einkorn, daher gehört auch in Ägypten das Brot, in flachen Fladen gebacken, zum täglichen Leben. Das mühsam gemahlene Mehl wird durch Siebe aus Binsengras gegeben, die leider so grobmaschig sind, dass all die kleinen Steinchen, die hier und da von den Mahlsteinen abbröckeln, meistens ebenfalls ins Brot gehen, was neben den oftmals im Mehl zurückgebliebenen schmerzhaft scharfen Spelzen eine weitere Herausforderung an ägyptische Zähne darstellt. Dafür werden die Brote bereits gewürzt oder auch mit Honig, Datteln und Feigen versüßt. Auch sonst ist die Ernährungslage selbst für die arme Bevölkerung nicht die schlechteste, denn der Nil ist voller Fische; Obst und Gemüse gedeihen in dem warmen Klima prächtig. Und überall wird täglich frisches Bier aus Gerste gebraut. Wein dagegen können sich Arbeiter nicht leisten. Auch Geflügel, vor allem aber Rindfleisch, das, zischend und brutzelnd, überm offenen Feuer gegrillt oder auch in Töpfen geschmort wird, ist der Elite vorbehalten. Die Rinderzucht ist ein exklusives und teures Geschäft, denn die meisten Flächen werden für den Anbau von Gemüse und Obst gebraucht, Weideland gibt es kaum. Und doch: Abgesehen von den ärgerlichen Jahren, in denen der Nil die Ufer überschwemmt und die Ernte ruiniert, könnte man sich bereits im Paradies auf Erden wähnen. Aber der Mensch will eben immer noch mehr.
Bei festlichen Anlässen setzen die alten Ägypter sich einen Kegel aus Bienenharz auf den Kopf, warum, weiß man heute nicht so genau, es ist aber möglich, dass diese mit parfümierten Ölen gefüllt sind, die während eines Festessens für kostbaren Wohlgeruch sorgen. Eine starke Affinität zu balsamischen Ölen, bereits zu Lebenszeiten, ist jedenfalls nicht zu leugnen. Vielleicht denkt manch einer in dem Augenblick, als ihm das duftende Öl die Nase heruntertropft, entzückt an sein zukünftiges Dasein als Luxus-Mumie, wenn die mumifizierten Gänse aus ihren bratenförmigen Sarkophagen steigen werden. Es ist nur ein kleiner Teil der Bevölkerung, der so exquisit wie die Pharaonen speisen kann. Doch die Speisen dieser wenigen markieren die Sehnsüchte vieler. Die saftigsten Gänsekeulen, die köstlichsten Rinderkoteletts, im besten Fall noch versetzt mit dem luxuriösen, zart duftenden Pistazienharz – auf diese Speisen richtet sich ein derartiges Begehren, dass man sie in die Ewigkeit mitnehmen will. Auf dass man dort für immer göttlich essen wird.
UM 850V.CHR.
Mansaf, Syrien
Kaum eine Landschaft macht den Menschen so klein wie die Wüste. Ein unermesslicher Raum aus Sand und Staub. Pudrige Berge, in denen die Füße versinken. Kein Fundament ist sicher, der Boden zerfließt in feinen Sand, der in Wellen über die Ebenen weht. Dazwischen schroffe, abweisende Felsen. Nachts schwarze Kälte, tagsüber blendende Hitze. In dieser Welt leben bereits seit Jahrtausenden die Beduinen. Als Nomaden, die zwischen Wüste und Steppe umherziehen, züchten sie vor allem Vieh – Ziegen, Schafe und Kamele – und bewegen sich das Jahr über von Weidestelle zu Weidestelle, wo sie jeweils ihre Zelte aufschlagen. Ihre Ernährung ist von Milchprodukten geprägt, Fleisch wird seltener gegessen. Längs ihrer jährlichen Routen bauen sie auch Getreide an, sie verwenden es für den Teig dünner Fladenbrote, die man shrak nennt, und zur Versorgung ihres Viehs. Knapp tausend Jahre vor unserer Zeitrechnung haben die Beduinen bereits ein fein choreographiertes Netzwerk aus Lagern, Siedlungen und dem Rhythmus der Jahreszeiten folgenden Reisebewegungen konstruiert, das sich über Teile der heutigen jordanischen, syrischen, irakischen und saudi-arabischen Wüste ausbreitet. Mittlerweile beziehen sie ihre wichtigsten Einnahmen aus der aufwendigen Logistik, die mit den wachsenden Handelsrouten einhergeht: Sie geleiten Fremde und ihr Transportgut durch die Wüste oder besteuern ortsfremde Karawanen.
Die Gesellschaft der Beduinen besteht aus unterschiedlichen Stämmen, die mehr oder weniger in Freundschaft miteinander verbunden sind. Loyalitäten folgen einer strengen Hierarchie der verwandtschaftlichen Verhältnisse: Je enger man miteinander verwandt ist, umso größer ist die Treue, die man einander hält. Es ist aber ein anderer gesellschaftlicher Wert, ein Kodex, an den sich alle Beduinen halten müssen und der dieses gesamte Gebilde aus Beziehungen, wechselnden Lebensräumen und durchreisenden Fremden organisiert und stabil hält: die Gastfreundschaft.
Gastfreundschaft ist das wichtigste Überlebensprinzip in der Wüste, denn sie besagt, dass man verpflichtet ist, jeden vorbeiziehenden Fremden mit Essen und Trinken zu versorgen. Essen ist in diesem System lebensbedingende Nahrungsquelle, sozialer Kitt und Gemeinschaftsstifter. Ein Gericht, mit dem die Beduinen bis heute ihre Gäste bewirten, ist die mansaf. Der Begriff bezeichnet gleichzeitig das große runde Tablett, auf dem die Speise serviert wird, die man seit jeher zu festlichen Anlässen zubereitet und deren hoher Fleischanteil für die Großzügigkeit des Gastgebers steht – je größer der Fleischberg, desto generöser ist er. Zunächst wird das Brot gebacken. Der Teig besteht aus Wasser und Vollkornmehl, also nicht gemahlenem Mehl, und wird papierdünn auf einem gewölbten Stein ausgebreitet, der schon seit Stunden von der Glut eines Feuers erhitzt wird. Mit diesen Fladen legt man das Tablett aus, das auf einem erhöhten Gegenstand bereitsteht. Das Fleisch, meistens Lamm, wird in Stücke zerteilt und in einem großen Topf Wasser gekocht. Daneben ein kleinerer Topf, darin schäumt ein ansehnlicher Klumpen Kamelbutter. Ein nussiger Duft steigt auf, während sie sich leicht braun verfärbt. Wenn das Lamm ganz weich gekocht ist, verteilt man es über das Fladenbrot, darüber wird erst die entstandene heiße Fleischbrühe, dann die geklärte Butter gegossen, das Ganze wiederholt man in ein paar Schichten.
Da die mansaf