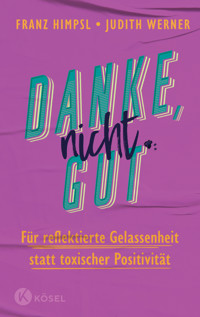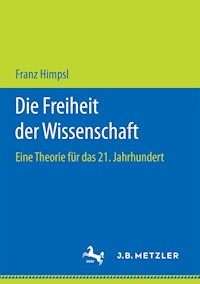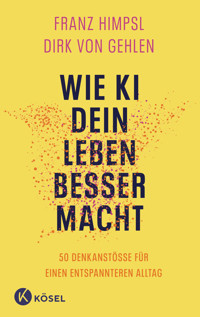
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel-Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Prompt zu einem besseren Leben – ein neuer Blick auf KI
Die Diskussion um die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz geht am Alltag der meisten Menschen vorbei. Viel ist von technischen Details die Rede, von utopischen Potenzialen und gesellschaftlichen Gefahren. Aber selten gibt es Antworten auf die Frage: Wie kann ich all das, was gerade erst möglich geworden ist, ganz einfach und konkret für mich und mein Leben nutzen?
In 50 Denkanstößen gehen die Autoren mit den Potenzialen von KI auf Tuchfühlung. Sie zeigen, wie wir KI schon heute dafür nutzen können, uns bei der Gestaltung eines gesünderen Lebensstils zu helfen oder uns zu unterstützen, bessere Beziehungen zu führen. Fernab der gängigen Dystopien helfen uns Franz Himpsl und Dirk von Gehlen, KI als eine Reihe von Werkzeugen zum kreativen Problemlösen zu begreifen. Die Experten bieten Inspirationen zum Verstehen, Ausprobieren und Weiterdenken und schaffen so ein umfassendes Grundlagenverständnis, wie wir mit KI schon jetzt ein entspannteres Leben führen können: verständlich, fundiert und zugleich optimistisch, ohne naiv zu sein.
»Dieses Buch ist ein fantastischer Auftakt zur wichtigsten Reise unserer Zeit: Die Epoche der künstlichen Intelligenz zu verstehen.« SASCHA LOBO
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
ÜBERDASBUCH:
Künstliche Intelligenz ist in unserem Alltag angekommen. Aber wie können wir all die neuen Möglichkeiten ganz einfach und konkret nutzen?
Franz Himpsl und Dirk von Gehlen geben 50 kluge Impulse zu den praktischen Potenzialen von KI. Du lernst, wie du mit einem Chatbot eine sokratische Argumentationsmaschine bauen kannst, wie maschinelles Lernen Kultur, Medizin und Landwirtschaft prägt und wie künstliche Intelligenz dir dabei hilft, deine menschliche Intelligenz zu stärken.
Die Autoren zeigen, dass eine sinnvolle Diskussion über KI vor allem eine entspannte Haltung braucht – fernab von Technikeuphorie und Untergangsdystopien.
Ein inspirierendes Buch zum Ausprobieren und Weiterdenken: verständlich, fundiert und zugleich optimistisch, ohne naiv zu sein.
ÜBERDIEAUTOREN:
Franz Himpsl ist promovierter Philosoph und Journalist. Als Autor war er für die ZEIT, Psychologie Heute und die SZ tätig. Er arbeitet bei der Wissens-App Blinkist als leitender Entwicklungsredakteur und Prompt Engineer und verantwortet die KI-basierte Erstellung von Texten und Audio. franzhimpsl.com
Dirk von Gehlen ist Leiter des Thinktanks SZ Institut der Süddeutschen Zeitung. Der Journalist, Vortragsredner und Autor ist für seine vielfältigen Beiträge zur digitalen Kultur bekannt. Er lebt in München und im Internet: dirkvongehlen.de
FRANZ HIMPSLDIRK VON GEHLEN
WIE KIDEINLEBENBESSERMACHT
50 DENKANSTÖSSE FÜREINEN ENTSPANNTEREN ALLTAG
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Alle in diesem Buch veröffentlichten Aussagen und Ratschläge wurden von den Autoren und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann jedoch nicht übernommen werden, ebenso ist die Haftung der Autoren bzw. des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ausgeschlossen.
Copyright © 2025 Kösel-Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich
Pflichtinformationen nach GPSR)
Umschlag: zero-media.net, München
Umschlagmotiv: FinePic®, München
Satz und E-Book Prodution: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-32674-6V002
www.koesel.de
INHALT
1. Los geht’s
TEIL I: TOOLSFÜREINBESSERESLEBEN
2. Der große KI-Moment
3. Das Muster der großen Sorge
4. Ein Werkzeugkasten
5. Ein entspannterer Alltag
6. Das Ende des Durchschnitts ist der Anfang neuer Probleme
TEILII: LERNEDEINENWERKZEUGKASTENKENNEN
7. Prompten mit Fingerspitzengefühl
8. Wie KI die Landwirtschaft revolutioniert
9. Kreativität auf Speed
10. In intelligenter Erwartung
11. Abschied von der einen Lösung
12. Die Macht der deummen Frage
TEILIII: ICHUNDDIEMASCHINE
13. Nur in guten Händen gut
14. Das bin ja ich
15. Ich höre mich sagen
16. Neues von FranzBot
17. Finde deine Analog-Digital-Abkürzung
18. Was ist ein Foto?
TEILIV: FÜRFORTGESCHRITTENE
19. Bessere KI-Texte
20. Was wir glauben wollen: Das Mögliche im Unmöglichen ausmachen
21. Bitte einmal Bilanz ziehen, Claude
22. Datenanalyse: Aus Zahlen wird eine Geschichte
23. Leg die Ordner zu den Akten
24. Auf dem Weg zum Werkzeug
TEIL V: REISEZUMMITTELPUNKTDERINTELLIGENZ
25. Und was ist jetzt intelligent?
26. Intelligenz ist mehr als Verstand
27. Emotionale Intelligenz
28. Lerne schreiben! Gerade weil KI es kann
29. Was würde Roman sagen?
30. Bewegungsintelligenz
31. Mehr – wenn du es teilst
32. Cool und uncool
33. Denken als Prozess
34. Co-Intelligence – wie Kondor, Fahrrad und KI uns klüger machen
TEILVI: DIENEUEWELTISTDA
35. Machine Learning in der Medizin: Kommt mir omisch vor
36. Argumentieren lernen mit der Sokratischen Maschine
37. »Macht die Technik nicht zum Sündenbock«
38. Lob des Überblickswissens
39. You in, you out!
TEILVII: MENSCHBLEIBTMENSCH
40. Was ist eigentlich menschlich?
41. Übernimm Verantwortung
42. Botshit und wie du ihn vermeidest
43. No Bot Is Perfect
44. und manchmal schreibt man lieber selbst
45. Lifehacking für Humanisten
TEILVIII: UTOPIENFÜRKI-REALISTEN
46. Die Brücke zwischen den zwei Kulturen
47. Werkzeug-Intelligenz
48 Forschung: Die große Synthese
49. Gute Vorsätze in voller Fahrt: Weiterfragen!
TEILIX: GLOSSARUNDANHANG
50. KI-Glossar
Anmerkungen
1. LOS GEHT’S
[von Dirk und Franz] Die Idee für dieses Buch wurde an einem historisch winterlichen Dezembertag geboren. Noch nie zuvor war an einem Tag so viel Schnee gefallen. Wir saßen in der Cafeteria der Süddeutschen Zeitung, wärmten uns die winterkalten Hände an unseren Cappuccinotassen und stellten bei unserem Gespräch schnell fest, dass uns gerade dasselbe Thema umtrieb: Die künstliche Intelligenz war für uns beide innerhalb kurzer Zeit von einem digitalen Nischenthema zu einem Fixstern unserer Arbeit geworden. Uns wurde damals klar, dass diese Entwicklung Ausdruck einer großen Veränderung ist. Dirk erzählte davon, wie irritierend es war, sich mit einem Chatbot konfrontiert zu sehen, der seinen eigenen Schreibstil nachahmen konnte. Und Franz berichtete von den Höhen und Tiefen mit seinem eigenen KI-Stimmklon »FranzBot«, die ihn und seine Kolleg:innen im zurückliegenden Jahr beschäftigt hatten.
Klar war: Da ist etwas Neues in unserem Leben, und es wird alles ändern.
Konkret merken wir als Head of Content Innovation bei der Wissens-App Blinkist beziehungsweise als Direktor des Digital-Thinktanks der SZ schon heute sehr deutlich, dass künstliche Intelligenz die Art und Weise ändert, wie mediale Inhalte produziert werden. Und wir ahnen, wie profund die Konsequenzen in vielen anderen Bereichen sein werden. In diesem Buch spüren wir diesen Verschiebungen nach. Wir tun dies nicht nur deshalb, weil wir die KI-Revolution dokumentieren wollen, sondern vor allem deshalb, weil wir glauben, dass auch du davon profitieren kannst. Auch dann, wenn du keine IT-Spezialist:in bist, sondern einfach nur offen für Neues und interessiert an Abkürzungen, Vereinfachungen und Lifehacks.
Es gibt viele Diskussionen, die die politischen, philosophischen und sozialen Folgen der KI-Revolution in den Blick nehmen. Sie stellen Fragen wie: Wird es irgendwann eine KI geben, die so etwas wie ein Bewusstsein hat? Wer haftet für Handlungen, die von einer künstlichen Intelligenz ausgeführt werden? Wie reguliert man große KI-Unternehmen? Oder: Was ist die beste Waffe gegen KI-generierte Desinformation? Diese Diskussionen sind wichtig; und dennoch fällt uns auf, dass sie oft alarmistisch und abstrakt geführt werden, nach dem Motto »Wollen wir das mit der KI überhaupt?«. Das ist geradezu skurril, denn wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, kommt man nicht umhin, festzustellen, dass künstliche Intelligenz sowieso schon längst im Alltag angekommen ist: in unseren Büros, in unseren Autos, in der Medizin, in den Lehrplänen der Unis – und in unseren mobilen Endgeräten sowieso.
Das hier ist deshalb ein persönliches, anwendungsorientiertes Buch, das dich und dein Leben im Mittelpunkt hat und dir Denkanstöße zum Umgang mit der KI gibt. Du findest hier Tipps, wie du Zeit bei der Wissensorganisation und der Bewältigung deines Alltags sparst, außerdem Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Ausprobieren, etwa wie du dir mit einem Chatbot eine Art Denkmaschine bauen kannst. Zudem bietet dir dieses Buch eine Reihe von Reflexionen, die dir helfen, mit der ganzen Widersprüchlichkeit der Chancen und Beschränkungen von KI souverän umzugehen und im Spiegel der intelligenten Maschinen deine menschliche Intelligenz besser verstehen zu lernen.
Denn von einem sind wir überzeugt: Wenn ich klug mit einer Technologie umgehen will, muss ich begreifen, was diese Technologie kann und ausmacht. Ich muss intentional mit ihr umgehen und dafür muss ich auch meine Fähigkeiten und Begrenzungen kennen. Für uns jedenfalls war die erstaunlichste Erkenntnis nicht mal, dass die KI schon vieles kann und einiges historisch ändert – sondern wie viel man durch das Interagieren mit jener KI über sich selbst lernt.
Wir sprechen im Folgenden zunächst über unseren ganz persönlichen Eindruck von der KI-Revolution, dann übers Prompten mit Chatbots, über Text-to-Speech, Bilderzeugung, KI-Kreativität und vieles mehr, das du im Alltag verwenden kannst. Denkanstöße findest du am Ende jedes Kapitels, Begriffserklärungen im Glossar ganz am Schluss.
In diesem Sinne: Mach mit und komm auf unsere KI-Entdeckungsreise.
TEIL I
TOOLS FÜR EIN BESSERES LEBEN
2. DER GROSSE KI-MOMENT
[von Franz]Bevor wir unseren Streifzug durch die Alltagsanwendungen der künstlichen Intelligenz antreten, müssen wir über einen besonderen Moment in der jüngeren Vergangenheit sprechen. Ich würde jede Wette eingehen, dass er in hundert Jahren in keiner Doku über die Zwanzigerjahre dieses Jahrhunderts fehlen wird. Und doch scheint er den meisten Menschen verborgen geblieben zu sein. Vielleicht liegt das daran, dass wir gewohnt sind, solche historischen Ereignisse mit eindrucksvollen Nachrichtenbildern zu verbinden: Panzer rollen über einen Platz, eine Weltraumrakete steigt in den Himmel auf, eine Politikerin hält eine Rede im Parlament. Das Ereignis, von dem die Rede ist, war indes ein virtuelles, kein visuelles.
Am 30. November 2022 machte das US-Forschungsunternehmen OpenAI die Anwendung ChatGPT der Öffentlichkeit zugänglich. OpenAI-Mitgründer Greg Brockman verkündete am 5. Dezember stolz auf Twitter, ChatGPT habe in den ersten fünf Tagen bereits eine Million Nutzer gewonnen.1
Technisch beruhte ChatGPT auf dem Sprachmodell GPT-3, das im Juni 2020 eingeführt worden war und das, so war zu lesen, 175 Milliarden Lernparameter beinhaltete. Ist das viel? Ist das wenig? Der Technikjournalist Christian Stöcker ordnete die Zahl im August 2020 so ein: »Ein menschliches Gehirn verfügt über etwa 100 Billionen Synapsen. Eine Billion sind tausend Milliarden. GPT-3 ist also weit davon entfernt, ein Gehirn zu simulieren, aber es ist hundertmal umfangreicher als sein auch schon ziemlich eindrucksvoller Vorgänger GPT-2.«2
Wenn man Technologie von der technischen Seite her denkt, könnte man solche Entwicklungen einfach als kontinuierliche Verbesserung sehen: Auf GPT-2 folgt GPT-3 folgt GPT-4, so wie auf den Golf VII der Golf VIII folgte und auf die Playstation 4 die Playstation 5. Aber das sind nur Zahlen. Aus menschlicher Sicht ist Technologie nicht nur eine bloße Abfolge von Versionsnummern und besseren Leistungsdaten. Denn hin und wieder gibt es Sprünge, die so groß sind, dass sie einen kategorialen Unterschied machen, weil sie uns ein anderes Grundgefühl bei der Nutzung vermitteln. Das iPhone war, als es 2007 eingeführt wurde, auch so ein Beispiel. Es gilt nicht deshalb als revolutionär, weil es einen besonders schnellen Prozessor oder viel Speicher hatte, sondern weil es die Art und Weise, wie wir mit Mobiltelefonen interagieren, neu bestimmte: mit Fingereingabe und einer intuitiven Benutzeroberfläche, die auf die Bedürfnisse der Nutzer:innen zugeschnitten war.
Was also war das völlig Neue an ChatGPT und dem zugrunde liegenden Modell GPT-3? Aus Anwender:innensicht war die Antwort einfach: Bisher waren Chatbots ziemlich dumm gewesen, aber ChatGPT war ziemlich klug; bisher waren gute Antworten eine Glücksfrage gewesen, aber jetzt waren sie die Norm; bisher hatte sich die Interaktion mit solchen Bots als Interaktion mit einer Maschine angefühlt, jetzt fühlte sie sich an wie die Interaktion mit einem Menschen.
Meine erste Begegnung mit Chatbots war jene mit Karl – einer animierten Büroklammer, die Teil des Office-97-Pakets war. Karl fragte einen gerne und, wenn man ehrlich ist, auch ein wenig zu aufdringlich, wie er behilflich sein könne. Und manchmal war er das tatsächlich: Wenn man eingab, dass man eine Tabelle oder einen Brief erstellen wolle, wies Karl den Weg zur entsprechenden Funktion in Word. Aber Karl war auch ziemlich beschränkt. Er lernte nicht dazu, er ging nicht auf meine Präferenzen ein, sondern er löste einfach bei bestimmten vorher definierten Triggern – »Brief« oder »Tabelle« – bestimmte Aktionen aus.
Seit 2011 begleitet mich Siri. Die Sprachassistentin wäre sicher beleidigt, würde sie (oder er? oder es?) erfahren, dass ich sie in eine Ahnenreihe mit Karl Klammer einsortiere, aber tatsächlich gehörte die frühe Siri für mich dorthin. Denn in den ersten Jahren ihrer Existenz hatte sie mit Karl gemein, dass sie nicht gut genug war, um mich wirklich zu bereichern. Klar, die Software reagierte auf menschliche Sprache und konnte einige unterschiedliche Anfragen verarbeiten. Das war ganz nett, wenn man, sagen wir, gerade ein Baby auf dem Arm trug und schnell wissen wollte, wie die Champions-League-Viertelfinal-Ergebnisse lauten, ohne sein Handy berühren zu müssen.
Aber sobald die Themen auch nur ein wenig komplexer wurden, häuften sich die Antworten, die wenig brauchbar sind. Auch heute noch bekomme ich einfach zu oft nicht das, was ich möchte, als dass ich Siri als Informationsquelle beständig in mein Leben lassen möchte. Früher wurden meine Fragen oft gar nicht verstanden. Legendär der Moment, als ich mit dreckigen Händen vor der Knetschüssel stand und Siri fragte, wie ich den Strudelteig weniger klebrig mache, nur um die Antwort zu erhalten, dass dies nach einem ernsten Problem klinge und Siri gerne meine Notfallkontakte anrufen könne. »Nein, Siri, nein!« Gut, mittlerweile bekomme ich auf »Wie pumpe ich einen Fahrradreifen auf?« oder »Wie hat sich der Zweite Weltkrieg auf unsere heutige Welt ausgewirkt?« wenigstens Linklisten mit ein paar einigermaßen nützlichen Seiten – aber googeln kann ich selbst.
ChatGPT ist anders. Es ist ein Browserfenster, das ich offen lasse, weil ich weiß, dass ich dort Fragen aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen stellen kann und dass ich in den meisten Fällen sinnvolle, kohärente Antworten erhalte. »Wie pumpe ich einen Fahrradreifen auf?« Ergibt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung einschließlich verschiedener Ventiltypen. »Wie hat sich der Zweite Weltkrieg auf unsere heutige Welt ausgewirkt?« erzeugt eine ausführliche, aber nicht überbordend volle Liste mit den wichtigsten Aspekten: geopolitische Neuordnung, europäische Integration, Dekolonialisierung, wirtschaftliche Entwicklung, Verschiebung der Machtzentren, kulturelle Auswirkungen. Damit kann man arbeiten.
Man sollte dabei nicht vergessen, dass ChatGPT und KI-Anwendungen im Allgemeinen eine lange Vorgeschichte haben. Das, was wir heute unter künstlicher Intelligenz verstehen, ist kein Phänomen, das erst in den Zwanzigerjahren dieses Jahrhunderts zum Thema wurde. Schon viel früher, in den Neunzigerjahren, gab es erstaunliche Fortschritte: Einfache Algorithmen des maschinellen Lernens wurden bereits damals in der Medizin genutzt, um Strukturen in Röntgenbildern zu klassifizieren. 1995 fuhr im Rahmen eines Forschungsprojekts ein Versuchswagen fast durchgehend autonom von München nach Kopenhagen. Und auch der Sieg des Schachcomputers Deep Blue gegen den damaligen Schachweltmeister Garri Kasparow im Jahr 1997 ist heute noch vielen im Gedächtnis.
Bei alledem handelte es sich allerdings nur um einzelne Anwendungen. Der qualitative Sprung nach vorne, den wir jetzt in der KI erleben, hat etwas damit zu tun, dass sich die Ausgangsbedingungen gleich auf mehreren Ebenen deutlich verbessert haben: die Modelle und Algorithmen; die Verfügbarkeit von Daten, mit denen man diese Modelle füttern kann; und die Rechenleistung und Energieeffizienz der Prozessoren, die die Daten verarbeiten.
Wenn sich Expert:innen über die Entwicklung der künstlichen Intelligenz äußern, dann wird oft gesagt, dass wir uns aufgrund dieser zunehmend günstigen Bedingungen auf einer exponentiellen Wachstumskurve befänden, dass also das Wachstum nicht linear, sondern in beschleunigter Weise zunehme. Fakt ist: Die KI ist in vielen Bereichen so gut geworden, dass dies ins Bewusstsein ganz normaler Anwender:innen gedrungen ist. Die Einführung von ChatGPT im November 2022 mag technologiegeschichtlich insofern nur ein kleiner Schritt gewesen sein, dem viele vorausgingen und viele folgen werden; aber für unser kulturelles Bewusstsein war es eine wichtige Wegmarke. Ein Symbol dafür, dass wir am Beginn einer Epoche stehen, in der künstliche Intelligenz nicht nur in Forschungslaboren zu Hause ist, sondern zu einem Teil unseres Alltags geworden ist.
Zeit also, sie gebührend willkommen zu heißen.
Der KI-Fortschritt hat sich enorm beschleunigt. Wenn du auf dem neuesten Stand bleiben willst, empfehlen wir dir, einen allgemeinverständlichen KI-Newsletter zu abonnieren, zum Beispiel jenen des Human Magazins oder Natürlich intelligent von ZEIT Online.
3. DAS MUSTER DER GROSSEN SORGE
[von Dirk] Vielleicht ist die eindringlichste künstlerische Verarbeitung der Angst vor der Wirkmacht von KI keine moderne Science-Fiction oder ein dystopischer Horrorfilm, sondern ein Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1940. Damals brachte Disney in Fantasia ein Narrativ auf die Leinwand, das sehr anschaulich die Sorgen illustriert, die heute mit der Nutzung von KI verbunden sind.
Zu sehen ist dabei, wie Micky Maus einen Hut findet, der ihm Zauberkräfte verleiht und mit dessen Hilfe er einen gewöhnlichen Besenstiel zum magischen Gehilfen macht: Der Besenstiel kann nämlich Wassereimer tragen. Eine Tätigkeit, die Micky vorher mühsam selbst erledigen musste. Mithilfe eines auf Imitation und Nachahmung angelegten Trainingsprogramms (Micky zeigt dem Besenstiel Schritt für Schritt, wie die Eimer zu tragen sind) wird der Besenstiel in die Lage versetzt, das Wassertragen selbst auszuführen. Und zwar so gut, dass es nur kurze Zeit später zum Problem wird. Er hört nämlich nicht mehr auf.
Das Motiv, dass ein Zauber außer Kontrolle gerät, ist aber keineswegs erstmals von Mickey Maus entdeckt worden. Im Märchen Der süße Brei von den Gebrüdern Grimm findet sich das gleiche Muster: Eine Hunger leidende Familie erhält durch einen zauberhaften Topf Zugang zu unbegrenztem Brei. Da die Mutter aber den stoppenden Zauberspruch vergisst, kocht und kocht der Topf, bis er zunächst überquillt und anschließend gleich die ganze Stadt unter Brei begräbt.
Die Sorge, dass eine unerklärliche Technologie außer Kontrolle gerät, ist also weit älter als die Errungenschaften der künstlichen Intelligenz. Das Motiv überträgt sich aber sehr deutlich auf unsere Debatten und Ängste im Umgang mit KI: Sie wird mehr Wissen erzeugen, als wir verarbeiten können. Sie wird nicht aufhören, auch wenn wir gar keine Wassereimer mehr benötigen. Sie wird diese unablässig tragen und tragen – und schließlich das ganze Haus unter Wasser setzen, ohne dabei auf Folgen des Tuns oder Kontexte des Handelns zu schauen. So das Szenario in Fantasia und so auch heute die zentrale Sorge im Umgang mit künstlicher Intelligenz.3
Das wirkt unheimlich – denn die Erzählung von KI, der wir folgen, bedient ein Muster, das der Psychiater Ernst Jentsch bereits im Jahr 1906 in seinem Aufsatz »Zur Psychologie des Unheimlichen« wie folgt beschrieben hat: »Einer der sichersten Kunstgriffe, leicht unheimliche Wirkungen durch Erzählungen hervorzurufen, beruht nun darauf, dass man den Leser im Ungewissen darüber lässt, ob er in einer bestimmten Figur eine Person oder etwa einen Automaten vor sich habe.«4 Genau dieser Effekt wird spürbar in der Diskussion, ob eine KI denn vielleicht eine Seele haben könnte – eine unheimliche Vorstellung, gepaart mit dem unbarmherzigen Zielerreichungswillen und der Unterordnung aller möglichen Folgen für uns Menschen unter einem unflexiblen und konsequent verfolgten Ziel.
Ob diese Sorge berechtigt oder unberechtigt ist, lässt sich zwar im Moment nicht final beantworten. Doch mir gefällt dahin gehend die Einschätzung von Kevin Kelly, dem Chefredakteur des Computermagazins Wired: »Wer Angst vor einer die Menschheit unterjochenden KI hat, überschätzt nicht nur KI-Systeme, sondern auch die Bedeutung von Intelligenz. Um die Welt zu ändern, braucht es mehr als nur Intelligenz: Raffinesse, Kooperation, Einfühlungsvermögen oder Ausdauer. Es sind nicht unbedingt die intelligentesten Menschen, die etwas auf die Beine stellen.«5 Sicher ist jedenfalls, dass in diesem Muster der großen Technologie-Sorge eine klare Lehre steckt. Und zwar eine für uns Menschen. Denn der Mensch unterscheidet sich von der Maschine dadurch, dass er auch mal inkonsequent ist; pragmatisch reagieren kann und nicht alles einem großen Ziel unterordnet.
Diese drei Entwicklungslinien werden wir uns im Folgenden noch genauer ansehen, denn um besser mit der KI umzugehen, sollten wir uns auch stärker damit auseinandersetzen, was nicht-maschinell, also menschlich sein sollte. Genau diese Erkenntnis ist es nämlich, die dem Außer-Kontrolle-Geraten der Maschine nach unserem Sorgemuster vorbeugen kann.
Der zentrale Pfad im Umgang mit KI ist die Mustererkennung, also die Fähigkeit wiederkehrende Schemata zu sehen und daraus Schlüsse zu ziehen. Je mehr Daten die KI bekommt, umso leichter kann sie diese Muster erkennen und daraus Prognosen erstellen. Ein Muster, das die KI erkennen wird, ist die genannte Erzählung der großen Sorge. Statt also dem Panik-Narrativ aus dem Märchen zu folgen, könnten wir aber auch beginnen, ein anderes Muster zu wählen, um uns selbst von den Herausforderungen der KI zu erzählen: die Heldenreise.
Jede bekanntere Geschichte, ob in Film oder im Roman folgt diesem immer gleichen Ablauf, der einem Muster folgt – das von Menschen und nicht von Maschinen bedient wird. Das Muster der Heldenreise (beginnt stets mit dem Aufbruch des Helden aus einem bekannten Umfeld und führt über mehrere Prüfungen und Rückschläge über einen Spannungsbogen zu einem Erkenntnisziel) bestimmt schon immer die Art, wie wir uns Geschichten erzählen (lassen). Wenn es also um den Umgang mit Mustern und um die menschliche Emanzipation geht, lohnt es sich, auf eine Metaebene zu treten – und den eigenen Umgang mit Werkzeugen wie KI aus der langfristigen Perspektive zu betrachten.
Wenn wir aus dem Muster der großen Sorge ausbrechen wollen, müssen wir uns auch vergegenwärtigen, was uns als Menschen ausmacht. Diese Haltung kann helfen, die Angst zu durchbrechen und stattdessen eine eigene Heldengeschichte mit bzw. über KI zu schreiben. Der wichtigste Startpunkt ist dabei, KI eine Rolle in deinem Leben zu geben: indem du sie aktiv als Helfer in deinem Alltag nutzt.
4. EIN WERKZEUGKASTEN
[von Franz]Es war ein warmer Vormittag im April und ich saß im Garten. Ich hatte mir vorgenommen, die ersten Zeilen für dieses Buch zu tippen, ließ mich aber dann doch von einer Signal-Nachricht ablenken. Mein Freund Simon hatte mir geschrieben und er wirkte aufgebracht. Das war ungewöhnlich, denn Simon ist eigentlich von der analytischen Sorte: Ingenieur, Softwareentwickler, Prozessoptimierer.
Ich klickte auf das YouTube-Video, das er mitgeschickt hatte. Es zeigte eine Präsentation auf einer Entwicklerkonferenz, die Jensen Huang, der Gründer des Chipherstellers Nvidia, vor Kurzem gehalten hatte.6
Ich ahnte schon, worum es gehen würde. In letzter Zeit war viel von Nvidia die Rede gewesen, auch außerhalb der Technologie-Nischenmedien. Die Firma hatte gerade eine Wachstumsgeschichte hinter sich, wie es sie selten gibt. Zuerst hatten sich in der Corona-Pandemie viele Leute mit Hardware eingedeckt, um sich das Eingesperrtsein mit 3-D-Spielen aufzuhübschen. Und dann kam direkt die Zeit, in der alle anfingen, von künstlicher Intelligenz zu sprechen, und in der der Durst der Datenzentren nach KI-optimierten Chips unstillbar wurde. Gewinn: in einem Jahr fast versechsfacht. Gute Zeiten für den Konzern aus Santa Clara.
Es war der vorläufige Höhepunkt eines ersten KI-Hypes, in dem sich alles um immer mehr Rechenleistung drehte und der mittlerweile durch die Ankunft der ressourcensparenden chinesischen DeepSeek-Modelle schon wieder etwas abgekühlt ist. Die Nvidia-Keynote war damals aber extrem selbstbewusst: Man wollte zeigen, dass man sich an der Speerspitze einer alles verändernden Revolution wähnte. Man sparte nicht an Pathos, als zu Beginn der Präsentation ein Videofilm eingespielt wurde, in dem die künstliche Intelligenz höchstselbst die Hauptrolle innehatte.
Das Publikum sah ein Bild des Universums, und aus dem Off deklamierte eine weibliche Stimme, die ebenjene künstliche Intelligenz darstellen sollte, »I am a visionary, illuminating galaxies to witness the birth of stars.« Die KI, legte das Video nahe, sei eine universelle Helferin, die uns unter anderem ermögliche, zu verstehen, wie Sterne entstehen. Es folgte eine Aneinanderreihung dessen, was sie darüber hinaus zu leisten imstande sei: uns ein besseres Verständnis von Extremwetter-Phänomenen geben; Blinde über viel befahrene Straßen führen und den Stummen eine Stimme verleihen; aus erneuerbaren Energien gewonnenen Strom speichern und einer Zukunft den Weg bereiten, in der es saubere Energie für alle gibt; Roboter lehren, wie sie Menschenleben retten; Krankheiten heilen; Symphonien komponieren. Ganz am Ende, bevor der lederbejackte Firmenchef auf die Bühne trat, war in weißen Kleinbuchstaben auf schwarzem Hintergrund zu lesen: »i am ai«.
»Was hältst du davon, KI zu personifizieren?«, fragte Simon.
»Gutes Marketing«, antwortete ich.
Die künstliche Intelligenz ist ja eigentlich ein ziemlich vielfältiges Konglomerat unterschiedlicher Fachdisziplinen, Forschungs- und Anwendungsfelder, von der Objekterkennung über die Robotik und statistische Vorhersagemodelle bis zur Verarbeitung natürlicher Sprache. Aber das alles passt natürlich nicht in einen emotionalen Film von 3 Minuten 24 Sekunden. Und deshalb begnügte man sich mit der stark vereinfachten Botschaft: Seht her, ich bin die KI. Das Video war voller plakativer Hauptsätze, aber so ist Firmen-PR nun mal. Rein handwerklich war das Ganze nicht schlecht gemacht, und überhaupt ist so eine Allegorie immer hilfreich, wenn man die Leute nicht mit ausufernden Erklärungen langweilen will.
Simon aber, der tief in der Materie steckte und auch gerne mal bei philosophischen Stammtischen über die Grundprinzipien des maschinellen Lernens referierte, hielt überhaupt nichts davon, »die« KI als echte Person mit einer Menge positiver Eigenschaften darzustellen. Schon gar nicht dann, wenn sie als Heilsbringerin gezeichnet wird. Denn, sagte er: »Das Ganze könnte man auch umdrehen: Was ist mit Deepfakes, Internetkriminalität, Fake News, Hackerangriffen, die von KI unterstützt werden? Haben wir etwa das personifizierte Böse geschaffen?« Simon fand, solche rhetorischen Manöver seien nicht sehr hilfreich, sie weckten nur Ängste, »dass morgen der Terminator kommt«.
Ich musste lange über diesen Einwand nachdenken, denn ganz von der Hand zu weisen ist er nicht.
Ich glaube aber auch, so ganz ohne Vereinfachungen und vermenschlichende Darstellungen – die sogenannten Anthropomorphismen – kommt man nicht aus, wenn man über die Anwendung von KI spricht. Das liegt nicht nur am cleveren Marketing der Betreiberfirmen, sondern auch daran, dass viele dieser Systeme dafür gemacht sind, in natürlicher Weise mit uns Menschen zu interagieren. Dass man manchmal vergisst, dass am anderen Ende kein Homo-sapiens-Gehirn ist, sondern ausgeklügelte Algorithmen, ist deshalb gewissermaßen Teil des Konzepts. Im Alltagsgebrauch ist das kein Problem, sondern ein Vorteil, denn es macht natürliche Interaktion möglich.
Was indes irreführend ist, ist die Vorstellung, es gebe die »eine« künstliche Intelligenz – ein Wesen mit einem Willen, einer Agenda. Der Punkt geht an Simon. Denn wenn man das glaubt, driftet man leicht in eins von zwei Lagern ab: das jener, die glauben, dass die KI »böse« sei und eines Tages den Untergang der Zivilisation einläuten werde, oder das jener, die – wie der erwähnte Werbefilm – der festen Überzeugung sind, sie sei zutiefst »gut« und führe uns auf direktem Weg in ein irdisches Paradies.
Die sogenannte »allgemeine künstliche Intelligenz«, die alle denkbaren intellektuellen Aufgaben mindestens genauso gut wie Menschen lösen kann und möglicherweise sogar eine Art Bewusstsein haben wird, ist bisher nur ein theoretisches Konstrukt, eine Fiktion, von der niemand weiß, wann und ob sie Realität werden wird. Bisher sind KI-Anwendungen darauf beschränkt, bestimmte intellektuelle Tätigkeiten in einer menschenähnlichen oder Menschen übertreffenden Qualität auszuführen.
Das kann einen großen Nutzen bringen, aber natürlich auch große Risiken. So warnt der Historiker Yuval Noah Harari, sprachmächtige KI-Anwendungen gefährdeten unsere Demokratie, weil sie im Dialog Intimität herstellen und dadurch Menschen in ungeahnter Weise beeinflussen könnten.7 Die Informatikerin Katharina Zweig weist darauf hin, dass die Sprachmodelle, die Anwendungen wie ChatGPT zugrunde liegen, auf Wahrscheinlichkeiten und Trainingsdaten aus dem Internet basieren. Da es aber viele unwahre Sätze gibt, die im Internet weit verbreitet sind – etwa dass die US-Wahl 2020 manipuliert gewesen sei –, bestehe hier die Gefahr, Falschinformationen zu reproduzieren.8 Und der Hirnforscher Manfred Spitzer fürchtet, dass KI-Anwendungen gerade für ungebildete Menschen eine Gefahr darstellen, weil es für sie besonders schwierig sei, KI