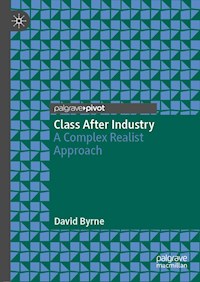24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit ›Wie Musik wirkt‹ ermöglicht Musiker David Byrne den Lesern einen außergewöhnlichen Blick in die Welt der Musik – die Mischung aus Musikgeschichte, Autobiographie und Handbuch ist so vielseitig wie der Talking Heads-Gründer selbst David Byrne ist ein Vordenker des Pop und ihm immer einen Schritt voraus. Nach all den Jahren im Musikbusiness weiß er genau, wie unterschiedlich Musik in Kellerkneipen und Aufnahmestudios, auf afrikanischen Dorfplätzen und in den Opernhäusern dieser Welt klingt. Aber wie genau funktioniert und wirkt Musik – akustisch, wirtschaftlich, sozial und technologisch? Diesen Fragen widmet sich Byrne mit seinem Buch, einer lebendigen Mischung aus Musikgeschichte und Autobiographie, anthropologischer Untersuchung und erklärendem Handbuch. Mit Verve und Witz nimmt er die Leser mit auf eine inspirierende Reise. Ein Buch für alle Fans von David Byrne und den Talking Heads – und für alle, die sich für die Kunstform Musik interessieren. Enthält zahlreiche farbige Abbildungen. »David Byrne ist ein brillanter, origineller und exzentrischer Rockstar, und er hat ein Buch geschrieben, das zu seinen vielfältigen Talenten passt.« The New York Times »Ein gut recherchiertes und wahnsinnig fesselndes Stück Musikgeschichte« The Independent
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 740
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
David Byrne
Wie Musik wirkt
Über dieses Buch
Mit ›Wie Musik wirkt‹ ermöglicht Musiker David Byrne den Lesern einen außergewöhnlichen Blick in die Welt der Musik – die Mischung aus Musikgeschichte, Autobiographie und Handbuch ist so vielseitig wie der Talking Heads-Gründer selbst
David Byrne ist ein Vordenker des Pop und ihm immer einen Schritt voraus. Nach all den Jahren im Musikbusiness weiß er genau, wie unterschiedlich Musik in Kellerkneipen und Aufnahmestudios, auf afrikanischen Dorfplätzen und in den Opernhäusern dieser Welt klingt.
Aber wie genau funktioniert und wirkt Musik – akustisch, wirtschaftlich, sozial und technologisch?
Diesen Fragen widmet sich Byrne mit seinem Buch, einer lebendigen Mischung aus Musikgeschichte und Autobiographie, anthropologischer Untersuchung und erklärendem Handbuch.
Mit Verve und Witz nimmt er die Leser mit auf eine inspirierende Reise. Ein Buch für alle Fans von David Byrne und den Talking Heads – und für alle, die sich für die Kunstform Musik interessieren.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
David Byrne wurde in Schottland geboren und in Amerika berühmt. Als Frontsänger der 1975 von ihm mitbegründeten Band Talking Heads gelang ihm der Durchbruch, später war er auch als Solokünstler erfolgreich – als Musiker, aber auch als Filmproduzent, Autor und Fotograf. Das Multitalent hat zahlreiche Preise gewonnen, darunter einen Oscar und einen Golden Globe. David Byrne lebt in New York, wo es heute nicht zuletzt dank des Fahrradaktivisten (›Bicycle Diaries‹) endlich Radwege gibt.
Achim Stanislawski, Übersetzer, Literaturkritiker und Blogger, lebt und arbeitet in Frankfurt am Main. Er ist der Herausgeber der ›Kleinen Philosophie der Gaumenfreuden‹ (kleinephilosophiedergaumenfreuden.de) und hat für S. Fischer zuletzt Alberto Manguels ›Die verborgene Bibliothek‹ ins Deutsche übertragen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Deutsche Erstausgabe
Erschienen bei S. FISCHER
Die Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel ›How Music Works‹ bei McSweeney’s, San Francisco. Die vorliegende deutschsprachige Ausgabe folgt der US-amerikanischen Paperback-Ausgabe, erschienen 2017 bei Three Rivers Press, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC, New York.
Copyright © 2012, 2017 Todo Mundo Ltd.
All rights reserved.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2019 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Schiller Design, Frankfurt
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490339-2
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Vorwort
Kapitel 1 Zurückgespult
Wir sind alle Afrikaner
Unterhaltungsmusik
Ruhe, bitte!
Musik auf Tonträgern
Die Konzertsäle von heute
»Birds do it« (Louis Armstrong)
Der größte aller Räume
Architektur als Instrument
Kapitel 2 Mein Leben auf der Bühne
Kapitel 3 Musik und Technik: analog
Konservierte Konstruktion
Wie lang sollte ein Song sein?
Improvisation wird zu Komposition
Die neue Welt
Techno-Utopismus, Teil 1
Tonbandaufnahmen
Glenn Goulds Prophezeiung
Instrumententechnik und ihr Einfluss auf die Musik
Die virtuelle Ein-Mann-Band
Die LP
Kassetten
Im Club
Kapitel 4 Musik und Technik: digital
CDs
Beschissener Sound
Musicsoftware und das Komponieren mit Samples
Private Musik
Akustische Assoziationen
Was nicht konserviert werden kann
Kapitel 5 Unbegrenzte Auswahl: die Macht der Playlisten
Weniger ist mehr
Wem vertrauen wir? Expertenmeinungen
Entkopplung: Empfehlung durch Songanalyse
Wir mögen das Gleiche wie unsere Freunde: soziale und kulturelle Einflüsse auf die Musikauswahl
Power to the People
Kontext ohne Kontext: Narrative als Empfehlung
Kapitel 6 Im Studio
Dekonstruieren und Isolieren
Imaginäre Feldaufnahmen
Modulare Musik
Die Musik schreibt die Lyrics
Zwei Platten auf einmal
Paris, eine afrikanische Stadt
New York, eine heimliche Latin City
Alles auf Anfang
Das Studio kommt zu dir nach Hause
Techtalk
Auf die gute, alte Art
In Heimarbeit
Die Welt um uns herum
Kapitel 7 Zusammenarbeit
Gut zusammenspielen
Notation und Kommunikation
Auf der Schulter von Riesen
Dreamworld
Mit den Wörtern beginnen – den Wörtern anderer
Dramaturgische Korrekturen
Emergentes Geschichtenerzählen
Kapitel 8 Business und Finanzen
Was ist Musik?
Was machen Plattenfirmen eigentlich?
Punkt 1: Die Kosten für Musikaufnahmen gehen inzwischen gegen Null
Punkt 2: Herstellungs- und Vertriebskosten gehen inzwischen gegen Null
Punkt 3: Künstler kriegen keine dicken Vorschüsse mehr
Punkt 4: Konzerte werden wieder zu einer Einnahmequelle
Vertriebsmodelle
1. Der 360°-Deal
2. Standard-Tantiemenvertrag
3. Lizenzdeal
4. Profit-Share Deal
5. P&D (oder M&D) Deal
6. Eigenvertrieb
Lizenzen
Der letzte Nagel zum Sarg
Freiheit oder Pragmatismus
Schöne neue digitale Welt
Kapitel 9 Eine Szene machen
1. Es muss einen Laden mit der richtigen Größe und in der richtigen Lage geben, in dem man neues Material ausprobieren kann
2. Die Musiker müssen ihr eigenes Material spielen dürfen
3. Musiker sollten immer umsonst reindürfen (und das ein oder andere Bier gratis bekommen)
4. Es muss ein Gefühl der Entfremdung von den gegenwärtig vorherrschenden Musikströmungen geben
5. Die Mieten müssen niedrig sein und es auch bleiben
6. Bands müssen fair bezahlt werden
7. Künstler und Publikum sollten sich nahe kommen können
8. Es muss (wenn nötig) möglich sein, die Band zu ignorieren
Vermächtnis einer Musikszene
Horizontale und vertikale Konzertbuchung
Kapitel 10 Amateure!
Neben einem Forellenbach sitzend, Lachs aus der Dose essend
Wozu ist Musik eigentlich gut?
Förderung
Popmusik: Manipulationswerkzeug der Kapitalisten?
Der Bilbaoeffekt
Amateure heranziehen
Die Zukunft
Kapitel 11 Harmonices Mundi
Sphärenmusik
Der Osten
Biologie und die neurologischen Grundlagen der Musik
Musik und Emotionen
Fühlst du, wie ich fühle?
Musik und Ritus
Die große Entzauberung
Visuelle Kultur vs. akustische Kultur
Musik der Stille
Selbstspielende Musik
Käsekuchen!
Dank
Anhang
Vorschläge für die weiterführende Lektüre
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Diskographie
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Abbildungen
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Über den Autor
Für Emma und Tom Byrne, die meine jugendlichen Experimente in der Musik nicht nur ertragen, sondern hin und wieder sogar mitgemacht haben.
Vorwort
Mein ganzes Leben habe ich immer irgendwie mit Musik zu tun gehabt. Das war nicht unbedingt so geplant, und zunächst hatte ich auch keine ernsthaften Ambitionen in dieser Richtung – es hat sich einfach so ergeben. Ein glücklicher Zufall, wenn man so will. Wie merkwürdig, dass ein so großer Teil meiner Identität an etwas so Flüchtigem hängt. Man kann Musik nicht anfassen – sie existiert nur in dem Moment, in dem sie wahrgenommen wird –, und dennoch kann sie unsere Sicht auf die Welt beeinflussen. Musik kann uns durch schwierige Zeiten in unserem Leben helfen, nicht nur, weil sie unsere Sicht auf uns selbst verändert, sondern auch, wie wir über die Dinge um uns herum denken.
Schon sehr früh war mir klar, dass ein Musikstück, wenn man es in einen anderen Kontext überführt, dort nicht nur völlig anders wahrgenommen wird, sondern dass auch das Stück selbst eine völlig neue Bedeutung annimmt. Je nachdem wo man es hört – in einem Konzertsaal oder auf der Straße – und welche Intention dabei mitschwingt, kann das gleiche Musikstück als Angriff und als Zumutung wahrgenommen werden oder die Leute zum Tanzen bringen. Wie Musik funktioniert und nicht funktioniert, hängt weniger von dem Stück an sich ab (vorausgesetzt, es gibt solch einen isolierten Zustand des Ansichseins überhaupt), sondern vielmehr davon, was drum herum geschieht, wo und wann du es hörst. Wie die Musik interpretiert und auf die Bühne gebracht wird, wie sie verkauft und wie sie aufgenommen wird, wer sie spielt, mit wem man sie zusammen hört, und zuletzt natürlich auch, wie sie klingt: All das sind Faktoren, die nicht nur einen Einfluss darauf haben, ob ein Musikstück funktioniert – ob es tatsächlich das erreicht, wonach es strebt –, sie sind selbst Teil der Musik.
Die Kapitel in diesem Buch widmen sich jeweils einem dieser besonderen Aspekte der Musik. In einem Kapitel geht es darum, welchen Einfluss die Technologie auf den Klang und unser Denken über Musik hat. Ein anderes beschäftigt sich mit den Orten, an denen wir Musik hören. Die Kapitel folgen keiner Chronologie und bauen nur lose aufeinander auf. Man kann sie in beliebiger Reihenfolge lesen, obwohl ich glaube, dass die Anordnung, die mein Lektor und ich für sie gefunden haben, eine gute Orientierung gibt – soll heißen, sie ist nicht völlig beliebig. Einige Kapitel habe ich für die amerikanische Taschenbuchausgabe erweitert, dazu kamen einige Nachbesserungen, die ich auf meiner Lesereise für die gebundene Ausgabe sowie aus Briefen und E-Mails zusammengetragen habe, Updates zu neuen Technologien und durch die Zusammenarbeit mit anderen Künstlern. Ich lerne kontinuierlich dazu, und so können sich auch die hier geäußerten Gedanken durchaus verändern.
Dieses Buch ist kein autobiographischer Bericht über mein Leben als Sänger und Musiker, aber vieles von dem, was ich über Musik weiß, beruht natürlich auf meiner jahrelangen Erfahrung im Tonstudio und auf der Bühne. In diesem Buch nutze ich diese Erfahrungen, um zu illustrieren, wie Technologie die Musik verändert hat und was das für mein eigenes Denken über Musik bedeutet. So haben sich zum Beispiel meine Ansichten darüber, wie eine gute Liveshow ablaufen muss, mit den Jahren völlig verändert, und meine eigene Bühnenkarriere ist ein anschauliches Beispiel dafür.
Viele haben sehr erhellend über die physiologischen und neurologischen Effekte von Musik geschrieben, die Wissenschaft durchleuchtet uns, um besser zu verstehen, wie Musik sich auf unser Fühlen und unsere Wahrnehmung auswirkt. Mein Anliegen ist jedoch ein anderes. Mir geht es darum, wie Musik gemacht wird, bevor wir sie zu hören kriegen. Wer sorgt dafür, dass sie überhaupt bei uns ankommt, und welche äußeren Faktoren spielen eine Rolle? Das können Dinge sein wie: Gibt es eine Bar in unmittelbarer Nähe zur Bühne? Kannst du die Musik unterwegs mitnehmen? Fahren die Mädels drauf ab? Ist sie teuer?
Ideologische Aspekte der Musikproduktion habe ich, so gut es ging, ausgeklammert. Musik kann nationalistische Gefühle wecken, zur Rebellion aufrufen oder helfen, eine etablierte Kultur vom Sockel zu stoßen – rebellische Musik kann durchaus politisch motiviert sein, meistens geht es aber einfach nur um den guten alten Generationenkonflikt. Aber auch das ist nicht das Thema dieses Buches. Ich beschränke mich auch nicht auf bestimmte Stile oder Genres, weil ich glaube, dass gewisse Muster und Verhaltensweisen in ganz unterschiedlichen Kulturen unabhängig voneinander auftreten können. Ich hoffe allerdings, dass die Leserinnen und Leser dieses Buch auch dann genießen können, wenn sie nicht unbedingt Fans meiner eigenen Musik sind. Auch die aufgeblasenen Egos so mancher Stars und Sternchen interessieren mich nicht sonderlich, obwohl ich durchaus der Ansicht bin, dass die psychischen Eigenheiten von Musikern und Komponisten einen genauso großen Einfluss auf die Musik haben wie die Phänomene, die ich in diesem Buch beschreibe. Stattdessen habe ich nach Mustern gesucht in der Art, wie Musik beschrieben, aufgenommen, unter die Leute gebracht und von diesen wahrgenommen wird, und mich dann gefragt, inwiefern die dabei wirkenden Kräfte auch mein eigenes Schaffen beeinflusst haben … und möglicherweise auch das Werk anderer Künstler. Moment mal, rede ich dann am Ende vielleicht doch nur über mich selbst? Ganz ausschließen kann ich es nicht, schließlich bin ich auch nicht anders als die anderen.
Aber verderben wir uns nicht den Spaß an der Musik, wenn wir versuchen, hinter die Fassade zu blicken und rauszufinden, wie die dahinter laufende Maschinerie funktioniert? Nein, für mich hat die Musik nichts von ihrer Magie eingebüßt. So fragil ist sie nun auch wieder nicht. Wir wissen ja auch, wie die Anatomie unseres Körpers funktioniert und haben trotzdem Spaß am Leben. Solange Menschen die Gemeinschaft anderer suchen, wird es immer Musik geben. Sie verschwindet nicht, sie verändert sich nur. Und ich liebe Musik heute mehr denn je. Umso mehr wir darüber wissen, umso weiter und tiefer ist das Meer, das Musik bedeutet.
Kapitel 1Zurückgespult
Es hat eine ganze Weile gedauert, bis mir dämmerte, dass der Kontext eine überaus wichtige Rolle dabei spielt, was geschrieben, gemalt, geformt, gesungen und aufgeführt wird. Das hört sich vielleicht nicht nach einer großen Offenbarung an, aber tatsächlich besagt dieser Satz so ziemlich das Gegenteil von dem, was wir uns konventionell unter einem kreativen Akt vorstellen. Wir glauben, dass Kunst aus einer tiefen Emotion entspringt, aus einem Aufwallen der Gefühle und der Leidenschaft, und dass der Drang zum kreativen Ausdruck keinen Aufschub duldet, er muss sich eine Form schaffen, in der er gelesen, gehört oder gesehen werden kann. Gewöhnlich stellen wir uns diesen Akt etwa so vor: Ein klassischer Komponist bekommt plötzlich einen entrückten Ausdruck und beginnt dann ansatzlos eine vollständig ausgereifte Komposition niederzuschreiben, die nur in dieser und keiner anderen Form existieren kann. Oder wir stellen uns einen von wilden Begierden und inneren Dämonen getriebenen Rocksänger vor, aus dem in einer Art inspirierter Eruption diese unglaublichen, perfekt geschliffenen Songs hervorbrechen, die rein zufällig alle drei Minuten und zwölf Sekunden lang sind. Das ist eine sehr romantische Vorstellung davon, wie Kunst entsteht. Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass es genau andersherum läuft. Ich glaube, dass Künstler instinktiv und unbewusst so arbeiten, dass das Ergebnis zu bereits vorhandenen Formvorgaben passt.
Natürlich kann Leidenschaft dabei trotzdem eine Rolle spielen. Nur weil die Form, die das Werk eines Künstlers annimmt, vorherbestimmt und opportunistisch ist (soll heißen, der Künstler kreiert, weil er die Möglichkeit dafür hat), heißt das nicht, dass diese Werke kalt, mechanisch und herzlos sein müssen. Auch düsteres und sehr emotionales Material kann auf diese Weise entstehen, denn die Anpassung an vorgefundene Gegebenheiten läuft größtenteils unbewusst und instinktiv ab. Meistens sind wir uns dessen gar nicht bewusst. Die Leidenschaftsnummer – »ich musste mir das einfach von der Seele schreiben« – wird zwar immer noch gerne bemüht, aber die Form, die solche Stücke annehmen, richtet sich ebenfalls nach kontextuellen Zwängen. Und das ist, wie ich meine, gar nicht so schlecht. Denn so müssen wir, Gott sei Dank, das Rad nicht jedes Mal neu erfinden, wenn wir uns kreativ betätigen wollen.
Auf gewisse Weise nähern wir uns der Sache also genau andersherum, indem wir, ob nun bewusst oder unbewusst, etwas schaffen, das zu einer bestimmten Situation passt. Das trifft auch auf andere Kunstformen zu: Ein Gemälde wird so gemalt, dass es an der weißen Wand einer Galerie gut aussieht, genau wie Discomusik für große Hallen komponiert wird und völlig anders sein müsste, wenn sie auch in einem Konzertsaal gut klingen soll. Auf gewisse Weise »erzeugt« der Raum, die Plattform oder die Software die Kunst oder Musik. Sobald dann etwas Erfolg hat, werden weitere Spielstätten von ähnlicher Größe und Form gebaut, um noch mehr Produktionen dieser Art dort aufzuführen. Nach einer Weile wird dann die besondere Form der Werke, die an eine spezifische Art von Spielstätte angepasst ist, als gegeben vorausgesetzt – und tatsächlich hören wir in einem Konzertsaal fast nur klassische Konzerte.
Auf dem Foto unten sieht man das Innere des CBGBs, wo ich meine ersten Auftritte hatte. A Versucht mal beim Betrachten dieses Fotos die schöne Inneneinrichtung zu vergessen und nur auf Größe und Form des Raumes zu achten. Daneben sieht man eine Band während eines Auftritts. B Der Sound in diesem Club war hervorragend – der ganze Müll, der überall herumlag, die Möbel, die Bar, die schiefen, unebenen Wände und die tiefhängende Decke sorgten für eine gute Schallabsorption, zudem konnten sich die hier zurückprallenden Schallwellen nicht überlagern, es gab also keinen Halleffekt. Das sind Voraussetzungen, für die man ein Vermögen ausgeben müsste, um sie in einem Tonstudio zu erzeugen. Diese räumlichen Besonderheiten passten gut zur dort gespielten Musik. Aufgrund des fehlenden Halls konnte man davon ausgehen, dass im CBGB auch noch die kleinsten musikalischen Details hörbar waren – und da der Laden recht klein war, waren auch alle Gesten und Bewegungen zumindest von der Taille aufwärts für alle gut sichtbar. Was unterhalb der Taille geschah, war mehr oder weniger verborgen, verdeckt von der halb sitzenden, halb stehenden Menge. Die meisten Leute im Publikum bekamen also nicht mit, wenn der Typ auf dem Foto sich wieder einmal auf der Bühne herumwälzte. Für sie war er einfach von der Bildfläche verschwunden.
Dieser Club in New York sollte ursprünglich ein Absackerladen mit Bluegrass und Country werden – ganz im Stile der berüchtigten Tootsie’s Orchid Lounge in Nashville. Der Legende nach kannte Sänger George Jones die Zahl der Schritte vom Ryman Auditorium, wo die legendäre Radioshow Grand Ole Opry aufgenommen wurde, bis zum Hintereingang des Tootsie’s in- und auswendig: siebenunddreißig. Und Charley Pride schenkte der Besitzerin Tootsie Bess eine Hutnadel, mit der sie auf ungehobelte Gäste losgehen konnte.
Das Foto unten zeigt einige Künstler, die im Tootsie’s auftraten. C Von der Architektur her waren die beiden Clubs fast identisch. Auch das Verhalten der Besucher ähnelte sich. D
Sogar was die Musik betrifft, war der Unterschied zwischen den beiden Clubs nicht so gewaltig, wie man annehmen würde. In ihrer musikalischen Struktur ähnelte sich, was in den beiden Lokalen gespielt wurde, sehr stark, obwohl das Country-Publikum bei Tootsie’s den Punkrock aus dem CBGB wohl gehasst hätte, und vice versa. Als die Talking Heads zum ersten Mal in Nashville spielten, kündigte uns der Ansager mit den Worten an: »Heute kommt der Punkrock nach Nashville! Zum ersten und wahrscheinlich letzten Mal!«
Beide Clubs sind eigentlich Bars. Die Besucher trinken, treffen Freunde, brüllen rum und fallen von den Stühlen, weshalb die Musik sehr laut sein muss, um überhaupt gehört zu werden – so war es schon damals, und so ist es bis heute. (Übrigens: Die Musik im Tootsie’s war meistens viel lauter als im CBGB.)
Mit Blick auf diese zugegeben noch recht spärlichen Belege, fing ich an mich zu fragen, inwiefern ich selbst – auch wenn es vielleicht unbewusst geschehen war – Musik spezifisch für Clubs wie diesen geschrieben habe? (Das Tootsie’s kannte ich noch nicht, als ich mit dem Songschreiben anfing.) Also begann ich Nachforschungen anzustellen, um zu sehen, ob es auch noch andere Musikarten gibt, die für einen speziellen akustischen Kontext geschrieben werden.
Wir sind alle Afrikaner
Percussion-Musik funktioniert sehr gut im Freien, wo die Leute sowohl tanzen als auch einfach herumlaufen können. Die für diese Art von Musik typischen, komplexen Rhythmen werden hier nicht von Nachhall erzeugenden Wänden zusammengestaucht, wie es etwa bei einem Konzert in einer Schulturnhalle passieren würde. Wer würde sich auch die Mühe machen, Musik zu schreiben, zu spielen oder ihr zuzuhören, wenn sie dort, wo sie aufgeführt werden soll, grässlich klänge? Niemand. Nicht einmal für eine Minute. Percussion-Instrumente hingegen kann man draußen spielen, diese Art der Musik kommt ohne Verstärker aus – auch wenn diese Option erst später aufkam.
Der nordamerikanische Musikwissenschaftler Alan Lomax vertritt in seinem Buch Folk Song Style and Culture die These, die Struktur dieser Musik und anderer ihres Typs – womit er Ensembles ohne Leadsänger oder Dirigenten meint – sei aus einer egalitären Gesellschaftsform entstanden, die sich in der Musik widerspiegele. Für uns mag der Hinweis genügen, dass wir es hier mit einer ganz anderen Dimension von Kontext zu tun hätten.[1] Mir gefällt der Gedanke, dass Musik und Tanz Bilder für die sozialen und sexuellen Sitten einer Gesellschaft sein können, aber das ist nicht das Thema dieses Buches.
Manche Wissenschaftler vertreten die Meinung, da die Instrumente auf dem Bild E oben alle aus lokal vorkommenden, leicht zugänglichen Materialien bestehen, sei es vor allem Bequemlichkeit, die die Menschen zu diesen Instrumenten greifen ließ (dabei schwingt eine gewisse Abwertung dieser Kulturen mit). Diese Meinung impliziert quasi, dass diese Instrumente und diese Art der Musik einfach das Beste waren, was diese Kultur unter den gegebenen Bedingungen zustande bringen konnte. Ich würde dem entgegenhalten, dass es im Gegenteil äußerst kunstfertig hergestellte, mit Bedacht gewählte Instrumente sind, die so gespielt wurden, dass sie einer bestimmten physischen, akustischen und sozialen Situation am besten entsprechen. Die Musik passt perfekt zu den Orten, an denen sie gehört wurde – sowohl in klanglicher wie auch in struktureller Hinsicht. Sie ist optimal auf diese Situation abgestimmt. Musik ist wie ein Lebewesen, das sich entwickelt, um eine zur Verfügung stehende Nische zu besetzen.
Dieselbe Trommelmusik würde sich in einer Kirche in akustischen Brei verwandeln. F Die westliche Musik des Mittelalters wurde in steinernen gotischen Kathedralen gespielt und in Klöstern und Kapellen, die von ihrer Architektur her ähnlich sind. In solchen Räumen ist die Zeit, die der Nachhall braucht, um von der Wand zurückzukommen, sehr lang – manchmal bis zu vier Sekunden –, wodurch eine gesungene Note lange weiterklingt und sich in die in der Luft hängende akustische Landschaft einfügt. Eine Komposition mit vielen Tonartwechseln würde hier unweigerlich Dissonanzen hervorrufen, weil die Töne sich überlappen und miteinander kollidieren würden – eine regelrechte akustische Massenkarambolage. Deshalb hat sich hier eine modale Struktur, oft mit lang gehaltenen Tönen, durchgesetzt, eben weil sie in diesen Räumlichkeiten am besten klingt. Sich langsam aufbauende Melodien, die Sprünge zwischen den Tonarten vermeiden, funktionieren hier wunderbar und tragen zu einem erhabenen Ambiente bei. Diese Art der Musik funktioniert also nicht nur auf dem akustischen Level sehr gut, sie hilft auch dabei, eine Stimmung zu erzeugen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen als besonders spirituell empfinden. Afrikaner, deren spirituelle Musik oft rhythmisch sehr komplex ist, würden die aus diesen Räumen hervorgegangene Musik vielleicht nicht unbedingt mit Spiritualität verbinden. Für sie würden sich diese Klänge eher verwaschen und undeutlich anhören. Der Mythenforscher Joseph Campbell vertrat die Ansicht, Tempel und Kathedralen wirkten gerade deshalb so anziehend, weil sie räumlich und akustisch jenen Höhlen nachempfunden seien, in denen die Frühmenschen zum ersten Mal das Konzept einer übersinnlichen Welt entwickelten. Diese Vermutung scheint schlüssig, auch wenn wir natürlich kaum Belege für solche Urzeitmusik haben.
Es wird angenommen, die westliche Musik des Mittelalters sei deshalb so »simpel« strukturiert (es gibt in ihr fast keine Sprünge zwischen den Tonarten), weil die Komponisten es nicht verstanden, sich komplexerer Harmonien zu bedienen. Doch es gab für sie überhaupt keinen Grund, komplexere Harmonien zu verwenden, da sie sich in einer Kirche furchtbar angehört hätten. Aus Sicht der Kunst haben sie genau das Richtige getan. Anzunehmen, es gäbe so etwas wie einen »Fortschritt« in der Musik und dass die heutige Musik in irgendeiner Weise »besser« sei als früher, ist typisch für die hohe Meinung, die einige Zeitgenossen von sich selbst haben. Aber das ist ein Mythos. Kunst wird nicht »immer besser« – nur anders.
Bach spielte und komponierte in einer Kirche, die viel kleiner als eine Kathedrale war. G Der Nachhall muss dort ziemlich stark gewesen sein, wenn auch nicht so gewaltig wie in einer der gigantischen gotischen Kathedralen.
Die Musik, die Bach für diesen Ort komponierte, hörte sich dort wunderbar an. Der Raum selbst ließ die eingebaute Orgel voluminöser klingen und hatte zudem den netten Nebeneffekt, dass Fehler weniger stark herausstachen, während er die Tonleitern nach Lust und Laune hoch und runter spielte. Er modulierte ausgesprochen gerne, und der Ort gestattete es ihm. Bisher waren für solche Räume komponierte Stücke stets in einer Tonart geblieben. So konnten sie so verwaschen klingen, wie sie wollten. Der Raum konnte die akustische Qualität eines leeren Schwimmbeckens haben, auch das wäre kein Problem gewesen.
Vor kurzem besuchte ich ein Balkanmusik-Festival in Brooklyn, das in einer Halle stattfand, die der Kirche auf dem Bild nicht unähnlich war. Die Band spielte in der Mitte des Raumes, während das Publikum um sie herum tanzte. Der Sound hallte hier besonders lange nach, eine nicht unbedingt optimale Umgebung für die komplizierten Rhythmen der Balkanmusik, aber diese Art von Musik war ja auch nie für solche Räume gedacht gewesen.
Im späten 18. Jahrhundert spielte Mozart seine Stücke in den Musikzimmern seiner Förderer, die zwar prunkvoll, aber nicht eben gigantisch groß waren. H,I Daher hat er zumindest anfangs seine Stücke nicht für große Konzertsäle geschrieben, wo sie heute mittlerweile meistens aufgeführt werden, sondern für diese kleineren, intimeren Räumlichkeiten. Bei solchen Veranstaltungen war der Salon zumeist bis zum letzten Platz mit Zuhörern vollgestopft, deren Körper und ausladenden Kleider den Klang abgedämpft haben müssen. Dies kombiniert mit dem ganzen zeittypischen Zierrat und der bescheidenen Größe des Raumes (verglichen mit der immensen Größe einer Kathedrale oder auch nur einer normalen Kirche) trug dazu bei, dass man seine filigrane Musik in ihrem ganzen überbordenden Detailreichtum gut aufnehmen konnte.
Man konnte sogar dazu tanzen. Ich vermute, dass man schon damals anfing, nach einem Weg zu suchen, die Musik lauter zu machen, damit sie trotz der Tanzgeräusche, der stampfenden Füße und dem Geplapper der Zuhörer noch hörbar war. Damals gab es nur eine Möglichkeit, um lauter zu sein, nämlich das Orchester zu vergrößern, was genau zu dieser Zeit auch geschah.
Ungefähr zur selben Zeit gingen auch immer mehr Menschen in die Oper. Die Mailänder Scala wurde 1776 erbaut. Der ursprüngliche Bereich für das Publikum bestand aus einer Reihe von Kabinen anstelle der Sitzreihen, die heute dort stehen. J Das Publikum aß, trank und unterhielt sich während der Vorstellung. Das Verhalten der Zuschauer, das einen wichtigen Teil des Kontextes bildet, in dem Musik gespielt wird, war damals wirklich sehr anders als bei einem heutigen Opernbesuch. Damals quatschte man miteinander und schrie sich während der Vorstellung über alle Köpfe hinweg Sachen zu. Man brüllte auch die Künstler auf der Bühne an, um dem Wunsch nach besonders populären Arien Nachdruck zu verleihen. Wenn den Zuschauern ein Stück besonders gut gefiel, dann wollten sie es noch einmal hören – und zwar sofort! Die Stimmung war wohl eher so wie im CBGB, und weniger, wie man es aus den Opernhäusern von heute gewöhnt ist.
Die Scala und andere Opernhäuser aus dieser Epoche sind ziemlich kompakt gebaut – viel enger als die großen Opernsäle, die wir heute überall in Europa und Amerika haben. Die Tiefe der Scala und vieler anderer Häuser jener Zeit ist vergleichbar mit dem Highline Ballroom und dem Irving Plaza in New York. Dafür ist die Scala höher und hat eine größere Bühne. Der Sound in solchen Sälen ist stark verdichtet (anders als in den großen Konzertsälen von heute). Ich bin in einigen dieser alten Häuser aufgetreten, und wenn man die Lautstärke nicht zu hoch dreht, funktioniert das Ambiente erstaunlich gut, allerdings wohl nur für gewisse Formen der zeitgenössischen Popmusik.
Man muss sich nur das Opernhaus anschauen, das Wagner sich in den 1870er Jahren in Bayreuth bauen ließ. K Wie man sehen kann, ist es nicht besonders groß. Nicht viel größer als die Scala. Wagner hatte die Chuzpe, den Bau eines Opernhauses durchzusetzen, das genau für die Art von Musik zugeschnitten sein sollte, die ihm vorschwebte – und damit war nicht gemeint, dass das Haus mehr Sitze als üblich haben sollte, wie es so manch cleverer Unternehmer von heute wohl tun würde. Ganz im Gegenteil wurde der Raum für das Orchester auf Kosten der Sitzplätze vergrößert. Wagner brauchte ein größeres Orchester, um den ganzen Bombast seiner Werke heraufzubeschwören. Er ließ sogar extra neuartige, größere Blechblasinstrumente entwerfen und vergrößerte die Basssektion seines Orchesters.
Wagner passt vielleicht nicht so ganz in meine Argumentation, denn seine Vorstellungskraft und sein Ego waren einfach zu groß, um sich auf die räumlichen Gegebenheiten einer Spielstätte einzustellen. Er war insofern eine Ausnahme, denn er passte sich nicht dem Raum an, sondern ließ den Raum seinen Vorstellungen anpassen. Dennoch kann man sagen, dass er die erprobten künstlerischen Formen der Oper zwar bis an ihre Grenzen trieb, aber kein Zertrümmerer aller Traditionen war, nach dem alles noch einmal von vorne beginnen musste. Als sein Festspielhaus fertig war, schrieb er mehr oder weniger nur noch Stücke, die auf diesen Konzertsaal mit seinen besonderen akustischen Qualitäten zugeschnitten waren.
Mit der Zeit wurden die Orchestersäle immer größer. Die Oper, die ursprünglich für Ballsäle in Palästen und die viel kleineren Konzerthäuser der ersten Stunde entwickelt worden war, musste nun auch in Räumen mit starkem Nachhall funktionieren. Also begannen die folgenden Komponistengenerationen damit, Musik speziell für diese neue Form von Opernhäusern mit ihrer veränderten Raumakustik zu schreiben. Diese Musik legt größeren Wert auf Textur und benutzt oft eine Art akustische Shock-and-awe-Strategie, um auch noch bis zu den hintersten Plätzen durchzudringen, die nun viel weiter weg vom Orchestergraben waren. Die Komponisten waren gezwungen, sich anzupassen, und genau das taten sie.
Die Musik von Mahler und anderen späteren symphonischen Komponisten funktioniert in Spielstätten wie der Carnegie Hall sehr gut. L Groove- und percussionlastige Musik mit starkem Gewicht auf den Drums – wie zum Beispiel auch ich sie mache – hat es dort hingegen sehr schwer. Ich habe ein paarmal in der Carnegie Hall gespielt und weiß daher, dass es machbar ist. Aber der Sound ist alles andere als ideal. Heute würde ich dort nicht mehr spielen. So lernte ich, dass es manchmal gerade die prestigeträchtigsten Konzerthallen sind, in denen eine bestimmte Musik einfach nicht so gut funktioniert. Diesen akustischen Widerstand kann man auch als eine subtile Verweigerungsstrategie deuten, eine Klangmauer, dazu gebaut, den Pöbel fernzuhalten – aber so weit sind wir noch nicht.
Unterhaltungsmusik
Zur gleichen Zeit, in der sich die klassische Musik an diese neuen Spielstätten anpasste, passierte etwas Ähnliches auch in der sogenannten Unterhaltungsmusik. Zu Beginn des letzten Jahrhunderts entwickelte sich der Jazz in eine ganz andere Richtung als die moderne Klassik. Jazz wurde ursprünglich in Bars gespielt, auf Beerdigungen und in Bordellen und Lokalen, in denen viel getanzt wurde. In diesen Schuppen war Nachhall kein Problem, und sie waren auch nicht sehr groß, weshalb die Musik, ähnlich wie im CBGB, sehr groovig und direkt sein konnte. M
Scott Joplin und andere Autoren haben darauf hingewiesen, dass Jazz-Solos und die für diesen Stil typischen Improvisationseinlagen einfach ein pragmatischer Weg waren, um mit einem immer wiederkehrenden Problem bei solchen Shows umzugehen: Den Musikern ging oft mittendrin die »geschriebene« Musik aus. Um einen bei den Tänzern besonders beliebten Part noch etwas in die Länge zu ziehen, fingen die Musiker an, mit den gegebenen Akkorden im gleichen Groove weiter zu jammen. So lernten sie, eine beliebte Sequenz eines Stückes zu strecken und auszubauen. Diese Improvisationen und ausgewalzten Passagen entwickelten sich aus einer unvorhergesehenen Notwendigkeit heraus, und eben dadurch wurde eine neue Musikform geboren.
Etwa in der Mitte des 20. Jahrhunderts hatte sich der Jazz dann bereits zu so etwas wie einer neuen Form klassischer Musik entwickelt, die nun vornehmlich in Konzertsälen gespielt wurde. Aber jeder, der schon eine der wunderbaren Jazz-Spelunken im Süden der USA besucht hat oder mal bei einem Konzert der Dirty Dozen Brass Band in einem Schuppen wie dem Glass House in New Orleans dabei sein durfte, weiß, dass man zu Jazz auch tanzen kann. Die Wurzeln des Jazz liegen in der spirituellen Musik, einer Musik, zu der getanzt wurde. Und es ist genau die Art von Musik, die sich in einer Kathedrale absolut schrecklich anhören würde.
Auch die Instrumentation der Jazzkapellen wurde verändert, damit man die Musik bei dem ganzen Lärm der Tanzenden und des allgemeinen Kneipenkrachs überhaupt noch hören konnte. Das Banjo zum Beispiel ist lauter als die Akustikgitarre, auch Trompeten klingen gut und sind schön laut. In der Zeit vor den Verstärkern und Mikrophonen mussten ebendie Instrumente, auf denen gespielt und für die die Musik geschrieben wurde, den Umständen angepasst werden. Die Zusammensetzung einer Band wie auch die Stücke, die die Musiker schrieben, entwickelten sich so, dass sie in dieser lauten Umgebung überlebten.
Country, Blues, Latin Music und Rock ’n’ Roll sind ebenfalls Musikarten, zu denen (eigentlich) getanzt werden soll, weshalb auch sie laut genug sein mussten, um vom lärmenden Publikum gehört zu werden. Die Tonträger- und Verstärkertechnik veränderte das zwar schlagartig, doch als diese Stile in den Kinderschuhen steckten, war der Einfluss dieser Techniken noch sehr gering.
Ruhe, bitte!
Bei der klassischen Musik hingegen änderte sich nicht nur die Größe der Konzertsäle, sondern auch das Verhalten des Publikums. Um das Jahr 1900, schreibt der Musikkritiker Alex Ross, war es dem Publikum nicht länger erlaubt, während des Konzerts rumzubrüllen, zu essen oder sich miteinander zu unterhalten. Stattdessen wurde erwartet, dass der Zuhörer still dasaß und andächtig lauschte. Ross meint, dass man damit das gemeine Volk von den neuen Opernhäusern und Konzerthallen fernhalten wollte.[1] (Man nahm wohl an, dass die unteren Schichten einfach unverbesserliche Krachmacher sind.) Eine ganze Musikrichtung, die sich im Prinzip an alle Menschen richtete, war fortan einer kleinen Elite vorbehalten. Heute sind wir so weit, dass ein klingelndes Mobiltelefon oder ein Flüstern die ganze Veranstaltung gefährden kann.
Diese Politik der Ausgrenzung wirkte sich auch auf die geschriebene Musik aus – weil niemand mehr schwatzte, tanzte oder aß, konnte die Musik eine ganz neue, extreme Dynamik entwickeln. Die Komponisten konnten sich sicher sein, dass jedes Detail gehört werden würde, nun waren auch sehr leise Passagen möglich. Auch harmonisch komplexere Passagen wurden nun endlich wahrgenommen und goutiert. Ein Großteil der klassischen Musik des 20. Jahrhunderts kann nur noch in solch einem akustisch und sozial restriktiven Raum funktionieren (denn sie ist für dieses Ambiente geschrieben). Dadurch wurde eine ganz neue Art von Musik geboren, die es so vorher nicht gegeben hatte. Die bald darauf auftauchenden Tonträger und eine stetig verbesserte Aufnahmetechnik machten diese Musik dann überall verfügbar. Dennoch frage ich mich, wie viel Spaß an der Musik wir geopfert haben, damit die sozialen Parameter des Konzertsaals neu definiert werden konnten – es wirkt fast masochistisch, wie rigoros die feinen Herrschaften sich ihrer eigenen Lebendigkeit beraubt haben, aber anscheinend setzten sie andere Prioritäten.
Obwohl die leisesten Harmonien, dynamischen Details und komplexen Akzentverschiebungen nun hörbar geworden waren, bedeutete das Spielen in den größeren, stärker nachhallenden Sälen auch, dass rhythmische Elemente nun weniger scharf pointiert und vager wurden – also weniger afrikanisch, wenn man so will. Sogar der Jazz, der in solchen Konzertsälen gespielt wurde, verwandelte sich in eine Art Kammermusik. Selbst wenn Bands mit so viel Swing wie Goodman, Ellington oder Marsalis ein Konzert dort spielten, kam keiner auf die Idee, zu tanzen, zu trinken oder den Musikern auf der Bühne ein begeistertes »Hell, yeah!« zuzurufen. Auch die kleineren Jazzclubs folgten nach und nach den neuen Gepflogenheiten. Im Blue Note oder Village Vanguard tanzt heute niemand mehr, und dein Drink wird dir von einem auf Zehenspitzen herumtrippelnden Kellner an den Tisch gebracht.
Man könnte also zu dem Schluss kommen, dass das Verschwinden der funkigen und relaxteren Stimmung aus den amerikanischen Konzertsälen beileibe kein Zufall war. In der Konsequenz wurde quasi der Kopf vom Körper getrennt – denn es kann doch keine »ernsthafte« Musik sein, wenn man den Shimmy drauf tanzen kann. (Wobei anzumerken wäre, dass keine Musikform sich wirklich ausschließlich an den Kopf oder den Körper wendet, diese strikte Unterscheidung ist eher ein intellektuelles oder soziales Konstrukt.) E-Musik darf nun nur noch mit den Teilen oberhalb des Nackens wahrgenommen und genossen werden. Alles was darunter liegt, ist zumindest moralisch suspekt. Die gleichen Leute, die solch eine Meinung vertraten und ihre Musik so konsumierten, haben auch die unglaublich innovativen und gleichzeitig raffinierten Arrangements im Tango jener Epoche als nicht ernstzunehmende Musik verworfen. Kein Wunder, denn der Tango der 1950er Jahre war sehr innovativ und zugleich tanzbar und sorgte dadurch im Gemüt dieser Snobs für eine kognitive Dissonanz, mit der sie einfach nicht umgehen konnten.
Musik auf Tonträgern
Durch die Einführung der Tonträgertechnik im Jahr 1878 änderten sich die Hörgewohnheiten radikal. Die Musik musste nun zwei sehr unterschiedlichen Bedürfnissen zugleich dienen. Der Phonographenschrank im Wohnzimmer ersetzte in vielen Fällen den Konzertsaal und den Club.
In den dreißiger Jahren hörten die meisten Leute ihre Musik entweder im Radio oder auf dem Phonographen beziehungsweise Grammophon zu Hause. N Dadurch konnten die Menschen viel mehr Musik hören und auch viel mehr unterschiedliche Stile, als sie es sonst getan hätten. Die Musik hatte sich vom Akt des Musizierens, ihrem bisherigen Kontext, losgemacht. Oder, um es präziser auszudrücken: Der neue Kontext, in dem Musik gehört wurde, waren das Wohnzimmer und die Jukebox, die nun eine Alternative zu den weiterhin sehr beliebten Tanzlokalen und Konzertsälen boten.
Von den Musikern wurde verlangt, für zwei sehr unterschiedliche Umgebungen zu komponieren und diese zu bespielen: einerseits für das kleine Lokal um die Ecke und andererseits für die Geräte, die eine Aufnahme abspielen oder eine Übertragung empfangen konnten. Diese beiden Räume waren zwei ganz unterschiedliche akustische und soziale Welten. Dennoch mussten die Kompositionen in beiden funktionieren! Das Publikum, das einen Song im Radio gehört hatte, wollte natürlich den gleichen Song auch im Club oder im Konzertsaal hören.
Diese doppelte Anforderung erscheint mir ziemlich schwierig. Die für das Spiel nötigen Fähigkeiten, die Instrumentenwahl, die Restriktionen für die Komponisten und die akustischen Eigenschaften der bespielten Räume sind grundverschieden. Genau wie ein Bühnenschauspieler für ein an Filme gewöhntes Publikum zu laut und exaltiert wirkt, sind auch die Voraussetzungen für unterschiedliche musikalische Medien oft nicht miteinander vereinbar. Was in dem einen Medium gut funktioniert, mag auch im anderen noch irgendwie hinhauen, doch das ist beileibe nicht immer der Fall.
Die Musiker passten sich also der neuen Technologie an. Besonders die auf einen einzelnen Sänger ausgerichteten Mikrophone veränderten die Art, in der gesungen und gespielt wurde. O Ein Sänger musste nicht mehr über ein riesiges Lungenvolumen verfügen, um erfolgreich zu sein. Frank Sinatra und Bing Crosby waren Pioniere, wenn es darum ging »für das Mikrophon zu singen«. Sie passten ihren Gesang den technischen Neuerungen auf eine Weise an, die zuvor nicht vorstellbar gewesen wäre. Heute mag sich das vielleicht nicht mehr so radikal anhören, aber das Crooning war damals eine ganz neue Dimension des Singens. Ohne Mikrophon wäre dieser sanfte, warme Ton einfach nicht möglich gewesen.
Chet Baker begann nun sogar im Flüsterton zu singen, ebenso João Gilberto und zahllose andere. Der Zuhörer hat das Gefühl, als flüsterten diese Sänger einem wie ein Liebhaber direkt ins Ohr. Noch nie hatte sich Musik so intim angehört, sie schlich sich direkt in deinen Kopf. Und selbstverständlich wäre diese Intimität ohne Mikrophon niemals möglich gewesen.
Die Technologie hatte das Wohnzimmer oder die kleine Kneipe mit Jukebox in einen Konzertsaal verwandelt P – hier durfte auch wieder getanzt werden. Die Tonträger veränderten nicht nur den akustischen Kontext, in dem Musik gespielt wurde. Darüber hinaus konnte man Musik jetzt auch in winzigen Lokalen ohne Bühne oder Livemusik hören. Der Abschlussball der Highschool wurde nun statt von einer Band von einem einzigen DJ gestemmt; die Leute mussten nur einen Vierteldollar in irgendeine Jukebox schmeißen und konnten dann zwischen den Tischen in ihrer Stammkneipe tanzen. Und in den Wohnzimmern kam die Musik plötzlich aus den Möbeln. Schließlich entstanden Tanzlokale, in denen ausschließlich Tonträger abgespielt wurden, ohne dass es einer Band bedurfte: Diskotheken. Q
Ich würde behaupten, die meiste Musik, die heute für Discos geschrieben wird, funktioniert ausschließlich an diesen physisch und sozial auf sie ausgerichteten Orten. Sie klingt nur dann gut, wenn sie über gigantische Soundsysteme in großen Hallen gespielt wird. Auch wenn es manche Hartgesottenen nicht lassen können, fühlt es sich doch ziemlich bescheuert an, Clubmusik zu Hause in entsprechender Lautstärke zu hören. Auch diese Musik ist zum Tanzen gedacht, genau wie der frühe Hiphop, der wie der Jazz aus Clubs hervorging, wo getanzt wurde. Beim Hiphop wurden bestimmte Passagen eines Stücks gestreckt, damit die Tänzer mit ihren Skills angeben oder weiter an ihnen arbeiten konnten. Wieder waren es die Tänzer, die den Kontext umformten und die Musik in eine neue Richtung lenkten. R
In den Sechzigern wurde immer mehr Popmusik in Basketballhallen und Stadien gespielt, die für gewöhnlich eine katastrophale Akustik haben – nur ein ganz schmales Spektrum an Musik funktioniert in solch einer Umgebung. Steady-state Music (also Musik mit einem konstanten Lautstärkepegel, mit mehr oder weniger gleichbleibender Textur und einfachen, pulsierenden Rhythmen) macht sich dort am besten, doch auch das nur selten. Das für Metal typische Grölen funktioniert dort auch ganz gut. Langsame Akkordwechsel könnten in dieser Umgebung irgendwie überleben, aber Funk, um nur ein Beispiel zu nennen, würde an den riesigen Wänden und an der Decke abprallen und als chaotischer Tonbrei beim Hörer ankommen. Der Groove wird an einem solchen Ort abgewürgt. Dennoch überlebten einige Funkbands, weil ihre Auftritte nicht nur einfach Konzerte, sondern gleichzeitig Happenings, magische Rituale und soziale Zusammenkünfte Gleichgesinnter waren. Konzerte in Stadien wurden meistens von Weißen besucht – und die Musik war tendentiell wagnerianisch.
Da sich in den Sportstadien riesige Massen versammelten, hatte die Musik hier ganz andere soziale und klangliche Aufgaben zu erfüllen als auf einem Tonträger oder in einem kleinen Club. Die Antwort, die die Musiker auf dieses Problem fanden, war der Stadionrock: mitreißende, langsam anschwellende Hymnen. Für mich ist das der ideale Soundtrack für ein Massenspektakel, und wenn ich mir diese Musik in einem anderen Kontext anhöre, wird die Erinnerung an dieses Zusammensein wieder heraufbeschworen, wie ein Stadion in deinem Kopf.
Die Konzertsäle von heute
Wo wird heute Musik gehört? Gibt es noch andere Orte und Gelegenheiten, die mir bisher entgangen sind, die beeinflussen, wie und welche Musik heute geschrieben wird? Als Erstes fällt mir da das Auto ein. S Ich glaube, der Hiphop in seiner gegenwärtigen Form (oder zumindest die musikalische Untermalung des Sprechgesangs) wird extra dafür komponiert, um in einem Auto, durch eine monströse Anlage geblasen, gut zu klingen. Die unglaubliche Lautstärke, die solche Anlagen produzieren, scheint einzig für den Zweck geschaffen zu sein, die Musik mit allen Menschen in der näheren Umgebung zu teilen, und das auch noch gratis! T So gesehen ist der Hiphop eine von Großzügigkeit gekennzeichete Musikrichtung. Ich vermute, der Klangraum einer mit solchen Lautsprechern ausgestatteten Autokabine zwingt die Komponisten dazu, ihre Musik ganz anders zu schreiben. Sie ist sehr basslastig, verfügt aber gleichzeitig über pointierte High-Ends. Doch was macht klanglich die Mitte aus? Es ist der Gesang, ihm wird der vakante Frequenzbereich in der Mitte zugewiesen, in dem ansonsten fast nichts lebt. Bei der frühen Popmusik übernahmen das Keyboard, die Gitarre oder auch mal die Violine dieses mittlere Territorium. Da diese aber im Hiphop fehlen, müssen die Vocals die entstandene Lücke füllen.
Hiphop lässt sich mit rein akustischen Instrumenten nicht mehr reproduzieren. Die Nabelschnur ist gekappt worden, die Musik hat sich völlig losgemacht. Es gibt keine Verbindung mehr zwischen der aufgenommenen Musik und dem live spielenden Interpreten. Obwohl sich diese Art von Musik aus dem zum Tanzen anregenden frühen Hiphop entwickelt hat (der wie der Jazz durch die Verlängerung einzelner Passagen innerhalb der Musikstücke entstand), hat sie heute eine vollkommen neue Gestalt angenommen: eine Musik, die sich dann am besten anhört, wenn sie im Auto läuft. Die Leute tanzen auch tatsächlich in ihren Autos dazu, oder versuchen es zumindest. Ich sage voraus, dass diese Musikrichtung sich abermals ändern wird, wenn die Leute endlich aufhören, riesige SUVs zu fahren.
Es gibt noch eine weitere neue Art, Musik zu hören. U Dieses besondere Modell eines MP3-Players spielt wahrscheinlich ausschließlich christliche Musik ab. Als 1979 der tragbare Kassetten-Walkman auf den Markt kam, begann die Ära des einsamen Musikhörens. Sich Musik auf einem Walkman anzuhören, ist eine ähnliche Erfahrung wie das »Stillsitzen in der Oper« (es gibt keine akustische Ablenkung). Hinzu kommt das Erlebnis einer virtuellen Raumakustik, erzeugt durch künstlich im Tonstudio eingefügten Nachhall und Echos. Mit Kopfhörern lassen sich all die noch so kleinen Details und subtilen Spielereien wahrnehmen, und durch den Wegfall des unkalkulierbaren Nachhalls in wechselnden Räumlichkeiten, die bei live gespielter Musik den Klang beeinträchtigen, kommen nun auch alle rhythmischen Elemente klar und wunderbar rein beim Hörer an. Ein Publikum bestehend aus einer Person. Und auch wenn das MP3-Format die Aufnahme etwas komprimiert, kann man nun Details heraushören, die einem sonst entgangen wären. Man hört, wie der Sänger Luft holt, wie die Finger über die Saiten der Gitarre gleiten. Andererseits können plötzliche, harte Übergänge auf einem solchen Player geradezu schmerzhaft sein. Deshalb trifft auf diese neue Art des Musikhörens das Gleiche zu wie für die Tanzmusik vor über hundert Jahren: Sie sollte am besten eine konstante Lautstärke halten. Von der Dynamik her eher statisch, aber dafür voller Details: Das ist das oberste Gebot.
Sollte es vonseiten der Komponisten eine Antwort auf diese neue Ära des MP3-Players und die ganz privaten Hörgewohnheiten geben, so ist sie mir bisher entgangen. Eine Musik, die hauptsächlich aus einem ruhigen Strom von Naturgeräuschen und Ambientsounds besteht, zu der man relaxen und entspannen kann, würde sich anbieten. Die andere Alternative wären sehr dichte und komplexe Kompositionen, die auf mehrmaliges und sehr aufmerksames Hören ausgerichtet sind, oder einfach ein sehr intimer, ja anzüglicher und erotischer Gesang, den man unmöglich öffentlich spielen könnte, aber alleine umso mehr genießen kann. Sollte derlei wirklich bereits existieren, dann habe ich das total verschlafen.
In vielerlei Hinsicht schließt sich heute der Kreis. Die Musik der afrikanischen Diaspora, die die Basis für fast unsere gesamte zeitgenössische Popmusik bildet, mit ihrem Reichtum an verzahnten und übereinandergeschichteten Beats, funktioniert sowohl als ganz privates Hörerlebnis wie auch als Rahmenwerk für einen Großteil der Musik, die heute geschrieben wird. Afrikanische Musik klingt deshalb so gut, weil sie dazu konzipiert wurde, draußen im Freien gespielt zu werden. Wie sich aber herausstellt, funktioniert sie auch in dem intimsten aller Klangräume – wenn sie über Kopfhörer direkt ins Ohr geht. Klar gibt es auch Leute, die sich Bach und Wagner auf dem iPod anhören, aber nicht allzu viele Komponisten schreiben heute noch solche Musik, es sei denn als Untermalung für Filme, wo der wagnerianische Bombast noch immer gut funktioniert. Wenn John Williams mit seiner Filmmusik für Star Wars ein moderner Wagner ist, dann kann man Bernard Herrmann mit seiner Musik für Psycho und andere Hitchcockfilme einen zeitgenössischen Arnold Schönberg nennen. Für unsere Ohren ist der Kinosaal das Konzerthaus des 21. Jahrhunderts.
»Birds do it« (Louis Armstrong)
Das beschriebene adaptive Verhalten beim Schaffen schöner Werke ist nicht nur bei Musikern und Komponisten (oder Künstlern anderer Richtungen) zu finden. Wir begegnen ihm auch in der Natur. David Attenborough und andere Ornithologen haben untersucht, wie sich die Lieder von Vögeln an ihre Umgebung anpassen.[1] Im dichten Laub eines Dschungels funktioniert ein konstantes, repetitives und kurzes Signal mit enger Frequenzbreite am besten, wobei die Wiederholung als Fehlerkorrektur fungiert. Sollte die Angebetete die Botschaft beim ersten Mal nicht ganz mitbekommen haben, schickt das Männchen eine identische gleich hinterher.
Am Waldboden lebende Vögel haben tiefere Rufe entwickelt, weil diese weniger stark reflektieren oder durch das Unterholz verzerrt werden, als es bei höheren Tonhöhen der Fall wäre. Wasservögel stoßen, auch das ist keine Überraschung, Rufe aus, die geradezu durch das Wellenrauschen hindurchschneiden, während in großen Ebenen und Savannen lebende Vögel wie die Grasammer sirrende Rufe von sich geben, die auch große Entfernungen überbrücken können.
Eyal Shy von der Wayne State University hat beobachtet, dass sich die Gesänge von Vögeln sogar innerhalb der gleichen Art unterscheiden können.[2] So ist zum Beispiel die Tonhöhe des Gesangs der Feuertangare im Osten der USA, wo die Wälder dichter sind, niedriger als bei den im Westen lebenden Artgenossen. V
Zudem passen Vögel derselben Art ihren Gesang auch kurzfristig Änderungen in ihrer Umwelt an. Eine Untersuchung über die Vogelpopulation in San Francisco kam zu dem Ergebnis, dass sie über vierzig Jahre hinweg die Lautstärke ihres Gesangs wegen des zunehmenden Verkehrslärms immer weiter angehoben haben.[3]
Und es sind nicht nur die Vögel. In den Meeren um Neuseeland haben die Walgesänge aufgrund des wachsenden Lärms der Motoren und jaulenden Schiffsschrauben in den letzten Jahrzehnten ebenfalls an Lautstärke zugenommen. Wale sind auf ihr weitreichendes Echolot angewiesen, um zu navigieren, und man kann nur hoffen, dass sie sich auch weiterhin diesen Widrigkeiten werden anpassen können.
Die Evolution und Anpassungen der Musik an ihre Umwelt ist also ein bei verschiedenen Spezies vorkommendes Phänomen. Manche Ornithologen gehen davon aus, dass Vögel auch aus purem Spaß singen, selbst wenn sie, genau wie wir, manchmal ihr Repertoire ändern. Die Freude an der Musik wird immer einen Weg finden, sich Ausdruck zu verschaffen, egal in welchem Kontext sie entsteht und welche Form sich dafür als die beste erweist. Der Musiker David Rothenberg behauptet daher folgerichtig, dass »das Leben viel interessanter ist, als es die reine Notwendigkeit gebieten würde, weil die Kräfte, die es lenken, nicht ausschließlich praktischer Natur sind«.[4]
Ich habe hier ein paar Beispiele zusammengetragen, wie der spezifische Kontext darüber bestimmen kann, welche Musik für ihn geschrieben wird. Darüber hinaus habe ich das Gefühl, dass meine umgedrehte Sicht auf das kreative Schaffen – das viel pragmatischer und adaptiver abläuft, als man allgemein glaubt – sich auch auf viele andere Gebiete übertragen lässt. Der Ansatz dreht unser Verständnis vom Entstehen von Kunst insofern um, als die Lokale, Kneipen und Stadien – oder im Fall der Vögel die Felder und Waldgebiete – natürlich nicht dafür gebaut wurden, um dem egoistischen oder künstlerischen Geltungsdrang eines Komponisten ein Betätigungsfeld zu geben. Die Vögel passen sich an die Gegebenheiten ihrer Umwelt an, und wir machen es genauso – und das ist gut so. Was mich daran interessiert, ist nicht so sehr die Tatsache, dass diese praktischen Anpassungen geschehen (im Rückblick erscheint mir meine ach so große Erkenntnis doch ziemlich naheliegend), sondern was dieser Umstand für unser Verständnis von Kreativität bedeutet.
Der kreative Akt, ob es sich nun um Vogelgesänge, Malerei oder das Komponieren von Musik handelt, ist eine Anpassungsleistung; wie alles andere auch. Das Genialische – zum Beispiel in Form eines herausragenden und unvergesslichen Werkes – scheint genau dann auf den Plan zu treten, wenn eine Sache optimal auf ihren Kontext abgestimmt ist. Wenn etwas wirklich passt, dann erscheint es uns nicht nur als eine clevere Adaption, sondern löst darüber hinaus eine emotionale Resonanz in uns aus. Wenn sich Inhalt und Kontext perfekt ineinanderfügen, dann berührt uns das.
Nach meiner Erfahrung ist der emotionale Gehalt der Musik immer schon da, tief in uns versteckt, wo er darauf wartet, angezapft zu werden. Und obwohl Musiker ihre Werke so entwerfen, dass sie in einem gegebenen Setting optimal funktionieren, können wir doch sicher sein, dass die in uns brodelnde Agonie und Ekstase sich potentiell in jede bereitstehende Form umgießen lassen.
Mit Musik geben wir unseren Emotionen einen Ausdruck, wir verarbeiten eine Trennung oder singen von der Liebe, aber die Art, wie wir dies tun – das heißt die Kunst, diesen speziellen Ausdruck zu finden –, besteht darin, sie entweder in vorgefundene Formen zu gießen oder sie in neue Formen zu pressen, die aus einem neuen Kontext entstehen. Das ist ein Teil des kreativen Prozesses, und wir machen es instinktiv: Wir internalisieren es. Und dann singen wir aus reiner Freude, so wie es die Vögel tun.
Der größte aller Räume
Bernie Krause, ein Pionier der elektronischen Musik, der sich heute vornehmlich mit Bioakustik beschäftigt, hat untersucht, wie sich die Rufe von Insekten, Vögeln und Säugetieren entwickeln und dabei abgegrenzte Bereiche im auditiven Spektrum einnehmen. Er hat fast die ganze Welt bereist, um Tonproben aus den vielen verschiedenen natürlichen Habitaten zu nehmen, und in jeder einzelnen Probe zeigte die akustische Analyse dieser Aufnahmen, wie strikt sich die unterschiedlichen Spezies an ihren eigenen Abschnitt im Audiospektrum halten: Insekten übernehmen die höchste Tonlage, die Vögel sind etwas darunter und die Säugetiere noch tiefer angesiedelt. W
Die Gesänge bestimmter Vogelarten haben sich also nicht nur an die akustischen Gegebenheiten ihrer spezifischen Umgebung angepasst, sie halten sich zudem auch aus den Frequenzen anderer in der Umgebung lebender Tiere heraus. Krause spricht in diesem Zusammenhang von einer Symphonie der Tierstimmen, in der jedes Tier/Instrument seinen Part in der für ihn vorgesehenen Frequenz spielt. Zusammengenommen ergeben sie dann eine gigantische Komposition. Diese Symphonien wechseln zwar mit den Tages- und Jahreszeiten, dennoch behält jeder seinen Platz.
Leider enthüllten Krauses Aufnahmen noch eine andere Wahrheit: Auch wenn eine Landschaft noch genauso aussehen mag wie vor ein paar Jahrzehnten, so zeigen die akustischen Analysen doch allzu oft, dass Tierstimmen, die zuvor ein bestimmtes Spektrum bespielt hatten, inzwischen verstummt sind. Das ist so, als wäre eine Farbe des sichtbaren Spektrums einfach von der Bildfläche verschwunden. In den meisten Fällen liegt dies an menschlichen Eingriffen – Verkehr, Landwirtschaft, wachsende Siedlungen, globale Erderwärmung. Interessanterweise führt uns hier also das Fehlen eines Klangs – und nicht ein visueller Hinweis – das ganze Ausmaß dieser tragischen Katastrophe vor Augen.
Architektur als Instrument
Ich habe schon mehrmals eine interaktive Installation namens Playing the Building ausgestellt, bei der mechanische Vorrichtungen die Infrastruktur leerer Gebäude dazu bringen, Töne abzugeben. Das Ganze wird durch ein umgebautes Piano gesteuert, an dem sich das Publikum selbst versuchen kann. Aber ich war beileibe nicht der Erste, der auf die Idee kam, Gebäude und natürliche Hohlräume als Instrumente zu benutzen.
Der Akustikingenieur Steven Waller hat herausgefunden, dass die Felsmalereien im Südwesten der USA oft an Orten zu finden sind, an denen ungewöhnliche Echos und Halleffekte vorkommen. Waller vermutet, das Vorhandensein dieser Echos sei kein Zufall, der Klang eines Ortes könnte die Menschen dazu bewogen haben, diesen als heilige Stätte anzusehen. Er geht sogar noch einen Schritt weiter und meint, die dort angebrachten Malereien hätten etwas mit der Eigenart dieser Echos zu tun. So finden wir an Orten, wo das Echo eines Schlaginstrumentes dem Getrappel von Hufen gleicht, Petroglyphen von Pferden, während wir an anderen Stellen mit langgestrecktem Echo (wodurch die Felsen selbst zu »reden« scheinen) oft Bilder von Geistern und anderen mythischen Wesen finden.
Waller hat ausschließlich natürlich entstandene Orte untersucht, aber die Archäologie hat ähnliche und andere Beziehungen zwischen Klangraum und Abbildungen bei vielen verschiedenen Völkern gefunden.
In einer Artikelreihe des National Geographic wurden einige interessante Verbindungen zwischen der präkolumbianischen Architektur, den akustischen Qualitäten dieser Gebäude und der dort gespielten Musik hergestellt.
Eines der untersuchten Gebäude ist der Mayatempel in Kukulcán, der zum Chichén-Itzá-Komplex gehört. X
Die Touristenführer demonstrieren den Besuchern dort gern einen interessanten akustischen Effekt. Wenn man vor der Pyramide stehend in die Hände klatscht, wird ein Echo zurückgeworfen, das sich genau wie der Ruf des heiligen Quetzal anhört, ein Vogel, dessen Federn für die Maya wertvoller als Gold waren. Der Vogel galt als Bote der Götter. Y
Gleich zwei Echos wirken hier zusammen, um das charakteristische »Chir-roop« des Quetzal zu erzeugen. Das »Chir« wird von den unteren und das tiefere »Roop« von den weiter entfernt liegenden oberen Stufen zurückgeworfen.
Der Akustikingenieur David Lubman zeichnete diese Echos auf und verglich sie mit älteren Aufnahmen des Quetzal-Schreis aus der Ornithologieabteilung der Cornell University. Und er stellte fest: »Sie stimmten vollkommen überein.« Danach tat er sich mit Sergio Beristain, dem Chef des Mexikanischen Instituts für Akustik, zusammen, der eine andere Pyramide in der Nähe von Mexiko City untersucht hatte. Und tatsächlich produzierte auch dieser Tempel ein ähnliches Gezwitscher – mit einer Verschiebung in der Tonhöhe von bis zu einer halben Oktave. Es sind im wahrsten Sinne des Wortes singende Gebäude.[1]
Andere Wissenschaftler sind der Meinung, dass noch mehr präkolumbianische Anlagen besondere akustische Eigenschaften aufweisen. Die Archäologin Francisca Zalaquett vertritt die These, dass die großen öffentlichen Plätze in der antiken Mayastadt Palenque so konzipiert waren, dass ein an einem bestimmten Punkt positionierter Sänger oder Redner auf dem ganzen Platz zu hören war. Die den Platz einfassenden Tempel mit ihren aufwendigen Reliefs sind in ihrer Bauweise und Anordnung zueinander dabei so geschickt verteilt, dass sie den Klang einer Stimme (oder eines für diese Kultur typischen Instruments) über die Weite eines ganzen Fußballfeldes »übertragen« konnten.
Unter der 1200 vor unserer Zeitrechnung errichteten heiligen Tempelanlage Chavín de Huántar in Peru gibt es ein unterirdisches Labyrinth Z, dessen merkwürdige akustische Eigenschaften einen Eindringling ebenso verwirren konnten wie seine verschlungenen Gänge. AA
Der Archäologe John Rick von der Stanford University meint, die verschiedenen für den Tunnelbau verwendeten Gesteinsarten könnten zusammen mit der Vielzahl an akustischen Brechungen die eigene Stimme so verzerren, »als käme sie aus allen Richtungen zugleich«. Er glaubt, dass das Labyrinth für besondere Rituale benutzt wurde. Die geradezu außerweltliche Akustik dieser Umgebung diente dabei wie das Bühnenbild in einer modernen Theaterinszenierung dazu, die richtige Stimmung zu erzeugen.[2] (Wobei ein Bissen vom San-Pedro-Kaktus, einer dort wachsenden Kakteenart mit psychotropen Eigenschaften, die bei Initiationsriten verzehrt wurde, das Übrige getan haben dürfte.)
Anscheinend wirkt die Architektur nicht einseitig auf Musik und Raumakustik, sie stehen in einem reziproken Verhältnis zueinander. So wie die Akustik eines Raums die Evolution der Musik bestimmen kann, so können akustische Eigenschaften – insbesondere solche, die die menschliche Stimme betreffen – die Form und Struktur eines Gebäudes beeinflussen. Wir haben alle schon von Konzertsälen gehört, die so geplant wurden, dass eine von der Bühne herab sprechende oder singende Person auch ohne Verstärker bis in den hintersten Winkel der Halle zu hören ist. Die Carnegie Hall zum Beispiel ist so stark auf gerade diesen Effekt ausgerichtet, dass andere Klangformen dort einfach nicht funktionieren – insbesondere Schlaginstrumente haben es dort schwer. Aber mit der menschlichen Stimme und solchen Instrumenten, die sie imitieren, lässt sich in diesem Arrangement genau jene erhabene Atmosphäre eines geweihten Ortes erzeugen, die die Menschheit seit Tausenden von Jahren immer wieder sucht.
Kapitel 2Mein Leben auf der Bühne
Für das Schreiben von Musik gibt es nicht den einen Weg. Manche Komponisten nutzen Noten, die viele Musiker als eine Art gemeinsame Sprache teilen. Selbst wenn ein Instrument (meistens ein Piano) bei der Komposition als Hilfsmittel benutzt wird, so ist es doch vornehmlich geschriebene Musik, die dabei entsteht. Der Interpret oder der Komponist selbst mag die Partitur später noch ändern, aber die eigentliche Niederschrift kommt für gewöhnlich ohne die Beteiligung eines anderen Musikers aus. Heutzutage gibt es auch die Möglichkeit, Musik komplett mechanisch oder digital zu kreieren, indem man Schichten aus Tönen, Samples, Geräuschen und Lautschnipseln entweder manuell oder in der virtuellen Welt des Computers übereinanderlegt.
Obwohl ich viele meiner Songs zunächst alleine komponiert habe, erhalten sie ihre endgültige Gestalt doch erst auf der Bühne, wenn sie live gespielt werden. So wie man es von Jazz- und Folkmusikern kennt, muss neues Material bei mir erst durch das Stahlbad eines Livegigs, damit ich weiß, welcher Song absäuft, welcher mitschwimmt und welcher vielleicht sogar abhebt. In der Junior Highschool gründete ich zusammen mit Freunden eine Band. Wir spielten Coverversionen unserer liebsten Songs, aber irgendwann, wahrscheinlich nachdem wir bei einem Bandwettbewerb sang- und klanglos untergegangen waren, beschloss ich, es von nun an solo zu probieren.
Nach einer Pause, in der ich alles überdachte und mich mit ein paar meiner liebsten Songs beschäftigte, begann ich regelmäßig in das Uni-Café zu gehen und merkte, dass die dort versammelte Folkszene ziemlich isoliert war und ein bisschen junges Blut gut gebrauchen konnte. Zumindest sah ich das damals so. Das war in den späten sechziger Jahren. Ich ging immer noch auf die Highschool. Damals wurde den Leuten langsam bewusst, dass der Purismus des Folk über kurz oder lang von den offeneren Formen wie Rock, Soul oder Pop abgehängt werden würde. Die Folkszene sprühte auch nicht gerade vor Energie, als ob der in dieser Musik angelegte Hang zu Larmoyanz und Bierernst langsam anfing, ihnen selbst auf die Nerven zu gehen. Das alles verhieß nichts Gutes für die Zukunft des Folk!