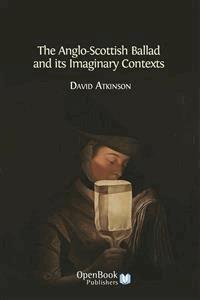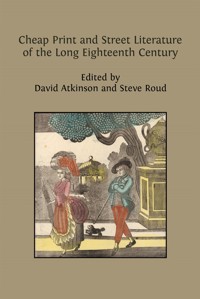8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Manchmal gibt das Leben dir eine zweite Chance – wenn auch auf sonderbare Weise …
Es sollte ein gemütlicher Samstag auf der Couch werden, aber als Nathan Jones die Straße überquert, übersieht er den Bus – und landet in einem Kühlfach in der Pathologie. Fälschlicherweise haben ihn die Ärzte für tot erklärt. Zu seinem Glück bemerkt die Angestellte Kat diesen Irrtum. Aber nach seiner Rückkehr zu den Lebenden läuft nichts wie erwartet. Seine Frau vergießt keine Freudentränen, sondern weint um die ausbleibende Versicherungszahlung. Ist seine Ehe doch nicht perfekt? Während er nach Antworten sucht, fühlt er sich zunehmend zu seiner »Lebensretterin« Kat hingezogen und hat bald noch mehr Fragen: Wieso erscheint ihm die Welt mit Kat, die immer nur Schwarz trägt, so viel bunter?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Zum Buch:
Kat, eigentlich Klaudette, trägt am liebsten Schwarz, dunklen Eyeliner und hat eine nicht alltägliche Familie: Ihr Vater hat eine unerklärliche Leidenschaft für Holzhütten und will jetzt auch noch Lamas im Garten halten. Ihre Mutter scheint sich neuerdings berufen zu fühlen, jede Glühbirne in Schottland abzustauben. Doch Kat liebt ihre Familie, auch wenn diese sich in ihr nicht vorhandenes Liebesleben einmischt. Aber Kat geht ganz in ihrer Arbeit in der Pathologie auf. Und dort dem Mann fürs Leben zu begegnen ist nicht so einfach. Hat Kat jedenfalls immer gedacht – bis versehentlich Nathan Jones in einem ihrer Kühlfächer landet …
Zur Autorin:
David Atkinson ist Vater von zwei kleinen Töchtern und lebt in Edinburgh, dem Athen des Nordens. Sein Debütroman wurde für den Romantic Novelists’ Association Award nominiert. Wenn er nicht arbeitet und sich um seine Familie kümmert, nutzt er jede freie Minute, um zu schreiben.
HarperCollins®
Deutsche Erstausgabe Copyright © 2020 by HarperCollins in der HarperCollins Germany GmbH, Hamburg
Copyright © 2019 by David Atkinson Originaltitel: »The Second Life of Nathan Jones« Erschienen bei: HarperImpulse, an imprint of HarperCollins Publishers, UK Published by arrangement with HarperCollins Publishers Ltd, London
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München Coverabbildung: Rolau Elena / ExpressVectors, Unitone Vector, Kindlena / Shutterstock Lektorat: Stefanie Kruschandl E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN E-Book 9783959679282
www.harpercollins.de
Werden Sie Fan von HarperCollins Germany auf Facebook!
Widmung
Für meine Mädchen Claire, Erin und Emme,
auch wenn erst eine von euch alt genug ist,
um diesen Roman zu lesen.
Kapitel 1
An diesem Samstagnachmittag zu sterben war nicht Nathan Jones’ Plan gewesen. Eigentlich hatte er vorgehabt, es sich auf dem Sofa gemütlich zu machen und sich die Walking Dead-Staffel anzuschauen, die er zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte.
Seine Frau Laura und die drei Kinder waren in der Grafschaft Fife, wo sie Lauras Mutter besuchten. Sie wollten erst am Abend zurück sein. Im Pyjama schlenderte er von Zimmer zu Zimmer und genoss die Stille, die sich über sein gewöhnlich so hektisches, lautes Leben gelegt hatte.
Nathan verdrückte einen von seinen Lieblingsbagels, den er getoastet und mit Tescos bester Marmelade bestrichen hatte. Dabei zappte er durch die Kanäle, um voll auszukosten, dass er ausnahmsweise die Alleinherrschaft über die Fernbedienung hatte. Hätte er geahnt, was ihn erwartete, wenn er die Wohnung verließ, wäre er lieber sicher und geborgen auf der Couch sitzen geblieben und hätte sich etwas zu essen bestellt. Doch stattdessen zog er sich an, knöpfte seinen Mantel zu und trat, während er ein paar Pickled-Onion-Chips verspeiste, in den windigen Novembertag hinaus.
Sein Ziel war der örtliche Tesco. Aber als er die viel befahrene Straße vor seinem Apartment überquerte, kam es zu einem unglücklichen Zusammenstoß mit einem Bus, der alles veränderte.
Als er den Vorfall später rekonstruierte, schien es, als wäre er vom Gehweg aus direkt vor das zwölf Tonnen schwere Fahrzeug gelaufen. Das war offensichtlich keine sonderlich gute Idee und für einen normalerweise so vorsichtigen Menschen wie ihn vollkommen untypisch. Unzählige Male hatte er seinen Kindern eingehämmert: Stehen bleiben, gucken und horchen!
Der Krankenwagen war in Rekordzeit da, doch ein Sanitäter erklärte Nathan noch vor Ort für tot. Ein Arzt in der Notaufnahme des Krankenhauses bestätigte wenig später diese Diagnose.
An das Sterben selbst konnte er sich kaum erinnern. Hätte man ihn gefragt, hätte er es als »viel Lärm um nichts« eingestuft. Vor seinen Augen war kein Film abgelaufen, und verstorbene Verwandte, die ihn ins Licht führen wollten, waren auch nicht aufgetaucht. Und selbst wenn es so gewesen wäre, wäre Nathan aufgrund des schwierigen Verhältnisses zu seiner Familie wahrscheinlich in die entgegengesetzte Richtung gestürmt.
Wenn die Schauspielerin Karen Gillan allerdings die Aufgabe gehabt hätte, ihn in die Herde zu holen, hätte er vielleicht darüber nachgedacht. Aber es war eben nicht ihre Aufgabe gewesen. Wahrscheinlich, weil …
1. sie zufällig noch sehr lebendig war und
2. er kein himmlisches Empfangskomitee aus A-Promis
verdient hatte.
Sein erster Eindruck vom Tod? Eine hoffnungslos überbewertete Erfahrung. Er hatte keine Ahnung, warum alle so viel Aufhebens darum machten.
Im Laufe der vergangenen Jahre hatte er bei vielen Dingen diesen Eindruck gehabt: unter anderem bei allen königlichen Hochzeiten und Geburten, beim Brexit-Desaster und bei der Markteinführung der letzten Inkarnation des iPhones.
Sein schlechter Eindruck vom Tod mochte auch der Tatsache geschuldet sein, dass sich Nathan – wie bei so vielen Dingen des Lebens – nicht besonders gut dabei anstellte. In vielen Sachen war er einfach mies. Er war weder ein Naturtalent beim Skilaufen noch beim Skaten, und er konnte auch keine quadratischen Gleichungen ausrechnen. Außerdem hatte er ein Problem mit Autoritätspersonen. Jetzt konnte er auch »Sterben« auf diese Liste setzen.
Wenn er sich an seine Kindheit erinnerte, musste Nathan vor allem daran denken, dass die Hauptsorge seiner Mutter bei allem, was mit Tod und Sterben zu tun hatte, der Unterwäsche gegolten hatte.
»Nathan, du musst darauf achten, dass du immer eine saubere Unterhose anhast, wenn du rausgehst – falls du mal einen Unfall hast oder so. Ich will nicht, dass du mich im Krankenhaus blamierst.«
Aus diesem Grund war die Unterwäsche, die sie beim Verlassen des Hauses getragem hatte, auch immer sauber und so gut wie neu gewesem. Selbst als Junge war Nathan schon klar gewesen, dass bei einer unfallbedingten Krankenhauseinlieferung die Unterwäsche vermutlich so verschmutzt war, dass man sie direkt entsorgen konnte.
Das hatte er seiner Mutter gegenüber nie erwähnt. Und hätte sie noch gelebt, dann wäre sie wenig erbaut darüber gewesen, dass ihr Sohn an seinem Todestag sehr alte und sehr zerschlissene Boxershorts getragen hatte.
Dass etwas mit seiner Leben-nach-dem-Tod-Erfahrung nicht stimmte, wurde Nathan zum ersten Mal in dem Moment klar, als er eisige Kälte verspürte und ihm bewusst wurde, dass seine Arme fixiert waren. Auf seinem Gesicht lag unangenehmerweise ein Stück Stoff oder Ähnliches.
Im ersten Augenblick musste er an eine Zwangsjacke denken. Vielleicht hatte das zunehmend angespannte Verhältnis zu seiner Frau einen Punkt erreicht, an dem sein Verstand sich verabschiedet hatte? Und das hatte womöglich zur Folge, dass er nun an einer Psychose litt, die es erforderte, dass er zwangseingewiesen und in einem sehr beengten Raum untergebracht wurde?
Er bekam noch immer gut Luft, auch wenn sein Atem nicht mehr besonders angenehm roch, was ihm das Tuch auf seinem Gesicht unmissverständlich verdeutlichte. Er versuchte, den linken Arm zu bewegen, doch das verursachte so bestialische Schmerzen, dass er keuchte und ihm Tränen in die Augen schossen. Vorsichtig bewegte er den rechten Arm. Er spürte ein leichtes Kribbeln, allerdings keine Schmerzen. Er befreite den Arm von was auch immer ihn festhielt, hob ihn an und nahm das Textilteil von seinem Gesicht.
Doch nachdem er sich aus seinem ersten Gefängnis befreit hatte, fand er sich sogleich in einem zweiten wieder. Er war in etwas Dunklem, Hartem, Metallischem gefangen. Soweit er wusste, wurden nicht einmal die durchgeknalltesten und gefährlichsten Geisteskranken in Metallkisten gesteckt. Zumindest glaubte er das. Obwohl er zugeben musste, dass er sich mit den aktuellen Bestimmungen zur Behandlung von psychischen Problemen in Großbritannien nicht sonderlich gut auskannte.
Leider kehrte in diesem Moment auch das Gefühl in den Rest seines Körpers zurück, und er bekam Schmerzen. Nicht die Art von Schmerzen, die man spürte, wenn man sich unsterblich in jemanden verliebte – daran konnte er sich noch erinnern (gerade noch so) –, sondern der allumfassende körperliche Schmerz, der mit einer echten Grippe einherging. Ein Schmerz, der sich anfühlte, als ob ein kleines Männchen im Körper umherrannte und einen überall mit einer heißen Nadel pikste. Tatsächlich fühlte es sich an, als wäre er von einem Bus angefahren worden. Dann fiel ihm wieder ein, dass ja genau das passiert war.
Er begann zu rufen. Leider brachten seine Stimmbänder nur ein klägliches Wimmern hervor. Er versuchte, mit seinem gesunden Arm gegen die Wände der Metallbox zu schlagen, aber da er nur wenig Platz zum Ausholen hatte, war das nicht annähernd laut genug.
Schließlich entdeckte Nathan, dass es wesentlich geräuschvoller war, wenn er mit den nackten Fersen gegen den unteren Teil des Metallgefängnisses trat. Er probierte es ein paar Sekunden lang, gab dann aber erschöpft auf.
Plötzlich merkte er, wie er sich nach vorn bewegte. Es erinnerte ihn an den Beginn einer Achterbahnfahrt – allerdings ohne die gespannte, freudige Erwartung. Mit einem Mal glitt er aus der Dunkelheit heraus in gleißend helles Licht.
Als er in das helle Licht blinzelte, tauchte ein Gesicht auf, und er wurde neugierig gemustert. Vielleicht ein Engel? Wenn dem so war, dann sah dieser Engel ganz anders aus als die Engel, die man so aus den einschlägigen Hollywoodfilmen kannte. Ihr Haar war schwarz, ihre Augen waren schwarz, ihre Kleider waren schwarz, ihre Ohrringe waren schwarz, ihre Piercings waren schwarz, sogar ihre Lippen waren schwarz – ihre Zähne waren dagegen perlweiß. Sie lächelte ihn an. »Hallo.«
Kapitel 2
Mein voller Name lautet Klaudette Ainsworth-Thomas (ja, ich weiß). An meinem zehnten Geburtstag wachte ich auf, beschloss, dass es jetzt endgültig reichte, und traf eine Entscheidung monumentalen Ausmaßes. Und wer war die erste Person, der ich davon erzählen musste? Meine Mutter.
»Mum?«
Janice, meine Mum, war für gewöhnlich am Bügelbrett zu finden. Sie bügelte jeden Tag. Bügeln war eine ihrer vielen Leidenschaften, die schon an Besessenheit grenzten. Wenn es auf 18 Uhr zuging und sich im Bügelkorb keine Wäsche mehr befand, wurde sie nervös und unleidlich. Sie bügelte dann Sachen, die bereits vollkommen knitterfrei waren – zum Beispiel die Hemden meines Vaters –, oder zufällig Ausgewähltes wie die Vorhänge im Schlafzimmer. Es wurde in unserer Familie sogar gemunkelt, dass sie die Zierkissenbezüge vom Sofa genommen und bei niedriger Hitze gebügelt haben soll.
»Mum?«
»Ja, Klaudie?« Das war übrigens noch etwas, das mich nervte. Obwohl ich dank meiner gedankenlosen Eltern mit einem Dreifachnamen aus der Hölle geschlagen war, machten sie sich nicht einmal die Mühe, ihn richtig zu benutzen. Stattdessen kürzten sie ihn ständig so ab, dass es wie das Wetter klang, das in Schottland vorherrschte. Cloudy. Bewölkt.
»Ich habe eine Entscheidung getroffen.«
»Das ist schön, Schatz.«
»Mum, ich meine es ernst.«
Sie legte das Bügeleisen zur Seite und starrte mich an. »Klaudie, du bist immer ernst – das ist ja dein Problem. Du …«
»Nein, Mum, das ist nicht mein Problem, das ist dein Problem. Ich bin so, wie ich bin. Ich habe beschlossen, dass ich es satthabe, Klaudette, Klaudie oder Klaudia genannt zu werden. Und von Ainsworth-Thomas habe ich ebenfalls die Nase voll. Von jetzt an reagiere ich nur noch auf den Namen Kat. K-A-T.«
»K-A-T?«
»Ja. Kat ist viel cooler, und die meisten meiner Freunde nennen mich sowieso so.«
Mum widmete sich wieder den Pantoffeln, die sie gerade bügelte. »Das ist schön, Schatz.«
Trotz Mums Gleichgültigkeit ließ ich mich nicht beirren. Von dem Tag an hörte ich nur noch auf den Namen Kat. Irgendwann hatten sich alle – inklusive meiner Eltern und der Großzahl meiner Lehrer – an den neuen Namen gewöhnt. Die einzige Ausnahme war die stellvertretende Rektorin meiner baufälligen Highschool in Glasgow: Mrs. Brock. Mrs. Brock bestand darauf, mich auch weiterhin Klaudette zu nennen. Das Ergebnis war, dass ich für die nächsten fünf Jahre alles ignorierte, was sie sagte.
Das einzige Problem an dieser Taktik war, dass Mrs. Brock mich während zwei dieser fünf Jahre in Geschichte unterrichtete. Deshalb zählte Geschichte nicht unbedingt zu meinen stärksten Fächern. Und die ganzen Harolds/Haralds, die 1066 so rumgelungert hatten, waren auch nicht gerade hilfreich.
Natürlich war meine Mum schuld. Sie hatte einen John Thomas (ja, echt) getroffen und geheiratet. Und sie hatten beschlossen, ihre Namen nach der Hochzeit mit einem Bindestrich zu koppeln. Ich hätte gedacht, dass jemand, der mit dem Namen John Thomas aufwachsen musste (was im Englischen ja auch eine flapsige Bezeichnung für Penis ist), bei der Namenswahl für seine Kinder etwas vorsichtiger wäre und davon absehen würde, der einzigen Tochter einen so unaussprechlichen Namen aufzubürden. Um seinen eigenen Vornamen nicht mehr benutzen zu müssen, war mein Dad sogar Professor für Ethnosoziologie geworden – selbst auf seinen Kreditkarten stand nur Prof. J. Thomas.
Als kleines Kind – bevor ich schlau genug war, meinen Namen zu ändern – hatte ich einen dicklichen, pummeligen Körper, ein seltsam gequetschtes Gesicht und kaum Selbstbewusstsein.
Ich kam von der Schule nach Hause, ging in mein Zimmer, zog mein Cinderella- oder Schneewittchenkostüm aus der Verkleidungskiste an, tanzte vor dem Spiegel herum und tat so, als würde ich ein anderes Leben leben. Die Kleider waren für mich eine Art emotionaler Schutzwall. Etwas, hinter dem ich mich verstecken konnte. Das machte ich übrigens weiterhin.
Ich hatte immer das Gefühl, es würde eine gewisse Grausamkeit dahinterstecken, als Einzelkind aufzuwachsen. Vor allem bei Eltern wie meinen, die mit ihren eigenen Leidenschaften viel zu beschäftigt waren, um irgendwie Notiz von meinen Problemen zu nehmen. Alle Eltern sollten verpflichtet sein, zwei oder mehr Kinder zu haben oder eben keines. Ein Dasein als Einzelkind konnte zu Vereinsamung führen – bei Kindern wie mir, die Schwierigkeiten hatten, Freunde zu finden, war es jedenfalls so. Wenn ich Geschwister gehabt hätte, hätten wenigstens die mit mir spielen und etwas von meiner Einsamkeit vertreiben können.
Ja, aber wie ich dich kenne, hätten sie dich gehasst, sodass alles nur noch schlimmer geworden wäre.
»Es hätte kaum schlimmer sein können.«
Wollen wir wetten?
Wenn ich gestresst bin, streite ich mich oft mit meinem inneren Selbst – normalerweise auch laut, was mir häufig konsternierte Blicke von Fremden einbringt. Na ja, noch konsternierterer als ohnehin schon. Kindheitserinnerungen lassen meinen Stresspegel für gewöhnlich ins Unermessliche steigen, also versuche ich, das zu vermeiden.
Trotz meiner Probleme auf der Highschool schloss ich zur Überraschung vieler meiner Lehrer – allen voran Mrs. Brock – mit ganz anständigen Noten ab und erhielt einen Platz an der Napier University of Edinburgh, um Gesundheits- und Krankenpflege zu studieren.
Den Gedanken an einen Bürojob konnte ich nicht ertragen. Ich war ein praktisch veranlagter Mensch und glaubte zu Beginn, es wäre eine gute Idee, in der Pflege zu arbeiten. Ich stellte mir vor, dass der Job eine stimulierende und sich ständig verändernde Umgebung bieten würde, sodass mir nicht langweilig werden würde. So war es allerdings nicht.
Zuerst wurde ich in der Chirurgie eingesetzt und musste mich um Patienten kümmern, die entweder auf eine Operation warteten oder sich von einer OP erholten. Die Station war chronisch unterbesetzt (wie so viele), was bedeutete, dass ich mich benutzt und ausgenutzt fühlte – von allen. Von Kollegen und Patienten gleichermaßen. »Kat, der Patient in Zimmer 3 braucht Toast und Tee. Kannst du ihm das bringen?«, bat mich meine Ausbilderin während der ersten Achtstundenschicht.
Nachdem ich das getan hatte, eilte ich zurück ins Schwesternzimmer. »Schnell erledigt«, sagte sie. »Kannst du die beiden Betten in Zimmer 11 frisch beziehen? Sie sind voller Blut und Erbrochenem. Und könntest du danach so freundlich sein und mir und Elaine, der Pflegemanagerin, aus der Cafeteria ein paar Sandwiches holen, weil wir beide vergessen haben, etwas für die Mittagspause einzupacken?«
Am Ende des Tages hatte ich den Eindruck, weniger eine Krankenschwester zu sein, sondern viel eher eine Kellnerin oder ein Zimmermädchen. Ich fragte mich auch, warum Patienten überhaupt »Patienten« genannt wurden, denn in meinen Augen waren sie mit dem ständigen Drücken des Klingelknopfs und dem Verlangen nach diesem und jenem alles andere als das.
Mit alldem hätte ich mich vielleicht noch abfinden und es trotzdem durchziehen können. Doch der Tropfen, der das Fass für mich zum Überlaufen brachte, kam am Ende der ersten Dienstwoche. Ich begleitete gerade einen älteren Herrn zur Toilette, als er sich unvermittelt umdrehte, mit seinen knochigen (aber überraschend starken) kleinen Händen meine Brüste packte, das Gesicht in mein Dekolleté drückte, seufzte und dann tot zu Boden sackte.
Genug war genug. Also stieg ich aus und begann ein medizinisches Praktikum in der Pathologie. Tote Patienten grapschten nicht, forderten nichts, redeten nicht mit mir, starrten mich nicht an und griffen mich auch nicht an. Tatsächlich machten sie fast überhaupt nichts – außer reglos herumzuliegen. Ab und an stanken sie ein wenig, daran allerdings gewöhnte man sich schnell.
Ich bewarb mich, und mit der Hilfe von Freistellungen sowie Abendkursen qualifizierte ich mich zur Pathologieassistentin – besser bekannt als Sektions- und Präparationsassistentin. Ich schätze, angesichts meiner Weltanschauung und meiner recht ernsten und introvertierten Art passte die Arbeit einfach zu mir. Inzwischen bin ich schon fast sechs Jahre am Royal Infirmary of Edinburgh, und es gibt kaum etwas, das ich noch nicht gesehen oder gerochen habe.
Anfangs reagierte Mum schockiert auf meine etwas ungewöhnliche Berufswahl und konnte die Motivation dahinter nicht nachvollziehen. Im Laufe der Zeit erkannte sie jedoch, dass ich meinen Job liebte, Spaß daran hatte – auch wenn es verrückt klang – und mich im Gegensatz zu vielen anderen Menschen auch nie darüber beklagte.
Montag, der 23. November, begann wie alle Arbeitstage, wenn ich Frühschicht hatte. Mein Wecker klingelte um 5:45 Uhr. Ich duschte, aß Cornflakes, während ich mir die Haare föhnte, und sah mir die BBC News mit Untertiteln an, damit ich trotz des Föhn-Lärms verstehen konnte, worüber die Moderatoren quasselten. Mein dickes Haar brauchte immer eine Ewigkeit, bis es trocken war.
Danach legte ich meine Manic Panic-Foundation auf. Wenn ich ehrlich war, gefiel mir an dem Produkt vor allem der Name, denn im Grunde genommen hätte ich auch jede andere Grundierung verwenden können. Dagegen ließ ich seit zehn Jahren ausschließlich Lippenstifte der Marke Rimmel an meine Lippen. In drei Farbnuancen: Schwarz, Dunkelrot und für besondere Anlässe RockChick Scarlet. Da es jedoch ein ganz normaler Arbeitstag war, entschied ich mich für das langweilige Black Diva.
Ich trug schwarzen Eyeliner auf und verteilte etwas pinkfarbenes Rouge, damit ich nicht ganz so aussah wie einer meiner bleichen Schützlinge. Tatsächlich hatte ich, je älter ich wurde, meinen Goth-Look immer weiter abgeschwächt. Wahrscheinlich gab es nichts und niemanden mehr, gegen den ich dieser Tage rebellieren musste, aber mir gefiel es, dass die Leute sich aufgrund meines Äußeren vor mir in Acht nahmen.
Schließlich zog ich mich an, verließ meine winzige Mietwohnung in Duddingston, im Osten von Edinburgh, und fuhr zur Arbeit. Mein Pensum für den Vormittag war überschaubar, da wir die nächste Autopsie erst am Nachmittag auf dem Plan stehen hatten. Also hatte ich vor, den liegen gebliebenen Papierkram zu erledigen, den ich Freitag nicht mehr geschafft hatte. Außerdem freute ich mich darauf, mit Sid zusammenarbeiten zu können.
Sids eigentlicher Name lautete Dr. David Ingles, doch sein Jugendidol war Sid Vicious gewesen, also hatte er sich den Spitznamen ausgesucht. Mein einziges Problem damit war, dass Taylor Swift meiner Meinung nach mehr Ähnlichkeit mit Sid Vicious hatte als David mit seinem netten runden Gesicht, den vollen Lippen und den freundlichen grauen Augen. Zudem war David, der erst sechsunddreißig war, noch nicht einmal geboren, als die Sex Pistols den Höhepunkt ihres Erfolgs erreicht hatten – aber … gut. Vermutlich war ich die Letzte, die diesbezüglich andere Menschen kritisieren sollte. Auf jeden Fall war Sid mein Lieblingspathologe, was angesichts seiner Art ein bisschen so war, als würde ich sagen, er wäre mein Lieblingsteddybär. Er hatte ungefähr zur gleichen Zeit wie ich am Royal Infirmary of Edinburgh angefangen. Und obwohl er sehr erfahren war, behandelte er einen nicht von oben herab, wie die meisten anderen Ärzte es taten. Wir kamen sehr gut miteinander aus.
Er war in unglaublich vielen Bereichen mit mir auf einer Wellenlänge. Und da wir körperlich überhaupt kein Interesse aneinander hatten, war es ganz leicht, mit ihm zu reden. Ich hatte den Verdacht, dass er schwul war – tatsächlich hätte ich sogar Geld darauf verwettet. Doch wann immer ich das Thema anschnitt (für gewöhnlich nach einigen Drinks), wechselte er es augenblicklich wieder. Was meiner Meinung nach der beste Beleg dafür war, dass er seine Homosexualität kategorisch unterdrückte. Er schien seine Neigung in eine Schublade gesteckt, sie verschlossen und den Schlüssel weggeworfen zu haben.
An diesem Montag war ich vor allen anderen da und öffnete die Tür zu dem großen Raum im Untergeschoss des Krankenhauses, wo sich die kürzlich Verstorbenen befanden. Plötzlich blieb ich wie angewurzelt stehen. Ich hatte etwas gehört. Einen Moment lang rührte ich mich nicht und atmete kaum. Dann beschloss ich, dass ich mich geirrt hatte. Ich war schon unzählige Male allein hier unten gewesen – am Tag und auch in der Nacht –, und es machte mir nichts mehr aus. Zuerst war es ein wenig unheimlich gewesen, doch irgendwann war mir klar geworden, dass die Verstorbenen mir nichts tun konnten (außer natürlich, wenn sie sich zu einer Art Zombiekalypse erhoben). Das Leben hatte mich gelehrt, dass es eher die Lebendigen waren, vor denen ich mich in Acht nehmen musste.
Schnell sah ich mir das Übergabeprotokoll an und stellte fest, dass es nur einen Neuzugang gab. Als ich mich umdrehte, um in die Umkleide zu gehen, hörte ich etwas aus einem der Kühlfächer. Wie seltsam.
Vorsichtig näherte ich mich dem Bereich, aus dem das Klopfen kam, und dachte einen Moment lang, dass mir ein Kollege vielleicht einen Streich spielen wollte. Doch diese Art von Scherzen war für gewöhnlich für die »Frischlinge« bestimmt. Langsam öffnete ich das Fach, aus dem die Geräusche gekommen waren, zog das Stahltablett heraus und betrachtete das blasse, lädierte, aber unglaublich schöne Gesicht, das mir entgegenblickte. Die leuchtend blauen Augen blinzelten, und es war um mich geschehen. In dieser Sekunde war es passiert – ich hatte mich in eine Leiche verliebt.
Kapitel 3
Nachdem ich mich vergewissert hatte, dass meine ziemlich attraktive »Leiche« tatsächlich lebendig war und keine Erfindung meiner oft recht blühenden Fantasie, rief ich oben an und bat sie, jemanden von der intensivmedizinischen Abteilung in die Pathologie zu schicken. Mein »Patient« (ich war der Meinung, dass das am Telefon besser klang als »Leiche«) war nicht lange tot gewesen, falls er überhaupt tot gewesen war. Die Ärzte waren verständlicherweise irritiert und stellten mir eine Unmenge von Fragen, von denen ich die meisten nicht beantworten konnte.
Fünfzehn Minuten nachdem ich den Patienten entdeckt hatte – laut des Zettelchens an seinem Zeh hieß er Mr. Jones –, war er bereits auf die Intensivstation gebracht, bis an die Zähne verkabelt und auf jede nur erdenkliche Weise untersucht worden. Im Anschluss an ihre Tests füllten sie ihn mit Schmerzmitteln ab und ließen ihn schlafen. »Nathan Jones ist eine medizinische Seltenheit, ein wandelndes Wunder – na ja, das wird er mal sein. Aktuell ist er ein liegendes, stöhnendes Wunder«, erzählte mir der Facharzt der intensivmedizinischen Abteilung.
Am Ende meiner Schicht schlenderte ich nach oben, um zu sehen, wie es meiner ersten »lebendigen Leiche« ergangen war. Ich fand ihn faszinierend, aber er verunsicherte und verwirrte mich auch. Ich hatte noch nie so schnell Gefühle für irgendjemanden entwickelt – egal, ob lebendig oder tot oder irgendetwas dazwischen, was Mr. Jones zu sein schien.
Ich wusste, dass ich mich auf unsicheres Terrain begeben hatte, doch ich konnte nichts gegen meine Gefühle tun.
Unterwegs hielt ich beim Schwesternzimmer an und bekam von Jan, der Pflegemanagerin vom Dienst, ein Update. Wir kannten einander seit Jahren. Sie hatte mich unter ihre Fittiche genommen (ihre Worte, nicht meine), als ich im Krankenhaus angefangen hatte. Eines Abends hatten wir uns zusammen ein wenig betrunken. Dabei hatte sie mir gestanden, dass sie vermutete, bisexuelle Neigungen zu haben, aber nicht riskieren wollte, dass ihr Ehemann oder ihr Teenagersohn das herausfanden. Angesichts dieser neuen Informationen war ich mir zu der Zeit nicht sicher gewesen, ob die Tatsache, dass sie mich unter »ihre Fittiche« genommen hatte, bedeutete, dass sie mich mochte oder dass sie mich mochte. Doch zu meiner großen Erleichterung war abgesehen von diesem betrunkenen Geständnis nichts weiter passiert.
Sie teilte mir mit, was sie wusste, und erklärte mir, dass Mr. Jones noch schlafen würde. Ich schlich mich in sein Zimmer und beobachtete ihn eine Weile, wobei ich mich fragte, wie er es geschafft hatte, für tot erklärt zu werden und trotzdem lebendig zu sein.
Ich hatte mich gerade entschlossen, aufzustehen und nach Hause zu gehen, als seine Augenlider zu flattern begannen. »Hallo«, sagte ich fröhlich.
»Können Sie noch etwas anderes sagen?«, murmelte er mit einem britischen Akzent und fuhr sich mit der Zungenspitze über die trockenen Lippen. Ich schenkte ihm etwas Wasser ein und reichte es ihm. Sein linker Arm war eingegipst, aber sein rechter Arm schien gut zu funktionieren. Er nahm mir den Becher aus der Hand.
»Sind Sie Rechtshänder? Was für ein Glück.«
Er nickte. »Ja, wahrscheinlich. Dass das Glück mir im Augenblick gewogen wäre, kann ich allerdings nicht behaupten. Ich glaube, ich sollte mich bei Ihnen bedanken … Sie wissen schon … weil Sie mich gefunden haben.«
»Sie waren ja auch sehr laut. In der Pathologie ist es für gewöhnlich still. So still wie … na ja, in der Pathologie eben.«
»Ich hoffe, ich war nicht zu laut – nicht laut genug, um Tote zu wecken.«
»Ich habe zwar nicht nachgesehen, aber ich meine, Sie wären der einzige Lebendige in den Kühlfächern gewesen.«
»Ist Ihnen das schon mal passiert?«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein, Sie sind mein erster Zombie. Sie waren definitiv tot, als man Sie gestern wieder ins Kühlfach geschoben hat.«
»Wieder?«
»Ja, am Wochenende war ich nicht da, doch nachdem Ihre Frau Sie am Samstagabend identifiziert hat, hat man Sie ein bisschen hin- und hergeschoben, weil die Kühlvorrichtung gewartet wurde. Also waren Sie im Endeffekt nicht besonders lange im Kühlfach. Trotzdem: Man sollte doch meinen, dass das ganze Herumgeschiebe Sie hätte aufwecken müssen.«
»Ich verstehe nicht …«
»Ich auch nicht. Und die Ärzte genauso wenig. Sie haben viele Leute verunsichert und in Aufregung versetzt. Die Mediziner wissen nicht, warum Sie leben, und das quält sie.«
»Hätten sie es lieber gesehen, wenn ich tot geblieben wäre?«
»Wahrscheinlich. Und wenn Sie noch viel länger im Kühlfach gelegen hätten, dann wären Sie wohl erfroren. Die Ärzte meinen, Sie wären vielleicht ein Fall des sogenannten Lazarus-Phänomens.«
»Was ist das?«
»Es ist auch bekannt als Auferstehung nach einer scheinbar erfolglosen kardiopulmonalen Reanimation. Gemeint ist das spontane Wiedereinsetzen der Kreislauffunktion, nachdem eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchgeführt wurde, die nicht zum Ziel geführt hat.«
»Was soll das bedeuten?«
»Sie haben sehr viel Glück gehabt.«
»Das haben Sie schon gesagt. Wie heißen Sie?«
»Kat.«
»Was? Wie eine Pussykatze? Tut mir leid, das klang etwas unflätig.«
»Schon gut. Nein, K-A-T.«
»Oh. Okay. Die Kurzform von Katie oder so.«
»Ja, so etwas in der Richtung. Hören Sie, ich bin nur gekommen, um zu fragen, ob Sie irgendetwas brauchen?«
»Vielleicht einen neuen Körper?«
Ich lachte. »Da kann ich Ihnen leider nicht behilflich sein. Ich glaube, Ihre Frau war vorhin mit den Kindern da.«
»Haben Sie mit ihr gesprochen?«
»Nein. Ich war zu dem Zeitpunkt unten und habe dabei geholfen, jemandem die Schädeldecke aufzusägen.«
»Das wollte ich gar nicht so genau wissen.«
»Tut mir leid. Die Pflegemanagerin meinte, Ihre Frau hätte wegen der Kinder nicht lange bleiben können. Aber sie wurde dann noch mal angerufen und benachrichtigt, dass Sie wach sind. Sie sagte, sie würde morgen kommen.« Ich kratzte mir die Nase. Am linken Nasenflügel befand sich ein schwarzes Piercing. Mir entging nicht, wie Nathan mich anblickte. Zugegebenermaßen war ich enttäuscht gewesen, als ich erfahren hatte, dass er eine Frau hatte. Mein Männergeschmack wurde nicht besser, je älter ich wurde. »Es muss ein Schock für sie gewesen sein.«
»Was? Dass ich gestorben bin?«
»Ja, dass Sie gestorben sind. Und dass Sie plötzlich wieder lebendig sind.« Mir fiel auf, dass seine Miene sich verfinsterte und er die Stirn runzelte. Irgendwie sah er älter aus. »Was ist los?«
»Abgesehen davon, dass ich völlig kaputt bin?«
Ich lächelte. »Ja, Sie sehen so aus, als wären Sie über irgendetwas bestürzt oder verärgert oder so.«
»Nein, ich habe nur Schmerzen.«
Ich glaubte ihm nicht, doch was auch immer ihn beschäftigte, ging mich im Grunde genommen nichts an.
»Tja, da Ihre Frau nicht kommen kann, um Sie zu besuchen … Wen kann ich sonst noch anrufen?«
»Die Ghostbusters«, sagte er grinsend.
»Ernsthaft … Gibt es denn sonst niemanden? Ihre Mutter vielleicht?«
»Sie ist seit siebzehn Jahren tot.«
»Ihren Vater?«
»Ist seit zwanzig Jahren tot.«
»Brüder? Schwestern?«
»Ich bin Einzelkind.«
»Wohl eher ein einsames Kind. Was ist mit Freunden?«
Nathan seufzte. »Sie hätten meinen Kumpel Graham anrufen können, aber der macht gerade Urlaub in Thailand.«
»Haben Sie bei der Arbeit Bescheid gegeben, dass Sie vermutlich eine Weile nicht da sein werden?«
»Ich arbeite hauptsächlich allein. Freiberufler. Also ist es nicht nötig, jemanden zu informieren.«
»Freiberufler in welchem Bereich?«
»Einfach Freiberufler. Sie sind sehr neugierig.«
»Sind Sie einsam?«
»Mit einer Frau und drei Kindern? Das muss ein Scherz sein.«
»Außerhalb des Familienkreises scheint es allerdings wenig für Sie zu geben.«
»Ich bin ein viel beschäftigter Mensch.«
»Das sagen einsame Menschen oft.«
»Ist das so?«
»Ja.«
Wir schwiegen einen Moment lang, und ich bemerkte, dass ihm die Augen zufielen.
»Ich sollte gehen. Sie sind offensichtlich sehr müde und müssen sich ausruhen.«
Er nickte. »Sie müssen vermutlich wieder an die Arbeit?«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein, meine Schicht ist zu Ende. Ich gehe jetzt nach Hause.«
»Wartet Ihr Freund auf Sie?«
Ich grübelte darüber nach, warum er das gefragt hatte, und es verärgerte mich ein bisschen. Vielleicht war er ein Serienbetrüger – falls es so war, war es kein Wunder, dass seine Frau nicht direkt ins Krankenhaus zurückgekommen war.
Meine Entgegnung klang ziemlich schroff. »Ich habe keinen Freund. Glauben Sie, ich würde hier sitzen, wenn ich auch irgendwo anders sein könnte?« Ich konnte ihm ansehen, dass meine Frage und mein Tonfall ihn überrascht hatten.
»Wahrscheinlich nicht«, erwiderte er gedämpft.
Vielleicht war es ein bisschen zu harsch gewesen. »Tut mir leid, das klang jetzt nicht so, wie es rüberkommen sollte.«
»Nein, schon gut. Ich weiß es zu schätzen. Ich hätte heute überhaupt keinen Besuch gehabt, wenn Sie nicht gekommen wären.«
»Ich werde wahrscheinlich nicht noch einmal wiederkommen. Ich wollte echt nur hören, ob Sie noch jemandem Bescheid geben wollen. Nachdem Sie mir nun gesagt haben, dass Sie das nicht wünschen … Na ja, auch gut.«
»Danke, dass Sie mich zurück ins Leben geholt haben.«
Ich lächelte und schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht, dass ich das getan habe, doch es ist auf jeden Fall eine schöne Vorstellung. Auf Wiedersehen, Mr. Jones.«
»Nathan.«
»Auf Wiedersehen, Nathan.«
Am nächsten Morgen wachte Nathan früh auf. Hauptsächlich weckten ihn das Klappern und Klirren, das zu dieser Tageszeit in Krankenhausfluren offenbar üblich war. Er hatte schlecht geschlafen. Immer wieder war ihm das Pathologie-Mädchen in seinen Träumen erschienen. Hinzu waren die Schmerzen gekommen, die schlimmer geworden waren, als das Schmerzmittel allmählich nachgelassen hatte. Gottlob war in aller Herrgottsfrühe eine Krankenschwester aufgetaucht, um seinen Blutdruck zu messen, und hatte ihm noch ein Schmerzmittel gegeben.
Im Laufe des Vormittags erschien seine Frau mit ihrer jüngsten Tochter. Daisy war vier Jahre alt. Die Kleine sprang aufs Bett und umarmte ihn – ein schönes Gefühl. Außer Daisy hatten sie noch Millie, die zehn war und gefühlt auf die fünfunddreißig zuging, und die sechsjährige Chloe.
»Wo sind die anderen beiden?«
Laura lächelte. »In der Schule natürlich – es ist Dienstag.«
»Sie hätten auch mal einen Vormittag schwänzen können, um ihren Vater zu sehen.«
»Sie sind schon verwirrt genug. Ich habe die vergangenen zwei Tage versucht, sie zu trösten, weil sie außer sich über deinen Tod waren. Jetzt glauben sie, dass ich das alles nur erfunden und sie angelogen hätte. Vor allem Millie spricht kaum noch mit mir.«
»Tut mir leid, dass ich dein Leben durcheinandergebracht habe.«
Lauras falsches Lächeln erstarb. »Fang jetzt nicht so an, Nathan. Ich hatte ein paar wirklich traumatische Tage. Du hast keine Ahnung, wie schwierig es gewesen ist, sich um alles zu kümmern. Wir dachten, du wärst tot.«
Er nickte. »Ich werde mich nicht dafür entschuldigen, noch am Leben zu sein, Laura. Es war das Lazarus-Phänomen.«
»Was ist das?«
»Das hat irgendetwas mit dem spontanen Wiedereinsetzen der Kreislauffunktion zu tun oder so … Wie auch immer, ich habe es nicht absichtlich getan, um alles noch komplizierter zu machen.«
Laura blinzelte und wandte den Blick ab. »Ja, ich weiß. Entschuldige. Wie geht es dir?«
Er seufzte. »Kaputt. Ich habe mir einiges gebrochen.«
»Ja, das haben sie mir gesagt.«
»Du hättest auch schon gestern kommen können.«
»Ich war mit den Mädchen da, aber sie haben verrücktgespielt, und ich … stand vielleicht ein bisschen unter Schock. Als die Ärzte meinten, wir müssten gehen, war es leichter, das einfach zu tun und nicht zu diskutieren.«
»Schock?«
»Dass du noch am Leben warst. Wie gesagt, habe ich zwei Tage damit zugebracht …«
»Ja, ja, den Mädchen zu erklären, dass ich tot wäre. Das hast du schon gesagt.«
Die nächsten Minuten über herrschte Schweigen, bis Daisy verkündete: »Ich muss Pipi.«
Laura ging mit ihr ins Badezimmer, und Nathan nahm sich einen Moment, um die Sache aus Sicht seiner Frau zu betrachten. Er sah ein, dass sein Tod sie schockiert hatte, und ihre drei Töchter konnten wirklich anstrengend sein … Aber hätte er sich im umgekehrten Fall so schnell geschlagen gegeben? Nein, er hätte vom Krankenhauspersonal verlangt, dass er und die Kinder ins Krankenzimmer gelassen wurden. Er hätte nicht aufgegeben. Schon allein um der Mädchen willen.
Er seufzte und versuchte, sich an die Liebe zu erinnern, die er früher mal für Laura empfunden hatte – doch es fiel ihm schwer. Sie standen sich schon so lange nicht mehr nahe. Ab und an gab es noch mal einen guten Tag oder eine gute Nacht, wenn sie gerade Lust auf Sex hatte. Der Sex brachte sie einander körperlich und mental auch wieder näher, aber das passierte immer seltener.
Laura kam zurück und setzte sich mit Daisy auf dem Knie an sein Bett. Seine Frau hatte schwarzes Haar. Es war ihre natürliche Haarfarbe. In all den Jahren, die er sie kannte, hatte sie nie etwas daran verändert. Obwohl die Haare inzwischen von einigen grauen Strähnen durchzogen waren, weigerte sie sich noch immer, sie zu färben. Ihre kleine Stupsnase saß wie ein süßer Knopf mitten in ihrem blassen, hübschen Gesicht. In den dunkelgrünen Augen, mit denen sie ihn früher so mühelos gefesselt und voller Liebe und Hingabe angesehen hatte, standen heutzutage viel öfter Ungeduld und Zorn.
»Tja, ich denke, wir sollten jetzt nach Hause fahren. Daisy braucht ihr Mittagessen, und ich muss die Mädchen um drei von der Schule abholen.«
Nathan widersprach nicht. Das Schweigen zwischen ihnen war alles andere als angenehm gewesen, und er musste schlafen. Die Schmerzmittel machten ihn müde und reizbar. Einige Minuten nachdem Laura und Daisy gegangen waren, fiel er in einen unruhigen Schlaf. Angenehme Träume waren selten geworden.
Kapitel 4
Solange er im Krankenhaus war, kam Laura jeden Abend mit den Mädchen vorbei, damit sie bei ihm sein konnten. Auch wenn es ihm Kraft gab, seine Töchter zu sehen, raubte es ihm gleichzeitig jegliche Energie, in das gestresste und unglückliche Gesicht seiner Frau blicken zu müssen. Er war froh, dass man ihn nach vier Tagen nach Hause entließ.
Am Freitagnachmittag erschien eine Ärztin mit einem Clipboard in der Hand in seinem Zimmer. Darauf war eine ausgedruckte Liste der Dinge befestigt, die er nicht tun durfte, nachdem sie ihm die starken Schmerzmittel ausgehändigt und ihn entlassen hatten.
Motocross
Drachenfliegen
Fallschirmspringen
Autorallyes fahren
Wasserski fahren
Boxen
Bullenreiten
Nathan hatte von all diesen Dingen bisher nichts ausprobiert und fragte sich, ob er im Leben vielleicht etwas verpasst hatte. Er unterschrieb das Formular, versprach, nichts Gefährliches zu tun, und stutzte kurz … Immerhin hatte sein Versuch, einfach nur die Straße zu überqueren, schon in der Pathologie geendet.
Die sehr jung aussehende Ärztin – Nathans Meinung nach zu jung, um Chefärztin zu sein – griff nach der unterschriebenen Erklärung, hakte noch etwas auf dem Clipboard ab und richtete dann, ohne aufzublicken, das Wort an ihn. »Sie sollten außerdem keine Maschinen bedienen und nicht am Straßenverkehr teilnehmen, solange Sie dieses Medikament bekommen.«
Er wartete, bis sie aufsah, und wedelte dann mit seiner Schlinge und dem eingegipsten Arm.
»O ja, tut mir leid. Das kommt ganz automatisch. Aber Sie wären überrascht, was manche Menschen versuchen und machen.«
»Wie zum Beispiel Bullenreiten.«
»Wie bitte?«
»Das steht auf der Liste von verbotenen Aktivitäten.«
»Tatsächlich?«
»Ja, ganz unten.«
Sie blickte auf das Formular, sah dann hoch und lächelte. »Stimmt, das sollten Sie zumindest ein paar Wochen lang nicht tun.«
»Ich werde es versuchen. Allerdings wird Bullenreiten in Edinburgh ja praktisch an jeder Ecke angeboten, also ist es möglicherweise unvermeidlich«, erwiderte Nathan.
Sie ignorierte seinen Sarkasmus und legte die Entlassungspapiere ans Fußende des Betts.
Abgesehen von der Armschlinge und ein paar Schnittwunden auf der Stirn hatte Nathan keine sichtbaren Erinnerungen an das Zusammentreffen mit dem Bus davongetragen. Unter dem Hemd waren seine gebrochenen Rippen straff verbunden. Und dass sein Schädel etwas abbekommen hatte, sah man ihm nicht an – dennoch hatte man ihm eingebläut, vorsichtig zu sein. Auch wenn ein glatter Bruch keine Behandlung benötigte, sollte er sofort ins Krankenhaus kommen, falls er unerwartete oder starke Kopfschmerzen bekam. Zu einer mürrischen Ehefrau und drei kleinen Kindern zurückzukehren hieß jedoch, dass starke Kopfschmerzen sich mit beinahe hundertprozentiger Sicherheit einstellen würden.
Trotzdem fühlte er sich beschwingt. Es mochte ein Hochgefühl sein, das durch das Nahtoderlebnis ausgelöst worden war, doch er fürchtete, dass er das niemals mit Sicherheit herausfinden würde – es gab einfach zu wenig Selbsthilfegruppen zu diesem Thema.
Laura erschien, um ihn abzuholen. Sie hatte außergewöhnlich gute Laune und redete viel. Genau genommen führte sie die Unterhaltung allein. Da sein Kopf schmerzte und er sich müde fühlte, war ihm das ganz recht. Den Großteil des Wochenendes verbrachte er damit, fernzusehen und ab und zu ganz unvorhergesehen einzuschlafen. Gerade noch schaute er eine Wiederholung von Antiques Roadshow, und im nächsten Moment war er in Morpheus’ Armen. Gut, vielleicht lag es auch am Fernsehprogramm und nicht so sehr an den Medikamenten. Chloe weckte ihn auf. »Dad, wie kannst du schlafen, wenn du so laut schnarchst?«
»Ich weiß es nicht, Chloe.« Er gähnte. Laura kam zu ihm und umsorgte ihn, was er sehr genoss.
Dann hüpfte Daisy auf die Couch und drückte ihn ganz fest. Dass er gestorben war, hatte zumindest seine jüngsten Töchter dazu gebracht, dankbar zu sein und ihn wertzuschätzen. Das würde wahrscheinlich nicht besonders lange anhalten, also musste er das Beste daraus machen. Sobald sie herausfinden würden, dass er sich wieder vollständig erholt hatte, wäre alles beim Alten. Daisy sprang vom Sofa und stolperte über seinen Fuß.
»Scheiße.«
»Daisy, sag so etwas nicht. Das ist kein schönes Wort«, schimpfte Laura.
»Daddy hat es gesagt.«
»Das hätte er nicht tun sollen. Nathan, sag nicht ›Scheiße‹.«
»Das habe ich nicht.«
»Scheiße«, kreischte Daisy voller Vergnügen.
»Daisy, hör auf.«
»Du hast schon wieder ›Scheiße‹ gesagt, Laura. Deshalb hat sie es wiederholt.«
»Scheiße!«, brüllte Daisy fröhlich.
»Das habe ich nicht. Oder? Scheiße, das wollte ich nicht.«
»Scheiße«, sagte Daisy und hopste auf dem Teppich auf und nieder.
Laura vergrub das Gesicht in den Händen. »Wir müssen damit aufhören, ›Scheiße‹ zu sagen. Ich sage es so gut wie nie – sie hat es von dir.«
»Warum ist alles immer meine Schuld?«
»Weil es für gewöhnlich so ist.«
»Scheiße«, schrie Daisy, während sie losstiefelte, um ihre Puppe zu holen. Sie nahm die Puppe mit in ihr Zimmer. Und flüsterte ihr unterwegs »Scheiße« ins Ohr.
Am Montag setzte Laura Daisy in der Kinderkrippe ab und ging zur Arbeit. Zum ersten Mal, seit er aus dem Krankenhaus zurückgekehrt war, ließ sie ihn allein zu Hause. Seine Frau hatte sich Mühe gegeben, nett zu ihm zu sein. Inzwischen hatte er ein schlechtes Gewissen wegen der argwöhnischen Gedanken, die er gehegt hatte, weil sie am ersten Tag nach dem Unfall so schnell aufgegeben und nicht darauf bestanden hatte, bei ihm im Krankenhaus zu bleiben. Aber jetzt war eine neue Nähe zwischen ihnen entstanden. Und vielleicht war das ein Zeichen dafür, dass sie sich doch noch zusammenraufen konnten.
Ihre Ehe hatte ziemlich gut angefangen, wenn man die Umstände bedachte, unter denen sie zusammengekommen waren. Nach Millies Geburt hatten sie sich auch weiterhin sehr nahegestanden. Die Leute hatten sie sogar »hingebungsvoll« genannt, wenn sie sie zusammen erlebt hatten.
Er konnte nicht mehr genau sagen, ab wann die Stimmung sich geändert hatte. Er vermutete, dass es ein schleichender Prozess gewesen war. Irgendwann zwischen der Schwangerschaft mit Chloe und der Geburt von Daisy hatte sich alles verschoben. Sie hatten, bevor Millie sich angekündigt hatte, nicht viele Chancen gehabt, als Paar Zeit miteinander zu verbringen. Wenn sie diese Zeit gehabt hätten, um sich – ohne Kind – kennenzulernen und die normalen Sachen zu machen, die ein junges Pärchen so machte, hätte die Beziehung wahrscheinlich einfach ihren Lauf genommen. Mit anderen Worten: Sie wäre irgendwann in die Brüche gegangen. Kinder jedoch verkomplizierten alles. Sie nahmen automatisch die erste Stelle ein, und irgendwann hatten Nathan und Laura sich verloren. Geld war erst zum Thema geworden, nachdem Chloe auf die Welt gekommen war. Beruflich war es bei Nathan nicht mehr gelaufen – eine Zeit lang hatten die Firmen dazu geneigt, möglichst viel inhouse erledigen zu lassen, sodass weniger externe Dienstleister benötigt wurden. Diese Tendenz kehrte sich seit Kurzem wieder um, aber gute Verträge waren schwer zu ergattern.
Wenn er noch weiter zurückdachte, vermutete Nathan, dass ein Teil von Lauras anfänglicher Verliebtheit damit zu tun gehabt hatte, dass sie ihn für vornehm und wohlhabend gehalten hatte. Gut, er war auf eine Privatschule gegangen. Aber die Unterbringung im Internat hatte wohl eher damit zu tun gehabt, dass er seinen Eltern ungelegen gekommen war, als mit irgendwelchen ehrgeizigen Hoffnungen, die sie für ihren Sohn gehegt hatten. Er hatte ihren Lebensstil gestört, also hatte er, bevor er in die Schule gekommen war, die meiste Zeit in verschiedenen Krippen verbracht und die meisten Wochenenden mit diversen Babysittern oder Tagesmüttern. (Er begriff noch immer nicht, was der Unterschied zwischen den beiden war.)
Kurz nach Nathans Geburt war eine betagte Tante gestorben und hatte ihr gesamtes, recht beträchtliches Vermögen seiner Mutter hinterlassen. Später hatte er erfahren, dass sie jahrelang auf dieses freudige Ereignis gewartet hatte und dass seine Eltern bereits intensiv darüber nachgedacht hatten, was sie mit dem Geld alles machen würden. Ihre Wunschliste beinhaltete unter anderem jede Menge Reisen, ein paar schöne Autos und ein Ferienhaus in Frankreich. Gut … dass sie ein Kind bekommen hatten, war etwas lästig. Aber sie hatten sich darum kümmern wollen – solange es keine Einschränkung bedeutete.
»Mum, warum hast du mich bekommen?«, hatte er sie einmal gefragt.
»Ich weiß es nicht, Nathan.«
»Wie … du weißt es nicht?«
»Na ja, du warst nicht direkt geplant, um es mal so zu formulieren.«
»Also war ich ein Unfall?«
»Sozusagen. Nachdem ich allerdings erfahren hatte, dass ich schwanger war, beschloss ich, dich zu behalten. Tante Caroline hielt länger durch, als alle gedacht hätten. Und so warst du in meinen Augen eine willkommene Ablenkung … etwas, um die Zeit schneller herumzubringen.«
Seine Eltern hatten ihn selten auf Reisen mitgenommen. Wenn, dann nur während der Sommerferien und nur in das Ferienhaus in der Bretagne. Dass er überhaupt mitgedurft hatte, hing vermutlich damit zusammen, dass eine Tagesmutter in der Bretagne billiger war als eine in London. Dafür waren seine Babysitter in Frankreich allerdings sehr viel schillernder gewesen als die bürgerlichen jungen Mädchen, die in London auf ihn aufpassen sollten …
Eines Abends, kurz nach seinem neunten Geburtstag, hatten seine Eltern Monsieur Masson beauftragt, nach ihm zu schauen, während sie auf eine Party gingen. Sobald sie das Haus verlassen hatten, war Monsieur Massons Geliebte aufgetaucht, und die beiden hatten Nathan sich selbst überlassen, während sie das riesige Bett seiner Eltern ausprobierten.
Als seine Eltern irgendwann nach Hause zurückgekommen waren, hatte Nathan es geschafft, sich mit dem Schaum und dem Rasierer seines Vaters die Augenbrauen abzurasieren. Leider hatte er sich dabei an diversen Stellen in die Haut geschnitten, sodass sein Gesicht einer blutigen Maske geglichen hatte. Laut dem späteren Bericht seiner Eltern hatte er ausgesehen wie ein dämonisches Kind aus einem billigen Horrorstreifen. Danach hatte er versucht, sich Essen zu kochen. Er hatte Eier in eine Edelstahlschüssel geschlagen, eine anständige Portion Tomatensoße und geriebenen Käse hinzugefügt und das Ganze dann ohne Abdeckung in die Mikrowelle gestellt. Es hatte Wochen gedauert, die Spuren der daraus resultierenden kunterbunten Explosion aus der Küche zu entfernen. Monsieur Masson war nie wieder als Aufpasser engagiert worden.
Ein paar Tage nach Nathans fünfzehntem Geburtstag war sein Vater mit gerade einmal sechsundfünfzig Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Vielleicht hatte es an dem hedonistischen Lebensstil gelegen, dem seine Eltern gefrönt hatten. Oder es waren einfach schlechte Gene gewesen. Auf jeden Fall hatte der Verlust seines Vaters die Ausschweifungen seiner Mutter zumindest für eine Weile zügeln können. Nathan war auf die örtliche Gesamtschule in Südlondon gekommen, weil es, laut seiner Mutter, keinen Sinn hatte, länger als unbedingt nötig Geld für eine Privatschule zu verschleudern.
Trotz der plötzlichen Veränderung hatte er die örtliche Schule als viel angenehmer empfunden. Und auch wenn seine Mutter nie wirklich vernarrt in ihn gewesen war, so hatte sie doch eine Zeit lang Interesse an ihm gezeigt.
Lauras Kindheit war das komplette Gegenteil von seiner gewesen. Sie stammte aus bescheidenen Verhältnissen und war in einem beengten Apartment in Fife aufgewachsen. Eine Beziehung zu jemandem mit seinem Hintergrund hatte für sie vermutlich einen besonderen Reiz gehabt – auch wenn es nicht gesund gewesen war. Nathan gab zu, dass er zu Beginn ein bisschen zu sehr damit »geprotzt« hatte, aus welchen Verhältnissen er stammte. Aber da Laura so außergewöhnlich hinreißend gewesen war, hatte er das Gefühl gehabt, jeden Vorteil ausspielen zu müssen.
Inzwischen arbeitete seine Frau für eine Risikokapitalgesellschaft. Sie hatte als Verwaltungsassistentin begonnen, doch nachdem sie Dutzende von zusätzlichen Prüfungen absolviert hatte, um »sich selbst und ihre Chancen zu verbessern« (ihre Worte), war sie bis in die Betriebsleitung aufgestiegen – eine bemerkenswerte Leistung, wenn man bedachte, dass sie währenddessen noch drei Kinder auf die Welt gebracht hatte. Sie war damit noch immer nicht zufrieden und erklärte ständig, wie viel mehr Geld sie verdienen könnte, wenn sie nach London zurückkehren würde. Nathan war in der Hauptstadt aufgewachsen und verspürte keinen Drang, dorthin zurückzugehen. Das war also noch ein Streitpunkt zwischen ihnen.
Der Briefträger, der lautstark etwas durch den Briefschlitz zwängte, riss ihn aus seinen Grübeleien. Nathan tapste den Flur entlang, um die Post zu holen.
Es waren vier Sendungen. Bei dem ersten Brief handelte es sich um ein Schreiben von der Bank – das legte er zur Seite, um es später zu lesen, weil es wohl kaum angenehm werden würde. Nummer zwei war ein Katalog für Kinderbücher, auf dem Lauras Name stand. Er legte den Katalog auf den Brief von der Bank. Die letzten beiden Umschläge weckten sein Interesse. Sie hatten Fenster. Obwohl beide an Laura adressiert waren, konnte er durch das Adressfenster einige Details erkennen. Er las seinen Namen und seine Versicherungsnummer. Auf der Rückseite standen der Name und die Adresse des Absenders: The Corporate Mutual Insurance Company.
Nathan machte den Brief auf und las ihn.
Mr. Nathan Jones –
Versicherungsnummer CM2345GY98
Sehr geehrte Mrs. Jones!
Mit Bedauern haben wir vom Tod Ihres Ehemannes gehört. Wie bei unserem Telefonat am 23. November besprochen, finden Sie anbei die gewünschten Informationen. Wir entschuldigen uns für die Verzögerung. Wegen eines Problems mit unserer Software haben wir erst jetzt bemerkt, dass Ihre Anfrage noch nicht beantwortet wurde. Wir bitten um Entschuldigung für jegliche Unannehmlichkeiten, die dieses Versäumnis Ihnen möglicherweise bereitet hat.
Beiliegend finden Sie das entsprechende Antragsformular, mit dem Sie es uns ermöglichen, Ihre Ansprüche aus dieser Versicherungspolice zu prüfen.
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir, um die Erträge unter der Versicherungsnummer CM2345GY98 auszahlen zu können, das Original der Sterbeurkunde benötigen. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, das ausgefüllte Formular zusammen mit dem Totenschein per Einschreiben zurückzusenden, damit es keine unnötigen Verzögerungen durch verloren gegangene Unterlagen gibt.
Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei Ihnen. Wenn Sie direkt mit uns sprechen möchten, rufen Sie uns unter der Kundenhotline 0804 345 6788 an. Die Hotline ist montags bis freitags von 8:30 Uhr bis 17:30 Uhr besetzt.
Mit freundlichen Grüßen
Mr. K. Stanton
Leiter Schadensabteilung
Anlagen:
Antragsformular
Nathan setzte sich auf die Couch. Er war fassungslos. An dem Morgen, als er zufällig von dem Mädchen aus der Pathologie gefunden worden war, hatte seine Frau mit der Versicherungsgesellschaft telefoniert, um Geld einzutreiben. Kein Wunder, dass sie so »geschockt« gewesen war, als sie erfahren hatte, dass er noch lebte. Er wusste, dass seine Frau manchmal etwas geldfixiert sein konnte, aber seine Leiche war noch nicht einmal kalt gewesen, als Laura bereits versucht hatte, aus seinem Tod Profit zu schlagen. Er hatte zwei Lebensversicherungen: die Police, um die es in dem Brief ging, und eine gemeinsame Versicherung mit Laura, die die Hypothek abdeckte. Jede Wette, dass Laura wegen der zweiten Police auch schon mit der Versicherungsgesellschaft telefoniert hatte. Was für eine kaltherzige Bitch.
Den zweiten Umschlag würde er ebenfalls öffnen, beschloss er. Er rechnete damit, dass das Schreiben von der zweiten Versicherung war. Doch dieser Brief war noch bizarrer: Er enthielt seine Sterbeurkunde. Während er auf der Couch saß und das Dokument betrachtete, fröstelte es ihn. Als wäre gerade jemand über sein Grab gelaufen. Dann tröstete er sich mit dem Gedanken, dass nicht viele Menschen die Gelegenheit bekamen, ihre eigene Sterbeurkunde zu lesen.
Er entschied sich dafür, zu warten, bis die Mädchen am Abend eingeschlafen waren, ehe er seine Frau mit seinen Erkenntnissen des Nachmittags konfrontierte. Sie hatte sich ein großes Glas Shiraz eingeschenkt und sich auf die Couch fallen lassen, um fernzusehen. Nathan setzte sich ihr gegenüber in einen Sessel, beobachtete sie und fragte sich, ob sie tatsächlich so hartherzig war, wie ihr Handeln es vermuten ließ.
Es war eindeutig, dass Laura seinen Blick bemerkte. »Was ist los, Nathan? Warum starrst du mich an?«
»Ich habe heute die Post geöffnet.«
Laura nippte an ihrem Wein und lächelte. »Das ist schön. Das Highlight deines Tages, nehme ich an?«
Er nickte. »In gewisser Hinsicht, ja. Der erste Brief war von The Corporate Mutual Insurance Company.«
Er sah, wie die Farbe aus ihrem Gesicht wich. »Nathan, ich kann das erklären …«
»Dann schieß mal los.«
»Äh … Na ja, ich habe mir Sorgen gemacht, dass sie die Policen kündigen würden, bevor ich Anspruch darauf erheben kann – du weißt ja, wie diese Versicherungen sind. Sie versuchen auf jede nur erdenkliche Art und Weise, sich um die Zahlung zu drücken.« Laura lächelte. Offensichtlich war sie stolz darauf, dass ihr so schnell eine Erklärung eingefallen war.
»Warum sollten sie die Policen kündigen, Laura? Sie waren auf dem neuesten Stand, und niemand bezweifelte, dass es sich um einen Unfalltod handelte – also, warum hätte es Probleme geben sollen?«
»Tja …« Laura hielt inne und nagte an ihrer Unterlippe. »Das stimmt, aber die Beiträge wurden von deinem Konto bezahlt. Ich dachte, dass deine Konten nach deinem Tod umgehend eingefroren werden würden. Die Bank hätte nicht weiterbezahlt. Also wollte ich sichergehen, dass ich den Antrag stelle, bevor sie die Police wegen Nicht-Bezahlung der Beiträge kündigen.«
»Hattest du es deshalb auch so eilig, an meine Sterbeurkunde zu gelangen?«
Laura nickte. »Ja, sie meinten, sie bräuchten die Urkunde, um die Ansprüche aus der Police bearbeiten zu können.«
Nathan dachte einen Moment lang darüber nach. Er wollte ihr wirklich glauben, doch das Problem war, dass er seine Ehefrau in- und auswendig kannte. »Das passt nicht so richtig zu deiner Behauptung, dass du vollkommen außer dir und traurig warst, oder?«
Laura seufzte und stellte ihr Weinglas auf den Boden. »Ich weiß nicht, was du von mir hören willst, Nathan.«
Das wusste er selbst auch nicht so genau. Wollte er, dass seine Frau zugab, dass sie keine Gefühle mehr für ihn hatte? Oder wollte er, dass sie ihn um Vergebung bat und sagte, alles würde sich ändern? Falls sie das täte, würde er ihr sowieso nicht glauben. Dazu waren sie schon viel zu weit gegangen, und er wusste es. »Wir könnten eine Eheberatung machen.«
Laura starrte ihn einen Augenblick lang an, blinzelte ein paarmal und lehnte den Vorschlag schließlich ab. »Ich glaube nicht an solche Dinge.«
»Was soll das heißen, dass du nicht daran glaubst? Man kommt vielleicht damit durch, wenn man sagt, dass man nicht an Feen, an UFOs und Kobolde glaubt. Aber eine Eheberatung ist reell, erprobt und hilft vielen Paaren.«
»Ich glaube, unsere Ehe ist zu zerrüttet, um noch gerettet zu werden, Nathan. Und das schon seit Langem.«
»Was du eigentlich sagen möchtest, ist, dass du nicht daran arbeiten willst.«
Laura nahm ihr Glas in die Hand, trank einen großen Schluck Wein und schüttelte den Kopf. »Ich habe einfach keine Lust, Nathan, und das ist – denke ich – noch schlimmer. Es erscheint mir zu anstrengend. Ich war nicht froh, als du gestorben bist, aber ehrlich gesagt war ich irgendwie erleichtert. Ich weiß, dass es kaltherzig und gefühllos klingt, doch das ist die Wahrheit. Für mich hat das bedeutet, dass ich mich nicht mehr mit dir, nicht mehr mit uns auseinandersetzen musste. Ich wollte dir das eigentlich nicht jetzt sagen, sondern noch ein bisschen warten, bis du wieder ganz gesund bist. Aber … tja, da hast du’s … Du hast mich dazu gezwungen.«
»War ja nicht so schwer.«
»Nein, das stimmt. Und genau darin liegt das Problem, oder? Ich muss weg von hier und nach vorn blicken. Ich brauche mehr vom Leben als dich.«
»Was ist mit den Mädchen?«
»Zuerst wird es schwer, doch sie werden sich schon daran gewöhnen. Am Ende ist es besser für sie, nicht mehr mit unseren Streitereien leben zu müssen und … wie soll ich es nennen … mit unserer Apathie?«
»Gleichgültigkeit.«
»Ja. Siehst du? Du hast es verstanden, oder? Tief in deinem Inneren weißt du, dass ich recht habe. Das wird es dir erlauben, auch nach vorn zu blicken und vielleicht irgendwann jemand anderes kennenzulernen.«
»Ich will niemand anderes kennenlernen. Ich will die Laura, die ich geheiratet habe.«
Traurig lächelte Laura ihn an. »Diese Laura gibt es nicht mehr. Sie ist schon lange tot. Du hast sie nach und nach umgebracht, ihr die Luft zum Atmen geraubt, ihr das Leben genommen.«
»Das klingt ja furchtbar.«
»Es ist die Wahrheit«, entgegnete Laura schulterzuckend.
»Es ist deine Wahrheit.«
Laura sah ihren Mann eine Weile an und versuchte, sich ins Gedächtnis zu rufen, wie es gewesen war, ihn zu lieben. Sie hatte sich im Laufe der Jahre verändert, während er immer der Gleiche geblieben war und nichts mitbekommen hatte. Vielleicht war es ungerecht von ihr gewesen, aufgrund seines Hintergrunds mehr zu erwarten – ebenjenes familiären Hintergrunds, den sie anfangs so überaus anziehend gefunden hatte. Laura wusste, dass sie den Drang hatte, gesellschaftlich aufzusteigen – und das in einer Zeit, in der es unmodern geworden war, so etwas zuzugeben. Ihrer Meinung nach zählte Qualität. Und bei allem, was sie über ihren Mann dachte, Qualität besaß er. Falls es so etwas überhaupt gab. Es half auch, dass er gut aussehend war, obwohl es ihm nicht bewusst zu sein schien. Im Laufe der Jahre war das zugleich Segen und Fluch gewesen. Er zog Menschen mit seiner lockeren Art und der entspannten Persönlichkeit mühelos in seinen Bann. Und genau dieser Wesenszug verärgerte sie am meisten – Nathan machte sich über gewisse Dinge einfach keine Gedanken, keine Sorgen. Termine waren für ihn eher lockere Verabredungen, Deadlines, etwas, auf das man lässig hinarbeitete. Die Zukunft … Welche Zukunft?
Sie hätte jeden haben können. Damals war ihr das nicht so bewusst gewesen, aber es stimmte. Sie war intelligent, wunderschön und extrovertiert gewesen. Nathan seinerseits war so loyal, so hingebungsvoll wie ein kleiner Welpe gewesen – und fast genauso niedlich.
Im Laufe der Zeit hatten sich die Loyalität und die Hingabe allerdings abgenutzt. Nach Nathans überraschendem Tod hatte sie eigentlich vorgehabt, in Edinburgh alles zu verkaufen und nach London zurückzukehren. Da das Leben dort nicht gerade günstig war, hätte das Geld aus den Lebensversicherungen eine willkommene Hilfe dargestellt. Doch auf jeden Fall wäre sie zurechtgekommen.
Sie seufzte. »Es spielt keine Rolle, wessen Wahrheit es ist, Nathan. Ich werde es für alle leichter machen und ausziehen. Ich habe mich um eine Versetzung nach London bemüht, und sobald diese Versetzung genehmigt ist, werde ich verschwinden. Du kannst mit den Mädchen hier wohnen bleiben. So verpassen sie auch nicht die Schule und dergleichen. Ich werde sie an den Wochenenden und an den Feiertagen sehen.«
Nathan war vollkommen geschockt. Er hatte nicht geahnt, welchen Verlauf dieses Gespräch nehmen würde. Zwar hatte er nicht mit einem Happy End gerechnet, aber Lauras Rückkehr nach London hatte er auch nicht vorausgesehen. »Wenn du rauswillst, ist London vielleicht ein bisschen zu drastisch. Könntest du nicht eine Weile bei deinen Eltern wohnen und mal schauen, wie sich alles entwickelt?«
»Ich weiß, dass es bei dir nicht möglich ist, aber angenommen, es wäre anders: Würdest du zu deinen Eltern zurückgehen und bei ihnen wohnen?«
Nathan schüttelte den Kopf. »Das war schon beim ersten Mal kein echtes Zusammenleben, sondern ein Schlag ins Wasser, also, nein. Aber warum London? Du warst doch diejenige, die vor Jahren unbedingt dort wegwollte.«
Laura nickte und biss sich auf die Unterlippe. »Ja, das war damals. Und jetzt ist jetzt. Die Welt hat sich verändert. Ich habe mich verändert. Auf diese Weise wird das Leben für alle angenehmer.«
»Angenehmer für dich, meinst du. Weil du dich in London voll ausleben kannst.«
Laura schüttelte den Kopf. »Das werde ich nicht machen, Nathan. Ich werde hart arbeiten, um eine bessere Zukunft für mich und die Mädchen zu schaffen. Und weißt du was? Zum ersten Mal seit meinem neunzehnten Geburtstag werde ich es allein durchziehen.«
Sie wartete auf eine Erwiderung. Aber Nathan schwieg. »Ich werde Anfang Januar hier weg sein«, verkündete sie. »In den nächsten paar Wochen und vor allem über Weihnachten müssen wir um der Mädchen willen versuchen, so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Das sollte uns eigentlich nicht schwerfallen – schließlich machen wir das schon seit Jahren.« Sie warf ihr Haar zurück, trank ihr Glas aus und stampfte aus dem Zimmer.
Nathan schaltete den Fernseher aus und lehnte sich in seinem Sessel zurück. Er dachte nach. Trotz aller Schwierigkeiten und Probleme konnte er sich ein Leben ohne Laura nicht vorstellen. Er hatte immer geglaubt, dass sich die Dinge irgendwie doch noch zum Guten wenden würden. Ihre kalte Entschlossenheit verunsicherte ihn.
Nach einer Weile ging er ins Bett und schlüpfte neben seiner schlafenden Frau unter die Decke – zumindest nahm er an, dass Laura schlief, da sie sich nicht rührte, als er sich unter die Decke kuschelte. Er hatte über zehn Jahre lang so geschlafen und konnte sich nichts anderes vorstellen. Aber schon bald wäre sein Bett kalt und leer. Würde er damit zurechtkommen?
Kapitel 5
Weihnachten und Neujahr vergingen, während über der Wohnung eine schwarze Wolke zu hängen schien. Egal, wie sehr er sich bemühte, Nathan konnte die Schwermut und Traurigkeit nicht abschütteln. Selbst der Weihnachtsmorgen, der wie immer in einem Geschenkerausch endete, fühlte sich dieses Mal leer und hohl an. Einige Zeit später kehrten die Mädchen in die Schule und die Kindertagesstätte zurück, und der Moment, vor dem Nathan sich so gefürchtet hatte, stand unmittelbar bevor.
Es war das letzte Wochenende, das er zusammen mit seiner Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung verbringen würde. Er hatte sich eigentlich etwas überlegen wollen, um sie zum Bleiben zu überreden, doch bisher war ihm nichts eingefallen. In den vergangenen Wochen hatte er sie ein paarmal angefleht, es sich doch noch mal zu überlegen, aber sie hatte keinerlei Interesse gezeigt. Er hatte mit dem Gedanken gespielt, sie mit den Mädchen emotional zu erpressen, doch seine Kinder derart schamlos zu benutzen gefiel ihm nicht. Im Übrigen hätte Laura wohl kaum die Entscheidung getroffen, zu gehen, wenn ihr die Mädchen so sehr am Herzen gelegen hätten.