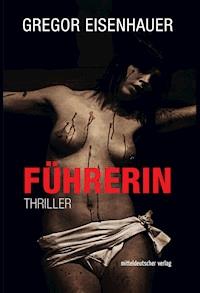8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Gregor Eisenhauer hat Angst. Überall und vor allem Möglichen. Sie überfällt ihn im Schwimmbad, im Keller, seltener im Zoo. Am allerstärksten fürchtet er sich jedoch davor, mit fremden Menschen zu reden. Dabei wäre es sicherlich einfacher, wenn er jemanden hätte, der ihm zur Seite stünde. All die Helden der Fernsehserien und Comics, die er als Kind liebte, hatten so jemanden: einen tapferen Collie oder einen Tiger, der mit ihnen durch dick und dünn ging. Denn wer wäre schon Calvin ohne Hobbes? Als Gregor Eisenhauer sich eines Tages eingesteht, dass er wie so viele an einer generalisierten Angststörung leidet, sucht er sich Hilfe. Dank einer unermüdlichen Therapeutin meistert er eine einwöchige Konfrontationstherapie. Begleitet wird er dabei von einem längst verstorbenen Leidensgenossen und heimlichem Vertrauten: Franz Kafka. Sprühend vor Witz und Intelligenz berichtet Gregor Eisenhauer davon, wie er seiner Angst ins Gesicht blickt und sie so Schritt für Schritt zu verlieren beginnt. Er nimmt den Leser an die Hand und führt ihn durch eine Woche, in der er die Furchtlosigkeit entdeckt. Immer mit dabei sind seine Therapeutin, der große Ängstliche der Weltliteratur – und der Mut zur Besserung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
»Wieso ich glaube, dass so etwas gelingen kann, Heilung durch Fantasie? Kafka hat es vorgeführt.« Gregor Eisenhauer
Es gibt keinen Bereich des Lebens, in dem Gregor Eisenhauer vor der Angst sicher wäre. Sie überfällt ihn im Schwimmbad, im Keller, vor dem Spiegel. Als er sich eines Tages eingesteht, dass er wie so viele an einer generalisierten Angststörung leidet, sucht er sich Hilfe.
Eisenhauer nimmt den Leser an die Hand und führt ihn durch eine Woche, in der er die Furchtlosigkeit entdeckt und sogar seine größte Angst überwindet. Dank seiner Therapeutin Frau Bürstner meistert er eine Konfrontationstherapie. Begleitet wird er dabei von einem längst verstorbenen Leidensgenossen und heimlichen Vertrauten: Franz Kafka. Denn wer könnte sich besser mit der Angst auskennen als er?
© Susanne Schleyer/autorenarchiv.de
Gregor Eisenhauer, geboren 1960, hat Germanistik und Philosophie studiert und über Arno Schmidt promoviert. Er lebt als freier Autor in Berlin und schreibt u.a. Nachrufe für den Tagesspiegel. Bei DuMont sind von ihm die Bücher ›Die 10 wichtigsten Fragen des Lebens – in aller Kürze beantwortet‹ (2014) und ›Wie wir alt werden, ohne zu altern. 7 Ideen gegen die Verholzung des Denkens‹ (2016) erschienen.
Gregor Eisenhauer
Wie wir die Angst vor der Angst verlieren
Furchtlos in 7 Tagen
eBook 2019 © 2019 DuMont Buchverlag, Köln Alle Rechte vorbehalten Lektorat: Jochen Veit Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln Umschlagillustration: © Lenan/Adobe Stock und © Sam/Fotolia.com Satz: Fagott, Ffm eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-8321-8482-7
www.dumont-buchverlag.de
Inhalt
Sicherheitshinweis:»Leben ist immer lebensgefährlich«
Montag:Der erste Schritt führt nie in die falsche Richtung
Dienstag:Auf dem Weg nach Indien entdecken Sie Amerika
Mittwoch:Der kluge Esel steht stets zwischen zwei Heuhaufen
Donnerstag:Je ferner die Ziele – desto kürzer die Umwege
Freitag:Was Sie gewinnen, wenn Sie verlieren, ist mehr, als was Sie verlieren, wenn Sie gewinnen
Samstag:Die Angst vor der Liebe stärkt die Treue zu sich selbst
Sonntag:Wie die Geschichte endet, bestimmen immer noch Sie
Dank
Sicherheitshinweis:
»LEBEN IST IMMER LEBENSGEFÄHRLICH«
… Befürchtungen, darüber, ob mein Augenlicht für mein ganzes Leben genügen wird.
Franz Kafka
Ich habe Angst. Seit ich denken kann. Angst vor der Dunkelheit, vor dem Erwachsenwerden, vor dem Altwerden, vor dem Dickwerden, vor dem Tod. Angst vor der Liebe, vor dem Hass, vor dem Neid, vor den Grillpartys meiner Nachbarn, vor dem Besuch alter Schulfreunde, vor der Zukunft, vor der Vergangenheit, vor den engen Kurven im Parkhaus. Es gibt nichts, wovor ich keine Angst haben könnte. Oft wache ich morgens auf und denke mir, bleib liegen, der Tag kann nichts Gutes bringen. Und wenn ich abends einschlafe, habe ich Angst vor meinen Träumen. Und dem Morgen. Denn irgendwas ist immer.
Was mich ganz und gar nicht beruhigt: Ich bin nicht allein mit meiner Angst. Alle haben Angst. Alle sind in der Krise, kriegen gerade die Krise, haben die Krise, erwarten die Krise, beschwören, beschönigen, besingen die Krise, bei sich oder bei anderen. Krise als Dauerzustand. Weltgeschichte als Chronik der Krise. Seit Adam und Eva das Paradies verließen, die Sintflut die erste Umweltkatastrophe auslöste, die Nudeln nicht länger von Hand gezogen werden: Krise. Überall. Globale Krisen, lokale Krisen, Krise im Kinderzimmer, im Schlafzimmer, im Klassenzimmer. Krise zwischen Mann und Frau, Tier und Mensch, Hund und Katze, Gott und der Welt. Unser Universum zur Gänze ist eine Ausgeburt der Krise, denn wer wollte den Urknall anders denn als Krisenmoment einer bis dahin unendlich friedlichen kosmischen Stille verstehen. Alles ist Krise – und insofern halb so schlimm. Krise ist nicht gleich Katastrophe, aber schlimm genug. Krisen kann man nicht weglachen, nicht ignorieren oder schönreden. Auch wenn Ratgeber gern so tun, als könnten sie bei der Bewältigung von Krisen helfen: Die nächste unvorhersehbare Schicksalswendung wartet schon. Wie sollte es auch anders sein? Alles andere wäre Stillstand.
Die ganze menschliche Existenz ist Existieren in der Krise. Seit die abenteuerlustigsten Affen die Bäume verließen, ist der Mensch in der Krise, denn der aufrechte Gang, den unsere Vorfahren einübten, ist nichts anderes als ein permanent krisenhaftes Geschehen. Wir müssen einen Fuß vor den anderen setzen, wieder und wieder, was kein leichtes Unterfangen ist. Kinder und Greise wissen: Gehen ist verhindertes Fallen.
Dieses Buch handelt nicht von den großen Krisen: Finanzkrise, Klimakrise, Hungerkrise, Glaubenskrise, Eurokrise, es handelt von den Krisen des Alltags. Es handelt von der Krise Alltag. Es handelt von Angst. Es handelt von Einsamkeit. Davon, dass es an manchen Tagen sehr schwerfällt, aufzustehen, anderen Menschen zu begegnen, die eigenen Probleme wahrzunehmen, sie anderen mitzuteilen. Es handelt davon, dass es unser gutes Recht wäre, uns, angesichts all der Widrigkeiten der Welt, einfach auf den Rücken fallen zu lassen, mit Armen und Beinen zu strampeln und lauthals »Wahnsinn« zu brüllen. Denn die Welt ist irrsinnig. Und sie wird von Tag zu Tag irrsinniger. Dieses Gefühl haben viele. Dagegen helfen keine Pillen. Dagegen hilft auch nicht die Schuldumkehr, von wegen nicht die Welt ist irrsinnig, sondern ich bin es. Falsch. Sie sind nicht irrsinnig. Unser Alltag ist es. Folglich ist unsere Angst berechtigt.
Welchen Experten wir auch befragen, welche Wahrsager wir auch konsultieren würden, niemand vermag im Augenblick zu sagen, wohin unsere Welt steuert. Die ultimative Katastrophe ist ebenso denkbar wie die Wende zum Besseren. Die Mittel haben wir. Die Vernunft auch. Nur am Zusammenspiel hapert es. Ob Androiden uns in Menschenparks kasernieren werden oder wir selbst zu Maschinenmenschen mutieren, ob die künstliche Intelligenz der natürlichen auf die Sprünge helfen wird oder Googles Algorithmus die Matrix der schönen neuen Welt kodifiziert: Wir wissen es nicht. Keiner weiß es. Nur eins ist sicher, eine Krise wird auf die nächste folgen. Also genießen wir es. Klingt absurd. Aber nichts anderes tun Sie, wenn Sie ins Kino gehen oder ins Theater, wenn Sie einen Thriller zur Hand nehmen oder die Boulevardnachrichten hören: Krisen genießen. Denn, Hand aufs Herz: Nichts hören wir lieber als schlechte Nachrichten – solange sie uns nicht betreffen. Die Erleichterung darüber ist meist viel größer als die Freude an guten Botschaften. Die Torte im Gesicht des Feindes macht uns mehr Freude als jene auf dem eigenen Kaffeetisch. Schadenfreude ist, redensartlich beglaubigt, die schönste Freude und die hässliche Kehrseite des Mitleids, aber – beide Gefühle entspringen dem gleichen Impuls: Wir spiegeln uns in den Krisen der anderen.
Warum? Weil wir hoffen, so unser eigenes Leben besser in den Griff zu kriegen. Wir nehmen uns an anderen ein Beispiel. Wir suchen Hilfe. Kein Mensch kann sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Auch Münchhausen nicht. Aber er kann eine gute Geschichte erzählen, in der er so tut, als ob. Eine Geschichte, die uns zum Lachen bringt. Denn wir begreifen sehr wohl, dass er lügt. Aber wir ahnen auch, warum er lügt. Weil wir genau wie er nichts inständiger hoffen, als dass wir unsere Probleme allein meistern können. Obwohl wir ganz genau wissen, dass es ohne Beistand nicht geht. Wir sind auf andere angewiesen. Vom ersten Tag unseres Lebens an. Autonomie ist eine Illusion.
»Niemand ist eine Insel, in sich ganz.« Wer das dennoch glaubt, teilt irgendwann das Schicksal Robinson Crusoes, besser gesagt das von Chuck Noland in Cast Away. Erinnern Sie sich? Chuck landet nach einem Flugzeugabsturz auf einer einsamen Insel. Unter dem Treibgut, das angeschwemmt wird, findet er einen Volleyball. Mit seinem eigenen Blut malt Chuck auf ihn ein menschliches Gesicht und tauft seinen neuen Freund auf den Namen Wilson, wie Wilson Sporting Goods. Wilson rettet ihn vor dem Wahnsinn. Denn er ist immer da. Und er ist ein geduldiger Zuhörer. Die einfache Moral dieser Geschichte: Ein Leben ohne Freunde ist sinnlos. Krisen bewältigen wir nur gemeinsam. Angst ist teilbar. Einsamkeit auch.
Dabei ist es unerheblich, ob ihr Freund »Harvey« heißt und ein über zwei Meter großer Hase ist oder »Pu der Bär« gerufen wird und in den Augen der Altklugen einem Kinderbuch entsprungen ist oder einfach so an einem Bahnsteig herumgestanden hat wie sein großer Bruder Paddington. »Ein Tag ohne einen Freund ist wie ein Topf, ohne einen einzigen Tropfen Honig darin« – Pu der Bär weiß, wir müssen uns Freunde suchen, wo immer wir sie finden. Ansonsten werden aus Krisen tatsächlich Katastrophen, und die Angst frisst uns auf.
Viele Menschen, erstaunlich viele, glauben, sie kommen ohne Freunde aus. Ihnen genügen Kollegen, Nachbarn, Bekannte oder Familienangehörige. Das kann gut gehen. Wird es in den meisten Fällen aber nicht. Denn Existenzkrisen zeichnen sich meist dadurch aus, dass gerade niemand zur Stelle ist. Kein Kollege, kein Nachbar, kein Bruder, keine Schwester, keiner der unzähligen Bekannten. Niemand ist zur Stelle. Ich bin allein. Diese Erfahrung gehört zu den bittersten, die man machen kann, denn sie lässt einen ratlos mit der Frage zurück: Was habe ich falsch gemacht? Warum sind nicht mehr Menschen um mich, die ich Freunde nennen kann? Warum ist keine Frau bei mir, kein Mann, der mich liebt? Wo verdammt sind sie alle geblieben, die Menschen, die ich gernhatte, die mich gernhaben? Gab es sie je?
Ich habe Angst. Angst vor dem Alleinsein. Wer noch nie einen Freund oder eine Freundin verloren hat, wem noch nie ein Mensch abhandenkam, der braucht jetzt nicht weiterzulesen. Der hat alles richtig gemacht und kann sich darauf verlassen, jede Krise ohne Katastrophe zu überstehen. So ein Mensch bin ich nicht. Solche Menschen kenne ich nicht. Mir begegnen viele einsame Menschen. Mir begegnen viele Menschen, die mit dem überfordert sind, was von ihnen erwartet wird. Die vergeblich nach Beistand suchen. Deswegen geht es in diesem Buch um Menschen, die Angst haben.
Ich habe Angst. Ich habe Angst vor Schlangen, vor der Dunkelheit, vor hohen Türmen, vor tiefen Schluchten, vor einsamen Nächten und leeren Tagen. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich habe viele Ängste. Vor allem habe ich Angst vor meinen Mitmenschen. Abwegig? Wir müssen Angst vor unseren eigenen Artgenossen haben. Und das nicht nur auf der Autobahn. Wir begegnen einander mit Misstrauen, weil wir wissen: Arglosigkeit wird nicht selten bestraft. Wir vertrauen Menschen – und wir werden enttäuscht. Dabei wissen wir oft gar nicht, was wir falsch gemacht haben. Waren wir zu offen, zu erwartungsvoll, zu hilfsbedürftig? Zu redselig oder zu schweigsam? Oder bin ich einfach nicht liebenswert?
Die Angst vor dem Alleinsein kann ich nur verlieren, wenn ich den Mut finde, mich aufzudrängen. Dieses Buch erzählt die Geschichte einer Freundschaft, besser, die Geschichte der Suche danach. Erinnern Sie sich an Ihre Schulzeit? Wie überlebenswichtig damals die Frage war, neben wem man in der Klasse zu sitzen kam? Freunde fürs Leben zu finden, gehört zu den schwierigsten Aufgaben, die uns vom Schicksal gestellt werden.
Nicht, dass wir uns missverstehen: Ich rede hier nicht von Liebe. Liebe ist meist Auslöser der Krise, selten die Lösung. Wer liebt, leidet ohnehin. Das kann wunderschön sein oder fürchterlich bedrückend, nur eins wird es nicht sein: beruhigend. Liebe, sofern sie die absolute, leidenschaftliche, verzehrende große Liebe ist, also genau das, was wir alle ersehnen, ist genau das Gegenteil von Ruhe und Freundschaft. Liebe ist niemals angstfrei, weil gänzlich ohne Garantie auf Dauer.
Das Wesen der Freundschaft hingegen ist Verlässlichkeit. Deshalb sind wir von Kindesbeinen an auf Freunde angewiesen. In Liebesfragen können wir nie sicher sein, die Liebe ist launisch. Freundschaften hingegen halten ewig. So will es der Kinderglaube. Denn für die kindliche Seele ist Stabilität noch viel wichtiger als für uns Erwachsene. Kinder brauchen, darin sind sich Eltern und Pädagogen einig, »Übergangsobjekte«, landläufig »Kuscheltiere« genannt. Aber es muss nicht immer etwas zum Anfassen sein. Fürs »innere Team« genügt letztlich auch ein imaginärer Komplize: Pan Tau, der rosarote Panther oder Hobbes, der sprechende Stofftiger, ohne den Calvin nur ein einsamer kleiner Junge wäre. Notfalls hilft es schon, einfach eine Schmusedecke hinter sich herzuziehen wie Linus van Pelt von den Peanuts.
Jedes dritte Kind, so schätzen Experten, hat eine Freundschaft, die nur in der Fantasie existiert. Bei Erwachsenen wird die Zahl kaum niedriger sein. Oder glauben Sie wirklich, dass Ihre Freunde tatsächlich auch in der Not Ihre Freunde bleiben? Nebenbei: Halten Sie sich selbst für einen guten Freund? Können Sie zuhören? Sind Sie loyal in Ihren Empfindungen? Menschen sind unzuverlässig, deswegen bin ich sicher, dass auch Sie schon von einem Freund oder einer Freundin enttäuscht wurden. Insofern ist es einfacher, sich einen Gefährten oder eine Gefährtin zu suchen, die absolut verlässlich an ihrer Seite bleibt, aus dem einfachen Grund, weil sie für andere nicht existiert. Zumindest nicht auf diese sehr persönliche Weise, in der Elizabeth Bennet plötzlich Amandas beste Freundin wird. Amanda wer? Keine Sorge, Sie müssen Amanda nicht kennen. Jane Austen kannte sie auch nicht. Selbst Amanda kannte Amanda nicht, weil sie es viele Jahre nicht wagte, in den Spiegel zu sehen. Amanda Price lebt im London unserer Tage das triste Leben einer kleinen Angestellten und träumt von Mr.Perfect, genauer gesagt von Mr.Darcy, der so ganz anders ist als ihr allzu lässiger Freund, der ihr einen Bierdosenverschluss als Verlobungsring andrehen will. Leider existiert Mr.Darcy nur in dem Roman Stolz und Vorurteil, zu dem sich in ihrem Badezimmer unversehens ein Türchen öffnet, das geradewegs nach Longbourn, dem Landsitz der Bennets führt. Nein, keine Comedy, ich rede von der Mini-Serie Lost in Austen, die vorführt, wie sich eine moderne Frau aus der Trostlosigkeit des Alltags retten kann, indem sie sich eine verlässliche Freundin sucht, die mehr von der Welt sehen will als sämtliche Folgen von Girlfriends.
Mit Jane Austen werden sich nicht alle anfreunden können. Für viele Männer ist sie zu klug, für etliche Frauen zu altmodisch. Seltsamerweise gibt es nur wenige Menschen, die Frauen und Männer gleichermaßen faszinieren. Den Dalai Lama, Buddha, Mohammed, Christus, aber das sind Wesen einer anderen Sphäre, die im Alltag nicht wirklich weiterhelfen, weil sie sich noch nie über ihren Rentenbescheid entsetzt haben. Unter den großen, weltberühmten Autoren kenne ich nur wenige, die wirklich als Freund oder Freundin taugen. Goethe ist zu alt, Joyce zu akademisch, Emily Dickinson zu versponnen, Ruth Klüger zu traurig. Gehen Sie die Reihe selbst einmal durch, streifen Sie durch die Bibliothek des 19., des 20., des 21.Jahrhunderts, und sie werden nur einen Autor finden, der als Mensch Männer und Frauen gleichermaßen fasziniert hat, ohne sie durch Besserwisserei vor den Kopf zu stoßen: Franz Kafka. Ein schwieriger Schriftsteller, ja, aber ein höflicher. Und ein absoluter Fachmann in allen Fragen der Angst und Angstbewältigung.
»Niemand ist hier, der Verständnis für mich im Ganzen hat«, notierte Kafka in sein Tagebuch, und damit meinte er nicht nur seine Heimatstadt Prag, sondern die ganze Welt. Ihm ging es wie Ihnen, wie mir, wie uns allen: Keiner hat ihn verstanden. Er war allein. Sicher, da war sein Freund Max Brod, der ihn bewunderte, liebte, durchaus auch ein wenig bevormundete, wenn er in seiner Biografie von den üblichen »Angst-Geistern« seines Freundes sprach, als wären sie »nichts Besonderes«. Da waren viele Frauen, die ihn liebten und die er wiederliebte, mit ganz unterschiedlicher Intensität, aber immer im festen Glauben, dass ihn keine jemals glücklich machen würde. Er war nicht sonderlich berühmt zu Lebzeiten, nicht reich und nicht gesund. Als es ans Sterben ging, war er kaum mehr als »ein mannshohes Skelett von 118Pfund«. Es gibt keinen Anlass, auf Franz Kafka neidisch zu sein oder gar Angst vor ihm zu haben. Er war ärmer dran im Leben, als Sie oder ich es vermutlich je sein werden, dennoch war er nicht mutlos. Er war ängstlicher als alle anderen, dennoch hat ihn die Angst nicht gedemütigt.
Daher mein Vorschlag: Lassen Sie uns das innere Team mit Franz Kafka formieren. Abwegig! Wieso? Dem Namen nach kennen ihn alle, und nicht wenige werden das ein oder andere Buch von ihm schon in der Hand gehabt haben. Kafka ist Schullektüre. Als ich meinen Neffen kurz vor seinem Abitur fragte, was sie gerade in der Schule lesen würden, meinte er lustlos: Kafka. Was denn von Kafka, fragte ich nach. »Die Verwandlung«, gab er mürrisch zur Antwort. Mein Neffe ist ein gut erzogener, kluger, wenn auch ein wenig fauler junger Mann. Er sieht gut aus und weiß das auch. Thomas Mann hätte ihn gern als Eisverkäufer am Lidostrand gesehen. Aber das Dienstleistungsgewerbe ist nicht so sein Fall. Ihn interessieren Maschinen, schwere Motorräder ebenso wie leistungsstarke Küchenmaschinen. Er liebt seine Oma über alles, weil sie gut kochen kann, und seinen Opa, weil er etwas von Technik versteht. Mir steht er ein wenig misstrauisch gegenüber, weil ich das Leben nur aus Büchern kenne. »Die Verwandlung! Wer sich so was ausdenkt … Kein Mensch verwandelt sich einfach so in einen Käfer.« Natürlich hat mein Neffe recht. Aber auf eine sehr belanglose Art und Weise.
Der Zufall wollte es, dass sich die beiden dann doch noch persönlich begegnet sind, Kafka und er. Mein Neffe war sich unschlüssig, welchen Beruf er wählen sollte. Da er das Meer liebt und mächtige Motoren, beschloss er, Kapitän zu werden. Das klingt nach Abenteuer, ist aber knallharter Dienst nach Vorschrift, vor allem, wenn es endlich auf große Fahrt geht. Sechs Monate an Bord eines Containerschiffs sind kein Spaß. Du bist oft allein. Die Matrosen sprechen viele Sprachen, aber es gibt wenig zu reden. Die Hierarchie erzwingt das Miteinander, aber der Zusammenhalt ist nur einer auf Zeit. Die einzige wirkliche Gemeinsamkeit ist die Angst vor Piraten. Ansonsten ist die große Fahrt nur ein Transportgeschäft und die Reederei eine fernab residierende Behörde, deren Weisungen du zu befolgen hast. In diesen Wochen war mein Neffe Gregor Samsa näher, als er es je für möglich gehalten hätte. Auch wenn er kein Buch von Kafka im Seesack hatte, kam er verwandelt zurück. Er hatte das Alleinsein durchlitten.
Franz Kafka ist uns näher als die meisten anderen Menschen der Vergangenheit und der Gegenwart. Nicht aus dem sehr offensichtlichen Grund, weil wir fast alles über ihn wissen. Das ist interessant, hilft uns aber beim Verständnis seiner Person und vor allem seiner Ängste nicht wirklich weiter. Nur, weil wir seinen Stundenplan als Schüler kennen, wissen wir nicht, wovon er in seinen Pausen geträumt hat. Woher nahm er den Mut zum Leben? Dank seiner Biografen können wir Tag für Tag mitverfolgen, wie Franz Kafka seinen Alltag meisterte, aber diese Lückenlosigkeit des Lebenslaufes erklärt nicht die seltsame Sympathie, die wir für ihn empfinden. Liegt es daran, dass er niemals auftrumpfte? Während andere zu Lebzeiten Tausende Bücher verkauften, konnte er seine Leser nach Hunderten zählen. Sein Name tauchte selten in den Feuilletons auf, er bekam keine Preise, füllte keine Säle, ging nie auf umjubelte Lesereise. In Prager Literatenkreisen war er bekannt, aber niemals hätte ein Nobelpreiskomitee seinen Namen auch nur in Erwägung gezogen. Kafka konnte vom Schreiben nicht leben. Er hat gearbeitet, in einem sehr ordentlichen Beruf, das kann man nicht von jedem Schriftsteller sagen. Sein Leben teilte sich in ein öffentliches und ein geheimes, und nur ganz selten gelang der Brückenschlag. Aber darauf legte er es auch gar nicht an. Wann immer sich ihm die Chance darbot, glücklich zu werden, bekam er es mit der Angst zu tun. Die Krise war sein Lebenselixier. Immer gab es da ein Warten, ein Hinauszögern der Entscheidung. Vor dem Beenden des Textes. Der Veröffentlichung eines Buches. Der Ankündigung der Heirat.
Kafka stieg nicht auf den Olymp, sondern ging ins Büro. Er liebte keine Operndiva, sondern das Mädchen von nebenan. Kafkas Karriereaussichten waren alles in allem bescheiden. Er hatte einen Beruf, aber er verdiente nicht allzu viel. Seine Wohnverhältnisse waren nicht prekär, aber beengt. Er wohnte mit den Eltern und der Schwester zusammen, was nicht viel Privatsphäre ließ, zumal sein Zimmer ein Durchgangszimmer war. Sein Chef war verständnisvoll, die Arbeit in der Versicherungsanstalt nicht allzu schwer, aber auch nicht sonderlich erfüllend. Seine Mobilität war äußerst eingeschränkt, in der Familie gab es kein Automobil, aber er fand auch so gewisse Mittel und Wege, sich in den kurzen Urlaubszeiten zu vergnügen. »Ich fahre viel auf dem Motorrad, ich bade viel, ich liege lange nackt im Gras am Teiche, bis Mitternacht bin ich mit einem lästig verliebten Mädchen im Park«, schrieb er im Ton meines Neffen an seinen Freund Max Brod.
Mit Frauen tat er sich ansonsten schwer, sehr schwer zuweilen; mit dem Schreiben auch. Im Alter von dreiundzwanzig Jahren erlitt er seinen ersten Blutsturz, im Jahr darauf erhielt er die Diagnose: Tuberkulose. Zu seiner Zeit eine nahezu unheilbare Krankheit. Kafka hatte also allen Grund, sehr verzweifelt zu sein. Aber er fand sich zurecht. Und was das Wunder ist: Kein Mensch in seinem Umfeld wäre je auf die Idee gekommen, ihn als unglücklich zu bezeichnen.
Das Wenige, was Kafka in seinem kurzen Leben zu Papier brachte – vergleicht man die Zahl der geschriebenen Seiten mit denen der Großautoren seiner Zeit, mit Franz Werfel, Stefan Zweig oder den Gebrüdern Mann –, das Wenige, was er schrieb, hat mehr Menschen erreicht als die Bücher seiner berühmten Zeitgenossen, denn seine Texte scheinen nicht zu altern. Kafka wurde zum Mythos. Warum? Und wie hilft uns seine »Heiligsprechung« bei der Bewältigung unserer ganz persönlichen Ängste?
Als Franz Kafka, todkrank, zu seiner letzten großen Liebe, zu Dora Diamant nach Berlin zog, gingen sie, wann immer er sich wohler fühlte, in einem nahe gelegenen Park spazieren. Eines Tages trafen sie dort auf ein Kind, das bitterlich weinte, weil es seine Puppe verloren hatte. »Aber die Puppe ist doch gar nicht verloren«, tröstete Kafka die Kleine, »sie ist doch nur auf Reisen gegangen!« Schon saß er in der Falle, denn das Mädchen wollte nun mehr über die Reisen seiner Puppe wissen. Also schrieb Kafka ihr kleine Briefe, in denen er von all den Abenteuern der Puppe berichtete, die sie von einer Heimkehr abhielten. Das Kind hat die Puppe von Kafka nicht zurückerhalten. Es hat auch keine schönere Puppe von ihm geschenkt bekommen. Es wurde auch nicht von ihm ermahnt, erwachsen mit dem Verlust umzugehen. Oder seine Tränen zu verleugnen, weil Tränen unschicklich sind. Das Mädchen bekam von Franz Kafka eine Geschichte geschenkt, die ihr erklärte, warum ein Verlust nicht immer ein Verlust ist. Leider sind diese Briefe nicht erhalten geblieben.
Wie gelingt es mir, meine Ängste auszuhalten? Welche Tricks braucht es, welche Listen kann ich mir ausdenken. Dazu muss ich nicht besonders tapfer sein oder besonders klug. Es wird immer wieder behauptet, Kafka sei genial gewesen. Seinem Schulzeugnis nach war er das keineswegs. Ebenso wenig nach Meinung seines Vaters. Auch seine Mitmenschen haben ihn nie als genialischen Künstler erlebt, sondern zuallererst als einen sehr höflichen, sehr scheuen Mitmenschen, der gerne lachte. Warum ihm Höflichkeit so wichtig war? Ich weiß es nicht. Doch ich weiß, je unfreundlicher uns das Schicksal mitspielt, desto freundlicher sollten wir zu anderen sein. Denn auf deren Liebe sind wir in der Not angewiesen.
Kafka war Beamter und folglich ein großer Freund der Regelmäßigkeit. Jeden Tag absolvierte er ein kleines Gymnastikprogramm. Diese Sturheit legte er auch beim Schreiben an den Tag. Er hakte gewissermaßen alle großen Lebenskrisen in seinen Texten ab. An diesem Vorgehen können wir uns leicht orientieren. Dazu müssen Sie Kafkas Texte nicht lesen. Ich stelle Ihnen ein Kafka-Wochenprogramm zusammen, eine Art metaphysischen Gymnastikkurs, der ihre Seele so kräftigen wird, dass sie alle Lebenskrisen heil übersteht.
Glauben Sie, was ich Ihnen da gerade versprochen habe? Nein? Gut so! Es wird in Büchern gemeinhin viel zu viel versprochen. Glücksversprechen sind einfach gemacht, aber schwer einzulösen. Lassen Sie uns stattdessen eine Wette eingehen! Die Wette, dass Sie dank Kafka und den Bee Gees in kürzester Zeit lernen, mit Ihren Ängsten klüger umzugehen: Furchtlos in nur sieben Tagen. Was können Sie groß verlieren?
Glauben Sie mir jetzt? Ja? Dann ist es gut. Denn der Glaube versetzt uns in die Lage, Dinge zu tun, die wir nie für möglich gehalten hätten. Eine Stunde still zu sitzen, zum Beispiel. Oder ruhig und bewusst zu atmen. Oder uns eine Woche ganz und gar uns selbst zu widmen. Dafür habe ich keine Zeit, werden viele einwenden. Wenn Sie dafür keine Zeit haben, wenn Sie keine Zeit haben, eine einzige Woche in Ihrem Leben für sich selbst zu erübrigen, dann haben Sie kein Leben! Dann funktionieren Sie nur. Und das vermutlich noch nicht einmal besonders gut. Schon klar, werden Sie einwenden, aber Sie haben nun einmal keine ganze Woche Zeit. Auch nicht weiter schlimm! Das Buch ist so angelegt, dass Sie jeden Tag der Woche im Einzeltraining abarbeiten können. Sie können sich keine ganze Woche am Stück freinehmen, aber doch wohl einen Montag? Oder einen Dienstag? Wahlweise Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag oder Sonntag? Aber bitte im Sommer, da sind die Tage ein wenig länger. Und bitte in der richtigen Reihenfolge. Fangen Sie mit dem Montag an.
Diesen einen Tag sollten Sie so verbringen, wie es ihm zusteht. Denn jeder Tag hat seinen eigenen Charakter, seine Vorzüge und seine Nachteile. Jeder Tag hat seinen Schutzheiligen, wahlweise seine eigene Schutzheilige, seine eigenen Versprechen und Forderungen. Und nur, wenn wir die sieben Tage in ihrem eigenen Rhythmus durchleben, nur wenn wir sie einander zuordnen, wird daraus eine Woche. Klingt befremdlich? Nicht, wenn Sie sich schlecht fühlen. Dann spüren Sie sofort, wie Ihnen die Zeit zerrinnt zu einem grauen Fluss, in dem alles unterzugehen scheint. »Es ist Sonntag. Gleichzusetzen mit: ›Ich will mir ein Loch buddeln und darin verschwinden.‹ Sonntag ist der deprimierendste Tag der Woche. Man sollte meinen, Montag wäre das, aber der Montag hat immer noch das Glück, immer eine neue Woche zu beginnen. Eine neue Woche ist immer auch ein neuer Anfang … Dienstag ist der Tag nach Montag, was bedeutet, dass man den überstanden hat. Ab Mittwoch, das weiß man, geht es bergauf, Donnerstag ist der kleine Freitag und Freitag ist der große Freitag und über Samstag brauchen wir gar nicht erst sprechen. Aber Sonntag …«
Die junge Frau, der ich diese Wochencharakteristik verdanke, litt schwer unter Liebeskummer. Jeder Tag gleicht da dem anderen. Man hangelt sich so vorwärts über den Abgrund des Lebens. Versucht wieder trittsicherer zu werden. Jedem neuen Tag einen Sinn zu geben, ihm zumindest ein Sinnversprechen abzulauschen. Über die Runden kommen. Einfach über die Runden kommen. »Ich atme ein, ich atme aus. Ich setze ein Fuß vor den andern. Bis ich alles das, was geschehen ist, kapier’«, singt Roger Cicero. Aus den traurigsten Momenten werden die schönsten Gedichte und Lieder. Den eigenen Rhythmus wiederfinden. Das gelingt besser, wenn wir jeden Tag als den einen ganz besonderen Tag wahrnehmen. Nicht als wäre er ein Festtag. Sieben Tage lang feiern ist keine seriöse Freizeitgestaltung. Es gilt, die sieben Tage der Woche in ihrem ganz eigenen Tempo zu erleben. Wir müssen einen Rhythmus fürs Leben finden, erst dann werden wir getragen.
Der Montag gleicht nicht dem Dienstag, nicht dem Mittwoch, nicht dem … ja, ja, verstanden! Dann leben Sie auch danach! Jeder Tag hat seinen eigenen Platz in der Woche. Diese Abfolge wahrzunehmen ist eine Art Atemübung, sie spüren den Atem der Zeit. Der Montag ist für viele Wochenbeginn. Tief einatmen. Dienstag, durchatmen, Mittwoch, weiteratmen, Donnerstag, Luft anhalten, Freitag, nach Luft schnappen, Samstag, aufatmen … Wenn wir das nicht tun, wenn ein Tag wie der andere wird, dann schließen wir selbst die Gefängnistür hinter uns: Strich, Strich, Strich, Strich, Querstrich, Strich. Das ist eine Tagesabfolge, die uns geradewegs in den Wahnsinn treibt. Daraus gibt es auch dann kein Entkommen, wenn wir uns einmal im Jahr in den Urlaub verabschieden.
Der Alltag ist die Herausforderung. Beispiel Montag. Der Montag ist für viele der Beleg dafür, dass die Woche erst gar nicht beginnen sollte. Der Tag, an dem man nicht aus dem Bett will. Die erste Existenzkrise. Wenn Sie die überstehen, sind Sie gut für den Dienstag gerüstet. Leicht dahergesagt! Aber wie widersteht man dem unheimlichen Sog, sich dem völligen Nichtstun zu ergeben? Gar nicht. Verwenden Sie den Montag, diesen einen Montag, einmal dazu, gar nichts zu tun. Zumindest am Vormittag. Bleiben Sie liegen. Malen Sie sich in Ruhe aus, welche Krisen Sie schon durchlebt haben in Ihrem Leben und welche Krisen noch auf Sie zukommen werden. Zählen Sie einfach mal durch. Ich persönlich komme auf sieben Krisen. Der Einfachheit halber ordne ich jede Krise einem Wochentag zu. Montag, die allgemeine Sinnkrise: Wozu das alles? Nicht leicht zu beantworten. Deswegen der Therapieplan: Spaziergang im Zoo. Aber das hat Zeit bis zum Nachmittag. Denn: Jedem Anfang wohnt ein Zögern inne. Zu Recht. Aber irgendwann wird es mir doch langweilig: Ich will etwas tun. Aber reicht die Kraft? Krise zwei. Und selbst wenn die Kraft reichen sollte: Wohin wird der Weg führen? Krise drei: Ich habe Angst vor der eigenen Courage. Denn es ist Mittwoch, und ich zweifle, ob der Weg, den ich eingeschlagen habe, der richtige ist. Krise vier: Ich mache Tabula rasa, und zwar am Donnerstag. Schon fühl ich mich besser, bis mir klar wird, was es wirklich heißt, reinen Tisch zu machen. Prompt bin ich in der Kahlschlag-Krise, die bis Freitag andauert. Dann der plötzliche Temperaturwechsel: Saturday Night Fever. Am Sonntag, dem Tag der Selbstmörder, der Schüttelfrost und die Rückkehr der Angst: Ist das wirklich mein Leben oder nur eine Abfolge von Tagen?
Montag:
DER ERSTE SCHRITT FÜHRT NIE IN DIE FALSCHE RICHTUNG.
»Unsere größten Ängste sind die Drachen, die unsere tiefsten Schätze bewahren.«
R. M. Rilke
Der Boden unter den Füßen tut sich auf. Ich stürze hinab, ins Endlose. Ein Traum, der immer wiederkehrt, der immer tiefer führt. Ein Traum von so einfacher Art, dass ich mich willentlich hineinträumen kann. Ich stelle mich schlafend, schließe die Augen, kippe vornüber und falle. Ich fühle, wie die Dunkelheit mir den Weg hinab weist. Ein Gleiten eigentlich nur. Angenehmer als Fliegen. Ich muss mir keine Sorgen um die Richtung machen. Es geht einfach nur hinab ins Nichts. Die Tiefe umarmt mich. Anfangs ist da noch ein Staunen, dass kein Boden ist, auf den ich aufschlage. Immer nur ein Dahingleiten, hinab in eine dunkle, sanfte Ewigkeit. Der Sturz ist endlos, das wird mir schon während des Fallens bewusst. Auf leise Art. Eine Ahnung ergreift den ganzen Körper. Kein Erschrecken. Als ich noch unerfahren war in diesem Traum, erwartete ich einen Aufprall. Aber ich weiß inzwischen, dass diese Erwartung sinnlos ist. Das Fallen hat kein Ende. Kein Ziel. Eine Dunkelheit, die nirgends leuchtet. Aber von unglaublicher Wahrnehmbarkeit. Es ist auch längst kein Fallen mehr. Es ist einfach nur ein Hinab. Da sollte eine Grenze sein, ich wünschte, ich könnte sie sehen. Aber sie kommt nicht. Ich ahne sie noch nicht einmal. Nein, dieses Fallen kann nicht enden, dazu falle ich schon viel zu lange, der Sturz kann nicht enden, denn wenn er enden würde, wäre er tödlich. Aber ich habe keine Angst. Ich vertraue auf das Immerwährende meines Falls. Ich denke nichts anderes. Ich fühle mich wohl. Solange ich falle, gibt es den Boden nicht, und eigentlich glaube ich gar nicht mehr, dass es noch einen Boden geben könnte. Oder ein Fallen. Ich bin schwerelos. Ich habe begriffen, was Unendlichkeit bedeutet. Wie sie sich anfühlt. Ein kaltes Kitzeln all meiner Organe. Ein leichtes Grauen. Nicht unangenehm. Eine Angst, die sich selbst widerspricht, denn wovor sollte ich mich noch fürchten? Es gibt ein Danach des Danachs des Danachs und nie ein Erwachen.
Big Bang! Plötzlich dieser Urknall! Der lauteste Lärm, der je ein Ohr erreichte. Du bist hilflos, du kannst die Ohren nicht vor ihm verschließen, deine Hände sind viel zu klein. Das Geräusch so fremd, so unvertraut, so absurd störend. Bist du es, der das hört?
Der Wecker. Der Wecker klingelt. Es ist dein Wecker. Es ist Montag. So ziemlich der unangenehmste Tag der Woche. »Ganz Deutschland schläft von Sonntag auf Montag am schlechtesten«, bestätigt der Psychologe Hans-Günter Weeß. Viele schlafen am Sonntag aus und gehen abends dennoch zur gewohnten Zeit ins Bett, obwohl sie noch nicht wirklich müde sind. Aber das allein ist es nicht, was sie wachhält. »Viele fragen sich abends im Bett, was die kommende Woche bringt und was ansteht«, erläutert Weeß und fügt hinzu: »Anspannung ist der größte Feind des Schlafes.«
Ich wache auf und bin müde. Woher die Müdigkeit rührt? Angst. Angst, die aus Unsicherheit herrührt. Einer Unsicherheit, die sich aus den falschen Fragen speist. Was bringt mir die Woche? Nichts Gutes! Falsche Antwort. Eine Menge Arbeit! Falsche Antwort. Richtige Antwort: Die Woche bringt mir sieben Tage und eine Menge Arbeit. Ich habe sieben Tage Zeit, um aus dieser Woche eine gute Woche zu machen. Ich muss nicht hetzen. Es bleibt Zeit. Ich kann noch liegen bleiben. Mich noch einmal umdrehen. Ein Stündchen weiterschlafen. Die Welt da draußen Welt sein lassen.
Funktioniert nicht. Ich entkomme der Müdigkeit nicht durch Schlaf. Die Angst vor dem Anfang, die mich so unglaublich müde macht, lässt sich nicht einschläfern. Ich weiß, ich muss aufstehen. Alles andere wäre Schwäche. Die Angst zu versagen treibt mich aus dem Bett. Kein guter Anfang.
Ich kenne Menschen, die gern aufstehen. Gern zur Arbeit gehen. Mühelos ihr Frühstück zubereiten. Umstandslos ihren Stuhlgang erledigen. Pfeifend die Haustür schließen.
Ich mag diese Menschen nicht. Sie haben keine Ahnung von den Mühen des Beginnens, und wer keine Ahnung von den Mühen des Beginnens hat, weiß auch nicht, wie unendlich groß die Zahl der Möglichkeiten ist, diesen Tag zum besten Tag meines Lebens zu machen. Oder zum schlechtesten. Ermüdend groß. Entsetzlich der Gedanke, ich könnte eine dieser Möglichkeiten übersehen haben oder sie versäumen, indem ich gedankenlos aktiv werde.
Ich habe mir vorgenommen, diese Woche zur besten meines Lebens zu machen. Punkt eins: Ich will der Müdigkeit entkommen. Die Angst vor dem Anfang ist der Beginn aller Müdigkeit, also muss ich die Angst vor dem Anfang besiegen. Kein leichtes Unterfangen, denn ich weiß, diese Angst ist begründet durch die Unendlichkeit meiner Wahlmöglichkeiten. Willkommen im Teufelskreis. »In jedem Anfang liegt die Ewigkeit«, flüstert mir eine vertraute Stimme zu. Ich kenne diese Stimme. Es ist die Stimme der Unverbesserlichen, die mich fortwährend mit angsteinflößenden Weisheiten versorgen. Ich nenne die Unverbesserlichen ›die Unverbesserlichen‹, weil sie immer schon klug waren und immer alles besser wissen. Vor dem Anfang ist ein Ende, in jedem Ende liegt ein neuer Anfang. Für manche ruht über all dem ein Zauber. Nicht für mich. Für mich ist aller Anfang mit Angst verbunden. Seit jeher beginnt jeder meiner Tage mit einem diffusen Gefühl des Unwohlseins.
Ich weiß, ich sollte den Tag mit einem munteren Vorsatz beginnen, dergestalt, dass ich mir einrede, alles werde gut. Aber ich bin doch nicht dumm! Wie soll denn alles gut werden, wenn ich krank bin? Die Diagnose: Ich habe Angst, und ich bin unendlich müde. Die Schlussfolgerung: Ich brauche einen guten Arzt. Den besten. Mein Anliegen ist berechtigt. Denn ich habe nachgelesen: Ich bin nicht allein. Wir alle sind müde. Wir alle haben Angst. Die Philosophen sprechen von einer »Müdigkeitsgesellschaft«. Besser gesagt, einer hat damit angefangen, und alle anderen sprechen es nun nach. Den Verdacht gab es allerdings immer schon. Die klügsten Menschen sind oft die übermüdetsten. Wir wissen zu viel. Wir wissen viel mehr, als wir eigentlich für einen guten Wochenstart wissen müssten. Wir bekommen zu viele Informationen. Jeden Tag geschieht irgendwo auf der Welt ein Unglück, und wir erfahren umgehend davon. So viele globale Krisen, die uns belasten. All die Sorgen um die Zukunft des Planeten, die mein Frühstücksei so unrund erscheinen lassen. All dieses Unvollkommene, was mich nervt, noch ehe ich einen Schritt vor die Tür getan habe. Wie entkomme ich der Melancholie des Beginnens? Mein Horizont ist offen, unendlich offen. So viele Richtungen, in die ich gehen kann. So viele Ziele, die noch in Reichweite sind. Aber: Wohin soll ich gehen?
»Geh zum Arzt«, flüstern die Unverbesserlichen. »Du bist krank. Eine generalisierte Angststörung.«
»Der Befund ist korrekt«, flüstere ich.
»Einzusehen, dass man krank ist, ist der erste Schritt der Gesundung«, tönt es sanft zurück. Wie die meisten Menschen gehe ich nicht ungern zum Arzt. Das gibt meinen Ängsten eine medizinische Würde. Allerdings würde ich meinem Arzt nie die Wahrheit sagen. Nicht, weil ich Angst habe, sondern aus der Erfahrung heraus, dass sich Ärzte für sehr, sehr viel interessieren, aber nicht für die Ängste ihrer Patienten. Ängste hat jeder, insofern gilt es vielen, auch vielen Ärzten, gar nicht als Krankheit, panische Angst zu haben. Mein Hausarzt zum Beispiel hat panische Angst davor, zu verarmen. Diese Angst quält ihn schon seit Jahren, was verständlich ist, weil immer wieder eine Gesundheitsreform droht, die ihn aller Einkünfte berauben könnte. Die Reform kam nie, und sie wird nie kommen. Aber die Angst ist geblieben. Über Ängste muss man reden, das weiß auch mein Hausarzt, also redet er gern mit mir über seine Ängste, denn er weiß, ich habe ein offenes Ohr dafür. Wie sonst könnte ich als Kassenpatient seine Zuneigung gewinnen. Zudem lassen sich seine Ängste rasch mindern, indem ich von Zeit zu Zeit die ein oder andere Zusatzbehandlung in Anspruch nehme und ihn dafür in bar honoriere. Das ist mir ein gutes Verhältnis zu meinem Arzt wert. Ich weiß ja nicht, wann ich seine Hilfe wirklich einmal brauchen werde. Nicht auszudenken, wenn er dann meines Geizes wegen einen Groll gegen mich hegte!
Ich könnte zum Arzt gehen und eine Krankheit vortäuschen. Allgemeines Unwohlsein. Er würde mir zuzwinkern und im sicheren Wissen um meine prompte Ablehnung das Angebot machen, mich zwei, drei Tage krankzuschreiben. Dann würden wir noch einige Minuten über seine Schwierigkeiten grübeln, gutes Personal zu finden, die Urlaubsziele für den Herbst abgleichen und uns herzlich verabschieden. Zuweilen erinnere ich ihn daran, ein EKG zu machen und mir ein wenig Blut abzunehmen. Letzteres ist eine Frage der Tagesform. Denn vor Spritzen habe ich Angst.
Ich könnte zum Arzt gehen und ihm die Wahrheit sagen. Ganz spontan. Aber vor der Begegnung mit dem Arzt, zudem vor einer unangemeldeten, liegt eine lange Wartezeit in einem Raum, der mir schon immer Furcht eingeflößt hat: dem Wartezimmer!
Da ist sehr viel, was einem im Wartezimmer Angst machen kann. Die schlechte Kunst an den Wänden, die abgegriffenen Zeitschriften, die alle den gleichen Warnhinweis zu tragen scheinen: »Vorsicht Sputum! Nur mit Gummihandschuhen anfassen!« Die Vorsorgeplakate der Krankenkassen, die auf all die Krankheiten hinweisen, die ich mir selbst schon eingebildet habe. Die bunte Liste mit den zahlreichen Zusatzangeboten, die gegen wenig Honorar eine viel umfangreichere Gesundung versprechen. Von den anderen Patienten ganz zu schweigen. Ein Wartezimmer ist ein Ort, der kranke Menschen zusammenbringt, auf dass sie ihre Krankheiten tauschen können. Meist im Verhältnis eins zu zwei. Wenn ich im Winter mit einer Erkältung in die Praxis komme, gehe ich mit einer Grippe. Komme ich mit einer Bronchitis, gehe ich mit einer Lungenentzündung. Hautausschlag gegen Neurodermitis. Nein, Unsinn. Neurodermitis ist nicht ansteckend. Angst sehr wohl. Angst ist ansteckend. Jedes Patientengespräch dient der Angststeigerung, denn worüber unterhalten sich Patienten – wenn nicht über ihre Krankheiten oder die der anderen und deren tödlichen Verlauf? Über Ärzte und deren Versagen. Oder über andere Patienten, die ihnen Angst machen. Oder ihnen immer wieder aus mysteriösen Gründen vorgezogen werden. Zugegeben, ich bin selbst auch so ein Patient, der anderen zum Ärgernis wird. Denn meine Nervosität wirkt wahnsinnig ansteckend. Und mein Schweigen verängstigt. Dann endlich sitzen Sie Ihrem Arzt gegenüber und wollen ihm begreiflich machen, dass Sie Angst haben.
»Ich habe Angst.«
Er blickt kurz vom Computer hoch und sieht sie freundlich an.
»Das ist nicht schlimm. Jeder von uns empfindet von Zeit zu Zeit Angst. Alle Kulturleistung ist Angstprävention. Die Angst ist der Motor der Erkenntnis. Ohne Angst wären wir nichts als Lemminge. Angst ist unser bester Ratgeber. Vor was genau …?«
»Wenn das so einfach wäre, müsste ich nicht zu Ihnen kommen.«
Aufmunterndes Nicken, das sagt: Kommen Sie zur Sache.
»Vor allem und nichts.«
Er wiegt bedenklich den Kopf.
»Sind Sie in einer Prüfungssituation, haben Sie Liebeskummer, berufliche Sorgen …«
»Wunderbar, wenn es so wäre … Aber es ist schlimmer: Das ganze Sein lastet auf mir. Alle Sonnen, alle Sterne, alle Planeten, das ganze Universum sprengt mir die Brust …«
»Also ein gewisser Druck auf der Brust?«, hakt er erfreut ein, »Herzrasen?«
Ich nicke, weil ich ihn gern glücklich sehe. Er atmet erleichtert auf. »Ich verschreibe Ihnen einen leichten Betablocker. Den sollten Sie gut vertragen. In vier Wochen sehn wir uns wieder.«
Was gibt es da noch zu sagen? Ich werfe ihm beim Hinausgehen einen letzten taxierenden Blick zu und bin mir ziemlich sicher: generalisierte, gegebenenfalls privatisierte Angststörung. Soll heißen: Sie haben Angst vor dem Arzt, aber der Arzt hat auch Angst vor Ihnen. Sie sind eine Bedrohung seiner Routine. Das ist kein Vorwurf. Die meisten Krankheiten sind Routine. Aber die Angsterkrankung nicht. Sie zwingt den Arzt, den ganzen Patienten in den Blick zu nehmen. Dafür fehlt den meisten die Geduld, die Zeit und das Geld. Insofern ist es nur logisch, wenn ich nicht ehrlich zu meinem Hausarzt bin. Ich will ihm nicht mehr zumuten, als er wirklich bewältigen kann. In allen medizinischen Belangen vertraue ich ihm. Aber ich traue ihm nicht zu, meine seelischen Leiden lindern zu können. Dafür hat er gar keine Ausbildung. Außerdem ist es gar nicht seine Aufgabe. Ein guter Hausarzt ist wichtig, ein guter Freund besser. Aber wenn ich mir vorstelle, einem Freund all meine Ängste erzählen zu müssen, wird mir unwohl.
Gehört es wirklich zu den Garantieleistungen der Freundschaft, seine Ängste zu tauschen? Denn darauf läuft es ja hinaus. Ein Geständnis bedingt das andere, weil nur so das Unwohlsein einer therapeutischen Situation beendet werden kann. Zwiegespräche der seltsamsten Art würden daraus resultieren: »Ich habe Angst.« – »Ich habe auch Angst.« – »Wovor hast Du Angst?« – »Davor habe ich keine Angst.« – »Seltsam.«
Unsere Ängste sind grundverschieden. Ich könnte mich nie in eine andere Angst als die meine hineindenken. Angst vor Spinnen? Wie das? Faszinierende Tiere! Ich kann zuhören, ich kann versuchen mitzufühlen, aber der Schrecken ist nicht teilbar. Vielleicht gehen Menschen deshalb gemeinsam in Horrorfilme, um ihre Angst zu teilen. Aber ich möchte mit keinem meiner Freunde in einen Horrorfilm gehen, weil ich Angst vor Horrorfilmen habe. Es bringt mir gar nichts, wenn ich dabei die Hand des Nachbarn halten kann, wer auch immer es sein mag. Die Angst gehört mir ganz allein. Sie ist nicht teilbar. Deswegen würde ich auch niemals mit irgendeinem anderen Menschen ehrlich über meine Ängste reden. Nicht mit der Frau, die ich liebe, nicht mit meinen Freunden. Ich würde sie auch nicht meinem Tagebuch anvertrauen, denn das könnte gefunden werden.
»Ich bin allein mit meiner Angst.« Daraus folgern viele: »Ich bin allein.« Das ist falsch. Angst macht nicht einsam. Die Einsamkeit macht Angst. Weil ich mir selbst begegnen muss. Ich muss mit meinen Ängsten zurechtkommen. Allein. Weil mir kein anderer helfen kann. Natürlich gibt es Hilfsangebote. Angebote, die ich nicht ausschlagen darf, wenn der Leidensdruck zu groß wird. »Aber«, flüstert mein Stolz, »vielleicht schaffst Du es ja auch allein!«
Ein ängstlicher Mensch wird immer dann mutig, wenn es darum geht, Hilfe auszuschlagen. Das klingt paradox, aber wir fürchten uns oft mehr vor der Therapie unserer Ängste als vor den Ängsten selbst. Kinder sind da anders. Kinder nehmen jede Hilfe in Anspruch, die ihnen geboten wird. In meinem Fall war das ein zwergwüchsiger Teddybär mit einer sehr putzigen Schnauze, an dessen Namen ich mich nicht mehr erinnern kann. Meine Großmutter strickte ihm ein rotes Trikot, dickmaschig, welches den Haarausfall im Bauchbereich kaschierte.
Ich habe keine Erinnerungen mehr an mein Zusammenleben mit ihm, aber er erinnerte sich offensichtlich an mich, denn auf wundersame Weise ging er nie verloren. Irgendwann, dreißig Jahre später, präsentierte ihn mein Vater mit den Worten: »Den kennst du doch wohl noch!« Und ja, das Wiedersehen war rührend, weil ich spürte, dass dieser kleine Bär oft an meiner Wange gelegen hatte oder unter meiner Achsel. Er hat mich nie verlassen. Was war ich ihm schuldig? War ich ihm etwas schuldig? Ein wenig Trotz verbitterte mein Herz. Das Wiedersehen war nicht frei von Scham, weil ich mir nur schwer eingestehen konnte, dass ich viele Jahre auf die Hilfe eines kleinen Bären angewiesen war. Meine Eltern waren gedanklich oft abwesend, aber stets im Haus. Meine Schwestern waren Zwillinge und insofern eins mit sich selbst, im Streit wie im Versöhnen, aber Einzelkind war ich deswegen dennoch nicht. Meine Großmutter war mürrisch, aber belesen und immer gewillt, mich im Mühle-Spiel zu besiegen.
Warum hatte ich als Kind Angst? Ich war klein und alles andere groß. Die Welt war unbegreiflich und voller Gefahren. Ich fing schon früh an, mich zu bewaffnen. Mit Wasserpistolen der unterschiedlichsten Kaliber, mit Zündplättchen-Revolvern, Platzpatronen-Colts, Raketenkracher-Pfeilen. Einem Taschenmesser, einem Pfadfinderdolch, Pfeil und Bogen, einer kleinen Streitaxt, die auch zum Wigwambau diente, aber vornehmlich zum Spalten gegnerischer Schädel. Diverse Sprengkörper, die ich vor dem sinnlosen Verpuffen im Neujahrsfeuerwerk gerettet hatte, lagerten in metallenen Pralinenschachteln. Das Sortiment war umfangreich, wurde ständig ergänzt, nicht zuletzt dank illegaler Geldentnahmen aus dem mütterlichen Portemonnaie, und bot, darüber war ich mir früh klar, dennoch keinen zureichenden Schutz gegen die Gefahren der Dunkelheit. Denn das war die Quelle aller Angst. Die Dunkelheit.
Ich hatte grässliche Angst vor der Dunkelheit. Ich wollte nicht allein in den Keller gehen, schon gar nicht in den Keller der großen Fässer. Zivilisation definierte sich für mich sehr früh als die – wenn nicht wohnliche, so doch lichte – Ausgestaltung der Kellerräume zum Zwecke der Angstvermeidung. Wenn wir auf dem Bauernhof meiner Großeltern zu Besuch waren, schien mir alles viel fremder als nötig.
Was die Lebewesen anbelangte ohnehin. Ich hatte Tiere aus dem Fernsehen anders vor Augen. Am grässlichsten benahmen sich die Schweine, die sich in einem dunklen, niederen Stall grunzend umherwälzten, bis sie die Witterung von Menschenfleisch aufnahmen und ihre Mäuler sperrangelweit aufrissen, weil sie mich wie jedes andere Futter einfach nur verschlingen wollten. An Streicheln war nicht zu denken. Die Kühe waren groß und ihre Euter von einer so prallen Angespanntheit, dass ihnen durch Melken auch nicht zu helfen war. Ich jedenfalls wollte an keiner Zitze ziehen, aus Angst, ein großes fleischliches Platzen auszulösen. Der Hofhund war eingestaubt und an einer langen Kette festgebunden, die sich im Laufe der Jahre mit seinem Nackenfleisch verwachsen hatte. Mit ihm war keine Freundschaft mehr möglich. Wenn ich ihm Essensreste brachte, dann nur, weil ich den Kerkermeister vertrat. Meine Freundlichkeit schien dem Hund verlogen. Die Hühner wiederum, die er bewachte, waren pickende Biester. Wenn sich die Tür öffnete, weil meine Tante die Eier holen wollte oder ein einzelnes Huhn für den Topf, tauchte sie ein in ein großes Gestöber. Mitleid empfand ich keins. Hühner waren bösartig und verdienten den Tod. Ich hielt mich fern von ihnen. Ich hielt mich auch fern von den Pferden, weil sie nicht die geringste Ähnlichkeit mit Ponys hatten. Ich hielt mich fern von dem Zuchtbullen, weil er so brutal stark war, dass selbst fünf Männer ihn nicht halten konnten, obwohl er durch einen großen Nasenring an sein Schicksal gekettet war. Ich hielt mich fern von dem Rehbock, der eines Abends am großen Haken vor dem Stall hing, weil er abgezogen werden sollte. Mein Großvater hatte ihn geschossen. Ich sah die Läufe und wünschte mir ein Messer mit einem Rehbockgriff. Mein Großvater drückte mir seins in die Hand, aber es war unhandlich. Ich sah den Kopf des Rehbocks sehr schräg auf den Schultern liegen und hatte Mitleid. Er war zu jung gestorben. Ich sah den Kopf als Trophäe wieder, was deshalb eine seltsame Erinnerung war, weil der weiße, fragile Schädelknochen gar nicht zu dem widerlichen Gestank passte, der entstand, als mein Großvater den Kopf auskochte.