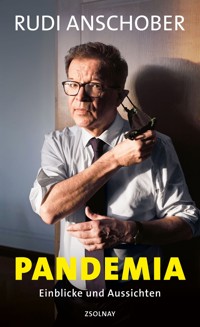Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Brandstätter Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
2040: Unser Leben ist besser geworden. Eine scheinbar kuriose Behauptung angesichts der vielen Krisen, die wir in der Gegenwart erleben. Doch Rudi Anschober zeigt in seiner ebenso Hoffnung machenden wie realistischen Zukunftserzählung: Wir können es gut haben. Anschober skizziert die Weichenstellungen, die es dafür in den nächsten entscheidenden Jahren braucht. Dafür bietet jeder Tag neue Chancen: Neue Pfade zu gehen, neue Strategien zu entwickeln, die große Trendwende einzuleiten. Oder, in den Worten von Oscar Wilde: Fortschritt ist nur die Verwirklichung von Utopien. Daher ist Anschober überzeugt: Es ist nicht die Zeit für Resignation, es ist nie zu spät für den Traum der Veränderung. Diese auf Wissenschaft, Fakten und Optimismus setzende Vision zeigt, wie ein gutes Leben mit der Klimawende aussehen kann – und wie es möglich wird. Unverklärt, der Realität ins Auge sehend, Mut machend. Ein Buch, das wir alle brauchen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
RUDI ANSCHOBER
WIE WIRUNS DIEZUKUNFTZURÜCKHOLEN
Ich möchte mich bei vielen Menschen bedanken, die mich mit Rückmeldungen, Diskussionen, Hinweisen, Anregungen beim Verfassen dieses Buches unterstützt haben, namentlich Petra, Martin, Judith, und bei allen Mitarbeiter:innen des Brandstätter Verlags für die freundschaftliche und professionelle Zusammenarbeit.
WIEN, IM MAI 2040:MEIN GEBURTSTAG
VOR DER WENDE
DIE ZEIT DER WIDERSPRÜCHE. EIN RÜCKBLICK AUF DAS JAHR2025
2026:DAS JAHR DES SCHWARZEN SOMMERS
2027:DER AUFSTAND BEGINNT
2028:EINE REISE IN DIE VERÄNDERUNG
2030:EINE NEUE WIRTSCHAFT ENTSTEHT
2032:DIE REVOLUTION SCHAFFT NEUES RECHT
2034:VIEL LICHT, WENIG SCHATTEN
2036:GREEN FIGHTER
2038:LAND IN SICHT
12. MAI 2040:EINE NEUE ZEIT BRICHT AN
LITERATUR
LIEBE LESERIN, LIEBER LESER!
„Wie wir uns die Zukunft zurückholen“ ist meine sehr persönliche Zeitreise in eine gute Zukunft. Das Gedankenexperiment erzählt davon, was alles möglich wird, wenn wir umgehend handeln, unsere Gewohnheiten und die bisherige Politik überwinden und gemeinsam eine Revolution starten – hin zu einer faszinierenden Klimawende, zur vollständigen Versorgung mit erneuerbarer Energie, zu Wahlfreiheit im Verkehr, Vielfalt in der Ernährung, einer gerechten Verteilung und einem neuen Verhältnis von uns Menschen zu Tieren und Natur. Es zeigt, welche Weichenstellungen gelingen müssen, damit es zu keiner Eskalation kommt und unser Leben besser wird.
Ausgehend von der Perspektive eines Europa im Jahr 2040, das die Klimawende geschafft hat, rolle ich die Ereignisse Schritt für Schritt bis in die Gegenwart auf: Lange Zeit ist in Sachen Klimaschutz vieles schiefgelaufen, bis eine noch nie dagewesene Hitzewelle, der Schwarze Sommer, die Krise eskalieren lässt. Die Möglichkeit eines solchen Schwarzen Sommers ist nicht weit hergeholt: In meinem Gedankenexperiment verlagere ich für einige Wochen lediglich die vielen, von uns oft unbeachteten, bereits realen Klimafolgen aus anderen Weltregionen zu uns nach Europa. Ein durchaus realistisches Szenario.
Nach diesem Schock und mit den Lehren aus der Polykrise gelingt es, die Wende umzusetzen, die Klimakrise zu begrenzen und unser Leben zu verbessern.
Ein neuer gesellschaftlicher Zusammenhalt, die weltweite Einigung auf ein großes gemeinsames Ziel, neue Mehrheiten für eine mutige Klimapolitik, eine starke Europäische Union und eine weltweite enge Zusammenarbeit stellen die Weichen dafür. Die für die Klimawende notwendigen Technologien gibt es längst, viele weitere sind in Entwicklung (siehe Literaturliste im Anhang).
Das Buch veranschaulicht, dass diese Veränderungen gelingen können, wenn viele Engagierte in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gemeinsam aktiv werden und Parteigrenzen, nationale Grenzen und alte Ideologien überwinden. Wir gewinnen damit eine neue Lebenskultur, die uns zu mehr Zeit, einem besseren Leben für alle und mehr Gerechtigkeit verhilft.
Anstelle von Dystopie, Resignation und Verdrängung tritt eine neue Aufbruchstimmung, weil wir die vielen Modelle bereits verwirklichter regionaler und lokaler Veränderungen in den Mittelpunkt rücken und die Chance auf eine gute Zukunft sichtbar machen.
Daraus schöpfen wir Ermutigung und Hoffnung und schaffen für die Umsetzung neue politische Mehrheiten. Die harte Analyse der Entwicklung und das tägliche Feuerwerk guter Nachrichten von Fortschritten machen uns stark, das Tun von immer mehr Menschen auf der ganzen Welt wirkt ansteckend. Sobald viele Menschen erkennen, wie sehr sie von der Wende profitieren, gibt es kein Halten mehr. Nach Jahrzehnten des Misstrauens gelingt uns schließlich die Wende hin zur weltweiten Zusammenarbeit in einem neuen Vertrauen.
Begleiten Sie mich auf den folgenden Seiten auf diesem faszinierenden Weg in eine gute Zukunft.
IHR RUDI ANSCHOBER
Kontakt: www.anschober.at
WIEN, IM MAI2040MEIN GEBURTSTAG
Es ist noch dunkel. Irgendetwas hat mich geweckt.
Didip – didip – didip, uuh – uuh – uuh.
Da ist es wieder.
Jetzt erkenne ich das Lied: Die Nachtigall, die sich vor wenigen Wochen nach ihrer Rückkehr aus dem Süden im mächtigen Lindenbaum hinter dem alten Haus einquartiert hat, singt wieder. Usignolo haben wir sie in Italien genannt.
Didip – didip – didip, uuh – uuh – uuh.
Belami, meinen Retriever, der wie jede Nacht neben dem Bett liegt, stört das nicht. Er bellt leise und ganz hoch im Schlaf, seine Pfoten scharren über den Holzboden, offensichtlich läuft er in einem wilden Traum irgendeinem Tier hinterher. Bald werden wohl die beiden Katzen wieder nach Hause kommen, über den Baum auf die Terrasse klettern und am Wassernapf ihren Durst stillen. Dass sie hier sind, höre ich dann am Schlabbern ihrer kleinen Zungen.
Ich liebe diese stillen Nachtstunden, die den leisen Geräuschen der Tiere Raum lassen. Vertraute Töne in einer besonderen Nacht. Den 12. Mai 2040 schreiben wir heute. Es ist mein Geburtstag. Ein besonderer Geburtstag: mein achtzigster.
Früher haben wir diese Zeit Mitte Mai als die „Eisheiligen“ bezeichnet, weil damals immer noch ein später Kälteeinbruch möglich war. Das ist heute nicht mehr zu erwarten, im Gegenteil: Mitte Mai sind Tropennächte keine Ausnahme mehr. Auch heute fühle ich bereits vor der Dämmerung die aufkommende Hitze. Feine Rinnsale aus Schweiß bilden sich auf meiner Haut, fließen auf das Bettlaken, hinterlassen kleine Flecken.
Im Bett liegend höre ich Belami nun wieder tief atmen, er hat sich beruhigt, sein Traum scheint vorbei zu sein. Mein Blick durch das Moskitonetz bleibt an dem großen alten Spiegel mit seinem mächtigen Goldrahmen hängen, der sich mir direkt gegenüber an der Schlafzimmerwand befindet. Er erinnert mich an mein Lebensmotto, das ich als Jugendlicher gewählt und mir im Laufe meines Lebens immer wieder ins Gedächtnis gerufen habe: Ich möchte mich mit achtzig in den Spiegel schauen, also den Respekt vor mir bewahren, und sagen können: Es war gut, ich habe alles versucht, habe meinen Beitrag geleistet.
Didip – didip – didip, uuuh – uuuh – uuh.
Usignolo beginnt wieder zu singen und unterbricht meine Erinnerungen. Es sind Balzlieder, mit denen er um eine Partnerin wirbt. Instinktiv lasse ich meine linke Hand über die Bettkante gleiten, hebe das Moskitonetz leicht an und taste nach Belami. Als ich ihm das Fell kraule, das wegen der Hitze kurz geschoren ist, beginnt er sich wohlig zu strecken und grunzt zufrieden. Wir sind miteinander vertraut.
Das Quietschen der Straßenbahn, die um die Kurve biegt, signalisiert mir den Beginn des Tages. Ich stehe auf, Belami hebt müde den Kopf und klopft mit seinem Schwanz ein einziges Mal auf den Boden, ehe er sich mit einem lauten Stöhnen wieder auf dem Holzboden ausstreckt und weiterschläft.
Ich gehe ein paar Schritte, leise, um meine Partnerin nicht zu wecken, bleibe vor dem Spiegel stehen und sehe einen alten Mann. Viele Falten und Altersflecken im Gesicht, die Haare weiß und dünn. Aber die Augen sind wach und klar.
Ich trete ans Fenster des Schlafzimmers und betrachte im ersten Morgenlicht die Umrisse unserer Hochbeete im Garten. Seit einigen Jahren pflanzen wir und andere Mieterinnen und Mieter dieses Hauses gemeinsam unser eigenes Gemüse an. Alle bringen Wissen und Zeit ein, dadurch ist ein Ort der Kooperation, der Begegnung und Unabhängigkeit entstanden.
Ich gehe in die Küche, schalte die Espressomaschine ein und befülle sie mit Kaffeebohnen aus Peru. Dieser Duft! Einmal im Jahr erhalte ich eine Lieferung vom Netzwerk jener Kleinbauern, die neue Kaffeesorten gezüchtet haben. Es sind hitzeresistentere Sorten, die mit wenig Wasser auskommen und so das Überleben der Ortsansässigen trotz der zunehmenden Trockenheit als Folge der Klimakrise sichern. Die Umstellung wurde mit Mikrokrediten aus einer Genossenschaft finanziert, in die ich einen Teil meines Ersparten eingezahlt habe, die Refinanzierung erfolgt über biologischen, fair produzierten Kaffee. Einmal im Jahr sehen wir uns bei einer Onlinekonferenz. Freundschaften sind entstanden.
Viele Großproduzenten, denen der globale Markt durch minimale Gewinnspannen keine Luft zum Atmen lässt, sind in den vergangenen Jahren an den Auswirkungen der zunehmenden Hitze gescheitert. Die Klimakrise hat Zehntausende Existenzen zerstört und die Preise am Weltmarkt in die Höhe getrieben – bei Kaffee genauso wie bei vielen anderen Lebensmitteln auch.
Ich kehre mit der roten Leine ins Schlafzimmer zurück und betätige den daran angebrachten Schnapper. Ein Geräusch, das den Morgenspaziergang ankündigt. Belami wird sofort wieder wach, mit einem Sprung ist er auf den Beinen, schüttelt sich kräftig und kommt mir mit freudig wedelndem Schwanz entgegen.
Gemeinsam drehen wir eine kleine Runde durch den Garten, die Blumenwiese gedeiht, bald werden viele Insekten unterwegs sein, dankbar für dieses kleine Stück Natur in der Stadt. Ich finde es großartig, dass wir auf unserem Planeten mittlerweile auf einem guten Weg sind, das Massensterben der Biodiversität, das bereits begonnen hatte, doch noch zu stoppen. Belami schnuppert aufgeregt, verfolgt für mich unsichtbare Spuren. In der Nacht kommen viele Wildtiere in den Garten und hinterlassen ihre Duftmarken, vom Dachs bis zu Fuchs und Marder. Bei den Brennnesselstauden in der Wiese beobachte ich die schwarzen Raupen der Tagpfauenaugen mit ihren kleinen weißen Punkten.
In der Natur ist alles eng miteinander verwoben, wir Menschen verstehen nur einen winzigen Teil davon. Schmetterlinge sind schon vor Hunderten Millionen Jahren über den Köpfen der Dinosaurier geflattert. Sie passen sich vielfach an, aber sie brauchen Nahrung, sie brauchen Wildblumenwiesen wie diese hier.
Den größten Teil des Gartens überdachen mehrere alte Bäume. Wir stehen unter dem Lindenbaum, dessen Stamm im Garten der Nachbarn Wurzeln geschlagen hat, doch Grenzen kennt er nicht, für ihn gehört alles zusammen. Während Belami weiter auf Spurensuche ist, betrachte ich die weitverzweigten Äste und staune wieder einmal über die Fähigkeiten der Natur: Ein Baum wie dieser kann mit seinen 500.000 Blättern an einem einzigen Tag 20 Kilogramm Kohlendioxid binden.
Jetzt hat das Morgenkonzert der Vögel voll eingesetzt. Die Natur hat eine eminent schützende Wirkung auf unsere Gesundheit. Der Gesang ist nun viel besser zu vernehmen als noch vor einigen Jahren, als er noch vom Verkehrslärm übertönt wurde. Seit dem Aus für fossil betriebene Fahrzeuge hat sich die Zahl der Autos auf ein Drittel verringert und die verbliebenen Fahrzeuge mit E-Antrieben sind leise. Pendelfahrten wurden deutlich weniger, Tempo 30 gilt mit Ausnahme der Durchzugsstraßen in der gesamten Stadt, das hat den Verkehrslärm noch einmal halbiert.
Wir treten durch das alte, quietschende Gartentor auf die Straße, die im Vergleich zu meiner Übersiedlung in die Stadt vor zwanzig Jahren nicht mehr wiederzuerkennen ist. Aus einer breiten, dunklen Asphaltfläche, die an heißen Tagen den Stadtteil aufgeheizt hat, wurde in den vergangenen zehn Jahren ein blauweißrotgrüngelbes Band. Wenn ich stadteinwärts blicke, sehe ich nur mehr eine Fahrbahn – auch hier wurde, wie auf den meisten Straßen, eine platzsparende Einbahnregelung eingeführt. Der Belag ist beinahe weiß, damit sich die Straße weniger aufheizt. Rechts davon erstreckt sich ein breiter Boulevard aus hellen Granitpflastersteinen, die sich ebenfalls nicht so stark erhitzen. In den Ritzen dazwischen gedeiht Gras, auf diese Weise kann Wasser versickern. Alle paar Meter steht ein großer, schattenspendender Baum. Lange wurde geforscht, welche Arten am besten geeignet sind, um in der zunehmenden Hitze der Stadt zu bestehen. Jetzt wachsen vor allem Ahorne, Zerreichen, Schnurbäume, Stadtulmen, Zedern und Douglasien in der neuen Allee, dazwischen auch Obstbäume. In ihrem Schatten laden am breiten Gehsteig Bänke, kleine Sitzgruppen, Wasserspender und Gastgärten zum Verweilen ein. Dazwischen wurden „Grüne Würfel“ errichtet, 25 Quadratmeter große, mobile Quader aus Holz, gleichsam Holzrahmen mit offenen Seiten, die mit Kletterpflanzen bewachsen sind. Die Würfel wurden einzeln oder an Stellen mit ausreichendem Platz in Gruppen aufgebaut, um das Mikroklima zu verbessern. Darin stehen Tische und Sessel, Liegestühle, Sandkisten und Schachspiele. Wo sich früher Autokolonnen stauten, befindet sich heute ein angenehmer, gekühlter Lebensraum – ein gewaltiger Zugewinn an Lebensqualität für uns alle.
Links von der einzigen verbliebenen Fahrbahn verlaufen wie seit vielen Jahrzehnten die Gleise der Straßenbahn, zwischen den Schienen liegen blaue Solarmodule der neuen, effizienteren und stabileren Generation und erzeugen Strom. Vor ein paar Jahren hat die Konstruktion noch futuristisch angemutet, heute ist sie alltäglich, heute ist Europas Bahnnetz das größte Photovoltaik-kraftwerk des Kontinents. Zwischen den beiden Gleispaaren wächst ein schmaler Rasenstreifen.
Dort, wo früher die zweite Fahrspur der Autos war, führt jetzt ein breiter Radweg zum Stadtteilbahnhof mit seiner Fahrradtiefgarage, stadteinwärts ist er rot gefärbt, gelb in die Gegenrichtung.
Ich muss lachen, während ich mich zurückerinnere. Was waren das für emotionale Auseinandersetzungen bei jedem Rückbau einer Straße, vor allem aber bei der Errichtung der Rad-garage!
Die Entflechtung des Verkehrs in Radwege, Gehsteige, Öffi-Flächen und Autostraßen samt eigenen Ampelschaltungen hat die Stadt beruhigt, vermeidet Konflikte und bringt mehr Sicherheit. Ein Symbol für diese neue Priorität ist die Fahrradtiefgarage beim Bahnhof: 6000 Fahrräder haben hier Platz, es gibt Sperr-boxen mit Ladeterminals, Duschen, einen Reparaturshop und eine Verleihstation. Meist sind fast alle Plätze belegt, Angebot schafft Nachfrage, der Radverkehr hat sich in den letzten Jahren verdreifacht.
Ich blicke auf die linke Straßenseite und sehe vor den Häusern, wo einst ein Auto neben dem anderen parkte, einen breiten Gehweg mit einer prächtigen Allee. Bereits vor Jahren ist die Stellplatzverordnung gefallen, die eine bestimmte Zahl an PKW-Stellplätzen für Geschäfte und Wohnungen vorschrieb. Seither wurden in der Stadt über 100.000 Bäume neu gepflanzt, 30.000 oberirdische Parkplätze für andere Nutzungsmöglichkeiten umgewidmet. Vorbild dafür war die französische Hauptstadt Paris, deren damalige Bürgermeisterin bereits Ende der 2010er-Jahre mit dem zukunftsweisenden Umbau ihrer Metropole begonnen hatte.
Jetzt genießen wir Stadtbewohner:innen viel mehr Lebensqualität: Nicht nur der Lärm hat sich deutlich verringert, auch die Luftschadstoffe wurden innerhalb von zwei Jahrzehnten halbiert. Das alles hat dazu beigetragen, dass ein neues Stadtklima entstanden ist, das die zunehmende Hitze erträglicher macht. Alte Menschen, Kranke, Kinder, wir alle atmen auf, der Aufenthalt im Freien ist gesund und sicher.
Die große Zahl an Begegnungsorten, die auf den früheren Verkehrsflächen geschaffen wurden, haben auch ein neues Miteinander und weniger Einsamkeit in der Stadt ermöglicht. Und noch etwas ist anders: Es gibt keine Barrieren mehr, alle Stufen im öffentlichen Raum wurden abgeflacht.
Belami und ich gehen an der Volkshochschule vorbei, in der seit zwei Jahren Klimavertriebene aus dem Globalen Süden, die mit einer „ClimateCard“ hierhergekommen sind, eine Ausbildung erhalten. Verdammt! Die Fensterfläche beim Eingang wurde mit rassistischen Sprüchen beschmiert. Das muss in dieser Nacht passiert sein, gestern war davon noch nichts zu sehen. Rechte Extremist:innen fühlen sich wieder im Aufwind, seit die Zahl der Klimavertriebenen zunimmt. So arbeiten nationale Populist:innen: Zuerst versuchen sie, den Klimaschutz zu behindern, um dann von der Zuspitzung der Krise zu profitieren. Sie wollen keine Lösungen, denn sie benötigen Probleme für ihre eigenen Interessen, ihren Weg an die Macht.
Ich greife zum Handy und versuche, eine junge Aktivistin zu erreichen, die sich mit Gleichgesinnten darauf spezialisiert hat, die Flächen der Stadt von solchem rassistischen Unrat zu reinigen. Es wäre schön, wenn es gelingen würde, die Schmiererei zu entfernen, bevor die ersten Schüler:innen eintreffen.
Belami und ich kommen zu einem Areal, auf dem sich noch vor wenigen Jahren eine Tankstelle befunden hat. Nun gibt es hier im Erdgeschoß des neu erbauten Wohnturms ein Reparatur-Center mit Verkaufsflächen für Second-Hand-Ware und Schulungsräumen für alle, die lernen wollen, kleine Probleme etwa an Haushaltsgeräten selbst zu beheben. Das Gebäude aus Ziegeln wurde von einer Architektin aus Bangladesch entworfen und ist ein Beispiel dafür, wie Vorbilder aus heißen Regionen zusammen mit alter Baukultur die Zukunft unseres Wohnens verbessern können.
Es ist noch nicht einmal sechs Uhr früh und doch sind bereits etliche Menschen unterwegs. Manche zu Fuß, etwa unsere Nachbarin Marie mit ihrem Hausschwein Piggy an der Leine, viele auf ihren Fahrrädern, die meisten mit den Öffis, einige wenige in Autos. Die Hitzewellen der letzten Jahre haben das Leben der Bevölkerung verändert: Zunehmend nutzen die Menschen die kühleren Morgenstunden und den Abend, den Nachmittag verbringen nur wenige mit Arbeit und schon gar nicht im Freien, sondern mit einer kleinen Siesta. Auch die Kleidung hat sich geändert, ist heller, luftiger, legerer geworden. Wir passen unser Leben an die Hitze an.
Belami wird nun schneller, er trägt einen Maulkorb und darf dafür in dieser Morgenstunde ohne Leine laufen. Offensichtlich wittert er bereits sein Ziel.
Durch die Stadt flossen einst eine Vielzahl größerer und kleinerer Bäche, die im Laufe der Jahrhunderte überbaut, kanalisiert, teilweise verschüttet wurden. In den vergangenen Jahren wurden sie wieder offengelegt und bilden nun neue Naturoasen, als Teil der Schwammstadt, die entsteht – urbane Gebiete, in denen Wasser nicht rasch abgeleitet, sondern für Trockenzeiten gespeichert wird. Unweit von hier ist bei diesen Bauarbeiten in tieferen Schichten eine Quelle mit großer Wassermenge zutage getreten. Zusammen mit dem Bachwasser wird sie für die Befüllung eines neuen Schwimmteiches genützt. Es ist unser kleines Paradies mitten im Stadtteil, entstanden an einer Stelle, an der früher ein großer Pendlerparkplatz in der Hitze flimmerte. Ich liebe diesen Ort so sehr: Ein kleiner Schilfgürtel umrahmt die Wasserfläche, daneben befinden sich Umkleidekabinen und ein kleiner, feiner Kiosk. Holzstege schaffen Platz für Badende.
Belami ist nun nicht mehr zu halten. Nach einem kurzen Sprint springt er vom Steg ins Wasser. Er schwimmt, ich werfe ihm ein Hölzchen. Während er aus dem Teich klettert und sich begeistert schüttelt, setze ich mich auf den Steg und lasse die Füße ins Wasser hängen.
Vor zwanzig Jahren hat der strukturelle Umbau der Stadt begonnen, zuerst zögerlich und in feigen Kompromissen, später mit immer mehr Mut. Ziel war eine klimaverträgliche, menschenfreundliche Metropole, eine Stadt der Nähe, die City der 15-Minuten-Stadtteile. Was zum Leben und Arbeiten nötig ist, um sich selbst zu versorgen und für andere zu sorgen, zum Lernen und Genießen sollte in jedem Grätzel in maximal einer Viertelstunde erreichbar sein.
Das war nur durch eine radikale Dezentralisierung und Digitalisierung aller Dienstleistungen machbar. Ein strenger Bodenschutzvertrag, der endlich Bauprojekte auf den Natur- und Agrarflächen vor der Stadt gestoppt und Renaturierungen eingeleitet hat, veranlasste Handelsketten, Einkaufszentren und Supermärkte, mit ihren Filialen in die Wohngebiete zurückzukehren, aus denen sie sich Ende des 20. Jahrhunderts auf die grünen Wiesen vor der Stadt verabschiedet hatten.
Auf dem Weg zum Teich sind Belami und ich an einigen kleinen Geschäften vorbeigekommen, die sich in den vergangenen Jahren hier angesiedelt haben, weil die Leute wieder in der Nachbarschaft einkaufen. Handwerksbetriebe, Buchhandlungen, verschiedenste Lebensmittel- und Bekleidungsgeschäfte finden sich nun in Gehdistanz, viele neue Jobs sind entstanden. Das trug dazu bei, dass Schlaforte, in denen man sich nur nachtsüber auf-hielt, wieder zum Lebensraum wurden und Pendlerströme ausdünnten.
Am schwierigsten umsetzbar war die Dezentralisierung der Arbeitsplätze. Homeoffice und „Shared Offices“ in den Stadtteilen erleichterten diese Entwicklung. Heute, im Jahr 2040, sind viel weniger Menschen zum Pendeln gezwungen als vor zwanzig Jahren, sie gewinnen dadurch Lebenszeit und Lebensqualität. Und noch eine positive Auswirkung des Arbeitens in der Wohnumgebung gibt es: Für viele stellte sich die Frage, warum sie sich bei wenig Bedarf und hohen Kosten noch ein eigenes Auto leisten sollten. Die Folge war eine deutliche Abnahme des Individualverkehrs und ein Rückgang des Autobesitzes.
Muss man verschiedene Produkte besitzen – oder reicht es, sie zu nutzen? Das Verhalten der Bevölkerung hat sich verändert, das Leasing-Center beim Stadtteilbahnhof boomt. Hier können Gebrauchsgüter vom Elektroauto bis zu Rasenmähern und Fahrrädern geliehen werden. Das minimiert Kosten, Rohstoffverbrauch und Emissionen und stärkt die Kreislaufwirtschaft.
Belami und ich setzen unsere morgendliche Stadtwanderung fort. In einiger Entfernung sehe ich die spektakulären vertikalen Wälder, drei zehnstöckige Büro- und Wohnhäuser aus Holz, in denen auf Balkonen und auf dem Dach 900 Bäume und Tausende Büsche gepflanzt wurden – ein neues Wahrzeichen der Stadt, gebaut auf den Erfahrungen des „Bosco Verticale“ in Mailand.
Nach Belamis Bad kommen wir nun rasch zu meinem Ziel, zu Omars Backstube. Mein Freund kam vor 23 Jahren aus Syrien nach Österreich, nachdem ein brutaler Krieg Millionen Menschen aus ihrer Heimat vertrieben hatte. Der liebenswürdige, fröhliche Omar führt seine Bäckerei mit viel Engagement und schafft es auf geniale Weise, die Geschmäcker des Orients mit unseren Traditionen zu verbinden. So entsteht großartiges Gebäck.
Alles auf diesem Planeten hängt miteinander zusammen, alle sind wir uns nähergekommen, denke ich.
Belami muss vor dem Geschäft warten, mich empfängt ein überwältigender Duft und das Lachen der Auszubildenden hinten im Lager. Gerade werden die Bestellungen für die letzten Zustellungen vorbereitet.
Beim Öffnen der Tür ertönt eine altmodische Klingel, und schon kommt Omar in den Verkaufsraum. Er begrüßt mich mit einer Umarmung und beginnt sofort, mir Empfehlungen für meinen Einkauf zu geben. Omar setzt auf traditionelles Handwerk, verarbeitet biologische und fair gehandelte Ware. Ich bestelle, Omar legt die Brote in meinen Rucksack und packt eine kleine Mehlspeise als Geschenk dazu. Und dann zeigt er mir einen großen Korb, der am Ladentisch steht. Langsam zieht er das weiße Leinentuch zur Seite und enthüllt einen großen Berg Erdbeeren, bereits schön rot und reif. Omar erzählt, dass seine Partnerin Sarah und er nicht weit von der Bäckerei entfernt in einem alten Gemeindebau wohnen. Auf dem Dach des Gebäudes haben die Bewohner:innen im Vorjahr einen großen Dachgarten errichtet. Dort werden Erdbeeren in senkrecht angebrachten Körben geschützt. Heuer ist die erste Ernte, die Früchte werden hier in der Bäckerei und in den Geschäften und Lokalen des Stadtteils verkauft.
Ich finde, es ist ein genialer Nebeneffekt der Stadt der Nähe, dass sie nicht nur die Wege verkürzt, sondern auch uns Bewohner:innen einander wieder näherkommen lässt. Die Aufspaltung unseres Lebens in Arbeitsorte und Wohnorte, in Orte des Freizeitkonsums, der Bildung und der Betreuung wurde aufgehoben, im Stadtteil selbst entstehen dadurch viel mehr Beziehungen. Soziale Geflechte, Freundschaften, Begegnungen sind in unserem Alltag wieder zur Normalität geworden. Die Singularisierung unseres Lebens ist Vergangenheit, ein neues Miteinander ist entstanden. Das ist wirklicher Wohlstand.
Als Belami und ich Omars Backstube verlassen, halte ich zwei Erdbeeren in der Hand, die mir mein syrischer Freund mitgegeben hat. Ich beschnuppere sie, als wären es Juwelen. Langsam genieße ich sie und freue mich über den süßen Geschmack. Sie zerschmelzen beinahe auf Zunge und Gaumen.
Nun geht es auf der anderen Straßenseite zurück nach Hause. In diesem Teil des Grätzels befindet sich die „Essbare Stadt“. Hier wurden Obstbäume und Beerensträucher gepflanzt, in kleinen Beeten wächst Gemüse. Die Anlagen werden von Anrainer:innen betreut, aber alle, die vorbeigehen, dürfen zugreifen. Wir schlendern an Apfel-, Kirschen- und Khakibäumen vorbei, aus dem Grün von Ribiselstauden leuchtet es schon rot, aus der Erde lugen die Blätter von Karotten und Radieschen hervor, daneben duften Minze und Zitronengras. Erste Früchte sind an den Bäumen, nur auf einigen Kirsch-, Apfel-, Quitten- und Birnbäumen leuchten noch frische Blüten. Bienen und Hummeln schwirren umher.
Nun kommen wir zur ehemaligen Trafik. In ihrem Keller befindet sich das Lager des „Food Coop“ unseres Wohngebiets: „Schmeckt“ nennt sie sich. Einmal pro Woche schicken die Landwirt:innen ihre Lieferungen in die Stadt, im Lagerraum können die bestellten Waren freitags abgeholt werden. Da der Großhandel umgangen wird, erhalten die Produzent:innen einen besseren Preis und Kund:innen Lebensmittel in einer besseren Qualität – und alle profitieren von mehr Nähe, Wertschätzung und dem Miteinander.
Das Erdgeschoß der benachbarten Trafik wiederum wurde zu einem „Offenen Haus“ umgebaut. Alt und Jung können sich hier treffen, gemeinsam Filme schauen oder sich wie früher bei Brettspielen messen, ganz ohne Konsumzwang, betreut von der Grätzelverwaltung.
Vorbei geht es am Einkaufszentrum, das dank 12.000 Solarpanelen viermal so viel Energie produziert, wie es verbraucht. An akuten Hitzetagen ist es unser Kühlraum, der allen zur Verfügung steht. Im Hitzeplan der Stadt ist festgeschrieben, dass alte und kranke Menschen betreut und mit kaltem Wasser versorgt werden, bei Bedarf können sie in den Hitzefluchträumen einige Zeit entspannen und Kraft finden.
Wie so oft, wenn ich hier entlangspaziere, freue ich mich darüber, dass die meisten Häuser frisch saniert sind. Das hat mit der Energiewende zu tun, die am Beginn des Umbaus der Städte, der Veränderung der Lebenskultur und des Wirtschaftens und lange vor der Umstellung der Mobilität stand.
Jedes Gebäude, an dem wir vorbeischlendern, produziert selbst Energie, es gibt kein Dach ohne Photovoltaikpaneele, kein Fenster ohne Solarfolie, keine Fassade ohne Solarputz zur Stromerzeugung. Viele Häuser besitzen hochreflektierende Dächer samt Dachbegrünung zur Verringerung der Sommerhitze und besseren Speicherung der Wärme im Winter.
Wir sind zurück bei unserem Wohnhaus, Belami wedelt in Vorfreude auf das Futter mit seinem Schwanz. Als wir das Gebäude betreten, höre ich beim Eingang eines meiner Lieblingsgeräusche, das Surren des Wechselrichters, der die verschiedenen Stromproduktionen im und am Haus in nutzbare Elektrizität verwandelt, das Haus versorgt und nicht verbrauchte Energie ins Netz einspeist.
Vor unserem Wohnungseingang erkenne ich jene Stelle, an der bis vor einigen Jahren noch unsere Gastherme angebracht war. Nun heizen – und kühlen – wir die ganze Stadt mithilfe des Fernwärmenetzes, das in der gesamten Stadt verlegt ist. Ergänzt wird das grüne Netz durch rund 100.000 Wärmepumpen.
Endlich gibt es nun Frühstück für den hungrigen Belami und für mich Omars Mehlspeise mit einem weiteren Espresso. Ich gieße mir kühles Leitungswasser in ein Glas, höre Belami schmatzen, blättere in meinen Tagebüchern, großen schwarzen Notizheften, die ich in den vergangenen fünfzehn Jahren eng beschrieben habe mit meinen Sorgen und Hoffnungen für die Zukunft, den Stationen der Veränderung, die wir schon nicht mehr für möglich gehalten hatten.
Beinahe hätten wir unsere Zukunft verspielt. Wir waren auf einem zerstörerischen Kurs. Heute sind wir zwar nicht gerettet, immer wieder werden uns die Folgen der jahrzehntelangen Untätigkeit in heftige Krisen stürzen, jeder Sommer ist auch hier in Europa durch Naturkatastrophen, deren Häufigkeit und Intensität weiter zunimmt, eine wachsende Herausforderung. Aber wir sind mittlerweile auf einem guten Weg, die Krise zu begrenzen, ihre hemmungslose Eskalation zu vermeiden. Wir haben viele unserer Lebensbereiche an die steigenden Temperaturen angepasst, konnten die Klimawende einleiten und vorantreiben, die CO2-Emissionen drastisch verringern.
Heute haben wir eine Chance, das Allerschlimmste zu verhindern, heute sind wir nach langen Kämpfen endlich auf dem richtigen Weg in die Zukunft. Und das Schöne daran ist, dass mit den vielen Veränderungen, zu denen wir gezwungen waren, um unsere Existenz zu sichern, unser Leben in vielen Bereichen schöner und angenehmer wurde. Wir haben gelernt, gemeinsam das Richtige zu tun. Endlich haben wir die Entwicklung in die Hand genommen, nachdem wir viel zu lange Mist gebaut hatten.
VOR DER WENDE
Mit einer Existenz von nicht einmal 300.000 Jahren sind „moderne Menschen“ die jüngste Säugetierart der Welt. Die meiste Zeit haben wir ähnlich wie die anderen Primaten jagend und sammelnd von den Geschenken der Erde gelebt. Und in ihrem faszinierenden Gleichgewicht, einem fein abgestimmten Supermechanismus sich wechselseitig stützender Untersysteme und genialer Schutzschichten, das vor 4,6 Milliarden Jahren in idealer Entfernung zu Sonne und Mond entstanden ist: ein einzigartiges Kunstwerk, auf dem komplexe Evolution und vielfältiges Leben möglich sind. Tausende Generationen von Menschen wurden geboren, lebten, starben im Einklang mit der Natur auf einem Planeten, der all seinen Bewohner:innen perfekte Bedingungen für ein gutes Leben bot.
Dann kam das Öl. Es veränderte alles und bescherte uns eine Zukunftsperspektive zwischen Wohlstand und Untergang. In nur zehn Generationen plünderten Menschen die Ressourcen der Erde, verstärkten die Vernichtung anderer Völker und Kulturen, versuchten, alles Lebendige zu beherrschen, verwüsteten die Pflanzenwelt, verpesteten die Atmosphäre, zerstörten die Natur, behandelten Tiere, als wären sie Dinge – und lösten damit das sechste Massensterben in der Geschichte des Planeten aus. Die Natur wurde zum Rohstoff degradiert und hemmungslos ausgebeutet. Ein Tsunami der Zerstörung wurde entfacht, wir befinden uns in immer schneller werdendem Tempo auf dem Weg in die Heißzeit.
Die Entwicklungen, die zur Erhitzung der Welt geführt haben, erinnern an den Untergang der Titanic – in Superzeitlupe. Im April 1912 wurden die Warnungen vor Eisbergen nicht ausreichend beachtet, die Rettungsboote boten nicht genügend Platz, Risiken wurden verleugnet. Die Katastrophe mit über 1.500 Toten war die Folge von Überschätzung, Sorglosigkeit und menschlichem Versagen. Frappant erinnert die Situation an die Sorglosigkeit im Umgang mit der fortschreitenden Erhitzung unseres Planeten: Seit Jahrzehnten wurden einschlägige Warnungen in den Wind geschlagen, Vorsorgemaßnahmen wurden unterlassen und das Handeln wurde immer wieder aufgeschoben – bis es fast zu spät war.
Nun, in den Zwanzigerjahren des 21. Jahrhunderts, leben wir im weichenstellenden Jahrzehnt. Unsere Generation entscheidet in den nächsten Jahren, ob die Klimakrise unkontrollierbar wird oder ob wir es schaffen, die Erderhitzung einzudämmen. Damit entscheiden wir darüber, wie die Erde in Zukunft aussehen wird, was Bestand haben und was nicht mehr sein wird. In diesem Sinn sind wir alle die letzte Generation. Die letzte, die noch maßgeblich gegensteuern kann.
Extreme Umwälzungen hat es auf der Erde mehrfach gegeben – aber noch nie haben sie sich in so kurzer Zeit auf einem dicht bevölkerten Planeten vollzogen. Und noch nie wurden sie von einer Spezies verursacht, noch dazu von einer, der ihre Verantwortung und die Auswirkungen ihres Handelns bewusst sein müsste.
Das bisher größte Massensterben der Erdgeschichte vor 252 Millionen Jahren war die Folge des Ausbruchs vieler Vulkane, die halb Sibirien mit Lava fluteten und große Kohle- und Erdölvorkommen in Brand steckten. Tausende Jahre hindurch wurden Unmengen von CO2 ausgestoßen, die Temperaturen stiegen um zehn Grad, 90 Prozent der damaligen Lebewesen überlebten die Krise nicht. Das Ökosystem des Planeten benötigte Millionen Jahre, um wieder in Balance zu kommen.
Diesmal übernehmen wir Menschen die Rolle der Vulkane, heute sind wir die Täter.
Wie konnte es so weit kommen?
Die menschlichen Gesellschaften sind auf ein stabiles Klima angewiesen. Das wissen wir seit Langem – und arbeiten doch daran, dies zu vernichten. Seit Jahrzehnten kennen wir die Technologien, die nötig sind, um die Balance auf dem Planeten zu erhalten. Wir wissen, dass der Raubbau an der Natur und die Zerstörung der Biodiversität unsere Lebensgrundlagen vernichten. Dass Eingriffe in die Systeme des Ausgleichs, etwa in die Strömungssysteme der Ozeane, unabsehbare Konsequenzen haben. Und dennoch handelten – und handeln – viele wie Brandstifter, als gäbe es kein Morgen, als hätten die nächsten Generationen kein Recht auf ein sicheres Leben, als stünde uns noch ein zweiter Planet zur Verfügung. Wir lebten in einer Persönlichkeitsspaltung zwischen Handlung und Wissen.
Wir Menschen haben unfassbar viel Mist gebaut.
Mit dem fortschreitenden Kapitalismus rückte nicht mehr das Sein in den Mittelpunkt unseres Glücks, sondern das Haben: ein Auto, eine Garage, ein Haus, ein Pool, noch ein Auto, später ein Carport und dafür ein weiteres Auto. In der Zeitmaschine des Konsums galt der neueste Computer bereits kurz nach dem Kauf als veraltet, das Auto nach wenigen Zehntausend gefahrenen Kilometern als schrottreif, die Kleidung nach Wochen als untragbar. Das Wegwerfen, die Verschwendung unserer Ressourcen wurde zur Norm; die Angst, bei der Schnäppchenjagd zu kurz zu kommen, zum ständigen Begleiter; die Kommerzialisierung allen Lebens und Sterbens zum allumfassenden Prinzip, das von Superreichen zur Perversion getrieben wurde.
Doch der viele Reichtum und Wohlstand, den wir anhäuften, blieb einem Gutteil der Menschheit und der Mehrzahl der Weltregionen vorenthalten. Ja, es wurden Fortschritte gemacht, der Zugang zur Bildung verbessert, die Alphabetisierungsrate erhöht, Kindersterblichkeit und extreme Armut verringert. Ein Kind, das im Jahr 1900 geboren wurde, musste den Ersten Weltkrieg, die Spanische Grippe, die Wirtschaftskrise, den Zweiten Weltkrieg überleben. Die Herausforderungen der im Jahr 2000 Geborenen sind damit nicht vergleichbar, aber es begann eine andere Art von Krieg.
Viele hatten verlernt, zu teilen. Verlernt, gerecht zu leben. Verlernt, Verantwortung zu übernehmen. Verlernt, Solidarität und Empathie zu leben. Verlernt, zu sein. Mit dieser Entwicklung wurden auch wir, die vergleichsweise Reichen, immer ärmer. Und merkten es nicht einmal. An die steigenden Temperaturen, den sinkenden Grundwasserspiegel, das extremere Wetter gewöhnten wir uns: Erhitzung, lange Dürrephasen, dann wieder Starkregen, Extremwetterereignisse – zuerst nur in fernen Regionen –, die Millionen Menschen aus ihrer Heimat vertrieben, erreichten später auch unsere Breiten. All diese Entwicklungen nahmen wir jahrzehntelang hin wie unsere Vorfahren den Frosteinbruch im Frühling, die Heuschreckenplage vor der Ernte oder das Hochwasser im Winter: als schicksalhafte Ereignisse, auf die wir scheinbar keinen Einfluss nehmen können – und die irgendwann vorübergehen würden.
Lethargie wurde zu unserer Religion, Gewohnheit unser erstes – und letztes – Gebot. „Es wird schon wieder“ erhoben wir zu unserem Mantra und das Leitmotiv der Operette von Johann Strauß „Die Fledermaus“ zu unserem Lebensmotto: „Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist.“ Durch diese Untätigkeit schufen wir neue Wirklichkeiten – nicht nur für andere Regionen und mit Verzögerung auch für uns, sondern auch für unzählige Generationen nach uns. Denn das ausgeklügelte System Natur reagiert mit starken Verzögerungen auf die ihm zugefügten Schäden. Lange Zeit sind diese kaum erkennbar, aber nach Überschreiten bestimmter Grenzen entwickelt sich die Krise exponentiell und droht, außer Kontrolle zu geraten. Und bringt als Resultat das Ende der Welt, wie wir sie kennen, das Ende einer Zukunft, die wir gestalten können.
Sind Treibhausgase erst einmal in zu großen Mengen in die Atmosphäre gelangt, bleiben sie dort vielfach unendlich lange, und die dadurch verursachte Erhitzung kann Tausende Jahre anhalten. Sogar wenn wir es schaffen, nicht mehr Treibhausgase zu emittieren als gespeichert werden, also Netto-Null-Emissionen zu erreichen, wird binnen fünfzig Jahren zwar die Hälfte der Schadstoffe absorbiert. Im weiteren Verlauf jedoch erfolgt der Abbauprozess immer langsamer und nach 500 Jahren sind noch immer 30 Prozent der ursprünglichen Konzentration vorhanden. Bis wir – ohne weiteren zusätzlichen Treibhausgasausstoß – eine CO2-Konzentration erreicht haben werden, die dem vorindustriellen Niveau entspricht, würde es bis zu 100.000 Jahre dauern. Einmal geschaffene Erhitzung könnte Zehntausende Jahre anhalten.
Ähnlich verhält es sich mit der Wärme, die in den Weltmeeren gespeichert ist. Die Erdoberfläche ist zu 71 Prozent mit dem Wasser der Meere bedeckt, das bis zu Tiefen von 11.000 Metern reicht und 80 Prozent des Lebens auf dem Planeten Erde beherbergt. Lange Zeit dienten diese Wassermassen unbemerkt als Klimaanlage des Planeten. Die Meere nehmen Jahr für Jahr eine Energiemenge auf, die vergleichbar ist mit 134 Atombomben. Meere sind demnach ein gigantischer Puffer, weil sie tausendmal mehr Wärmeenergie als die Atmosphäre speichern. Dadurch verzögerten die Ozeane jahrzehntelang die Erhitzung der Erde. Doch erst schleichend, nun aber plötzlich mit zunehmender Geschwindigkeit begann auch die Temperatur der Ozeane anzusteigen. Diese Erwärmung greift in das maritime Leben ein, verändert und schädigt es, verringert den Sauerstoffgehalt und die Speicherleistung des Wassers. Sie führt dazu, dass sich das Volumen des Wassers ausdehnt und dadurch der Meeresspiegel steigt, sie ändert die Strömungsverhältnisse der Ozeane und damit den Transport von Wasser und Wärme, der verschiedene Teile der Erde erst bewohnbar macht.
Al Gore, Nobelpreisträger und ehemaliger Vizepräsident der USA, setzt in seinem 2006 veröffentlichten Dokumentarfilm „Eine unbequeme Wahrheit“ ein Bild ein, das unser Verhalten auf den Punkt bringt: Ein Frosch sitzt in einem Glas mit kaltem Wasser. Er fühlt sich wohl. Dass die Temperatur langsam, aber stetig erhöht wird, merkt er nicht, weil dies in kleinen Schüben geschieht. Er ist nicht alarmiert, er flüchtet nicht, wie er es gemacht hätte, wenn er ins heiße Wasser gefallen wäre, sondern bleibt so lange sitzen, bis das Wasser kocht und er stirbt. Eine tödliche Gewöhnung.