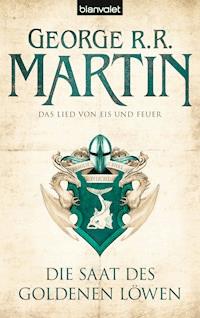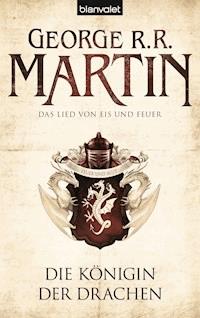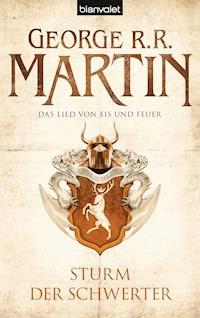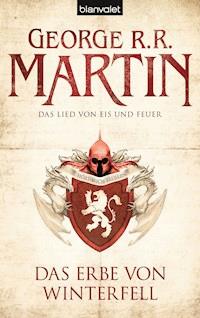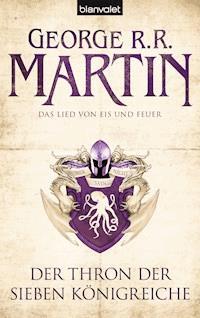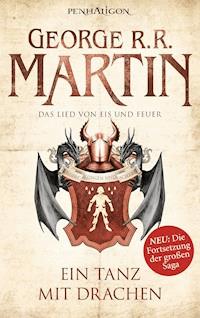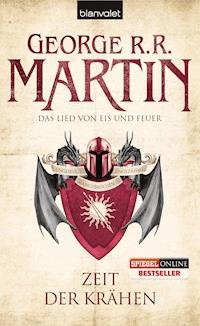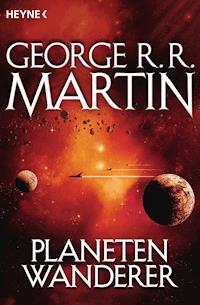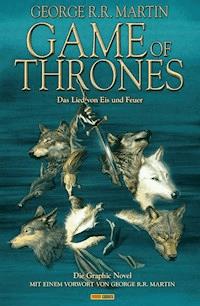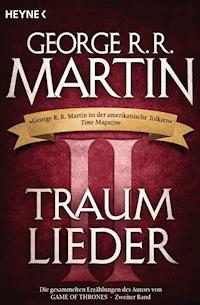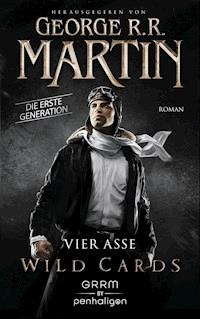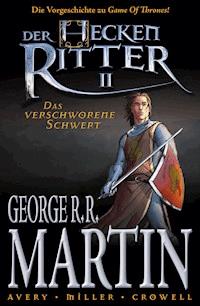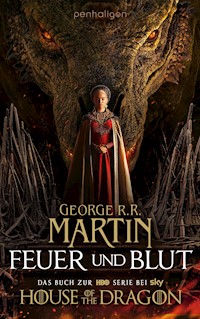8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Wild Cards - American Heroes
- Sprache: Deutsch
The World's next SUPERHERO!
Seit sich in den Vierzigerjahren das Wild-Card-Virus ausgebreitet hat und Menschen mutieren lässt, gibt es neben den normalen Menschen auch Joker und Asse. Joker weisen lediglich körperliche Veränderungen auf, während Asse besondere Superkräfte besitzen.
Da ist zum Beispiel Jonathan Hive, der sich in einen Wespenschwarm verwandeln kann, oder Lohengrin, der eine undurchdringliche Rüstung heraufbeschwört. Doch wer ist Amerikas größter Held? Diese Frage soll American Hero, die neueste Casting Show im Fernsehen, endlich klären.
Für die Kandidaten geht es um Ruhm und um so viel Geld, dass sie beinahe zu spät erkennen, was wahre Helden ausmacht.
Alle Wild Cards-Reihen im Überblick
Wild Cards – Die erste Generation:
Band 1: Vier Asse
Band 2: Der Schwarm
Band 3: Der Astronom
Wild Cards – American Heroes:
Band 1: Das Spiel der Spiele
Band 2: Der Sieg der Verlierer
Band 3: Der höchste Einsatz
Wild Cards – Jokertown:
Band 1: Die Cops von Jokertown
Band 2: Die Gladiatoren von Jokertown
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 751
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
unterstützt von Melinda M. Snodgrasspräsentiert
Das Spiel der Spiele
Wild Cards 1
Geschrieben vonDaniel Abraham – Melinda M. Snodgrass – Carrie Vaughn – Michael Cassutt – Caroline Spector – John Jos. Miller – George R. R. Martin – Ian Gregillis – S. L. FarrellIns Deutsche übertragenvon Simon Weinert
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel »Wild Cards – Inside Straight« bei Tor Books, New York.
Deutsche Erstveröffentlichung August 2014
bei Penhaligon, einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, München.
Copyright © 2008 by George R.R. Martin and the Wild Cards Trust
Published by agreement with the authors and the authors’ agent, The Lotts Agency, Ltd.
Copyright © der Vorbemerkung 2014 by Simon Weinert
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2014 by Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Redaktion: Hannes Riffel
HK · Herstellung: sam
Umschlaggestaltung und Composing Art: Isabelle Hirtz, Inkcraft, unter Verwendung einer Fotografie von Phoung Herzer, Dojo Filmhouse; Fersch Media
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-12468-7V004
www.penhaligon.de
Für Kay McCauley, das Agentenass,das uns immer Trümpfein die Hand gibt
Vorbemerkung
Kaum hatte die Menschheit die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs überstanden, da brach bereits das nächste Unheil über sie herein. Ausgerechnet der verbrecherische Dr. Tod stolperte im Wrack eines außerirdischen Raumschiffs über das Alienvirus Takis-A. Damit erpresste er von seinem Luftschiff aus die Bevölkerung Manhattans. Ein wagemutiger Pilot stellte sich dem Schurken am Himmel über New York entgegen und opferte sein Leben in einer denkwürdigen Luftschlacht. Doch vergebens. Das Virus wurde freigesetzt. Und Jetboy ging postum als einer der größten Helden aller Zeiten in die Geschichte ein.
Rasend schnell breitete sich das Virus aus. Der Erreger überschreibt die menschliche DNA und führt zu Mutationen. Doch nicht alle Betroffenen erleiden dasselbe Schicksal, sondern es ist wie beim Pokern: Manche haben gute Karten, andere nicht. Aber seien wir ehrlich: Die meisten haben Pech, ziehen die Pikdame und gehen drauf. Nur jeder Zehnte zieht einen Joker, verwandelt sich auf häufig groteske Weise, kommt aber mit dem Leben davon. Heute sind die Joker nicht mehr aus der Gesellschaft wegzudenken.
Nur den allerwenigsten spielt das Virus ein Ass in die Hand. Diesen Glücklichen verleiht die Mutation meist keine sichtbaren Merkmale, sondern besondere, übernatürliche Fähigkeiten. Die Geschichte der Nachkriegszeit bis heute ist voll von Assen, die als Schurken oder Helden, als Promis im Rampenlicht oder als Agenten im Geheimen die Geschicke der Welt beeinflusst haben. Und so erstaunlich die Superkräfte der Asse auch sind, so sind sie doch Teil des Alltags geworden. Im Fernsehen kann man ihnen genauso begegnen wie am Arbeitsplatz. Niemand hätte das für möglich gehalten, als Jetboy sich der Gefahr aus dem Weltraum entgegenwarf. Aber die Welt hat sich tiefgreifend verändert, seit das Wild-Card-Virus die Karten verteilt.
Jonathan Hive
Daniel Abraham
<< II nächste Seite >>
1. Wer zur Hölle war Jetboy?
Heute um 13:04
Geschichte, Jetboy | Nachdenklich | »These Are The Fables« – The New Pornographers
Wer zur Hölle war Jetboy?
Mein Großvater hat versucht, es mir zu erklären, aber ich war noch zu jung und hab’s nicht kapiert. Ein Fliegerass, hat er gesagt, und zwar noch bevor es Joker gegeben hat. Das wollte mir nie so recht in den Kopf. Wie konnte er ein Ass sein, noch dazu eines, das flog, bevor es überhaupt Joker gab? Und das alles passierte während der Weltwirtschaftskrise, also kurz vor Napoleon, der gleich nach dem Untergang des Römischen Reiches das Zepter übernommen hat. Als Jetboy starb, hatte mein Großvater noch nicht mal ein Mädchen geküsst. Ewig her.
Seither konnte ich mir ein besseres Bild von Geschichte machen. Zum Beispiel weiß ich mittlerweile, dass es ein Mittelalter gab. Mir ist inzwischen bekannt, dass vor Christina Ricci schon andere Frauen existiert haben, auch wenn ich immer noch nicht recht weiß, wieso überhaupt. Ich habe alle Undergroundcomics von R. Crumb über den Sleeper gelesen. Mein Vater hat mir Geschichten über Turtle, die großmächtige Schildkröte, erzählt. Meine Babysitterin in der fünften Klasse – die kiffte und manchmal vergaß, einen BH zu tragen – erzählte blutrünstige Geschichten über Fortunato, das Zuhälterass, das seine Fähigkeiten durch Sex erlangte. Ich erlebte mit, wie Tarantino die ganzen Klischees der Wild-Cards-Modewelle zu recyclen versuchte und sich wie ein Notarzt auf Speed bemühte, ihnen neues Leben einzuhauchen.
Als ich mein Ass gezogen hatte, dachte ich, das wäre das Coolste von der Welt. Ich war nicht mehr Jonathan Tipton Clarke, sondern ich war der krasse Jonathan Hive. Ich war der heißeste Typ in der ganzen Milchstraße. Ich war das Ding, das stechen konnte wie eine Biene. Ich kann euch versichern: Nichts hält Arschlöcher so effektiv davon ab, einen zu triezen, wie wenn man sich vor ihren Augen in einen menschengroßen Schwarm kleiner stechender Wespen verwandelt. Damit stopft man diesen Wichsern echt das Maul. Ich dachte mir, ich bräuchte nicht zur Schule zu gehen und müsste mir keine Gedanken darüber machen, wie ein Wespenschwarm seine Miete bezahlt. Ich war sechzehn und ein Ass. Ich war Gott.
Vielleicht wollte Großvater deshalb immer über Jetboy reden. Jetboy, der keine übermenschlichen Fähigkeiten besaß. Jetboy, der verhindern wollte, dass sich das Wild-Card-Virus auf der Welt ausbreitete, und bei dem Versuch gescheitert ist.
Jetboy – so dachte ich während meiner Kindheit und Jugend und auch noch als Erwachsener, fast bis heute – war ein erbärmlicher Loser, der vor einem halben Jahrhundert gestorben ist. Aber die Wahrheit sah anders aus: Für meinen Großvater war er ein Held, und mein Großvater war nicht auf den Kopf gefallen.
Als Großvater auf die Mittelschule kam, gab es noch keine Asse auf der Welt. Als er auf die Highschool kam, waren sie überall. Er war schon auf der Welt, als das Virus zuschlug. Er hörte von den neunzig Prozent, die die Pikdame gezogen hatten. Noch während die Leute Joker versteckten, als wären sie Gestalten aus einem Film von David Lynch, schnappte er schon die ersten Gerüchte über sie auf. Und er hat die ersten Asse gesehen. Golden Boy. Und Envoy – den »Gesandten«.
Wie kann ich mir diesen Umbruch vorstellen? Wie kann ich mich als ein Kind meiner Zeit zurückversetzen und ermessen, wie es in einer Welt ohne Joker, geschweige denn ohne Jokerrechtsbewegung gewesen sein mag? In einer Welt, in der niemand ernsthaft geglaubt hat, dass es Aliens gibt? In der Telefone noch Wählscheiben hatten und niemand sein Auto abschloss?
Es ist schwer – und es war stets schwer –, auf die unbedarfteren, unwissenden Zeiten zurückzublicken und sich ein Grinsen zu verkneifen. Heute wissen wir es besser. Wir wissen mehr. Wir sind mit Präsident Barnett aufgewachsen. Wir haben die Bilder des Roxkrieges gesehen. Wir wissen, was passieren kann, wenn man in den Kampf zweier Asse verwickelt wird. Dass sie Häuser einreißen können, dass sie uns mit Laserstrahlen aus ihren Augen töten oder uns in Stein verwandeln können, ohne es überhaupt zu wollen. Wir können jederzeit auf jede nur erdenkliche Weise draufgehen, und es gibt keine Möglichkeit, sich davor zu schützen. Da kann man nicht von uns erwarten, dass uns ein Typ zu Tränen rührt, der, noch bevor unsere Eltern zur Welt kamen, aus einem Flugzeug gefallen ist.
Die Leute meiner Generation teilen die Geschichte grob in zwei Epochen ein: vor dem Internet und danach. Aber schon davor gab es einen Umbruch, und vielleicht hat es immer schon Umbrüche gegeben. Vielleicht hat jede Generation etwas erlebt, das die Welt für immer veränderte, und wir wissen davon bloß nichts, weil wir nicht dabei waren.
Ich war nun ein Ass, ja, aber ich wurde trotzdem älter und ging aufs College. Ich habe meinen Abschluss gemacht und ein kleines Treuhandvermögen geerbt, das ich jetzt zügig ausgebe. Ich schreibe gelegentlich Zeitschriftenartikel und arbeite an einem Roman. Ich bin ein Ass, und das ist genial. Aber ich bin auch Journalist – oder werde mal einer sein, wenn ich Glück habe. Dass ich mich in einen Wespenschwarm verwandeln kann, wird mir nicht helfen, Abgabetermine einzuhalten, die rechten Worte zu finden oder meine Stromrechnung zu bezahlen. Was mein Großvater mir klarmachen wollte, ist vielleicht doch langsam bei mir durchgesickert. Oder ich habe seine Botschaft bis heute nicht verstanden und nur selbst etwas dazugelernt.
Und zwar Folgendes, Leute:
Jetboy markierte das Ende einer Welt. Er war der letzte Mensch, der gestorben ist, bevor die Wild Cards kamen, und sein Zeitalter starb mit ihm. Er ist ein Symbol, dessen Bedeutung ich nie begreifen werde. Höchstens so, wie ich König Artus, JFK und all die anderen glorreichen Verlierer der Weltgeschichte verstanden habe. Mir wird er nie das bedeuten, was er meinem Großvater bedeutet hat, aber nicht, weil ich gebildeter, schlauer oder abgebrühter wäre als er. Sondern weil sich die Welt einfach verändert hat.
Mich wird Jetboy immer nur daran erinnern, dass es stets Menschen gegeben hat – wenn auch nicht viele –, die für eine Sache gekämpft haben, auf die es ankam. Und (Jungs, jetzt setzen die Violinen ein) dass ein Held zu sein nicht automatisch bedeutet, dass man gewinnen muss. Manchmal geht es vielleicht einfach bloß darum, dass man einen denkwürdigen Abgang hinlegt.
Und? Wäre das nicht ein Spruch fürs Leben?
2 Kommentare | Kommentar hinterlassen
♠
Die dunkle Seite des Mondes
Melinda M. Snodgrass
Irgendwo rechts von ihr fielen Schüsse.
Überall sonst auf der Welt hätten die Leute bei diesem Geräusch die Flucht ergriffen, aber hier in Bagdad war es nur eine von vielen Stimmen in der Symphonie der Festlichkeiten. Das Rattern eines Maschinengewehrs bildete einen schrillen Kontrapunkt zum dröhnenden Bass der Raketen. Goldene Funken wurden an den Nachthimmel gesprüht und umgaben die nadelspitzen Minarette wie Heiligenscheine. Wie in Zeitlupe schienen sie herabzuschweben. Kurz beschienen die Lichter des Feuerwerks die Gesichter in der Menschenmenge. Männer wirbelten tanzend umher, glitzernde Tränen auf den Wangen. Mit weit aufgerissenen Mündern sangen sie zum Ruhm ihres Kalifen.
Kamal Faraq Aziz, der neue ägyptische Präsident, war nach Bagdad gekommen, um sich dem Kalifen zu unterwerfen und sein Land mit den Nationen Syriens, Palästinas, Iraks, Jordaniens und Saudi-Arabiens zum wiedererstandenen Kalifat zu vereinigen. In Kairo, Bagdad, Damaskus, Ostjerusalem und Mekka feierten die Massen. In Libanon, Katar und Kuwait erzitterten die Führer der wenigen verbliebenen souveränen Einzelstaaten Arabiens.
Lilith zog ihren Shemag über Nase und Mund. Zum einen, um die Tatsache zu verschleiern, dass sie eine Frau war, aber auch zum Schutz gegen den von tausend trampelnden Füßen aufgewirbelten Staub, der sie zu ersticken drohte. Nur im Irak konnte man den feuchten, stechenden Geruch von Wasser und Schilf in der Nase haben, dabei auf Sand beißen und nächtliche Temperaturen von über fünfunddreißig Grad erleiden. Das Gewand klebte ihr am Leib, und sie spürte, wie ihr der Schweiß unangenehm die Wirbelsäule hinunterlief. Als Saddam noch im Palast lebte, hatten sich die Felder um das Gebäude in üppige Gärten verwandelt. Doch der Kalif hatte beschlossen, den irakischen Bauern kein Wasser wegzunehmen, und ließ die Gärten verdorren.
Von ihrem Aussichtspunkt nahe der Gartenmauer hatte Lilith einen guten Blick auf das massige Palastgebäude. Das Feuerwerk tauchte die weißen Marmormauern in ein Kaleidoskop aus Farben. Ein Mann in weißem Gewand und einer Kufiya auf dem Kopf trat auf einen Balkon im dritten Stock. Er ging hin und her, legte die Hand auf die gemeißelte Balustrade, sah in die Menschenmenge hinunter, ging erneut hin und her und verschwand schließlich wieder im Haus.
Idiot, dachte Lilith. So erwischt dich noch ein Querschläger.
Sie wartete, bis besonders spektakuläre Feuerwerkskörper den Nachthimmel erleuchteten und alle mit täppischem Staunen die Köpfe in den Nacken warfen. Dann schlang sie die Falten ihrer Dishdasha und Dschallabija um sich und spürte dieses seltsame innerliche Reißen, während sich der Staub und Beton unter ihren Sandalen in weniger Staub auf poliertem Marmor verwandelte.
Prinz Siraj starrte sie mit offenem Mund an. Er sah gut aus, doch das glatte runde Gesicht und der Bauch, der sich unter dem Gewand wölbte, zeigten, dass ein reichliches Nahrungsangebot für einen Beduinen auch gewisse Risiken barg. Und da half es nicht, dass die königliche Familie Jordaniens schon seit vier Generationen nicht mehr in der Wüste lebte. Zweitausend Jahre spärliche Kost steckten ihnen tief in den Knochen, und bei jeder Mahlzeit flüsterte ihnen eine Stimme ins Ohr, dass dies auf lange, lange Zeit der letzte Bissen sein könnte.
»Hat …« Er hustete und fing noch einmal von vorn an. »Hat Noel Sie geschickt?«
»Ja, zum Glück für Sie.« Lilith trat ins Zimmer. Eine Brise vom Tigris bauschte den weißen Stoff des Moskitonetzes über dem Bett. Der Boden war mit einem aufwendigen Mosaik aus vielen bunten Steinen bedeckt. Es zeigte König Nebukadnezar beim Jagen von Wasservögeln im Schilf. Klar, Saddam war ja auch ein weltlicher Herrscher gewesen. Lilith fragte sich, wie lange es noch dauern würde, bis die islamistischen Tugendwächter des Kalifen dieses Kunstwerk zerstörten.
»Ich habe Kleider für Sie.« Siraj griff nach dem schwarzen Stoff, der auf dem Bett lag, und drückte ihr Abaya und Burka in die Hand.
Sie zog den Shemag vom Kopf, und ihr hüftlanges schwarzes Haar fiel herab. Siraj starrte sie an. Mit ihren knapp eins achtzig überragte Lilith den Prinzen um einige Zentimeter. Sorgen machte sie sich nur wegen ihrer silbernen Augen, dem Vermächtnis der Wild Card, doch zum Glück schrieb der Islam den Frauen ja vor, stets züchtig den Blick zu senken.
»Noel sagte, Sie seien zusammen in die Schule gegangen?«, fragte sie, während sie das zeltartige Kleidungsstück über ihren Körper stülpte. Mit einer ihrer Klingen schnitt sie unauffällige Öffnungen in den Stoff, durch die sie hindurchgreifen konnte.
»Ja. In Cambridge. Wir waren dicke Freunde. Er liebt unsere Kultur.« Die Sätze brachen wie hektische kleine Geräuschexplosionen aus ihm hervor.
»Würde ein Freund Sie in eine solche Situation bringen?«, fragte Lilith. Es irritierte sie, durch das Stoffgitter schauen zu müssen, und der Schleier engte ihr Sichtfeld ein. Unter den Kleiderschichten fühlte sie sich dennoch nackt.
»Ich kann eine Brücke sein«, sagte der Prinz, während er im Zimmer auf und ab ging. Ständig verschränkte er die Hände und löste sie wieder. »Zwischen unseren beiden Welten.«
»Es gibt nur eine Welt«, sagte Lilith und fügte dann hinzu: »Haben Sie die Karte?«
»Ja.« Er reichte ihr ein Stück Papier, und als sich ihre Finger berührten, zog er hastig die Hand zurück.
Das wunderte Lilith nun doch. Er war in England ausgebildet worden und hatte lange im Westen gelebt. Vielleicht war er nur deshalb so nervös, weil er sich in der Nähe des Kalifen befand. Sie sah auf das Blatt Papier hinab. Darauf war so etwas wie ein Wabenmuster abgebildet. »Ein Tipp wäre ganz hilfreich. Sie wissen ja«, sagte Lilith mit übermäßig betontem britischen Akzent, »dass hier lauter durchgeknallte religiöse Spinner schlafen.«
Siraj errötete. »Er wechselt das Zimmer … ziemlich oft.«
»Tja, das ist … ärgerlich.«
»Er leidet zunehmend an Verfolgungswahn.«
»Verständlich. Wenn man bedenkt, dass seine eigene Schwester ihn fast ermordet hätte.« Sie grinste ihn breit an, bevor ihr bewusst wurde, dass er ihr Gesicht nicht sehen konnte. Was für eine alberne Kultur.
Als hätte sie kein Wort gesagt, fuhr Siraj fort: »Obwohl ich seinem Beraterstab angehöre, habe ich den Eindruck, dass er … nun ja, ich glaube, dass er kein Vertrauen mehr zu mir hat. Angefangen hat es, als der Rechtschaffene Dschinn auftauchte. Der Dschinn hat etwas gegen westliche Erziehung. Er glaubt, dass sie uns befleckt.« Er rieb sich immer hektischer die Hände. »Sie dürfen nicht versagen.«
»Beruhigen Sie sich. Heute haben Sie es mit einem Profi zu tun.«
Der Prinz sah sich um, als erwartete er, dass die Zimmerwände einstürzen und ihn begraben würden. »Es ist vielleicht nicht so einfach, wie Sie glauben. Der Dschinn begleitet den Kalifen überallhin. Er ist unheimlich stark und kann sich in einen Riesen verwandeln.«
»Dann trifft es sich ja gut, dass die Räume hier klein sind.«
Ihre flapsige Antwort gefiel Siraj nicht im Mindesten. »Da der Dschinn Sie nicht zu beeindrucken scheint, sollten Sie daran denken, dass da auch noch Bahir ist.«
»Über Bahir bin ich mir durchaus im Klaren.«
Doch auch diese Erwiderung brachte seinen nervösen Redefluss nicht zum Stocken. »Bahir kann teleportieren. Manch einer seiner Feinde hat das zu seinem Leidwesen festgestellt, als Bahir plötzlich mit seinem Krummsäbel hinter ihm stand. Doch dann ist es schon zu spät, um den Kopf noch zu retten.«
»Ein bisschen theatralisch, finden Sie nicht? Eine Knarre wäre leichter zu handhaben und sicherer.« Deutlich spürte sie die Pistole, die sie an der Innenseite ihres Schenkels festgeschnallt hatte.
»Na schön, ja, das ist ein Klischee, aber es ist auch symbolisch. Die einfachen Leute finden so etwas großartig.«
»Dieser ganze Symbolismus ist der Grund, weshalb die Araber verachtet und nicht ernst genommen werden.« Lilith blickte noch einmal auf die Karte. »Ich kann nicht einfach in irgendwelche Zimmer teleportieren und hoffen, den Kalifen dort zu finden. Haben Sie eine Ahnung, wo er sein könnte?«
»Im Moment ist er beim Bankett«, erwiderte der Prinz. »Mit den Ägyptern. Mit Aziz.«
Kamal Faraq Aziz. Ägyptens neuer Mann fürs Grobe war an die Macht gekommen, weil die Amerikaner durch ihre Einmischungen eine freie Wahl erzwungen hatten. Bei dieser Wahl wurden die Säkularen aus der Regierung gefegt, und die Fundamentalisten des Ichlas al-Din kamen an die Macht. »Ist es ein Problem, dass Sie da nicht anwesend sind?«
Siraj schüttelte den Kopf. »Ich habe Brechwurzelsirup genommen. Niemand bezweifelt, dass mir übel ist.«
»Ah, Brechwurzelsirup. Sehr beliebt bei britischen Schulknaben.« Lilith ging ein paar Schritte hin und her. »Nun, ich kann ja nicht mitten in die Party reinplatzen.« Die Falten ihrer Burka wanden sich um ihre Beine. »Ist der Kalif ein typischer Mann? Wird er bis zum Morgengrauen bei den Jungs bleiben?«
»Er ist ein seriöser Mensch, der sich nichts aus Frivolitäten macht.« Siraj hielt inne.
Lilith entging sein nachdenklicher Gesichtsausdruck nicht. »Was?«
»Er hängt sehr an seiner ersten Frau, Nashwa. Oft feiert er seine Erfolge mit ihr.«
»Wie gut, dass ich ein Mädchen bin.«
»Was wollen Sie damit sagen?«
»Dass ich schon immer mal einen Harem von innen sehen wollte.«
♣
Vor der Tür zu den Frauengemächern standen zwei Soldaten Wache. Ihre eintönigen graubraunen Uniformen wurden von einem grünen Tuch aufgelockert, das sie sich um den Hals gewickelt hatten. Ihre Blicke glitten über Lilith hinweg, ohne auf ihr zu verweilen.
Mit breitem ländlichen Akzent sagte Lilith: »Der Kalif lässt seinen geliebten Frauen das hier schicken, aber der Kalif, groß sei sein Ruhm, hat auch nichts dagegen, wenn seine treuen und tapferen Soldaten ein paar dieser Leckereien kosten.«
Sie wiederholten das Kalifenlob, und Lilith hielt den jungen Männern das Tablett hin, damit sie sich etwas Süßes nehmen konnten. Ihr fiel auf, dass die beiden schmutzige Fingernägel hatten. Dann huschte sie unter ihren Armen hindurch und stieß sacht die Tür auf. Der schwere Türflügel fiel hinter ihr wieder zu und schloss das tiefe Brummeln der Männerstimmen aus.
Sie betrat ein großes Zimmer; es war hübsch, aber nicht über die Maßen prächtig. An der linken Wand schimmerte unter der weißen Farbe noch ein Gemälde hindurch. Die Luft war von Rosenwasser und Orangenöl geschwängert.
Zwei Frauen standen am Fenster und blickten durch die Vorhänge auf das Feuerwerk hinaus. Rotes, blaues, goldenes und grünes Licht ergoss sich auf den Stoff und ihre Gesichter. Eine von ihnen war hochschwanger – ihr Gesicht war aufgedunsen, ihre Finger waren geschwollen, und ihr Bauch war so stark gewölbt, dass es bis zur Geburt nur noch Tage sein konnten. Die andere befand sich etwa in der Mitte der Schwangerschaft, in jenem Stadium also, in dem Frauen zu leuchten scheinen.
Zusammengerollt auf einem Sofa lag eine weit jüngere Frau. Sie war höchstens Anfang zwanzig und um einiges schöner als die beiden anderen Frauen, und nicht nur deshalb, weil sie nicht wie eine trächtige Kuh aussah. Sie blätterte so rasch in einem französischen Modemagazin, dass sie unmöglich etwas davon wahrnehmen konnte. Dabei schob sie die Unterlippe vor, und die goldene Haut zwischen ihren Brauen runzelte sich.
Lilith bot das Essen auf dem Tablett erst den Schwangeren an. Mit gierigen Fingern stürzten sie sich auf die Süßigkeiten. Dann ging sie zu der jungen Frau, die ein schmales Stück Melone nahm.
Lilith ergriff die Gelegenheit beim Schopfe. Das Schlimmste, was ihr passieren konnte, war, dass sie sich eine Ohrfeige einfing. »Ich bin in Paris zur Schule gegangen«, sagte sie leise. »Bevor mein Vater die Familie nach Hause geschickt hat.«
»Dein Dialekt«, sagte das Mädchen, »hört sich saudisch an.«
»Ich komme aus Kuwait.« In das letzte Wort legte sie viel Gefühl. »Bist du schon lange hier?«
»Drei Monate.«
»Du hast bestimmt Heimweh.«
Das Mädchen fing an zu weinen.
»Entschuldige, Herrin. Wünschst du, dass ich wieder gehe?«
Die Hand des Mädchens umklammerte Liliths Ärmel. »Nein, erzähl mir von Paris.«
Lilith bauschte Impressionen ihrer tatsächlichen Besuche mit romantischen Filmszenen auf. Sie erzählte von den mit Lichtern behängten Restaurantschiffen, die unter mittelalterlichen Brücken hindurchglitten und auf denen getanzt wurde, während sich Notre-Dame im Wasser spiegelte. Sie erzählte von Spaziergängen entlang der Stände am linken Seineufer, wo alte bucklige Männer in abgewetzten Jacken Bücher verkauften, die noch viel älter als sie selbst waren. Von Montmartre, wo Kinder Tauben fütterten und hoffnungsvolle junge Künstler Ansichten der berühmten Kirche malten. Lilith entführte ihre hingerissene Zuhörerin in die Bäckereien, in denen es so intensiv nach Brot und Backwaren roch, dass man die Luft kauen konnte.
Die Augen der jungen Frau funkelten aufgeregt, aber auch wütend. Lilith erfand eine Leidensgeschichte und fabulierte einen selbstherrlichen Vater herbei, der ganz begeistert vom Aufstieg des Neuen Kalifats war. Auf der Stelle schickte er die Familie wieder zurück, damit ihre beiden Brüder etwas zur Renaissance des Islam beitragen konnten. »Und er selbst ist in Paris geblieben«, ergänzte die junge Frau, und ihre Worte klangen ein wenig giftig.
Lilith zuckte mit den Schultern. »Ja, aber er ist eben auch nur ein Mensch. Das sind sie alle, bis auf unseren ruhmreichen Kalifen, lang möge er leben und regieren.«
»Ja, er ist ein guter Mensch«, pflichtete ihr das Mädchen bei.
»Wie ist er denn? Hast du viel Zeit mit ihm verbracht? Besteht die Chance, dass er euch besucht? Ich würde ihn so gerne einmal sehen. Bisher habe ich ihn nur aus der Ferne erblickt.« Lilith stieß die Sätze hastig hervor, um ihrem Gegenüber keine Gelegenheit zu einer Antwort zu geben.
Die Frau lachte. »Nein, tut mir leid. Er wird nicht kommen. Er bestellt immer eine von uns zu sich.« Wieder schob sich die volle Unterlippe vor. »Und ich werde es nicht sein. Nicht heute Abend. Er wird mit Nashwa reden wollen.«
Nashwa, Ende vierzig, die erste Frau des Kalifen und Mutter seines Sohnes und Erben, Abdul-Alim. Und die Tochter eines prominenten jemenitischen Geschäftsmanns. »Dann gehe ich mal besser und bringe ihr Erfrischungen«, sagte Lilith. Sie stand auf und nahm das Tablett.
»Sie ist in ihrem Zimmer«, sagte die jüngste der Frauen und zeigte flüchtig den Korridor hinunter. Lilith ging los. »Übrigens, ich heiße Amira. Wie heißt du?«
»Sura«, erwiderte Lilith und genoss den versteckten Witz. Der Name bedeutete: Die, die nachts unterwegs ist.
♥
»Wie kannst du es wagen? Klopf gefälligst an und warte, bis du hereingerufen wirst!«
Edelsteine, die vom Rand ihrer Kopfbedeckung herabhingen, unterstrichen die tiefe Falte auf der Stirn der älteren Frau. Nashwa war bei Weitem keine Schönheit, sogar eher gewöhnlich, und ihre Stimme gurrte nicht, sondern schnarrte. Für den Kalifen musste sie die Dame seines Herzens sein, sonst hätte er sich von diesem Raubvogelgesicht schon längst scheiden lassen.
Lilith ließ den Rüffel unbeantwortet. Mit vier schnellen Schritten durchquerte sie das Zimmer, packte die Frau und bog ihr den Arm auf den Rücken, sodass sie bewegungsunfähig war. Dann stellte Lilith sich den Saal der Uffizien mit der Sammlung römischer Büsten vor und brachte sie dorthin.
Wie immer war ihr einen Moment lang schummrig und höllisch kalt. Der Stein unter ihren Pantoffeln wich einem weicheren, federnden Holzboden. Nashwa kreischte laut auf. Lilith ließ die Frau los, wickelte ihre Hände in die Falten der Burka und zerrte am Rahmen eines der großen Gemälde. Das Alarmsystem meldete sich mit heiserem Schrillen.
Lilith teleportierte zurück nach Bagdad in Nashwas Gemach im Palast. Die italienische Polizei würde die Frau stundenlang festhalten. Bis sie ihr die Geschichte abnehmen würde und ihre Identität überprüft hätte, wäre Nashwa bereits Witwe.
Zurück im Zimmer warf Lilith ihre schwarze Burka von sich und zog eine von Nashwa an. Diese war zwar auch schwarz, aber der Stoff war von bester Qualität und mit Silberfäden durchzogen. Sie setzte sich die Kopfbedeckung auf und spürte, wie die Saphire und Perlen kalt und scharf auf ihrer Stirn klimperten. Darüber warf sie das Übergewand, das selbst ihre Augen bedeckte. Lilith setzte sich und wartete.
♦
Drei Stunden vergingen, bevor sie gerufen wurde.
Vier Wachen schickte der Kalif, um seine Erste Frau zu eskortieren. Obwohl sie nur eine Frau war, verhielten sich die Wachen unterwürfig, schließlich war sie die Hauptfrau des Kalifen. Die Mutter seines ältesten Sohnes. Naswha besaß die Macht über Kissen und Schlafzimmer. Lilith berührte die Messerscheiden an ihren Schenkeln und hinten auf ihrem Rücken. Und die Pistole, die sie sicherheitshalber bei sich trug. Sie bogen in einen anderen, noch schmaleren Korridor ein. Von drei Stockwerken weiter unten vernahm Lilith schwach das Murmeln von Männerstimmen und das Säuseln von Instrumenten. Ein Hauch von gebratenem Lamm und Zimt stieg ihr in die Nase, worauf sich ihr Magen mit einem Knurren meldete. Sobald sie zu Hause war, würde sie sich ein Abendessen und ein Glas Cabernet gönnen.
Sie stiegen eine enge Treppe hinauf. Zwei Soldaten gingen voraus, zwei folgten ihr nach. Jetzt hatten sie das oberste Stockwerk erreicht, und die Decke strahlte die Hitze ab, die sie tagsüber gespeichert hatte. Zwischen Liliths Brüsten und auf dem Rücken lief dicker, klebriger Schweiß hinunter. Nur zu gern hätte sie sich unter dem Riemen ihres BHs gekratzt.
Wie schrecklich, wenn man der Herrscher fast des gesamten Nahen Ostens ist und aus Furcht so unbequem leben muss.
Einer der Soldaten klopfte an einer geschlossenen Tür, und es ertönte eine gedämpfte Antwort. Die Tür wurde geöffnet, und die Soldaten komplimentierten Lilith mit Verbeugungen hinein. Dann fiel die Tür wieder zu. Jemand, der hinter ihr stand, musste sie zugemacht haben, doch mit ihren zahlreichen Stofflagen und Schleiern am Leib trug sie praktisch Scheuklappen. Sie konzentrierte sich auf das, was sie durch das Stoffgitter vor ihren Augen sehen konnte.
Sie befand sich in einem kleinen, weiß gekalkten Zimmer, dessen Wände mit Schriftbändern verziert waren: Koranverse. Ja, sieht ganz nach dem Schlafzimmer eines religiösen Fanatikers aus, dachte Lilith. Außer einem schmalen Bett und einem Beistelltisch, auf dem ein gläserner Wasserkrug stand, waren keine Möbel zu sehen. Seltsamerweise war das Bett nicht an die Wand gerückt, sondern stand in einigem Abstand von ihr entfernt. Im Gips erkannte sie die Umrisse einer Tür. Ein Schlupfloch.
Hinter sich hörte sie die Schritte des Mannes, der die Tür geschlossen hatte, und drehte sich zu ihm um, um ihn zu begrüßen. Doch es war nicht der Kalif, sondern der Rechtschaffene Dschinn. Er war größer, jünger und breiter. In seinem schwarzen Vollbart waren die feuchten, dicken Lippen zu sehen, und er saugte an der Unterlippe wie ein Kind, das über einer kniffligen Aufgabe brütet. Eigenartigerweise hatte er graue Augen.
Er war zwar nicht besonders groß, aber immer noch zu groß für Liliths Geschmack. Unter dem traditionellen weißen Gewand trug er Stiefel, und sie fragte sich, ob sich seine Kleider mit ihm vergrößerten, oder ob er als zehn Meter hoher Riese dann nackt dastand.
»Verehrte?«, sagte der Dschinn, doch es war kein Gruß. Vielmehr schwebte eine Frage in den Worten.
Wahrscheinlich müsste ich jetzt etwas Bestimmtes tun, dachte Lilith. Aber ich weiß nicht, was. Verdammter Mist.
»Meine Dame, wir müssen uns unterhalten.« Seine Bassstimme rumpelte tief, und er hatte den Akzent eines Bauern. »Ich muss mich vergewissern, dass Sie … Sie selbst sind.« Ein besserer Euphemismus für Gedankenkontrolle war Lilith bisher nicht untergekommen, jedoch half ihr das im Moment nicht viel.
Sie zögerte nur einen Augenblick lang, doch das reichte schon.
Argwohn ließ die Züge des Dschinns versteinern. Er stürzte sich auf sie. Lilith wich tänzelnd zurück. Dabei verfing sich ihr Absatz im Saum ihrer Burka. Dem Dschinn gelang es, den Arm um ihre Hüfte zu schlingen. Er war erschreckend stark. Der Griff des Messers in ihrem Rücken drückte tief in ihre Haut. Der Dschinn riss ihr die Schleier herunter, enthüllte ihre silberfarbenen Augen. »Scheusal!«
Lilith versuchte zu teleportieren, doch die Fähigkeit wich wie eine abfließende Flutwelle aus ihr, während sich Trägheit auf ihre Glieder legte. Jetzt verstand sie, wie Sharon Cream, Israels stärkstes Ass, hatte überwunden werden können. Hier war die Macht einer Wild Card am Werk.
Sie spürte einen ersten Anflug von Panik. Rasch unterdrückte sie ihn. Denn Furcht war tödlich. Sie zwang sich, die Lage zu analysieren. Seine Fähigkeit, sie ihrer Fähigkeit zu berauben, war wahrscheinlich eine geistige Gabe. Dazu musste er sich konzentrieren. Und Konzentration konnte man zunichte machen.
Sie wurde von einem warmen Wohlgefühl erfüllt. Anstatt dagegen anzukämpfen, ließ Lilith zu, dass sie vollends erschlaffte.
Der Dschinn grunzte zufrieden. Seine vollen Lippen näherten sich ihrem Mund. Durch einen der Schlitze in ihrer Burka griff sie nach der Pistole und umschloss sie mit den Fingern. Er drückte ihr seine Lippen auf den Mund. Sein Mundgeruch brachte sie zum Würgen. Schwein. Sie zog die Pistole, hielt ihren Lauf an seinen Ellbogen und drückte ab. Der Knall, der von den Wänden widerhallte, wurde beinahe vom Schmerzgeheul des Dschinn übertönt. Die Verletzung an der empfindlichsten Stelle des menschlichen Körpers hatte wieder einmal Wunder gewirkt. Schlaff sank der verwundete Arm an der Seite des Asses hinab. Lilith rammte ihm den Absatz in den Spann, bevor sie sich wegdrehte. Mit der gesunden Hand holte der Dschinn aus und traf ihre Waffenhand. Die Pistole segelte durch die Luft, und Lilith ging zu Boden. Ihre Beine waren kraftlos. Seine Augen funkelten wild, er brüllte und stieß in einem fort Flüche aus. Als er sich auf sie stürzte, tropfte Blut von seinem Arm. Mit letzter Anstrengung sammelte Lilith ihre Kräfte, spürte das Reißen und teleportierte gerade in dem Moment, als die Tür aufgerissen wurde. Sie hörte noch das verwirrte Bellen der Wachen.
Sie fand sich auf dem Korridor wieder, den sie vor wenigen Augenblicken noch durchschritten hatte. Ihr würden nur wenige Sekunden bleiben, bis der ganze Palast alarmiert wäre. Schnell zog sie die Karte heraus. Höchste Zeit, sie ein wenig in die Irre zu führen. Sie suchten eine Frau? Also sollten sie Frauen bekommen.
Wieder das Reißen. Sie befand sich in der Waschküche, wo Frauen in der Hitze schufteten. Lilith schnappte sich zwei von ihnen und hüllte sie mit ihrer Burka ein. Dann teleportierte sie mit ihnen davon. In einem Korridor im ersten Stock tauchten sie wieder auf, und das Kreischen der beiden Frauen schrillte ihr schmerzhaft in den Ohren. Die Marmorwände verstärkten das Geräusch noch. Darunter mischten sich laute Männerstimmen und das Donnern von Stiefeln, die auf sie zugaloppierten. Gerade als Lilith wegteleportierte, hörte sie das Rattern einer Kalaschnikow und den durchdringenden Schrei einer der Frauen. Sie vermochte ihr Glück kaum zu fassen. Sie hatten tatsächlich das Feuer eröffnet! Im Palast brach offenbar Panik aus. Das konnte ihr nur nützlich sein.
Lilith packte zwei weitere Dienerinnen und zwei Tänzerinnen, die in der Küche ihre Mahlzeit einnahmen. Mit ihnen würzte sie das wachsende Chaos, das sich zusammenbraute. Plötzlich schoss ihr ein stechender Schmerz in die Seite; Schultern und Rücken taten ihr weh. Die hysterischen Frauen im Zaum zu halten, war nicht einfach gewesen. Sie lehnte sich in einer Nische an die Wand und wartete, bis ihr Atem sich etwas beruhigt hatte. Da hörte sie eine hohe, nörgelnde Tenorstimme. Abdul, der Idiot, hat also das Kommando übernommen. Bestens.
»Verriegelt alle Tore. Nein, wartet. Erst, wenn das Militär da ist. Macht im Garten alle Lichter an.«
»Dann können unsere Soldaten die Nachtsichtgeräte nicht mehr einsetzen, mein Prinz«, warnte eine zweite Stimme.
»Oh, ja. Nun, dann gebt Nachtsichtgeräte aus.«
»Sie haben doch schon Nachtsichtgeräte«, rief eine andere Stimme.
»Ach ja, stimmt.«
»Sollten wir nicht besser bei Ihrem Vater bleiben?«, fragte eine weitere.
Was bedeutet, dass der Kalif sich aus dem Staub gemacht hat, dachte Lilith.
»Nein. Wir müssen den Meuchelmörder, diesen Ungläubigen, schnappen.«
Lilith teleportierte in Prinz Sirajs Zimmer zurück.
Dieser stieß einen erschrockenen Schrei aus, beruhigte sich aber, als er sie erkannte. »Was ist da los? Haben Sie es geschafft? Ich habe Schüsse gehört.«
»Der Teufel ist los. Nein. Ja«, sagte Lilith. »Wie sehr liebt der Kalif Nashwa?«
»Sehr.«
»Ist er ein Feigling?«
»Nein.«
»Danke.« Lilith teleportierte aus dem Zimmer, denn nun war sie sich sicher, wo sie den Kalifen finden würde.
♠
Der Kalif wirbelte herum, als das Ploppen der verdrängten Luft sie ankündigte.
In dem schwach erleuchteten Schlafzimmer sah man deutlich das grüne Schimmern, das von ihm ausging. Sein schwarzes Haar war von Grau durchzogen, und den Mund säumten zwei lange silberne Bartsträhnen. Er war in weiße Gewänder gehüllt, und Lilith sah die faltige braune Linie an seiner Kehle, wo die Klinge seiner Schwester einst nicht tief genug eingedrungen war. Damals war er nur der Nur al-Allah gewesen und die Errichtung des Kalifats nicht mehr als ein ferner Traum.
Der Blick des Nurs verriet, dass er die Pistole auf sie richten würde. Lilith griff nach einer Schale mit Nashwas Gesichtspuder und schleuderte sie nach dem Kalifen. Dieser riss den Kopf zur Seite, und sein Schuss verfehlte sie. Allerdings nur knapp. Lilith spürte die Hitze des Mündungsfeuers im Gesicht, und der Knall war ohrenbetäubend. Von der anderen Seite der Tür drangen Frauenschreie herüber.
Sie rannte auf das Bett zu. Als sie an der Tür vorbeikam, warf sie sie zu und verriegelte sie. Lange würde die Tür nicht standhalten, aber doch lange genug. Sie sprang aufs Bett, und die Matratze diente ihr als Trampolin, um noch schneller zu werden. Während sie über den Kopf des Nurs hinwegsegelte, trat sie nach ihm und verpasste ihm so einen kräftigen Kinnhaken. Mit dem nachgezogenen Fuß erwischte sie seine Faust und spürte, wie seine Knochen brachen.
Der zweite Tritt zeigte die erwünschte Wirkung – der Kalif ließ die Pistole fallen –, doch sie kam dadurch von ihrer Flugbahn ab und traf bei der Landung härter als vorgesehen mit der Hüfte auf. Sie biss die Zähne zusammen, rollte sich ab, kam auf die Füße und zog ein Messer aus der Scheide an ihrem Bein. Der Nur schüttelte den Kopf, um sich nach ihrem Tritt gegen sein Kinn wieder zu orientieren.
Lilith machte einen Satz nach vorn, doch er wandte sich zu ihr um und zog den Zeremoniendolch, den er an einem Ledergürtel trug. Der Griff mochte zwar mit Juwelen übersät sein, doch die Klinge war kein Spielzeug. Zudem war sie um einiges länger als Liliths Messer. Sie umkreisten sich in der gebeugten und lauernden Haltung von Messerkämpfern.
»Wer hat Sie geschickt?« Seine Stimme war heiser wie die einer alten Krähe. Einst war sie samtweich gewesen und hatte Tausende in ihren Bann gezogen.
»Die Welt.« Lilith wich seitlich aus, als er plötzlich zustach. Sie schlug seine Hand zur Seite und ließ ihr Messer an seinem Arm hinaufgleiten, um ihm die Sehne oberhalb des Ellbogens zu durchtrennen. Mit dieser Wunde war es ihm nahezu unmöglich, das Messer zu halten. Polternde Tritte ließen die Schlafzimmertür erzittern.
»Ihr könnt mich töten, aber ihr könnt nicht zerstören, was ich aufgebaut habe.«
»Sie haben recht. Aber wir können es in Besitz nehmen.« Sie verlieh ihrem perfekten Arabisch einen hörbaren Akzent. Dies hatte die gewünschte Wirkung.
»Ungläubige! Kreuzfahrerin!« Wieder stürzte er sich auf sie.
»Vergessen Sie nicht die Imperialistin.« Sie stieß ihm mit dem Fuß einen kleinen Ottomanen in den Weg. Er stolperte darüber und landete krachend auf dem Boden. Sie ließ ihn bis auf die Knie hochkommen, ehe sie hinter ihn huschte, ihm das Messer in die Brust rammte und es auf der Suche nach dem zähen Muskel, der sein Herz war, nach oben schob. Der Stahl fand sein Ziel. Warmes, klebriges Blut schwappte über ihre Hand, und sein würziger, süßer Geruch erfüllte das Zimmer.
Im Schlafzimmer waren keine Überwachungskameras zugelassen. Sie musste einen Weg finden, wie sie die Schuld jemand anderem zuschieben konnte. Fünf für einen. Ihr fiel das alte Motto von Black Dog und seinen Jokerterroristen ein. Der Dschinn hatte ihre Augen gesehen und wusste, dass sie eine Wild Card war.
Die Tür würde nicht mehr lange standhalten. »Schönen Gruß von Black Dog!«, brüllte sie hoch und schrill. Kurz setzten die Schläge an der Tür aus, bevor sie mit vermehrter Kraft wieder einsetzten.
Lilith hob die Pistole des Nurs auf und teleportierte davon. Jetzt benötigte sie nur noch vier weitere Opfer. Als letzte Ablenkung.
♣
Jonathan Hive
Daniel Abraham
2: Jonathan Hive verkauft seine Seele!
Jonathan Hive las die Einverständniserklärung ein weiteres Mal durch, blätterte vor und zurück. Die Zeit, in der er versucht hatte, Berichte von Senatsdebatten zu analysieren, brachte ihm bei diesen ausgefuchsten Westküsten-Typen der Unterhaltungsindustrie leider gar nichts. Der Sinn der Übung bestand doch darin, dass er etwas in die Finger bekam, worüber er schreiben konnte. Wenn er gleich am ersten Tag damit anfing, alle seine Rechte abzutreten, konnte er sich genauso gut bei Starbucks bewerben.
Er ließ den Blick über den Parkplatz schweifen. Da standen große silberne Busse und Lastwagen herum, und auf den Schultern verwahrlost wirkender Techniker bewegten sich Tonaufnahmegeräte und Kameras in die säkulare Kathedrale von Ebbets Field. Man hatte einen Kaffeetisch aufgeklappt, auf dem eine angeschlagene Kaffeekanne und ein paar Kartons mit Donuts standen. Einige der anderen Kandidaten trieben sich auf dem Platz herum und taxierten sich gegenseitig.
»Haben Sie eine Frage, bei der ich helfen kann?«, fragte die Assistentin mit einstudiertem Lächeln. Sie war Anfang zwanzig, hatte ein langes Gesicht und um die Augen herum etwas Fieses. Anscheinend bekamen durchschnittlich aussehende Leute, die zu lange in Hollywoods Schlangengrube der Schönen lebten, nach einiger Zeit diesen gefährlichen Ausdruck, der zu sagen schien: Ich bin kein Supermodel, aber umbringen könnte ich sie alle.
»Oh«, sagte Jonathan und setzte seinerseits ein Lächeln auf. »Es ist nur so … ich bin Journalist. Ich habe da dieses Blog, und ich weiß nicht, worüber ich schreiben darf und worüber nicht. Wenn ich für die Show genommen werde, kann ich es nicht einfach so ein paar Monate ruhen lassen.«
»Natürlich nicht«, sagte die Assistentin mit einem Nicken. »Das ist lediglich die Einverständniserklärung für die Bewerbung. Wenn Sie genommen werden, dann spielen ganz andere Dinge eine Rolle.«
Was nicht mal ansatzweise Jonathans Frage beantwortete. Sein Lächeln wurde breiter. Mal sehen, wer den anderen als Erstes mit Nettigkeit zur Weißglut brachte.
»Bestens«, sagte er kopfschüttelnd. »Ich hätte da bloß ein paar winzige Fragen zu der einen oder anderen Formulierung hier?«
»Klar«, erwiderte die Assistentin. »Wenn ich helfen kann, immer gerne. Aber das ist eine Standarderklärung.« Womit sie sagen wollte: Mach schon, du Penner, ich muss außer dir noch hundert andere Idioten abfertigen.
»Ich werd’s kurz machen, und ich bin Ihnen wirklich dankbar«, sagte Jonathan. Womit er sagen wollte: Friss das, du Trine, denn wenn ich will, kann ich dich den ganzen Tag aufhalten.
Das Lächeln der Assistentin wirkte so hart wie Zement. Jonathan schlug eine halbe Stunde damit tot, an Details herumzunörgeln und hypothetische Szenarien zu entwerfen. Doch am Ende lief es alles auf dasselbe hinaus: Wenn er mitmachen wollte, dann musste er unterschreiben. Wenn er sich weigerte … nun, das Feld war voller Asse, die nur darauf warteten, seinen Platz einzunehmen. Er setzte das Pingpong fröhlicher Falschheiten fort, bis das Lächeln der Assistentin an den Rändern abzublättern begann. Am Ende aber unterschrieb er.
Er schlenderte zu Kaffee und Donuts hinüber, gerade lange genug, um klarzustellen, dass er nichts davon wollte. Und schon tauchte ein blonder Kerl auf, der ihm irgendwie bekannt vorkam, sammelte ihn und die anderen Kandidaten ein und führte sie über den Asphalt zum Eingang des Baseballplatzes. Dort teilte man sie in zehn Gruppen auf, die jeweils zu einem eigenen Filmset geführt wurden. Kleine Beleuchtungsanlagen standen bereit, um ihn und die anderen vor der Kamera glänzen zu lassen. In seiner Gruppe hatte er das zweifelhafte Glück, der Erste zu sein.
»Machen Sie sich keine Gedanken wegen der Kamera«, sagte die Interviewerin. »Die wollen nur sehen, wie Sie durchs Objektiv rüberkommen. Tun Sie einfach so, als wäre sie gar nicht da.«
Sie war um einiges hübscher als die Assistentin, sexy angezogen und ganz offensichtlich durchaus gewillt, ein bisschen zu flirten, wenn es half, ihn vor den Zuschauern etwas Dummes oder Peinliches sagen zu lassen. Jonathan mochte sie auf Anhieb.
»Klar doch«, sagte er. Das schwarze Glasauge mit seinen zehn Zentimetern Durchmesser starrte ihn an. »Gerade so, als wären wir beide ganz allein.«
»Genau«, erwiderte sie. »Also, dann wollen wir mal sehen. Können Sie mir ein wenig erzählen, warum Sie bei American Hero mitmachen wollen?«
»Nun«, sagte er. »Haben Sie jemals von Paper Lion gehört?«
Eine kleine Falte verunstaltete die ansonsten perfekte Stirn der Interviewerin. »War das nicht das Ass, das …«
»Das ist ein Buch«, sagte Jonathan. »Von George Plimpton. Der gute George kam in den 60ern zum professionellen Football. Hat ein Buch drüber geschrieben. So was will ich auch machen. Aber zum einen ist Football etwas für die Footballfans. Zum anderen hat das schon einer gemacht. Und drittens ist Reality-TV für unsere Generation das, was Sport für unsere Väter war. Eine Form der Unterhaltung, die jeder verfolgt.«
»Sie wollen … über die Show berichten?«
»Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Viele Leute ergreifen ein Amt, um später ihre Memoiren drüber schreiben zu können«, sagte Jonathan. »Ich will mitkriegen, wie das funktioniert. Es verstehen. Versuchen, in dem Erlebnis einen Sinn zu erkennen. Und natürlich auch darüber schreiben.«
»Das ist interessant«, sagte die Interviewerin, als wäre es das tatsächlich. Jonathan war allerdings gerade erst dabei, sich warmzulaufen. Dies war das Festival der markigen Sprüche, für das er wochenlang geprobt hatte.
»Die Sache ist die – wenn die Leute etwas von uns Assen mitbekommen, sehen sie immer nur das, was wir können, verstehen Sie? Was uns ungewöhnlich macht. Diese kleinen Tricks, die wir so draufhaben – fliegen, sich in eine Schlange verwandeln oder unsichtbar werden –, die machen uns aus. Es spielt keine Rolle, was wir tun, sondern nur das, was wir sind.
Ich möchte der Journalist, Essayist und politische Kommentator sein, der nebenbei auch noch ein Ass ist. Nicht das Ass, das auch schreibt. Und das hier ist die perfekte Plattform dafür. In die Show reinzukommen wäre ein großer Schritt. Dadurch würde ich die Glaubwürdigkeit erlangen, um darüber zu reden, wie es so ist, ein Ass zu sein. Und wie es nicht ist. Hört sich das halbwegs vernünftig an?«
»Das tut es in der Tat«, gab die Interviewerin zurück, und jetzt hatte er den Eindruck, dass sie ein bisschen fasziniert von ihm war.
Einen Schritt weiter, dachte er. Dann hab ich ja nur noch eine Million Schritte vor mir.
»Okay«, sagte sie. »Und Jonathan Hive? Stimmt das?«
»Tipton-Clarke ist mein richtiger Nachname. Hive ist mein nom de guerre. Oder nom de plume. Oder was auch immer.«
»Richtig. Tipton-Clarke. Und was genau ist Ihre Fähigkeit als Ass?«
»Ich verwandle mich in Insekten.«
♥
American Hero bildete den Höhepunkt des Reality-TV-Fiebers. Man brachte richtige Asse dazu, übereinander abzulästern, gegeneinander zu intrigieren und anzugeben, und das alles, um damit die Zuschauerschaft zu unterhalten. Und moderiert wurde die Sendung, um ihr einen Hauch von Authentizität zu verleihen, von einem berühmten Promiass – von Peregrine. Der Preis: ein Haufen Geld, ein Haufen Medienaufmerksamkeit und die Chance, ein Held zu werden. Das Ganze war so künstlich wie koffeinfreie Diätcola.
Und doch …
Noch vor dem Morgengrauen war er in seinem völlig austauschbaren Hotelzimmer aufgewacht, ziemlich überrascht davon, wie nervös er war. Das Frühstück – gummiartige Eier und bitterer Kaffee – hatte er auf dem Zimmer eingenommen und dabei die Nachrichten geschaut. Jemand, den man mit ägyptischen Jokerterroristen in Verbindung brachte, hatte endlich den Kalifen ermordet; ein Typ aus Sri Lanka mit einem Namen, den niemand aussprechen konnte, war zum neuen UN-Generalsekretär ernannt worden; und eine neue Diät versprach, ihn um drei Größen schlanker zu machen. Jonathan zappte weiter zu einem Kanal, auf dem ein junger, ernster Journalist ein deutsches Ass namens Lohengrin interviewte. Lohengrin war durch die Vereinigten Staaten getourt, um ein neues Motorrad von BMW zu promoten. Dann schaltete er aus. Er stellte einen kurzen Beitrag auf seinem Blog ein, um die zwei Dutzend Leser auf dem Laufenden zu halten, und ging hinaus.
Während der U-Bahnfahrt zum Stadion fühlte er sich, als ginge er zu einem Bewerbungsgespräch. Er malte sich aus, was er zu tun im Begriff stand, überlegte, wie er sich präsentieren sollte. Ob seine Kleider zu flach auf dem Boden liegen würden, um darunterzukriechen, wenn er sich zurückverwandeln musste. Fast war er überzeugt, dass sein Aufnahmetest damit enden würde, dass er splitternackt dastand. Er konnte den Prozess natürlich auch jederzeit unterbrechen. Konnte ein paar Insekten übrig lassen, um seine Scham zu bedecken. Wie eine knallgrüne Badehose aus Wespen. Aber das wäre wohl noch gruseliger.
Jetzt, als er tatsächlich auf einer der Bänke saß, die die Studioleute in Hollywood aufgebaut hatten, und die Beleuchtung, die Kameras und das Gewimmel sah, fühlte er sich ein bisschen weniger eingeschüchtert. Er und die anderen Bewerber saßen auf vier Bankreihen innerhalb der Foul Line der First Base. Die drei Mitglieder der Jury – Topper, Digger Downs und Harlem Hammer – saßen an einem erhöhten Tisch mehr oder weniger auf dem Pitcher’s Mound. Die unsichtbaren Teile einer Fernsehproduktion – Tontechniker, Kameras, die Stühle der Visagisten, das miserable Buffet – befanden sich größtenteils zwischen Home Plate und Third Base. Die weite Fläche des Outfields war für die Asse reserviert. Hier konnten sie beweisen, wie telegen sie waren.
Und da gab es ziemliche Unterschiede.
Nehmen wir zum Beispiel den armen Schweinehund, der gerade dran war. Schon seit einigen Sekunden hielt er theatralisch die Arme zu kleinen, aufgedunsenen Wolken am Himmel emporgestreckt, während seine entschlossene Miene zusehends verzweifelter wirkte.
»Worauf warten wir?«, flüsterte Jonathan.
»Auf einen großen Sturm«, murmelte der Typ neben ihm, eine fahrige Nervensäge namens Joe Twitch. »Vielleicht einen Tornado.«
»Aha.«
Sie warteten. Das mutmaßliche Ass schrie und krümmte die Finger zu Krallen, während es dem weiten Himmelsgewölbe seinen Willen aufzuzwingen versuchte. Die anderen Asse, die ihre Bewerbung erfolgreich absolviert hatten, saßen in sicherem Abstand auf Klappstühlen, nur für den Fall, dass etwas passieren sollte. Die Morgenluft roch nach Benzin und gemähtem Rasen. Innerhalb von nur eineinhalb Minuten stand Joe Twitch nicht weniger als dreißig Mal auf, nur um sich wieder hinzusetzen.
»Hey«, sagte Jonathan. »Die Wolke da oben. Die lange, die in der Mitte so dünn wird?«
»Ja?«, erwiderte Joe Twitch.
»Sieht fast wie ein Fisch aus, wenn du die Augen ein wenig zusammenkneifst.«
»Hä?«, sagte Twitch. Und dann: »Abgefahren.«
Die Lautsprecheranlage greinte. Harlem Hammer würde den armen Irren gleich von seinen Mühen erlösen. Jonathan tat es fast leid um den Kerl. Aber nur fast.
»Mr. Stormbringer?«, sagte Harlem Hammer. »Vielen Dank, Mr. Stormbringer, dass Sie gekommen sind. Wenn Sie jetzt bitte …«
»Die Finsternis! Sie kommt!«, sagte Stormbringer mit Grabesstimme. »Der Sturm möge losbrechen!«
Es herrschte peinliches Schweigen.
»Weißt du«, sagte Jonathan, »wenn wir lange genug warten, wird es irgendwann einmal regnen. Weißt du? Zwangsläufig.«
»Mr. Stormbringer«, versuchte Harlem Hammer es noch einmal, während Digger Downs hinter ihm so tat, als würde er einen Gong schlagen. »Wenn Sie bitte … äh … John? Würden Sie Mr. Stormbringer bitte in den Green Room führen?«
Der Blonde, der Jonathan vage bekannt vorkam, löste sich von einer Traube Techniker und ging mit dem Klemmbrett in der Hand los, um den Mann aus dem Stadion zu geleiten. Jonathan kniff die Augen zusammen, um herauszufinden, woher er ihn kannte: milchkaffeebraune Haut, eine kleine Epikanthusfalte am Auge, blond gefärbtes Haar.
»Ach, Mensch«, sagte er.
»Was?«, fragte Twitch.
Jonathan deutete mit einer Bewegung des Kinns auf den Blonden. »Das ist John Fortune«, sagte er.
»Wer?«
»John Fortune. Der war vor einiger Zeit auf der Titelseite von Time. Er hat ’ne Pikdame gezogen, aber alle glaubten, er wäre ein Ass. Um ihn hat sich so ’ne krasse religiöse Geschichte entwickelt, von wegen er wär der Antichrist oder der neue Messias oder so was.«
»Der, den Fortunato irgendwie heilen wollte und dabei gestorben ist?«
»Ja, er ist Fortunatos Sohn. Und der von Peregrine.«
Joe Twitch schwieg einen Moment. Er wurde nur dann langsamer, wenn er nachdenken musste. Jonathan überlegte, ob er dem Kerl mal ein Buch mit Sudokurätseln besorgen sollte.
»Peregrine produziert die Show«, sagte Twitch.
»Jau.«
»Dann arbeitet dieser arme Wicht für seine Mama?«
»Wie tief sind die Mächtigen doch gefallen«, sagte Jonathan wegwerfend. Ein neues Ass kam aufs Feld, ein älterer dürrer Kerl mit riesigen Stiefeln, die verchromt wirkten, einer braunen Lederjacke und einem Pilotenhelm aus den 40er-Jahren, dessen Riemen ihm wie die Ohren eines Beagle links und rechts vom Gesicht herabhingen.
»Danke sehr«, sagte Harlem Hammer. »Und Sie sind?«
»Jetman!«, verkündete der Neue und erhob sich in die Lüfte, angetrieben von den kleinen feuerspuckenden Düsen an seinen Stiefelsohlen. Er nahm die Haltung eines Helden ein. »Ich bin der Mann, zu dem Jetboy geworden wäre!«
»Ach du liebe Güte«, grummelte Jonathan. »Das war vor sechzig Jahren. Könnt ihr das arme Schwein nicht endlich mal ruhen lassen?«
Anscheinend konnte man das nicht.
In dem anhaltenden Strom von Möchtegerns, die sich hier vorstellten, war Mr. Stormbringer bislang der schlimmste gewesen. Aber auch der Typ, der sich der Crooner nannte, hatte nichts zustande gebracht. Und Jonathans persönlicher Meinung nach war Hell’s Cook – ein stiernackiger Mann, der eine Bratpfanne erhitzen konnte, indem er sie anstarrte – eher eine Lusche denn ein Ass, aber wenigstens war er ein guter Entertainer.
Und es waren auch ein paar ganz passable dabei gewesen. Jonathans Nebensitzer, Joe Twitch, lieferte eine ziemlich gute Show ab und zeigte sich dabei so ruppig, dass klar war, dass er für haufenweise zwischenmenschliche Konflikte sorgen würde. Matrjoschka, ein Bär von ein Meter fünfundneunzig, war auch okay. Wenn man ihn schlug, teilte er sich in zwei Bären von ein Meter siebzig auf und dann in vier Bären von ein Meter fünfunddreißig und so weiter. Offenbar so lange, bis man ihn nicht mehr schlug. Das elfjährige Mädchen, das einen Plüschdrachen mit sich herumschleppte, schien erst ein schlechter Witz zu sein, bis es das Stofftier in eine fünfzehn Meter hohe, Feuer speiende Version seiner selbst mit Schuppenpanzer verwandelte. Sie hatte einen Beutel mit weiteren Stofftieren dabei. Da hatte sich selbst Digger Downs seine Kommentare über Kindertagesstätten für Wild Cards verkniffen. Jonathan hätte Geld darauf gewettet, dass sie es schaffen würde.
Unter höflichem Applaus beendete Jetman seine Vorführung, und der Blonde – John Fortune – erschien neben Jonathan.
»Jonathan Hive?«, fragte Fortune.
»Der bin ich.«
»Okay, Sie sind als Nächster dran. Wir nehmen das mit den Kameras zwei und drei auf«, erklärte er und deutete dabei auf einige der zahlreichen Kameras im Stadion. »Die Jurymitglieder haben Monitore, wenn Sie also die Wahl haben, ist es immer besser, sich der Kamera zuzuwenden anstatt dem Publikum.«
»Bestens«, sagte Jonathan und passte seinen Plan entsprechend an. »Okay, ja. Danke.«
»Keine Ursache«, sagte Fortune.
»Sonst noch einen Tipp?«
Einen Moment lang machte Fortune ein ernstes Gesicht. Er war ein gutaussehender Kerl, wirkte nur um die Augen herum vielleicht ein bisschen verloren.
»Sie sind der, der sich in Wespen verwandelt, stimmt’s? Okay, der Typ an Kamera zwei hat total Schiss vor Bienen, wenn Sie also irgendwas in Nahaufnahme machen wollen, dann konzentrieren Sie sich auf Kamera drei.«
»Und das da ist Kamera drei?«
»Sie haben’s erfasst«, sagte Fortune. Jonathan änderte erneut sein Konzept.
»Cool. Danke.«
Jonathan holte tief Luft, stand auf und ging auf die freie Fläche zu, die Jetman eben geräumt hatte. Jonathan nickte der Jury zu, grinste die anderen Asse an und zog seine Schlappen aus. Das Gras kitzelte ihn an den Fußsohlen.
»Möchten Sie uns erst noch irgendwas sagen? Nein? Nun denn, wann immer Sie bereit sind«, sagte Topper.
Es fühlte sich an wie Atemholen, dieses angenehme Heben des Brustkorbs, doch es hörte nicht auf. Sein ganzer Körper blähte sich auf und wurde leichter, sein Gesichtsfeld vergrößerte sich langsam. Wie einen weit entfernten Vorgang spürte er seine Kleider zu Boden fallen, wo eben noch seine Arme und Beine gewesen waren. Ein paar Insekten hatten sich darin verfangen und blieben zurück wie abgeschnittene Fingernägel.
Jonathan erhob sich über die Köpfe der Zuschauer, durch hunderttausend Augen sah er sie alle gleichzeitig. Und er vernahm ihre Stimmen über dem Summen seiner Flügelschläge. Im Moment hatte er keine bestimmte Gestalt. Die Freude über das zwanglose Dahinfliegen, über die Freiheit seines Schwarmleibs durchzuckte ihn. Seit Tagen hatte er sich nicht mehr ausgetobt. Aber er musste sich konzentrieren, sich seine Vorführung wieder in Erinnerung rufen. Er richtete seine vielgestaltige Aufmerksamkeit auf die Menschenmenge, wählte eine geeignete Frau auf einem von Kamera drei gut einsehbaren Platz aus und schickte ihr eine Ranke aus Wespen entgegen. Als die Tiere auf ihrem Schoß landeten, erstarrte die Frau, doch als er die winzigen Leiber so anordnete, dass sie Buchstaben und Worte ergaben, entspannte sie sich ein wenig.
Alles in Ordnung. Keine Angst!
Er hüllte sie in ein hellgrünes, wimmelndes Ballkleid, bevor er sich wieder in die Luft erhob, zum Ende des Stadions und wieder zurück raste und im Kreis herumwirbelte. Dann wurde es Zeit für den Showdown. Es war nicht leicht, willentlich seinen Körper nachzubilden, und seine kinästhetische Wahrnehmung war nur sehr grob. Deshalb schickte er ein paar Wespen los, um sich auf Kamera drei zu setzen, und konzentrierte sich auf das, was diese sahen.
Langsam, ganz langsam ließ er den Schwarm auf einen kleineren, dichteren und wütend summenden Knäuel zusammenschrumpfen. Als die Insektenwolke so dicht war, dass sie kein Sonnenlicht mehr durchließ, setzte er sie in Bewegung. Es war wie Tanzen oder wie wenn man versuchte, einen Bleistift auf dem Finger zu balancieren. Der Schwarm, aus dem sein Leib bestand, nahm eine neue Gestalt an – riesige, schwebende, krakelige Buchstaben: ESSEN SIE BEI JOE’S.
Er ließ den Schwarm zu seinem Kleiderhaufen zurückkehren. Die Insekten krochen in die Kleidungsstücke hinein, drückten nach außen, um Platz für weitere Wespen zu schaffen, die nachdrängten, während sie bereits wieder zu menschlichem Fleisch gerannen. Er war erschöpft und aufgeregt. Es gab höflichen Applaus, und er verneigte sich. Dann stellte ihm die Jury ein paar Fragen. – Ja, die Wespen konnten stechen; der Schwarm bestand aus ungefähr hunderttausend Insekten; ja, wenn er durch eine Insektizidwolke flog, konnte er ernsthaft erkranken. Digger Downs nannte ihn Bugsy, Harlem Hammer erkundigte sich nach seinem Blog (was ihm noch ein paar Tausend Aufrufe bringen würde, wenn sie die Szene nicht rausschnitten). Und dann war es vorbei. Er kehrte auf seinen Platz auf der Bank zurück.
»Sauber«, sagte Joe Twitch.
Jemand klopfte Jonathan sacht auf die Schulter. Die Frau, die er für seine Vorführung als Opfer erkoren hatte. Jetzt, aus nur einem einzigen Blickwinkel betrachtet, sah sie anders aus.
»Hey«, sagte Jonathan mit einem Lächeln.
»Hey.« Sie hatte eine nette Stimme. Sexy. »Jonathan Hive? So nennst du dich also? Nun, Bugsy, wenn du es noch einmal wagst, mich anzugrapschen, bringe ich dich um. Verstanden?«
Die Hand der Frau verwandelte sich in eine hochkonzentrierte Flamme wie bei einer Lötlampe, nur um gleich darauf wieder auf seiner Schulter zu liegen. Die Frau lächelte ihn eiskalt an, nickte einmal und ging zu ihrem Platz zurück.
Jonathan wandte sich wieder zu Joe Twitch um.
»Ups«, sagte Twitch.
»Ja. Ups«, pflichtete ihm Jonathan bei.
»Passiert dir das öfter?«
»Was? Dass man mir mit dem Tod droht?«
»Bugsy.«
»Ach, das. Ja.«
<< II nächste Seite >>Heute um 12:18
American Hero | Aufgeregt | »American Idiot« – Green Day
Also, ganz offiziell: Ich bin dabei. Jetzt ist es kurz vor Mitternacht, aber das hier wird erst morgen irgendwann veröffentlicht. Ich habe mit dem Sender vertraglich vereinbart, dass jemand aus der Rechtsabteilung sich um meinen Blog kümmert, während ich bei der Show bin. Sagt alle mal Hallo zu Kenny! (Hi, Kenny!)
(EDIT: Hi allerseits – Kenny)
Ich komme gerade von der Kennenlernparty mit meinen Teamkollegen zurück. Chateau Mamont. Totaler Hollywood-Chic, so nach dem Motto: Hier starb John Belushi. Alle Mitspieler waren da, wir sind insgesamt achtundzwanzig, also schnappt euch schon mal eure Bewertungslisten, Jungs und Mädels. Das wird ein heißer Ritt.
Ich saß neben Candle, dessen Fähigkeiten zur Folge haben, dass er aussieht, als stünde sein Haar in Flammen. Mir gegenüber die fetteste Frau, die ich je gesehen habe – Amazing Bubbles. Mir wurde gesagt, dass sie Bewegungsenergie in Form von Fett speichern kann … mein Gott, dann hat man sie wohl auf dem Weg zur Party hinter einem Cadillac hergeschleift. Der Einzige, der noch dicker war als sie, war ein Baptistenprediger aus den Südstaaten in einem speziellen Rollstuhl für Fettleibige, der sich Holy Roller nennt und gut dreihundert Kilo wiegt. Anscheinend ist keiner von beiden in meiner Gruppe, von daher hoffe ich, dass wir in einer der Missionen, die auf uns zukommen, alle in einen Aufzug müssen.
(Eine persönliche Zwischenbemerkung: Ja, Opa, Jetman hat es auch geschafft. Und Du hast wieder die Feststelltaste gedrückt. Sag Oma, sie soll es in Ordnung bringen.)
Nachdem man uns ein Abendessen aufgetischt und unsere Unterhaltungen dabei aufgezeichnet hatte, wurden wir noch mal einzeln interviewt und anschließend in Teams eingeteilt. Es war nicht gerade der Sprechende Hut, aber ein bisschen fühlte es sich so an. Peregrine hat jeden ausgerufenen Namen fett inszeniert, Applaus, Jubelrufe, Lächeln – alle trinken darauf, und dann kommt der Nächste dran. Am Ende waren wir alle ziemlich beschickert, vermutlich haben wir uns voll zum Affen gemacht mit unseren Posen und Grimassen vor den Kameras. Um ehrlich zu sein, ich war zu betrunken, um mich an Einzelheiten zu erinnern. Ich werd’s mir anschauen müssen, wenn es ausgestrahlt wird, genau wie ihr.
Ich wurde dem Team Herz zugeteilt, denn Gott bewahre, dass die Medien irgendwas, das mit dem Wild-Card-Virus zu tun hat, nicht mit so einem Wortspiel versehen. Es gibt drei weitere Teams: Karo, Pik und Kreuz. Wir haben uns alle umarmt und kennengelernt, sind uns nähergekommen und haben geschworen, so lange als Team zusammenzuarbeiten, bis es uns nicht mehr in den Kram passt.
Dann drängten wir uns alle in eine Limousine und wurden zu unserem geheimen Unterschlupf chauffiert. Ich verscheißere euch nicht. Ein geheimer Unterschlupf.
Dabei handelt es sich um eine alte Villa, die so aufgemotzt ist, dass sie Big Brother höchstpersönlich alt aussehen lässt. Überall Kameras, außer auf den Klos (und ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass nicht auch dort ein paar versteckte Gimmicks eingebaut sind). Und ein kleiner Beichtstuhl, wo wir nach Herzenslust lästern und tratschen können, und zwar unter vier Augen mit unserem engsten und liebsten Vertrauten: der verdammten Weltöffentlichkeit.
Lasst mich die Mitspieler vorstellen. Das Team Herz besteht aus:
Drummer Boy – alias Michael Vogali. Ja, der Drummer Boy, der Schlagzeuger von Joker Plague, zwei Meter zehn, meine Fresse, sechs Arme, mehr Tattoos als auf einer Biker-Convention. Er verbrachte das ganze Dinner damit, Autogramme zu geben und mit einem Frauenass zu labern, das alle nur Pop Tart nannten, allerdings nicht, wenn sie es hören konnte. Da ich weder Joker Plague höre noch ein dreizehnjähriges Fangirl bin, war mir nicht bekannt, dass er auf der Brust sechs verschiedene Trommelfelle hat. Ja, er ist sein eigenes Schlagzeug.
Wild Fox – alias Andrew Yamauchi. Ganz netter Kerl. Offenbar kann er was mit Illusionen machen, das thematisch irgendwie einen Sinn ergibt, wenn man über japanische Mythologie besser Bescheid weiß als ich. Den werdet ihr leicht erkennen, wenn ihr die Show anschaut. Er hat einen großen, buschigen Fuchsschwanz. Im Ernst. Er hat einen Schwanz.
Curveball – alias Kate Brandt. Das hübsche Mädchen von nebenan. Was immer sie wirft, kann sie im Flug steuern und beim Aufprall explodieren lassen. Beim Dinner hat sie ein bisschen angegeben, indem sie einen Wasserkrug mithilfe eines Reiskorns explodieren ließ. Möglich, dass sie auch ein bisschen betrunken war. Aber um Gerechtigkeit walten zu lassen, muss man sagen, dass sie ziemlich knuffig aussieht, wenn sie betrunken ist.