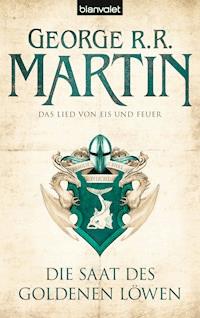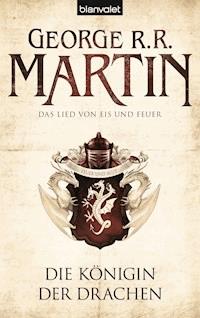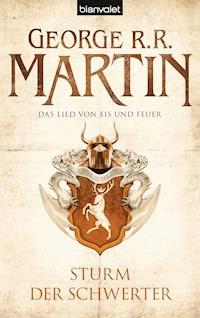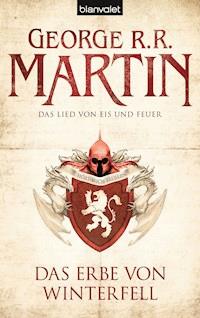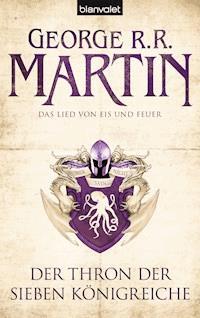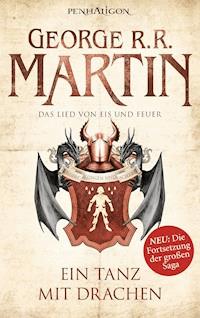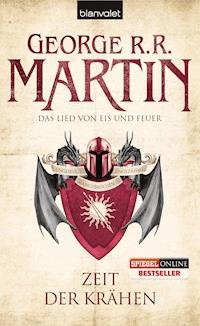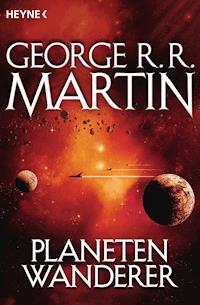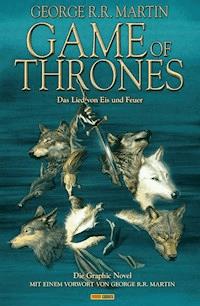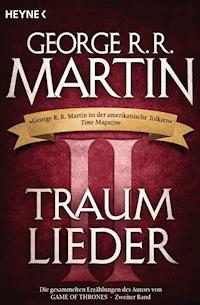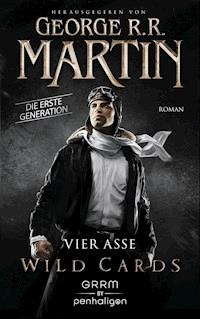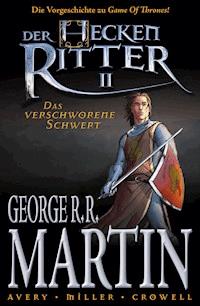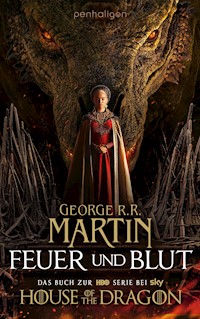11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Wild Cards - 1. Generation
- Sprache: Deutsch
George R.R. Martin – der Superheld der Superhelden!
Vor genau vierzig Jahren veränderte der Wild-Cards-Virus das Antlitz der Erde, schuf mächtige Asse und mutierte Joker. Grund genug für die größte Party des Jahrhunderts! Doch während sich New York auf die Feierlichkeiten vorbereitet, plant der Astronom seine Rache. Er ist eines der mächtigsten Asse der Welt, und hätten ihn nicht einige Helden aufgehalten, würde er längst die Erde beherrschen. Doch nun ist er zurück – und seine alten Widersacher ahnen noch nicht einmal etwas davon …
Die vorliegende Anthologie ist bereits im Heyne Verlag erschienen unter den Titeln „Wild Cards – Wilde Joker“.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 725
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Das Wild-Cards-Virus hat die Welt verändert: Die Joker, die durch das Virus körperlich verändert wurden, werden verachtet. Die Asse hingegen, die nun mit unfassbaren Fähigkeiten ausgestattet sind, werden gefürchtet oder bewundert. Doch nur wenn Joker, Asse und Normalsterbliche zusammenarbeiten, können sie die Erde vor der Vernichtung bewahren. Denn die Schwarmmutter ist auf unseren Planeten aufmerksam geworden – und keine bekannte Macht des Universums konnte sie jemals aufhalten.
Autor
George Raymond Richard Martin wurde 1948 in New Jersey geboren. Sein Bestseller-Epos Das Lied von Eis und Feuer wurde als die vielfach ausgezeichnete Fernsehserie Game of Thrones verfilmt. George R. R. Martin wurde u. a. sechsmal der Hugo Award, zweimal der Nebula Award, dreimal der World Fantasy Award (u. a. für sein Lebenswerk und besondere Verdienste um die Fantasy) und dreimal der Locus Poll Award verliehen. 2013 errang er den ersten Platz beim Deutschen Phantastik Preis für den Besten Internationalen Roman. Er lebt heute mit seiner Frau in New Mexico.
Wild Cards – Die erste Generation bei Penhaligon:1. Vier Asse2. Der Schwarm3. Der Astronom
Wild Cards (die zweite Generation) bei Penhaligon:1. Das Spiel der Spiele2. Der Sieg der Verlierer3. Der höchste Einsatz
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag
präsentiert
Der Astronom
Wild Cards – Die erste Generation 3
Geschrieben von Melinda M. Snodgrass, Leanne C. Harper, Walton Simons, Lewis Shiner, John J. Miller, George R. R. Martin, Edward BryantDeutsch von Christian Jentzsch
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1987 unter dem Titel »Wild Cards – Jokers Wild« bei Bantam Books, New York.Die vorliegende Anthologie ist bereits im Heyne Verlag erschienen unter den Titeln »Wild Cards – Wilde Joker«.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage
Copyright © 1987 by George R. R. Martin and the Wild Cards TrustPublished by agreement with the authors and the authors’ agent, The Lotts Agency, Ltd.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2017 by Penhaligon in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Umschlaggestaltung und -illustration: Isabelle Hirtz, Inkcraft
Redaktion: Catherine Beck
HK · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-21859-1V001www.penhaligon.de
Inhalt
Prolog
Erstes Kapitel06:00
Zweites Kapitel07:00
Drittes Kapitel08:00
Viertes Kapitel09:00
Fünftes Kapitel10:00
Sechstes Kapitel11:00
Siebtes Kapitel12:00
Achtes Kapitel13:00
Neuntes Kapitel14:00
Zehntes Kapitel15:00
Elftes Kapitel16:00
Zwölftes Kapitel17:00
Dreizehntes Kapitel18:00
Vierzehntes Kapitel19:00
Fünfzehntes Kapitel20:00
Sechzehntes Kapitel21:00
Siebzehntes Kapitel22:00
Achtzehntes Kapitel23:00
Neunzehntes Kapitel00:00
Zwanzigstes Kapitel01:00
Einundzwanzigstes Kapitel02:00
Zweiundzwanzigstes Kapitel03:00
Dreiundzwanzigstes Kapitel04:00
Vierundzwanzigstes Kapitel05:00
Fünfundzwanzigstes Kapitel06:00
Dieser Band ist den Herausgebern gewidmet,die mir unter die Arme gegriffen haben.Für Ben Bova, Ted White und Adele Leone,für David G. Hartwell, Ellen Datlow und Ann Patty,für Betsy Mitchell, Jim Frenkel und Ellen Couch,für die Erinnerung an Larry Herndon und das Texas Triound natürlich für Shawna und Lou, die immer wussten,wann sie ein Gewinnerblatt auf der Hand hatten.
Prolog
Es gibt den Mardi Gras in New Orleans, den Karneval in Rio, Fiestas und Festivals und Gründertage zu Hunderten. Die Iren haben den St. Patrick’s Day, die Italiener den Kolumbustag, die Amerikaner den Vierten Juli. Die Geschichte wimmelt von Aufzügen, Maskenfesten, Orgien, Feiertagen und vaterländischen Ausschweifungen.
Der Wild-Card-Tag ist ein wenig von alledem und mehr.
Am 15. September 1946 starb Jetboy am kalten Nachmittagshimmel über Manhattan, und das takisische Xenovirus – allenthalben unter dem Namen Wild Card bekannt – wurde auf die Welt losgelassen.
Es ist nicht ganz klar, wann die Feierlichkeiten begannen, aber gegen Ende der Sechziger hatten diejenigen, die eine Wild Card gezogen und überlebt hatten, die Joker und Asse von New York, den Tag zu ihrem Feiertag gemacht.
Der 15. September wurde zum Wild-Card-Tag. Zu einem Tag des Feierns und Trauerns, des Kummers und der Freude, des Gedenkens an die Toten und des Glücks der Lebenden. Zu einem Tag des Feuerwerks, der Straßenumzüge und -feste, der Maskenbälle, politischen Kundgebungen und Gedächtnisbankette, des Trinkens, des Liebens und der Straßenkämpfe. Jedes Jahr wurden die Feierlichkeiten größer und fieberhafter. Kneipen, Restaurants und Krankenhäuser hatten Hochkonjunktur, die Medien nahmen Notiz von dem Rummel, und schließlich strömten auch die Touristen in die Stadt.
Einmal im Jahr erfasste der Wild-Card-Tag Jokertown und New York City, und ein karnevalistisches Chaos beherrschte die Straßen.
Der 15. September 1986 war der vierzigste Jahrestag.
Erstes Kapitel06:00
Ruhiger und dunkler wurde es auf der Fifth Avenue nicht.
Jennifer Maloy warf einen Blick auf die Straßenlaternen und den stetig fließenden Verkehr. Sie spitzte verärgert die Lippen. Das Licht und die Aktivitäten gefielen ihr nicht, aber sie konnte kaum etwas dagegen tun. Schließlich war dies die Fifth Avenue auf Höhe der 73rd Street, inmitten einer Stadt, die nie schläft. In den letzten Tagen, in denen sie die Gegend ausgekundschaftet hatte, war es um diese Uhrzeit nicht weniger geschäftig zugegangen, und sie hatte keinen Grund zu der Annahme, dass sich die Verhältnisse je bessern würden.
Die Hände tief in den Taschen ihres Trenchcoats, ging sie an dem fünfstöckigen grauen Wohnhaus vorbei und huschte in die Gasse dahinter. Sie zog sich in einen Teil der Gasse zurück, der durch einen Müllcontainer abgeschirmt wurde, und lächelte.
Wie oft sie es auch schon getan haben mochte, es war immer noch aufregend. Ihr Puls beschleunigte sich, und sie atmete schneller, während sie sich die kapuzenähnliche Maske überstreifte, die ihre fein gemeißelten Züge und den im Nacken zu einem Knoten zusammengebundenen blonden Schopf verbarg. Sie zog ihren Trenchcoat aus, faltete ihn ordentlich zusammen und legte ihn neben den Müllcontainer. Unter dem Trenchcoat trug sie nur einen knappen schwarzen Bikini. Sie war hager, auf grazile Art muskulös und hatte kleine Brüste, schlanke Hüften und lange Beine. Sie bückte sich, zog die Turnschuhe aus und stellte sie neben den Trenchcoat.
Beinahe zärtlich strich sie mit der Hand über den Verputz des grauen Wohnhauses, lächelte und ging dann einfach durch die Wand.
Es war das Geräusch einer Motorsäge, die durch feuchtes, hartes Holz schnitt. Das Jaulen der Kette bereitete Jacks Zähnen Schmerzen, während sich der nur zu bekannte Junge mühte, sich tiefer im Gewirr der Zypressen zu verstecken.
»Er ist irgendwo da drinnen!«
Das war sein Onkel Jacques. Die Leute um Atelier Parish nannten ihn Snake-Jake. Zumindest hinter seinem Rücken.
Der Junge biss sich auf die Lippe, um nicht aufzuschreien. Dann biss er noch fester zu, bis er Blut schmeckte, um sich nicht zu verwandeln. Manchmal klappte das. Manchmal …
Wieder fuhr die Stahlsäge kreischend in feuchtes Zypressenholz. Der Junge duckte sich ganz tief. Braunes, brackiges Wasser schwappte ihm gegen den Mund und in die Nase. Er würgte, während der Bayou über sein Gesicht wusch.
»Ich sag’s doch! Der kleine Alligatorköder ist da drinnen. Fangt ihn.« Andere Stimmen fielen ein.
Die Säge heulte erneut auf.
Jack Robicheaux schlug in der Dunkelheit um sich, einen Arm in sein verschwitztes Laken verheddert, während der andere nach dem Telefon tastete. Er knallte die Tiffany-Lampe gegen die Wand, fluchte, als er irgendwie den Lampenfuß zu fassen bekam und sie wieder auf den Nachttisch stellte, und spürte dann die kühle Glätte des Telefons. Mitten im vierten Klingeln nahm er den Hörer ab.
Jack fing wieder an zu fluchen. Wer zum Teufel hatte diese Nummer? Bagabond natürlich, die aber hielt sich in einem anderen Zimmer seiner Behausung auf. Bevor er den Hörer ans Ohr hielt, wusste er, wer anrief.
»Jack?«, sagte die Stimme am anderen Ende der Leitung. Das bei Ferngesprächen typische statische Rauschen übertönte sie für einen Augenblick. »Jack, hier spricht Elouette. Ich rufe aus Louisiana an.«
Er lächelte im Dunkeln. »Ich dachte mir, dass du es bist.« Er drückte auf den Einschaltknopf der Lampe, doch nichts geschah. Der Glühdraht der Birne musste gerissen sein, als er die Lampe umgestoßen hatte.
»Ich habe noch nie über eine so große Entfernung telefoniert«, sagte Elouette. »Robert hat sonst immer die Verbindung hergestellt.« Robert war ihr Mann.
»Wie spät ist es?«, fragte Jack. Er tastete nach seiner Armbanduhr.
»Ungefähr fünf«, sagte seine Schwester.
»Was ist los? Ist es wegen Ma?« Er wurde langsam wach und schüttelte die Eindrücke seines Traums ab.
»Nein, Jack, Ma geht es gut. Ihr wird nie was passieren. Sie wird uns beide überleben.«
»Was gibt es dann?« Ihm fiel der scharfe Unterton in seiner Stimme auf, und er versuchte, ihn herauszunehmen. Er war ungehalten, weil Elouette so langsam sprach und er beinahe sehen konnte, wie sich ihre Gedanken in die Länge zogen.
Die Stille, die nur vom statischen Rauschen gestört wurde, dehnte sich weiter. Schließlich sagte Elouette: »Es geht um meine Tochter.«
»Um Cordelia? Was ist mit ihr? Stimmt irgendwas nicht?«
Wiederum Stille. Dann: »Sie ist ausgerissen.«
Jack überkam ein merkwürdiges Gefühl. Schließlich war er vor vielen Jahren ebenfalls ausgerissen. Und da war er noch viel jünger gewesen als Cordelia jetzt. Wie alt mochte sie jetzt sein? Fünfzehn? Sechzehn? »Erzähl mir, was passiert ist«, sagte er beruhigend.
Und das tat sie. Cordelia, sagte sie, hatte sich nicht ungewöhnlich benommen. Am Morgen des vergangenen Tages war das Mädchen nicht zum Frühstück heruntergekommen. Make-up, Kleidung, Geld und eine Tasche fehlten. Ihr Vater hörte sich bei Cordelias Freundinnen um. Es waren nicht viele. Dann verständigte er den Gemeindesheriff, der wiederum die Streifenwagen informierte. Niemand hatte sie gesehen. Die Polizei vermutete, dass sie per Anhalter gefahren war.
Der Sheriff hatte traurig den Kopf geschüttelt. »’n Mädchen, das so aussieht … Tja, da müssen wir uns wirklich Sorgen machen.« Er tat, was er konnte, aber das dauerte natürlich seine Zeit, kostbare Zeit. Schließlich war es Cordelias Vater gewesen, der auf etwas gestoßen war. Ein Mädchen (»Das hübscheste kleine Ding, das ich seit einem Monat gesehen hab«, sagte der Fahrkartenverkäufer) mit üppigem schwarzen Haar (»So schwarz wie der Bayou-Himmel bei Neumond«, sagte ein Schaffner) hatte in Baton Rouge einen Bus bestiegen.
»Es war ein Greyhound«, sagte Elouette. »Sie hat eine einfache Fahrt nach New York gelöst. Als wir das herausgefunden hatten, sagte man bei der Polizei, es sei nicht möglich, den Bus in New Jersey anzuhalten.« Ihre Stimme zitterte ein wenig, als sei sie den Tränen nah.
»Das geht schon in Ordnung«, beruhigte sie Jack. »Wann kommt der Bus hier an?«
»Ungefähr um sieben«, erwiderte Elouette. »Um sieben Uhr deiner Zeit.«
»Merde.« Jack schwang die Beine aus dem Bett und richtete sich in der Dunkelheit auf.
»Kannst du hingehen, Jack? Kannst du sie finden?«
»Klar«, sagte er. »Aber dann muss ich sofort zum Busbahnhof, sonst schaffe ich es nicht mehr rechtzeitig.«
»Gott sei Dank«, sagte Elouette. »Rufst du mich an, wenn du sie gefunden hast?«
»Mache ich. Dann überlegen wir uns, was wir als Nächstes tun. Ich gehe jetzt, okay?«
»Okay. Ich rühre mich nicht von der Stelle. Vielleicht kommt Robert auch bald.« Vertrauen lag in ihrer Stimme. »Danke, Jack.«
Er legte auf und stolperte durch das Zimmer. Er fand den Lichtschalter an der Wand und konnte in dem fensterlosen Raum endlich etwas sehen. Die Arbeitskleidung des gestrigen Tages lag verstreut auf der klobigen Bank gegenüber. Jack streifte die ausgewaschene Jeans und das grüne Baumwollhemd über. Er verzog das Gesicht wegen der stinkenden Arbeitssocken, aber er hatte keine anderen. Heute war sein freier Tag, und er hatte ihn eigentlich in einem Waschsalon verbringen wollen. Rasch schnürte er die Lederstiefel mit den Stahlkappen, wobei er nur jede zweite Öse benutzte.
Als er die Zimmertür öffnete, standen plötzlich Bagabond, die beiden großen Katzen, ein ganzer Schwung kleiner Kätzchen und ein glotzgesichtiger Waschbär vor ihm und starrten ihn schweigend an. Im diffusen Licht, das vom Wohnzimmer ausging, nahm Jack den Glanz von Bagabonds dunkelbraunen Haaren und den noch dunkleren Augen wahr. Wangenknochen und Haut sahen bleich aus.
»Jesus, Maria und Josef!«, sagte er, indem er einen Schritt zurückwich. »Erschreck mich doch nicht so!« Er holte tief Luft und spürte, wie die ledrige, körnige Haut auf seinen Handrücken wieder weicher wurde.
»War nicht meine Absicht«, sagte Bagabond. Der schwarze Kater rieb sich an Jacks Bein. Er machte einen Buckel, der Jack bis zur Kniescheibe reichte. Sein zufriedenes Schnurren klang wie das Summen einer Kaffeemühle. »Ich hab das Telefon gehört. Ist alles in Ordnung?«
»Ich erzähl dir alles auf dem Weg zur Tür.« Er gab Bagabond eine kurze Zusammenfassung des Telefongesprächs, während er in die Küche ging, um den vom Vortag übrig gebliebenen Kaffee in einen Pappbecher zu gießen, den er mitnehmen konnte.
Bagabond hielt ihn am Arm fest. »Sollen wir mitkommen? An einem Tag wie heute könnten ein paar zusätzliche Augen am Bahnhof von Nutzen sein.«
Jack schüttelte den Kopf. »Dürfte kein Problem sein. Sie ist sechzehn und war noch nie in einer Großstadt. Hat nur viel ferngesehen, sagt ihre Mama. Ich werde sie direkt am Bus in Empfang nehmen.«
»Weiß sie das?«, fragte Bagabond.
Jack bückte sich und kraulte den Schwarzen rasch hinter den Ohren. Die Gescheckte miaute und kam, um sich ebenfalls ihre Streicheleinheiten abzuholen. »Nee. Wahrscheinlich hätte sie mich nach ihrer Ankunft angerufen. So sparen wir eben Zeit.«
»Mein Angebot steht immer noch.«
»Bis zum Frühstück bin ich längst wieder mit ihr da.« Jack hielt inne. »Oder auch nicht. Sie wird sich unterhalten wollen, also gehe ich mit ihr vielleicht noch ins Automat. In Atelier wird es so was nicht geben.« Er richtete sich auf, und die Katzen jankten enttäuscht. »Außerdem hast du doch eine Verabredung mit Rosemary, oder?«
Bagabond nickte zögernd. »Um neun.«
»Mach dir keine Sorgen. Vielleicht essen wir alle gemeinsam zu Mittag. Hängt davon ab, wie hoch es in der Innenstadt hergeht. Vielleicht können wir was vom Koreaner mitnehmen und auf der Staten-Island-Fähre picknicken.« Er beugte sich vor und gab Bagabond einen flüchtigen Kuss auf die Stirn. Bevor sie die Arme auch nur halb gehoben hatte, um ihn zu umarmen und den Kuss zu erwidern, war er schon verschwunden. Zur Tür hinaus. Ihrer Wahrnehmung entzogen.
»Verdamm mich«, sagte sie. Die Katzen sahen zu ihr auf, verwirrt, aber mitfühlend. Der Waschbär umschlang ihren Knöchel.
Jennifer Maloy glitt wie ein Geist durch die beiden unteren Stockwerke des Wohnhauses. Sie störte nichts und niemanden und wurde weder gesehen noch gehört. Die Wohnungen waren vor einiger Zeit in Eigentumswohnungen umgewandelt worden, das wusste sie. Die drei oberen Stockwerke gehörten einem reichen Geschäftsmann mit dem bedauernswerten Namen Kien Phuc. Er war Vietnamese und besaß eine Restaurantkette sowie mehrere chemische Reinigungen. Diese Informationen hatte Jennifer einem Beitrag von New York Style entnommen, der vor zwei Wochen von PBS gesendet wurde. Die Show lud ihre Zuschauer zu Besichtigungen der gewollt künstlerischen und stilvollen Häuser und Wohnungen der New Yorker Oberschicht ein und versorgte Jennifer mit zahllosen nützlichen Informationen.
Sie schwebte durch den dritten Stock, wo Kiens Dienstboten wohnten. Sie hatte keine Ahnung, was sich im vierten Stock befand, da er von den Fernsehkameras nicht erfasst worden war. Also ließ sie ihn aus und steuerte Kiens Wohnbereich im obersten Stock an. Er wohnte dort allein in acht Zimmern voller Luxus und Überfluss, fast schon Dekadenz. Jennifer war bisher nicht klar gewesen, dass mit Reinigungen und chinesischen Restaurants so viel Geld zu verdienen war.
Im fünften Stock war es dunkel und still. Sie mied das Schlafzimmer mit dem runden Bett unter einer Spiegeldecke (ein wenig schäbig, hatte sie gedacht, als sie es auf dem Bildschirm gesehen hatte) und den mit handbemalter Seide bespannten spanischen Wänden. Sie ließ auch das im westlichen Stil eingerichtete Wohnzimmer mit seinem zweitausend Jahre alten Bronzebuddha aus, der gütig von seinem Ehrenplatz neben einer bombastischen Stereoanlage nebst Großbildfernseher, Videorekorder und CD-Player herabstarrte, flankiert von einer Reihe Regale, die mit Video- und Audiokassetten sowie CDs vollgestopft waren. Sie wollte ins Arbeitszimmer.
Dort war es so dunkel wie im ganzen Stockwerk, und sie erschrak, als sie eine schattenhafte Gestalt neben dem riesigen Teakholzschreibtisch aufragen sah, der die Rückwand des Zimmers beherrschte. Obwohl sie beim Herumgeistern gegen körperliche Angriffe unempfindlich war, bewahrte es sie nicht vor Überraschungen, und diese Gestalt war von den Kameras von New York Style nicht gefilmt worden.
Rasch zog sie sich in die nächste Wand zurück, aber die Gestalt rührte sich nicht und ließ auch keine Anzeichen erkennen, dass sie Jennifer bemerkt hatte. Vorsichtig glitt sie wieder in das Arbeitszimmer und stellte mit Erleichterung fest, dass es sich bei der Gestalt um die annähernd einen Meter achtzig große Terrakottafigur eines orientalischen Kriegers handelte. Die künstlerische Vollkommenheit der Figur war atemberaubend. Gesichtszüge, Kleidung, Waffen, alles war mit einer unglaublichen Liebe zum Detail gestaltet. Es war, als sei ein lebendiger Mensch in Ton verwandelt und dann in einem Ofen gebrannt und durch die Jahrtausende konserviert worden, um hier in Kiens Arbeitszimmer zu landen. Ihr Respekt vor Kiens Reichtum – und Einfluss – stieg noch ein wenig. Die Figur war ohne Zweifel ein Original. Kien hatte in dem Fernsehinterview deutlich gemacht, dass er für Nachbildungen nichts übrig hatte. Jennifer wusste aber auch, dass die 2200 Jahre alten Terrakotta-Grabfiguren Ying Zhengs, des ersten Kaisers der Qin-Dynastie und Einiger Chinas, für private Kunstsammler definitiv nicht zu bekommen waren. Kien musste sich einiger Tricks bedient und ein Vermögen für Bestechung ausgegeben haben, um die Figur zu erwerben.
Es war ein unglaublich wertvolles Stück, aber zu groß für Jennifer, um es mitzunehmen, und wahrscheinlich auch zu einzigartig, um es verkaufen zu können.
In ihrer unstofflichen Gestalt verspürte sie einen jähen Schwindelanfall und nahm rasch wieder Substanz an. Sie mochte dieses Gefühl nicht. Es trat immer dann auf, wenn sie sich überanstrengte – ein sicheres Anzeichen dafür, dass sie bereits zu lange unstofflich war. Sie wusste nicht, was geschehen würde, wenn sie zu lange ein Gespenst blieb, und wollte es auch nicht herausfinden.
Wieder im stofflichen Zustand, sah sie sich in dem Zimmer um. Es war mit einer Vielzahl von Vitrinen angefüllt, die Kiens Jadesammlung enthielten: die schönste, größte und wertvollste Sammlung in der westlichen Welt. Wegen dieser Sammlung hatte New York Style Kien vorgestellt, und ihretwegen war sie gekommen. Zumindest wegen einiger Stücke. Ihr wurde klar, dass sie nicht alle mitnehmen konnte, auch wenn sie ein Dutzend Mal in die Gasse zurückkehrte, denn ihre Fähigkeit, Fremdmasse unstofflich werden zu lassen, war begrenzt. Bei jedem Gang konnte sie nur ein paar Stücke geistern. Aber mehr als ein paar Stücke brauchte sie auch nicht.
Doch bevor sie sich um die Jadesammlung kümmerte, musste sie noch etwas anderes tun. Der dicke Flor des luxuriösen Teppichs fühlte sich unter ihren nackten Fußsohlen fast sinnlich an, während sie beinahe so lautlos wie in ihrer unstofflichen Gestalt um den Teakholztisch herumging und vor dem Hokusai-Druck stehen blieb, der an der Wand hing.
Hinter dem Druck, hatte Kien gesagt, befand sich ein Wandsafe. Er hatte es erwähnt, weil der Safe hundertprozentig, total und unwiderruflich diebstahlsicher war. Kein Dieb könne sich mit der Mikroelektronik ausreichend auskennen, um das elektronische Schloss zu umgehen, und der Safe sei stark genug, um jedem gewaltsamen Öffnungsversuch zu widerstehen – von einer Bombe, die das ganze Haus in die Luft sprengen würde, einmal abgesehen. Niemand könne ihn irgendwann irgendwie aufbrechen. Kien, der sehr selbstzufrieden aussah, als er all das gesagt hatte, war offenbar ein Mann, der gern prahlte.
Mit einem schelmischen Lächeln auf den Lippen, da sie sich fragte, welche Reichtümer Kien wohl in seinem Hightechsafe verborgen haben mochte, geisterte Jennifer ihren rechten Arm. Dann schob sie die Hand durch das Bild und die Stahltür dahinter.
Er jonglierte sie in den Armen, während er nach seinem Schlüssel suchte und schließlich die Tür aufschloss.
»Lass mich runter, du Idiot. Dann kannst du die Tür öffnen.«
»Nee, ich trag dich über die Schwelle.«
»Wir sind nicht verheiratet.«
»Noch nicht«, erwiderte er und grinste sie an.
Aus ihrer Perspektive war die Entstellung seines Halses besonders deutlich zu sehen, und sein Kopf sah aus wie ein Tennisball auf einem Podest. Abgesehen von dem Hals – ein Vermächtnis des Wild-Card-Virus – war er ein ziemlich gut aussehender Mann. Kurz geschnittene braune Haare, die an den Schläfen ergrauten, verschmitzte braune Augen, kräftiges Kinn – ein nettes Gesicht.
Er öffnete die Tür und stellte sie auf die Füße. »Mein Zuhause. Ich hoffe, es gefällt dir.«
Das Apartment spiegelte den Arbeiterhintergrund dieses Mannes wider. Ausziehbare Couch, ein Lehnstuhl vor dem Fernseher, ein Stapel Reader’s Digest auf dem Kaffeetisch, ein großes und nicht besonders gutes Ölgemälde eines Segelschiffs, das sich durch übertrieben hohe Wellen kämpfte. Die Art Gemälde, die man auf Verkaufsausstellungen hungernder Künstler in Hilton-Hotels fand.
Aber alles war makellos sauber und mit einem gewissen Feingefühl eingerichtet, das bei einem derart großen und starken Mann fehl am Platz wirkte. Auf den Fensterbänken stand eine Reihe bunter Usambaraveilchen.
»Roulette, ich war seit meinem Highschool-Abschlussball nicht mehr die ganze Nacht aus.«
»Ich wette, dass du bis zum nächsten Morgen aus warst.«
Er errötete. »Hey, ich war ein guter katholischer Junge.«
»Vor guten katholischen Jungen hat mich meine Mama immer gewarnt.«
Er trat näher und legte ihr seine kräftigen Arme um die Taille. »So ›gut‹ bin ich längst nicht mehr.«
»Ich hoffe, das bezieht sich auf deine Moral und nicht auf dein Stehvermögen, Stan.«
»Roulette!«
»Du bist prüde«, neckte sie ihn.
Er liebkoste ihren Hals und nagte an ihrem Ohrläppchen, und Roulette wunderte sich wieder einmal über die zufällige Natur des Wild-Card-Virus – dass es diesen ganz normalen Allerweltsmann infiziert und zu einem Übermenschen gemacht hatte.
Sie streckte die Hand aus und strich über seinen geschwollenen Hals. »Stört dich das nicht?«
»Der Howler zu sein? Teufel, nein. Das macht mich zu etwas Besonderem, und ich wollte schon immer etwas Besonderes sein. Das hat meinen Alten wahnsinnig gemacht. Er sagte immer, Wasser sei gut genug für unsereins, was bedeutete, ich sollte nicht zu hoch hinauswollen. Wahrscheinlich wäre er jetzt ziemlich überrascht. Hey.« Er strich ihr über die Wange und fing eine Träne auf. »Warum weinst du?«
»Nur so. Ich … fand das irgendwie traurig.«
»Na, dann zeige ich dir wohl besser, wie gut mein Stehvermögen ist.«
»Vor dem Frühstück?«, fragte sie, um das Unvermeidliche hinauszuzögern.
»Klar, das ist gut für den Appetit.«
Resigniert folgte sie ihm ins Schlafzimmer.
Jennifer tastete in dem Safe herum und berührte etwas, das sich wie ein Münzstapel in einem kleinen Beutel anfühlte. Sie versuchte eine der Münzen zu geistern und runzelte die Stirn, als sie fest blieb.
Wahrscheinlich Gold, dachte sie. Krügerrands oder kanadische Maple Leafs.
Es war schwierig, dichte Materialien wie Metall zu geistern, insbesondere Gold, da ein höherer Grad der Konzentration und ein größerer Energieaufwand erforderlich waren. Sie beschloss, die Münzen erst mal zu lassen, wo sie waren, und erforschte den Safe weiter.
Ihre Hand strich über einen flachen rechteckigen Gegenstand, der sich viel leichter geistern ließ als die Münze. Sie zog drei kleine Bücher heraus, und da sie in der Dunkelheit keine Einzelheiten erkennen konnte, schaltete sie die kleine Schreibtischlampe ein. Zwei der Bücher hatten schlichte schwarze Einbände. Das dritte hatte einen blauen Stoffeinband mit Bambusmuster. Sie schlug das oberste Buch auf.
Kleine bunte Papierschnipsel steckten in Taschen auf den dicken Seiten des Buchs. Briefmarken. Bei denen in der obersten Reihe schien es sich um britische zu handeln, aber sie trugen einen Stempel in einer anderen Sprache und mit der Jahreszahl 1922. Sie beugte sich vor, um sie eingehender zu betrachten, und erstarrte, als ein schwaches Geräusch von irgendwoher außerhalb des Lichtkreises ertönte, der einen Teil der Schreibtischplatte erhellte.
Sie blickte auf und sah nichts, da sich ihre Augen an das Licht gewöhnt hatten. Dann klappte sie den Lampenschirm hoch, sodass das Licht auf den Rest der Schreibtischplatte fiel.
Sie erstarrte, das Herz rutschte ihr in die Hose.
Am Rand der Schreibtischplatte stand ein Zwanzigliterbehälter von der Größe eines Wasserspenders. Nur dass dieser Behälter aus Glas und nicht aus Plastik war, außerdem war er auch nicht mit einem Spender verbunden. Er stand auf einem flachen Sockel auf der Schreibtischkante, offenbar eine Art Aquarium für das Ding, das darin trieb.
Es war kaum größer als ein Fuß und hatte eine grüne, glibbrige und irgendwie warzige Haut. Der Kopf befand sich außerhalb des Wassers, und die Hände mit den Schwimmhäuten zwischen den Fingern waren gegen das Glas gepresst. Menschliche Augen in einem spitzen Gesicht starrten Jennifer durchdringend an. Sie glotzten einander einen langen Augenblick an, dann öffnete das Ding den Mund und rief mit schriller, heulender Stimme: »Kiennnnnn! Dieeeeeeb! Dieeeeeeb!«
New York Style hatte nichts davon erwähnt, dass Kien sich einen krötenartigen Joker als Wachhund hielt, dachte Jennifer. Ihre Gedanken überschlugen sich, während in anderen Räumen die Lichter angingen. Aus anderen Bereichen der Wohnung hörte sie tumultartigen Lärm, und der Joker in dem Glasbehälter fuhr fort, mit wehklagender Stimme, die ihre Ohren zu umgehen und direkt in ihren Verstand zu dringen schien, nach Kien zu rufen.
Konzentrier dich, sagte sie sich, konzentrier dich, oder der wagemutige Dieb, das selbst ernannte Gespenst, wird geschnappt und als Jennifer Maloy, Bibliothekarin in der öffentlichen Bibliothek von New York, enttarnt. Sie würde ihren Job verlieren und mit Sicherheit ins Gefängnis wandern. Was würde ihre Mutter dann von ihr denken?
An der Tür bewegte sich etwas, und jemand schaltete das Deckenlicht im Arbeitszimmer ein. Jennifer sah einen hochgewachsenen, schlanken, reptilienhaft aussehenden Joker. Er zischte sie an, und seine lange gegabelte Zunge zuckte zwischen den Lippen hindurch. Er hob eine Pistole und schoss. Er hatte genau gezielt, aber die Kugel schlug harmlos in die Wand ein. Jennifer sank bereits durch den Fußboden, die drei Bücher eng an die Brust gepresst.
Als Jack gegangen war, begann Bagabond, die immer noch den getigerten Bademantel trug, den er ihr gegeben hatte, mit ihrem Morgenritual. Sie setzte sich auf einen der mit rotem Samt bezogenen Polstersessel, schloss die Augen und lokalisierte die Wesen, die das Leben mit ihr teilten. Die Gescheckte säugte ihre Jungen, während der Schwarze sie bewachte. Der Waschbär schlief mit dem Kopf an ihrem Knöchel. Er war müde, weil er die ganze Nacht in Jacks viktorianischem Zimmer herumgestöbert hatte. Bagabond hoffte, keine Unordnung angerichtet zu haben. Sie hatte Sicherungen im Kopf des Waschbären eingesetzt, die ihn von Jacks Habseligkeiten abhielten. Die Sicherungen waren ziemlich wirksam, aber sie würde nie die Auseinandersetzung mit Jack vergessen, als der Waschbär jedes seiner Pogo-Bücher aus dem Regal geholt hatte.
Sie bückte sich, um den Waschbären zu streicheln, und dehnte ihr Bewusstsein auf die Stadt aus. Es fiel ihr jetzt leicht, dieses Ritual des Aufwachens – obwohl sie sich, wenn sie nicht mit Jack zusammen war, mehr und mehr zu einem Nachtmenschen entwickelte. Jahrelang hatte sie ihre Beziehung auf einer beiläufigen Ebene aufrechterhalten und war nur aufgetaucht, wenn das Wetter extrem schlecht war, oder an Tagen wie diesem, wenn sich Fremde an Orte vorwagten, an die vorzudringen sie normalerweise nicht den Mut hatten. Wenn Jack zu Hause war, blieb sie. Wenn nicht, zog sie in einen anderen Bau. In letzter Zeit hatte sie jedoch begonnen, unter ständig neuen Vorwänden seine Gesellschaft immer öfter zu suchen. Jack und Rosemary waren ihr sehr wichtig geworden, und zwar auf eine Art, die sie nicht definieren konnte. Es hatte Jahre gedauert, bis sie ihnen vertraute. Inzwischen war es jedoch beängstigend leicht, sich darauf zu verlassen, dass sie für sie da waren. Verärgert schüttelte sie den Kopf, weil sie sich dazu hinreißen ließ, über Dinge nachzudenken, auf die sie keinen Einfluss hatte, und dabei die Wesen vernachlässigte, für die sie verantwortlich war.
Mit ihren Wesen zu wachen und zu leiden, kam ihr jetzt natürlicher vor. Ihr Geist tummelte sich zwischen den Ratten, Maulwürfen, Opossums, Eichhörnchen, Tauben und anderen Vögeln. Sie machte eine Bestandsaufnahme der Opfer, die die Nacht gefordert hatte. Jeden Morgen gab es viele, die nicht überlebt hatten. Sie hatte gelernt, dass es keine Rettung für die Opfer gab. Viele starben, weil sie Beute der Raubtiere wurden. Andere wurden von Menschen getötet. Einmal hatte sie versucht, sie zu retten, die Beute vor den Raubtieren zu schützen. Das hätte sie fast in den Wahnsinn getrieben. Der natürliche Kreislauf von Leben, Tod und Geburt war stärker als sie, und so hatte Bagabond angefangen, nicht gegen ihn, sondern in ihm zu arbeiten. Die Tiere starben. Es gab andere, die ihren Platz einnahmen. Nur die Einmischung des Menschen konnte den Rhythmus stören. Menschen konnte sie noch nicht kontrollieren. Sie verweilte kurz bei den Insassen des Zoos. Hass auf die Käfige färbte ihre Eindrücke. Eines Tages, versprach sie den Gefangenen des Zoos wieder. Eines Tages …
Eine warme Pfote auf ihrer Wange brachte sie zurück. Der Schwarze. Seine vollen vierzig Pfund lagen auf ihrer Brust. Als sie die Augen öffnete, leckte er über ihre Nase. Sie kraulte ihn hinter den Ohren.
Das kurze Fell in seinem Gesicht war mittlerweile von einer Spur Grau durchsetzt, aber meistens bewegte er sich immer noch wie ein junger Kater. Sie vermittelte ihm das Gefühl, das sie für Liebe hielt. Er schnurrte und antwortete mit dem Bild der Gescheckten, die die Jungen von Jacks viktorianischen Möbeln fernhielt. Wenn sie nicht gut auf die Jungen achtgaben, fanden die, dass die wie Löwenpfoten gestalteten Stuhlbeine wunderbare Kratzpfosten abgaben.
Tja, alter Freund, Jack hat mich letzte Nacht abgewiesen. Was glaubst du, was stimmt da nicht? Die unterbewusst formulierte Frage zog zuerst nur einen fragenden Blick des Katers nach sich, aber dann vermittelte er ihr ein Bild von ihr, wie sie von Hunderten ihrer Wesen umgeben war.
Ja, ich weiß, dass ihr alle da seid, aber ab und zu will ich auch mit einem anderen Menschen zusammen sein. Sie schuf ein Bild vom Schwarzen und der Gescheckten als Paar. Der Schwarze antwortete darauf mit einer Vision von Bagabond und einem Kater in Menschengröße. Bagabond nickte, während sie den Jungen beim Spielen zusah. Bedauerlicherweise nicht mein Typ.
Sie fragte sich, warum Jack nicht mit ihr schlief. Ihre Enttäuschung und ihr Mangel an Verständnis verwandelten sich langsam in Verärgerung. Es hatte erst im letzten Jahr begonnen. Jedes Mal, wenn sie mit den Jungen spielte, hatte sie das Gefühl, dass in ihrem Leben etwas fehlte.
Das Gefühl ärgerte sie, aber sie konnte es nicht leugnen. Vor Kurzem hatte sie sich an Jack gewandt, um bei ihm Trost zu finden, aber er hatte sie abgewiesen. Sie beschloss, ihn nicht noch einmal zu behelligen.
Ohne die Schichten alter, schmutziger Kleidung, die sie in der Welt draußen schützten, war sie nicht unattraktiv, das wusste sie. Um ihrer Freundin Rosemary Peinlichkeiten zu ersparen, hatte sie gelernt, sich bei seltenen Gelegenheiten annehmbar zu kleiden, aber es war immer ein unangenehmes Gefühl. Das waren Zeiten, in denen sie eigentlich ein Kostüm trug, und sie verabscheute es. Vielleicht hatte sie sich zu sehr mit Jack und Rosemary eingelassen. Vielleicht war es an der Zeit, wieder unterzutauchen.
Der Schwarze folgte der Stimmung ihrer Gedanken, auch wenn er ihre abstrakte Bedeutung nicht übersetzen konnte. Er war mit dem Abbruch der Beziehung zu den Menschen einverstanden, indem er ihr ein Bild von einigen ihrer ehemaligen Behausungen sandte.
Aber nicht heute. Heute muss ich mich mit Rosemary treffen. Bagabond stemmte sich aus dem Sessel und ging zu dem Stapel alter, schmutziger, formloser Kleidung, die den größten Teil ihrer Garderobe ausmachte. Der Schwarze und zwei Junge folgten ihr.
Nein, ihr bleibt hier. Vielleicht will Jack mich erreichen. Außerdem ist es auch ohne eure Begleitung schon schwer genug für mich, in ihr Büro vorzudringen. Sie richtete ihre Aufmerksamkeit auf die Kleidung. Blauer Mantel oder grüner Armeeparka?
In dem Zimmer befanden sich dreizehn schwarze Kerzen. Wenn sie brannten, nahm das Wachs die Farbe frischen Blutes an und lief an den Seiten herunter. Jetzt wurde das Zimmer allmählich grau, und der schwache Lichtschein der Kerzen verblasste.
»Weißt du, wie spät es ist?«
Fortunato sah auf. Veronica stand in rosa Baumwollslip und zerrissenem T-Shirt vor ihm, die Arme vor der Brust verschränkt. »Fast Morgen«, sagte er.
»Kommst du ins Bett?« Sie drehte den Kopf zur Seite, und Wellen schwarzer Haare fielen über ihr Gesicht.
»Später. Steh nicht so da, du streckst den Bauch heraus.«
»Ja, o Sensei.«Der Sarkasmus war unterdrückt, kindisch. Ein paar Sekunden später hörte er, wie sie die Badezimmertür hinter sich zusperrte. Wäre sie nicht Mirandas Tochter gewesen, hätte er sie schon vor Wochen zurück auf die Straße geschickt.
Er streckte sich und starrte ein paar Sekunden lang auf die trüben Wolken, die am Osthimmel Gestalt annahmen. Dann widmete er sich wieder dem Werk vor sich.
Er hatte den fünfzackigen Stern auf dem Boden mit Tatami abgedeckt und darauf Hathors Spiegel gelegt. Er war etwa einen Fuß lang und trug an der Verbindungsstelle zwischen Griff und Sonnenscheibe ein Bildnis der Göttin. Ihre Kuhhörner ließen sie ein wenig wie einen mittelalterlichen Narren aussehen. Der Spiegel bestand aus Messing, die Vorderseite verspiegelt für Hellsicht, die Rückseite abgeschliffen, um die Angriffe eines Feinds abzuwehren. Er hatte ihn bei einem alternden Hippie im East Village bestellt und die letzten zwei Tage damit verbracht, ihn mit Ritualen für alle neun bedeutenden Gottheiten zu reinigen.
Seit einigen Monaten war er weniger denn je in der Lage, an etwas anderes als an seinen Feind zu denken, an jenen Mann, der sich selbst »Astronom« nannte und ein ausgedehntes Netz Ägyptischer Freimaurer beherrscht hatte, bis Fortunato und die anderen deren Nest in den Kreuzgängen vernichtet hatten. Der Astronom war entkommen, auch wenn das für das bösartige Ding, das er aus dem Weltraum mitgebracht hatte, nicht galt. Die Monate der Ruhe hatten Fortunato nur noch ängstlicher gemacht.
Das Ungeborene Ritual, das Akrostichon von Abramelin, die Sphären der Kabbala, die gesamte westliche Magie hatte ihn im Stich gelassen. Er musste die Magie des Astronoms gegen ihn einsetzen. Er musste ihn irgendwie finden, und zwar trotz der Barrikaden, die der Astronom errichtet hatte und ihn für Fortunato unsichtbar machten.
Der Trick bei der ägyptischen Magie – der wirklichen, nicht der verdrehten und blutrünstigen Version des Astronoms – bestand darin, von ihrer Verehrung von Tieren auszugehen. Fortunato hatte sein ganzes Leben in Manhattan verbracht. Zuerst in Harlem, dann, als er es sich leisten konnte, in der Innenstadt. Für ihn waren Tiere Pudel, die ihre Scheiße auf dem Bürgersteig liegen ließen, oder träge, übel riechende Kreaturen, die ihr Leben im Zoo verschliefen. Er hatte sie nie verstanden oder auch nur gemocht.
Es war eine Einstellung, die er sich nicht mehr leisten konnte. Er hatte erlaubt, dass Veronica ihre Katze mit in die Wohnung brachte, ein eitles, übergewichtiges, grau getigertes Ding, das Veronica zu Ehren des Filmstars Liz genannt hatte. Im Moment schlief die Katze auf seinen gekreuzten Beinen, die Krallen in die Seide seines Morgenmantels geschlagen. Das primitive Wertesystem der Katze war eine Tür zum ägyptischen Universum.
Er nahm den Spiegel in die Hand. Er hatte jetzt fast die richtige Einstellung. Er betrachtete sein Spiegelbild: schlankes Gesicht, braune Haut, vom Schlafmangel ein wenig fleckig, die Stirn von Rasa angeschwollen, der tantrischen Macht des aufgestauten Spermas. Langsam schmolzen seine Züge und zerliefen.
Er hörte einen Laut aus dem Badezimmer, einen gedämpften Seufzer, und verlor die Konzentration. Und dann sah er in dem Spiegel anstelle des Astronoms Veronica. Sie saß auf der Toilette, den Slip um die Knöchel. In der linken Hand hielt sie einen Taschenspiegel, in der rechten ein kurzes Stück eines rot gestreiften Strohhalms. Ihr Kopf schwankte locker hin und her, sie rieb sich die Wange an der Schulter.
Er legte Hathors Spiegel wieder auf die Matte zurück. Das H überraschte ihn nicht, nur dass sie es hier tat, in seiner Wohnung. Er hob die protestierende Katze von seinen Beinen und ging zum Badezimmer. Dort öffnete er das Schloss mit seinen Geisteskräften und trat die Tür auf. Veronicas Kopf kam schuldbewusst hoch. »Hey«, sagte sie.
»Pack deinen Kram und verzieh dich«, knurrte Fortunato.
»Hey, is’ nur ’ne Prise Koks, Mann.«
»Um Himmels willen, für wie blöd hältst du mich eigentlich? Glaubst du, ich erkenne kein Smack? Wie lange bist du schon auf diesem Scheiß?«
Sie zuckte die Achseln und verstaute Spiegel und Strohhalm in ihrer offenen Handtasche. Dann stand sie auf, stolperte beinahe und sah dann, dass sich ihre Füße im Slip verheddert hatten. Sie hielt sich am Handtuchhalter fest, während sie den Slip hochzog und dann ihre Handtasche schloss. »’n paar Monate«, sagte sie. »Aber ich bin nicht auf irgendwas. Ich tu’s nur manchmal. Pardon.«
Fortunato ließ sie vorbei. »Was zum Teufel ist los mit dir? Kümmert es dich nicht, was du dir antust?«
»Ob es mich kümmert? Ich bin ’ne beschissene Hure, warum sollte es mich kümmern?«
»Du bist keine Hure, gottverdammt, du bist eine Geisha.« Er folgte ihr ins Schlafzimmer. »Du hast Verstand und Klasse und …«
»Geisha, am Arsch«, sagte sie, indem sie sich schwer auf die Bettkante sinken ließ. »Ich lasse mich für Geld von Männern ficken. Das ist das Allerletzte.« Sie schob ein Bein in ihre Strumpfhose, wobei der Nagel des großen Zehs eine Laufmasche über die ganze Länge des Beins riss. »Du verarschst dich mit diesem Geishaquatsch gern selbst, aber echte Geishas lassen sich nicht für Geld ficken. Du bist ein Zuhälter, und ich bin eine Hure, und mehr gibt es dazu nicht zu sagen.«
Bevor Fortunato darauf antworten konnte, hämmerte jemand gegen die Wohnungstür. Wellen der Anspannung und Dringlichkeit strahlten vom Flur ins Schlafzimmer aus, aber nichts Bedrohliches. Nichts, das nicht warten konnte.
»Ich dulde keine Junkies bei mir«, sagte er.
»Ach nein? Dass ich nicht lache. Die Hälfte der Mädchen in deinem Stall snieft zumindest ab und zu. Fünf oder sechs sind an der Nadel. Voll drauf.«
»Wer? Ist Caroline …«
»Nein, deine kostbare Caroline ist clean. Nicht dass du’s erfahren würdest, wenn sie’s nicht wäre. Du hast doch überhaupt keinen Schimmer, was verdammt noch mal abgeht!«
»Ich glaube dir nicht. Ich kann nicht …«
Ein kratzendes Geräusch an der Wohnungstür ließ ihn innehalten, dann öffnete sich die Tür. Ein Mann namens Brennan stand im Eingang, einen Plastikstreifen in der einen Hand. In der anderen hielt er einen etwas zu groß ausgefallenen ledernen Aktenkoffer. Darin befanden sich, wie Fortunato wusste, die Einzelteile eines Jagdbogens und ein Köcher mit Pfeilen.
»Fortunato«, sagte er. »Tut mir leid, aber ich …« Sein Blick wanderte zu Veronica, die sich das T-Shirt ausgezogen hatte und ihre Brüste in den Händen hielt.
»Hi«, sagte sie. »Willst du mich ficken? Du brauchst nur etwas Geld.« Sie strich sich mit den Daumen über die Brustwarzen und leckte sich die Lippen. »Wie viel hast du? Zwei Dollar? Eineinhalb?« Tränen rannen ihr über die Wangen, und aus einem Nasenloch lief ein dünner Rotzfaden.
»Halt die Klappe«, schnappte Fortunato. »Halt, verdammt noch mal, die Klappe.«
»Warum schlägst du mich nicht?«, schrie sie ihn an. »Das tun Zuhälter doch, oder nicht?«
Fortunato sah Brennan an. »Vielleicht solltest du später wiederkommen.«
»Ich weiß nicht, ob die Sache warten kann«, sagte Brennan. »Es geht um den Astronom.«
Zweites Kapitel07:00
Als Jack schließlich am Busbahnhof ankam, wünschte er, er hätte seinen elektrischen Streckenwartungswagen genommen und mit den Zügen Himmel und Hölle gespielt. Aber was soll’s, dachte er, als er die Stufen zu den Bahnsteigen des City-Hall-Bahnhofs erklomm – heute ist Feiertag. Er wollte nicht an die Arbeit denken. Mehr als alles andere wollte er seine Klamotten waschen, ein paar Kapitel des neuen Romans von Stephen King, Die Kannibalen, lesen und vielleicht zum Central Park gehen, um dort an einem Stand mit Bagabond und den Katzen ein paar billige Hot Dogs zu essen.
Aber dann war der 7th-Avenue-Zug kreischend in den Bahnhof gefahren, und er hatte das Gefühl gehabt, es sei eine gute Idee einzusteigen. Während der Zug durch Tribeca, das Village und Chelsea fuhr, fiel Jack durch die verschmierten Scheiben auf, dass die Bahnhöfe für einen Feiertag schrecklich belebt waren – zumindest so früh am Morgen.
Als er am Times Square ausstieg und durch den gekachelten Tunnel unter der 42nd Street den Block nach Westen ging, hörte er einen Bahnpolizisten angewidert zu seinem Kollegen sagen: »Warte erst mal, bis du nach oben kommst. Da draußen sieht es aus wie eine Mischung aus dem Bronxer Zoo und dem Frühlingsanfang in Lauderdale.«
Auf der Eighth Avenue kam er ans Tageslicht und ließ den starken Geruch nach Desinfektionsmitteln hinter sich, der den Gestank nach Erbrochenem kaum überdecken konnte. Der Betrieb auf der Straße war so wie an jedem Wochentag in der Stoßzeit, aber Jack hatte den Eindruck, dass das Durchschnittsalter der Leute bedeutend geringer war als sonst, und die grauen Anzüge waren grelleren Aufmachungen gewichen.
Jack verließ den Bürgersteig, um nicht mit einem schwankenden Trio von Teenagern – ihrem Aussehen nach Norms – zusammenzustoßen, die unmögliche Kopfbedeckungen aus Schaumgummi und Styropor trugen. Die Hüte waren mit Tentakeln, hängenden Lippen, segmentierten Insektenbeinen, Hörnern, ausgelaufenen Augen und anderen, unappetitlicheren Anhängseln versehen, die bei jeder Bewegung schwankten und schaukelten.
Einer der Jungen legte die Daumen an die Wangenknochen und schnitt den Passanten Grimassen. »Blblblblb«, rief er ihnen zu. »Wir sind Mutanten. Wir sind böse!« Seine Freunde lachten schallend.
Einen Block weiter kam Jack an einem der Straßenhändler vorbei, der die Hüte verkaufte. »Hey!«, rief der Händler. »Hey, kommen Sie her, kommen Sie her! Sie müssen kein Joker sein, um wie einer auszusehen. Heute ist die Gelegenheit, sich wie einer zu verhalten. Haben Sie Interesse?«
Jack schüttelte wortlos den Kopf, kratzte sich den Handrücken und ging weiter.
»Hey!«, rief der Mann einem anderen möglichen Kunden zu. »Seien Sie einen Tag lang ein Joker! Morgen können Sie wieder Sie selbst sein.«
Jack schüttelte den Kopf. Er war nicht sicher, ob es besser war, deprimiert weiterzugehen oder einfach umzukehren und dem Straßenhändler den Hals umzudrehen. Er sah auf die Uhr. Fünf vor sieben. Der Bus würde jede Minute eintreffen. Das Leben des Verkäufers war vorübergehend außer Gefahr.
Das große, hoch aufragende Busbahnhofsgebäude war ein dunkleres Grau im kühlen Grau des morgendlichen Manhattan. Jack fiel auf, dass die meisten Fußgänger das Gebäude zu verlassen schienen, anstatt es zu betreten. Der Anblick erinnerte ihn an eine Wohnung, nachdem die Kammerjäger ihre chemischen Bomben zur Explosion gebracht hatten – ein Exodus von Schaben, die aus jedem Ausgang quollen.
Er kämpfte sich durch einen der Haupteingänge, wobei er die hoch aufgeschossenen Männer ignorierte, die ihn mit ihren Sprüchen behelligten. »Hey, Mann, wollen Sie ’n Taxi? Brauchen Sie ’ne Begleitung zum Bus?« Die meisten Schaufenster der Geschäfte im Gebäudeinnern waren dunkel und mit Rollgittern versperrt, aber in den Snackbars lief das Geschäft auf Hochtouren.
Jack sah noch mal auf die Uhr. Sieben Uhr zwei. Normalerweise wäre er stehen geblieben und hätte die große kinetische Skulptur »42nd St. Carousel« bewundert, ein Glaskasten mit einem wunderbaren musikalischen Apparat von Rube Goldberg, aber jetzt war dazu keine Zeit. Weniger als keine Zeit.
Er warf einen Blick auf die Ankunftstafel. Der Bus, den er suchte, fuhr in einem Bahnsteig drei Etagen höher ein. Merde! Die Rolltreppen waren außer Betrieb. Die meisten Leute strömten die normalen Stiegen hinunter. Jack eilte zu den stationären Metalltreppen. Er fühlte sich wie ein Lachs, der sich zur Laich stromaufwärts kämpfte.
Nur ein Bruchteil der ankommenden menschlichen Flutwelle schien zu der gewöhnlichen Sorte von Leuten zu gehören, die mit dem Bus nach Manhattan kamen. Die meisten schienen entweder Touristen zu sein – Jack fragte sich, ob tatsächlich so viele Leute wegen dieses Feiertags in die Stadt kamen – oder Joker. Jack nahm zur Kenntnis, dass die Norms wegen der Enge der Treppen und Rolltreppen gezwungen waren, sich auf einen viel engeren Kontakt mit den Jokern einzulassen, als ihnen vermutlich lieb war.
Dann rammte ihm jemand schmerzhaft den Ellbogen in die Seite, und die Gelegenheit zum Sinnieren war vorbei. Als er schließlich die dritte Etage erreicht hatte und aus dem Strom der abwärtsstrebenden Menge trat, hatte Jack das Gefühl, die Spitze der Freiheitsstatue erklommen zu haben.
Jemand in der Menge tätschelte ihm den Hintern. »Pass auf, du Penner«, sagte er ohne Groll und ohne hinzusehen.
Er fand den Bereich mit dem Bahnsteig, den er suchte. Überall herrschte dichtes Gedränge. Es sah aus, als sei mindestens ein halbes Dutzend Busse gleichzeitig angekommen. Er stürzte sich in die Menge und schlug die ungefähre Richtung zu seinem Bahnsteig ein. Dann blieb er stehen, um einem Dutzend traditionell gekleideter Nonnen zu gestatten, im rechten Winkel an ihm vorbeizugehen. Ein großer Joker mit ledriger Haut und großen Hauern, die aus seinem Oberkiefer nach unten ragten, versuchte sich durch die Nonnen zu drängen. »Hey, bewegt euch, ihr Pinguine!«, rief er. Ein anderer Joker mit großen braunen Hundeaugen und Wunden in den Handflächen, die wie Stigmata aussahen, erhob Einwände. Das daraufhin einsetzende Geschrei erweckte den Eindruck, als könne es in Gewalttätigkeiten ausarten. Natürlich blieb eine zunehmend dichter werdende Menge stehen, um sich das Spektakel anzusehen.
Jack versuchte, den Auflauf zu umgehen. Er stolperte gegen einen anscheinend Normalen, der sich mit einem Stoß revanchierte. »Tut mir leid!«
Der Norm war über sechs Fuß groß und entsprechend muskulös. »Schwirr ab.«
Und dann sah er sie. Es war Cordelia. Er wusste es so sicher wie nur irgendwas, obwohl er sie noch nie in seinem Leben gesehen hatte. Elouette hatte zum vorigen Weihnachtsfest ein paar Bilder geschickt, aber die Fotos wurden der jungen Frau nicht gerecht. Cordelia sah aus wie seine Schwester vor dreißig Jahren, fand Jack. Seine Nichte trug Jeans und ein Sweatshirt. Das Sweatshirt hatte einen verwaschenen roten Farbton und einen leuchtend gelben Aufdruck. FERRICJAGGER, las Jack. Er kannte den Namen, obwohl ihn Heavy Metal nicht sonderlich interessierte. Außerdem konnte er eine Art Muster aus Blitzstrahlen und ein Schwert erkennen und etwas, das wie ein Hakenkreuz aussah.
Cordelia war etwa zehn Meter von ihm entfernt auf der anderen Seite des dichten Stroms aussteigender Fahrgäste. Sie hielt einen abgewetzten, mit Blumen bedruckten Koffer in der einen und eine Ledertasche in der anderen Hand. Ein großer, schlanker, teuer gekleideter Hispano versuchte, ihr mit dem Koffer zu helfen. Jack empfand augenblicklich Misstrauen gegen jeden hilfsbereiten Fremden, der einen violetten Nadelstreifenanzug, einen Schlapphut und einen pelzbesetzten Mantel trug. Das Material sah aus wie Robbenfell.
»Hey!«, schrie Jack. »Cordelia! Hier drüben! Ich bin’s – Jack!«
Offensichtlich hörte sie ihn nicht. Für Jack war es wie Fernsehen oder vielleicht ein Blick durch das falsche Ende eines Teleskops. Es gelang ihm nicht, Cordelia auf sich aufmerksam zu machen. Wegen des Lärms im Bahnhof, der Busse, die ihre Motoren aufheulen ließen, und des massierten Gebrülls der Menge konnten seine Worte die Kluft zwischen ihnen nicht überbrücken.
Der Mann nahm ihren Koffer. Jack schrie hilflos. Cordelia lächelte. Dann ergriff der Mann ihren Ellbogen und führte sie zu einem Seitenausgang.
»Nein!« Das war so laut, dass sogar Cordelia den Kopf wandte. Dann sah sie einen Moment lang verwirrt aus, bevor sie auf Drängen ihres Führers weiterging.
Jack stieß einen Fluch aus und fing an, Leute aus dem Weg zu schieben, um den Wartebereich zu durchqueren. Nonnen, Joker, Punker, Penner, es spielte keine Rolle. Zumindest nicht, bis er gegen einen Joker stieß, der in etwa die Gestalt und ungefähr das halbe Gewicht eines VW-Käfer hatte.
»Hast du’s eilig?«, fragte der Joker.
»Ja«, antwortete Jack, indem er sich an ihm vorbeizudrängen versuchte.
»Ich bin extra den ganzen Weg von Santa Fe gekommen. Ich hatte schon vorher gehört, dass die Leute hier grob und unhöflich sind.«
Eine Faust von der Größe eines Zweischeibentoasters packte Jacks Hemdrevers. Stinkender Atem ließ ihn an eine öffentliche Toilette nach der Stoßzeit denken.
»Entschuldigung«, sagte Jack. »Hör mal, ich muss meine Nichte erwischen, bevor sie mir so ein verdammter Zuhälter von hier entführt.«
Der Joker betrachtete ihn einen Moment lang. »Verstehe«, sagte er. »Wie in der Glotze, hm?« Er ließ Jack los, der ihn umrundete wie einen Bergausläufer.
Cordelia war verschwunden. Der piekfein gekleidete Mann, der sie geführt hatte, auch. Jack erreichte den Ausgang, den die beiden vermutlich genommen hatten. Er konnte Hunderte von Leuten sehen, hauptsächlich ihre Hinterköpfe, aber niemanden, der aussah wie seine Nichte.
Er zögerte nur eine Sekunde. Diese Stadt hatte acht Millionen Einwohner. Er hatte keine Ahnung, wie viele Touristen und Joker aus allen Teilen der Welt zum Wild-Card-Tag in die Stadt geströmt waren. Wahrscheinlich noch ein paar Millionen. Er brauchte nur eine Sechzehnjährige aus dem ländlichen Louisiana zu finden.
Im Moment war alles eine Sache des Instinkts. Ohne weiter darüber nachzudenken, strebte Jack den Rolltreppen entgegen. Vielleicht holte er den Mann und Cordelia noch ein, bevor sie den Bahnhof verließen. Wenn nicht, würde er Cordelia eben auf der Straße suchen.
Er wagte nicht daran zu denken, was er seiner Schwester sagen sollte.
Spector hatte nicht geschlafen. Er nahm das bernsteinfarbene Fläschchen mit Tabletten vom Nachttisch und warf es in den Abfall. Er brauchte etwas Stärkeres.
Die Schmerzen waren immer da, wie der Geruch nach abgestandenem Rauch in einer schmierigen Bar. Spector richtete sich auf und atmete langsam. Das Licht des frühen Morgens ließ seine Wohnung noch grauer aussehen als sonst. Er hatte das kleine Apartment mit billigem Schrott aus Pfandleihen und Secondhandläden möbliert.
Das Telefon klingelte.
»Hallo.«
»Mr. Spector?«
Die Stimme hatte einen kultivierten Bostoner Akzent. Spector kannte sie nicht.
»Ja. Wer sind Sie?«
»Mein Name ist unwichtig, zumindest einstweilen.«
»Schön.« Sie wollten also die Verschlossenen spielen, aber das taten die meisten. »Warum rufen Sie mich an? Was wollen Sie?«
»Ein gemeinsamer Bekannter namens Gruber hat angedeutet, dass Sie bestimmte einzigartige Fähigkeiten besitzen. Ein Klient von mir ist daran interessiert, Sie zu beschäftigen, anfangs auf freischaffender Basis.«
Spector kratzte sich am Hals. »Ich glaube, ich verstehe, was Sie meinen. Wenn das irgendein falsches Spiel ist, sind Sie ein toter Mann. Wenn nicht, wird es Sie einiges kosten.«
»Natürlich. Vielleicht haben Sie schon von der Shadow Fist Society gehört? Es könnte ziemlich lohnend für Sie sein, für diese Organisation zu arbeiten. Diese Leute sind jedoch sehr vorsichtig und würden zunächst eine Demonstration verlangen. Wäre heute Morgen zu früh?«
Es hieß allenthalben, dass die Shadow Fist Society vom neuen anonymen Verbrecherkönig der Stadt betrieben wurde. Die Organisation setzte den alten Bandenbossen schwer zu. Spector würde sich in dem bevorstehenden Blutbad wie zu Hause fühlen. »Ich habe nichts anderes vor. Wer schwebt Ihnen vor?«
»Das ist ohne Bedeutung für uns.« Er hielt inne. »Mr. Gruber scheint einiges über Sie wissen, und er ist nicht gerade die Verschwiegenheit in Person …«
»Von mir aus.«
»Seien Sie um elf Uhr dreißig am Times Square. Wenn wir der Ansicht sind, dass Sie unseren Anforderungen genügen, wird man Kontakt mit Ihnen aufnehmen.«
»Was ist mit dem Geld?« Spector hörte ein Summen am anderen Ende.
»Darüber verhandeln wir später. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen, ich muss mich um etwas anderes kümmern. Auf Wiedersehen, Mr. Spector.«
Spector ließ den Hörer auf die Gabel fallen. Er lächelte. Gruber gehörte nicht gerade zu den Leuten, auf die er gut zu sprechen war. Der Mann zahlte niemandem einen fairen Preis für die Ware, die man ihm brachte. Einen gierigen Hehler zu töten war so etwas wie Dienst an der Öffentlichkeit.
Er ging nackt ins Badezimmer und starrte in den Spiegel. Sein strähniges braunes Haar musste gewaschen werden, und sein Schnurrbart wuchs bereits über seine dünne Unterlippe. Er sah anders aus als an dem Tag, an dem er gestorben war. An dem Tag, als Tachyon ihn zurückgeholt hatte. Spector fragte sich, ob er vielleicht ewig leben würde. Im Moment war ihm das egal. Er streckte die Zunge heraus. Sein Spiegelbild tat es nicht, sondern lächelte ihn an.
»Keine Sorge, Demise«, sagte sein Gesicht im Spiegel. »Du kannst immer noch sterben.« Es lachte.
Er wich ins Schlafzimmer zurück. Ein lautes Knistern ertönte. Spector lief ins Wohnzimmer. Die Schlafzimmertür knallte ihm ins Gesicht. Er roch Ozon.
»Na, na, Demise. Ich wollte nur ein wenig plaudern.« Spector erkannte jetzt die Stimme. Er drehte sich um. Das projizierte Ich des Astronoms saß auf dem Bett. Er trug einen schwarzen Hausmantel, der von einer Kordel aus Menschenhaar zusammengehalten wurde. Sein verkrüppelter Körper war gerader als üblich, was bedeutete, dass seine Kräfte aufgeladen waren. Er war mit Blut besudelt.
»Was willst du?« Spector hatte Angst. Der Astronom gehörte zu den wenigen Leuten, bei denen seine Kraft nicht funktionierte.
»Weißt du, was heute für ein Tag ist?«
»Wild-Card-Tag. Alle Welt weiß das.« Spector hob eine braune Cordhose vom Boden auf und zog sie an.
»Ja. Aber es ist auch noch ein anderer Tag. Der Tag des Jüngsten Gerichts.« Der Astronom verschränkte die Finger.
»Der Tag des Jüngsten Gerichts? Wovon redest du?«
»Von diesen Schweinehunden, die meinen Plan durchkreuzt haben. Sie haben sich in unsere wahre Bestimmung eingemischt. Sie haben uns daran gehindert, die Welt zu regieren.« Die Augen des Astronoms funkelten. In ihnen lag ein Irrsinn, wie ihn selbst Spector noch nicht gesehen hatte. »Aber es gibt andere Welten. Diese Welt wird mein Abschiedsgeschenk für die Wichser, die mir in die Quere gekommen sind, so schnell nicht vergessen.«
»Turtle. Tachyon. Fortunato. Den Burschen willst du an den Kragen?« Spector klatschte leicht in die Hände. »Wie schön für dich.«
»Bis zum Ende des heutigen Tages werden sie alle tot sein. Und du, mein lieber Demise, wirst mir dabei helfen.«
»Blödsinn. Ich habe einmal die Drecksarbeit für dich erledigt, jetzt nicht mehr. Du hast mich ziemlich hängen lassen, und ich gebe dir keine zweite Chance.«
»Ich will dich nicht töten, also gebe ich dir Gelegenheit, deine Meinung zu ändern.« Ein Regenbogen aus farbigem Licht umschwirrte unversehens den Astronom.
»Verpiss dich, Mann.« Spector schüttelte die Faust. »Du wirst nicht noch mal einen Idioten aus mir machen.«
»Nein? Dann muss ich wohl eine Leiche aus dir machen. Zusammen mit all den anderen.« Der Astronom verwandelte sich in einen Schakalskopf. Er öffnete das Maul. Dunkles Blut strömte dampfend auf den Teppichboden. Er heulte. Das Gebäude erbebte bei dem Geräusch.
Spector hielt sich die Ohren zu und fiel zu Boden.
Fortunato rief Caroline an und trug ihr auf, Veronica abzuholen. Caroline konnte sie ins Stadthaus ihrer Mutter bringen, der offiziellen Geschäftsadresse der Hostessenagentur. Caroline und ein halbes Dutzend der anderen Frauen wohnten dort, mehr oder weniger. Er scheuchte Veronica in ihre Kleider und ließ sie dann dösend auf der Wohnzimmercouch zurück.
Brennan sagte: »Kommt sie wieder auf die Beine?«
»Ich bezweifle es.«
»Ich weiß, es geht mich nichts an, aber bist du nicht ein bisschen zu hart mit ihr umgegangen?«
»Es ist unter Kontrolle«, sagte Fortunato.
»Klar ist es das. Ich habe nie behauptet, dass es das nicht ist.«
Sie standen da und sahen einander ein paar Sekunden lang an. Als Yeoman war Brennan wahrscheinlich der einzige von den kostümierten Helden, die in New York frei herumliefen, dem Fortunato traute. Zum einen, weil Brennan noch ein Mensch und nicht vom Wild-Card-Virus verändert worden war. Zum anderen, weil Brennan und Fortunato in dem monströsen außerirdischen Wesen, das einige Leute den Schwarm nannten, einiges zusammen durchgemacht hatten.
Der Astronom nannte ihn TIAMAT, und er hatte eine Maschine benutzt, die er Shakti-Vorrichtung nannte, um ihn zur Erde zu holen. Fortunato hatte die Maschine persönlich zerstört, allerdings nicht früh genug. Der Schwarm war bereits eingetroffen, und Hunderttausende waren deswegen auf der ganzen Welt gestorben.
»Was ist mit dem Astronom?«, fragte Fortunato.
»Kennst du einen Burschen, den sie das Walross nennen? Jube, den Zeitungsverkäufer?«
Fortunato zuckte die Achseln. »Kommt mir bekannt vor.«
»Er hat den Astronom heute früh in Jokertown gesehen. Er hat Chrysalis davon erzählt, und sie hat die Information an mich weitergegeben.«
»Was hat sie dich gekostet?«
»Nichts. Ich weiß, das sieht ihr gar nicht ähnlich. Aber sogar Chrysalis hat Angst vor dem Kerl.«
»Woher kennt dieser Jube den Astronom?«
»Ich weiß es nicht.«
»Also haben wir die Schilderung eines unzuverlässigen Zeugen aus zweiter Hand und eine kalte Spur?«
»Bleib ruhig, Mann. Ich hab versucht, dich anzurufen. Die Vermittlung hat mir gesagt, der Hörer sei abgenommen. Das ist nicht mal mein Kampf. Ich bin nur gekommen, um dir zu helfen.«
Fortunato warf einen Blick auf Hathors Spiegel. Er würde vermutlich den ganzen Tag brauchen, um ihn zu reinigen und sich so zu konzentrieren, dass er es erneut versuchen konnte. Wenn der Astronom tatsächlich aus seinem Loch gekrochen war, konnte es in der Zwischenzeit eine Menge Ärger geben.
»Ja, okay. Ich kümmere mich noch um diese andere Geschichte, dann können wir der Sache nachgehen.«
Als Fortunato sich angezogen hatte, traf Caroline ein. Obwohl ihre Haare ein Gewirr aus kurzen blonden Locken waren und sie nur ein altes Sweatshirt und Jeans trug, begehrte Fortunato sie, kaum dass er sie sah.
Sie sah nicht älter aus als vor sieben Jahren, als er sie aufgenommen hatte. Sie hatte ein Kindergesicht und einen stämmigen, energetischen Körper, dessen Muskeln sie voll unter Kontrolle zu haben schien. Fortunato liebte alle seine Frauen, aber Caroline war etwas Besonderes. Sie hatte alles gelernt, was er ihr beibringen konnte – Benehmen, Fremdsprachen, Kochen, Massage –, aber ihr Wille war ungebrochen. Er hatte sie nie gezähmt, und vielleicht war das der Grund, warum sie ihm im Bett immer noch mehr Freude bereiten konnte als alle anderen.
Er küsste sie flüchtig, während er sie einließ. Er wünschte, er hätte sie mit in sein Schlafzimmer nehmen können, um sich von ihr einen Schuss tantrischer Macht geben zu lassen. Aber dazu blieb keine Zeit.
»Was willst du mit ihr machen?«, fragte Caroline.
»Hat sie heute Abend eine Verabredung?«
»Es ist Wild-Card-Tag. Jeder hat heute Abend eine Verabredung. Meine müsste bis Mitternacht vorbei sein, und ich muss vielleicht noch mal raus, wenn ich zu früh nach Hause komme.«
»Behalt sie im Auge. Lass sie ausgehen, wenn du glaubst, dass alles mit ihr in Ordnung ist. Aber halt sie vom H fern. Den Rest überlege ich mir später.«
Sie warf einen Blick auf Yeoman. »Ist was passiert?«
»Kein Grund zur Sorge. Ich ruf dich später an.« Er küsste sie noch einmal und sah ihr nach, wie sie Veronica zu dem wartenden Taxi führte. Dann wandte er sich Brennan zu und sagte: »Also los.«
»Ist das ein Hummer, oder ist das ein Hummer?«, fragte Gills. Er hielt ihn hoch, sodass Hiram ihn inspizieren konnte, und der Hummer bewegte hilflos die Beine. Die Scheren waren zugebunden, und ein paar Stränge Seegras lagen auf der harten Schale.
»Ein Hummer von Rang«, stimmte Hiram Worchester zu. »Sind alle so groß?«
»Dieser gehört eher zu den kleinen«, sagte Gills. Der Joker hatte eine gesprenkelte grünliche Haut und Kiemenschlitze in den Wangen, die sich öffneten, wenn er lächelte, sodass feuchtes rotes Fleisch zu sehen war. Die Kiemen funktionierten natürlich nicht. Hätten sie es getan, wäre der ältliche Fischhändler kein Joker, sondern ein Ass gewesen.
Draußen fiel das Licht des Morgengrauens über die Fulton Street, aber auf dem Fischmarkt herrschte bereits reges Treiben. Fischhändler und Käufer feilschten um die Preise, Kühltransporter wurden beladen, Lastwagenfahrer schnauzten einander an, und Männer mit gestärkten weißen Schürzen rollten Fässer über die Bürgersteige. Der Fischgeruch hing wie Parfum in der Luft.
Hiram Worchester hielt sich für eine Nachteule und zog es an den meisten Tagen vor, bis lange in den Tag hinein zu schlafen. Aber heute war kein gewöhnlicher Tag. Es war Wild-Card-Tag, der Tag, an dem sein Restaurant für die Öffentlichkeit geschlossen und Schauplatz einer Privatparty der New Yorker Asse war. Die Party war zu einer Tradition geworden, und besondere Anlässe erforderten besondere Maßnahmen wie zum Beispiel frühes Aufstehen zu einer Zeit, wenn es draußen noch dunkel war.
Gills wandte sich ab und versenkte den Hummer wieder in dem Fass. »Wollen Sie noch einen sehen?«, fragte er, indem er eine Handvoll nasses Seegras beiseitewarf und einen zweiten Hummer hervorholte. Er war größer als der erste und lebendiger. Seine dünnen Beine bewegten sich energisch. »Sehen Sie doch, wie er sich wehrt«, pries Gills seine Ware an. »Sagte ich frisch, oder sagte ich frisch?«
Hirams Lächeln war ein Aufblitzen weißer Zähne inmitten seines schwarzen Vollbarts. Er war sehr wählerisch, was das Essen betraf, das er im Aces High servierte, und ganz besonders am Wild-Card-Tag. »Sie enttäuschen mich nie«, erwiderte Hiram. »Diese Hummer sehen wirklich hervorragend aus. Lieferung bis spätestens elf Uhr, nehme ich an?«
Gills nickte. Der Hummer wedelte mit seinen Beinchen in Hirams Richtung und betrachtete ihn mürrisch. Vielleicht sah er sein Schicksal voraus. Gills steckte ihn wieder ins Fass.
»Wie geht es Michael?«, fragte Hiram. »Ist er immer noch in Dartmouth?«
»Es gefällt ihm dort wirklich sehr gut«, sagte Gills. »Er beginnt gerade sein vorletztes Jahr, aber er schreibt mir schon vor, wie ich mein Geschäft führen soll.« Er legte den Deckel auf das Fass. »Wie viele brauchen Sie?«