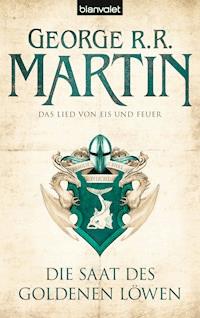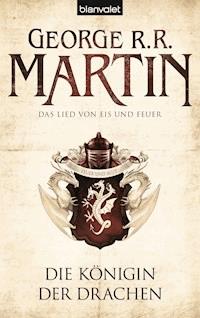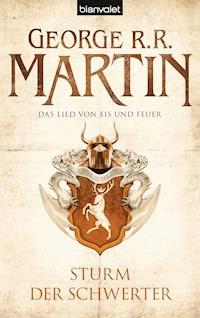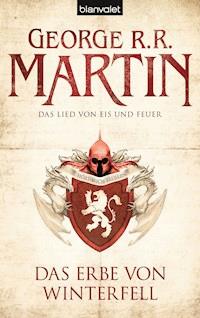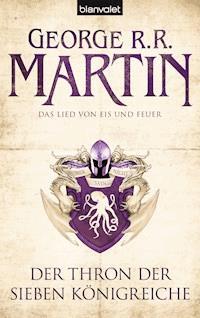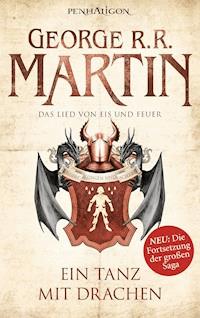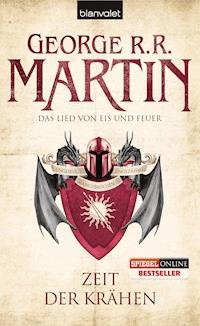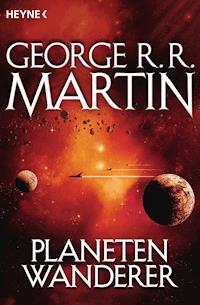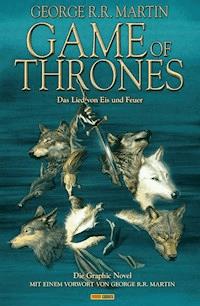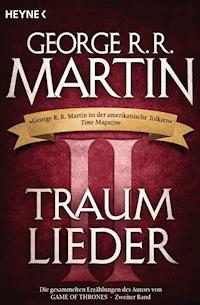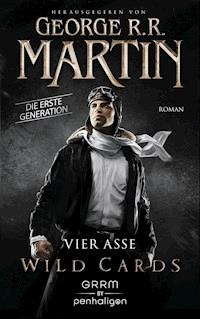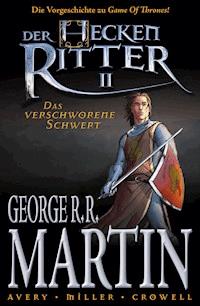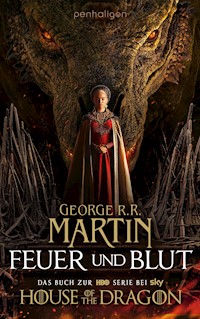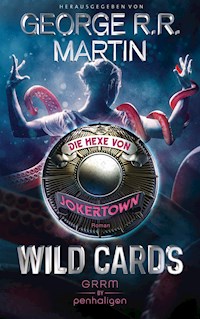
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Wild Cards - Jokertown
- Sprache: Deutsch
Brutal, skrupellos, pure Action – Urban Fantasy von George R.R. Martin ist einfach cool.
»Wild Cards« ist die spektakuläre Superhelden-Reihe des »Game of Thrones«-Erfinders, in der sich Asse und Joker bekriegen: Die kaltblütige Hexe Baba Yaga zwingt Joker an illegalen Käfigkämpfen in Kasachstan teilzunehmen. Doch ihr Plan ist noch teuflischer: Die Kämpfer müssen sterben, damit der Hexe ein Monster aus einer anderen Dimension gewogen bleibt. Aus New York wird ein Team an Assen zur Ermittlung ausgesandt. Einer nach den anderen fällt der Hexe zum Opfer – bis ein einziger bleibt, um die Welt zu retten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1064
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
»Wild Cards« ist die spektakuläre Superhelden-Reihe des »Gameof Thrones«-Erfinders, in der sich Asse und Joker bekriegen: Die kaltblütige Hexe Baba Yaga zwingt Joker an illegalen Käfigkämpfen in Kasachstan teilzunehmen. Doch ihr Plan ist noch teuflischer: Die Kämpfer müssen sterben, damit der Hexe ein Monster aus einer anderen Dimension gewogen bleibt. Aus New York wird ein Team an Assen zur Ermittlung ausgesandt. Einer nach den anderen fällt der Hexe zum Opfer – bis ein einziger bleibt, um die Welt zu retten.
Herausgeber
George Raymond Richard Martin wurde 1948 in New Jersey geboren. Sein Bestseller-Epos »Das Lied von Eis und Feuer« wurde als die vielfach ausgezeichnete Fernsehserie »Game of Thrones« verfilmt. George R. R. Martin wurde u. a. sechsmal der Hugo Award, zweimal der Nebula Award, dreimal der World Fantasy Award (u. a. für sein Lebenswerk und besondere Verdienste um die Fantasy) und dreimal der Locus Poll Award verliehen. 2013 errang er den ersten Platz beim Deutschen Phantastik Preis für den Besten Internationalen Roman. Er lebt heute mit seiner Frau in New Mexico.
Aus dem Wild-Cards-Universum bereits erschienen:
WILD CARDS. Die erste Generation
Vier Asse
Der Schwarm
Der Astronom
WILD CARDS. Die zweite Generation
Das Spiel der Spiele
Der Sieger der Verlierer
Der höchste Einsatz
WILD CARDS. Jokertown
Die Cops von Jokertown
Die Gladiatoren von Jokertown
Die Hexe von Jokertown
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
GEORGE R. R. MARTIN
In Zusammenarbeit mit Melinda M. Snodgrasspräsentiert
WILD CARDS
Die Hexe von Jokertown
Geschrieben von David Anthony Durham | Stephen Leigh | John Jos. Miller | Melinda M. Snodgrass | Caroline Spector | Ian TregillisDeutsch von Simon Weinert
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »High Stakes« bei Tor Books, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2016 by George R. R. Martin and the Wild Cards Trust
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2019 by Penhaligon in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Catherine Beck
Umschlaggestaltung und -illustration: © Max Meinzold, München, unter Verwendung eines Motivs von Ahturner/Shutterstock.com
BL · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-23638-0V001
www.penhaligon.de
Für Ty Franck, für all die Schrecken, und Jayné Franck, für Jugendstilwunder
Montag
Barbara Baden – das Ass Babel – starrte durchs offene Fenster. Oben floss die Milchstraße als herrlicher vielfarbiger Strom im Bogen über den Nachthimmel – bestäubt mit einer Vielzahl von Sternen, die Barbara seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen hatte. In New York City konnte man von Glück sagen, wenn man am von Stadtlichtern und Smog verseuchten Himmel auch nur so prominente Konstellationen wie den Orion ausmachen konnte. Hier in Peru, auf dem Machu Picchu, mitten im Gebirge mit seiner dünnen Luft und fern jeglicher Stadtbeleuchtung, tobten sich die Sterne in all ihrer Pracht aus. Unten, an den steilen Hängen, lag eine neue Stadt, eine Zeltstadt. Viele Zelte leuchteten von innen, und alle glänzten im silbernen Licht des Halbmonds, der über die Hänge des Huayna Picchu kroch, des Gipfels, in dessen Schatten die Inkaruinen lagen.
In den Zelten hausten einige der Komitee-Asse: Earth Witch, Bugsy, Tinker, Llama, Brave Hawk und Toad Man. Und auch UNO-Soldaten. Klaus und Barbara jedoch hatten – wie auch UNO-Generalsekretär Jayewardene – richtige Zimmer in einem der wiederaufgebauten Häuser weit oben am Hang für sich requiriert. Das war einer der Vorteile, wenn man das Kommando hatte.
»Schön hier, nicht wahr?«, hörte sie Klaus – für beinahe alle anderen hier oben war er Lohengrin – hinter sich sagen, und seine Arme legten sich um sie. Sie ließ es zu und lehnte sich an ihn. Als er den Kopf neigte, spürte sie seine Augenklappe über ihren Schädel schaben, und sie betrachtete seine Arme. Seine Haut war trocken, und auf seinen Handrücken bildeten sich schon feine Fältchen. Sie waren nun beide schon weit über dreißig, und in der Ferne blitzte schon die gefürchtete Vierzig auf. Vor acht Jahren, als sie Klaus kennengelernt hatte, war ihr dieser Gedanke völlig unmöglich erschienen. Doch auch ihre Hände, die auf denen von Klaus lagen, sahen nicht mehr so jung aus wie früher, und sie hatte Mühe, ihr Gewicht zu halten. Gelegentlich zeigten sich unter ihren kurzen braunen Haaren auch ein paar graue Exemplare. Sie hatte den Kampf gegen die Falten um die Augen bereits aufgegeben. »Man kann verstehen, wieso die Inkas diesen Ort zu ihrer Hauptstadt machen wollten. Und war es nicht gut von mir, dass ich das organisiert habe?«
»Du meinst ›wir‹, oder?«, fragte sie und spürte sein Lachen mehr, als dass sie es hörte.
»Klar. Wir.«
Das Komitee war in Peru eingeschritten, als absehbar geworden war, dass hochkochende innere Streitereien zu Todesopfern führen würden. Gegenüber standen sich zum einen die Rebellen des Neuen Leuchtenden Pfads, die für die Rückkehr zu den Strukturen des Inkareichs und den Sturz der peruanischen Regierung und der sie am Leben haltenden militärischen Seilschaften eintraten. Angeführt wurden die Rebellen von Assen: Lorra (besser bekannt als Cocomama) und Curare, einem froschhaften Jokerass, dessen Haut und Zunge Gift absonderten.
An der Spitze der peruanischen Regierung saß Präsidentin Keiko Fujimori, die Tochter des ehemaligen Präsidenten Alberto Fujimori. Als angeblich demokratisch gewähltes Staatsoberhaupt erhielt sie Unterstützung der Staatschefs anderer südamerikanischer Staaten, vor allem von jenen Präsidenten, die selbst Aufstände und Putschversuche zu fürchten hatten. Hinter der peruanischen Regierung stand freilich der Militärapparat, eine gut ausgerüstete Armee mit Waffen, die vielleicht nicht ganz auf der Höhe der Zeit waren, aber dennoch Massenvernichtungen verursachen konnten. Präsidentin Fujimori hatte in ihren letzten Reden deutlich gemacht, dass sie entschlossen war, diese einzusetzen, sollte sie dazu gezwungen sein.
Die UNO-Truppen mit Jayewardene an der Spitze waren vor zwei Wochen eingetroffen, als in der Nähe des Machu Picchu gerade die ersten ernsthaften Zusammenstöße stattgefunden hatten. Die Rotorblätter der UNO-Hubschrauber hatten das Laub rings um die Lichtung aufgewirbelt und alles Grün zu einem fieberhaften Tanz angepeitscht. Unten sah man das schmaler werdende Niemandsland zwischen der peruanischen Kompanie und den Rebellentruppen. Tinkers bewaffnete Drohnen schwebten bereits bedrohlich jaulend über den verfeindeten Linien und wurden beschossen.
Ehe der erste Hubschrauber landete, setzte Babel ihre Wild Card ein. Ihre Fähigkeit, gesprochene Sprache unverständlich zu machen, hatte auf beiden Seiten für Verwirrung und Panik gesorgt, was man an der unkoordinierten Reaktion auf die Ankunft der UNO-Truppen erkannte. Armeen waren nicht kampffähig, wenn die Befehle der Kommandeure unverständlich waren, wenn Offiziere sie nicht weiterleiten und Sergeanten sie nicht an ihre Mannschaften weitergeben konnten. Denn dann wusste niemand, was er tun oder wohin es gehen sollte. Selbst Funksprüche schienen nur noch in einer unverständlichen Unsinnsprache zu erfolgen. Die Verwirrung wurde noch größer, da die UNO-Truppen und ihre Komitee-Asse dieses Problem anscheinend nicht hatten und ihre Aktionen wirkungsvoll koordinieren konnten. Das Geschwader von acht Hubschraubern – zwei UH-1Y Venoms, in denen die Komitee-Asse saßen, und sechs riesige, zweimotorige Transporthubschrauber des Typs MG-47G Chinook – rauschten in leichter Schräglage heran wie bedrohlich dröhnende Raubvögel. Der Venom »Super Hueys« spie Maschinengewehrfeuer aus und pflügte damit den Boden zwischen den beiden aufeinander zustrebenden Heeren um. Eine Kugel traf eine von Tinkers Drohnen, die in ihre herabregnenden Plastik- und Drahteinzelteile zerfiel. Babel beobachtete das Ganze durchs Cockpitfenster, während Tinker hinter ihr laut fluchte. Der Hubschrauber machte eine schwindelerregende Kehre und landete.
Mit schimmernder Phantomrüstung sprang Lohengrin aus dem Komitee-Helikopter. Bedrohlich schwang er sein Schwert, und sowohl die peruanischen Soldaten als auch die Rebellen wichen vor dem Rotorenwind und den Blauhelmen, die aus den Hubschraubern strömten, zurück. Die Komitee-Asse, die Lohengrin und Barbara zugeteilt waren, folgten ihm, während Tinkers verbliebene Drohnen herabschwirrten und die Rw entlangsausten. Unter den beiden verfeindeten Heeren erbebte die Erde, als Earth Witch innerhalb von Sekunden zwischen ihnen einen breiten Graben aushob und die feuchte, dunkle Erde zu beiden Seiten aufhäufte. Llama, ein in Südamerika bekanntes und beliebtes Ass, trat rechts neben Lohengrin. Zur Warnung spuckte er aus, und der schmierige Speichel flog zehn Meter weit, bevor er nah der peruanischen Frontlinie landete. Hinter Llama erschien Buford Calhoun und verwandelte sich in Toad Man. Wie eine groteske Peitsche flitzte seine Zunge heraus – und bei dem Anblick wichen die Rebellen, die dem Hubschrauber am nächsten waren, hastig zurück, denn das erinnerte sie auf beunruhigende Weise an ihren eigenen Curare. Tom Diedrich – Brave Hawk – segelte furchteinflößend über den anderen Assen und schlug mit den Flügeln. Und ganz hinten stand, als kristallen glitzernde Bedrohung, Glassteel.
Und hinter den Assen nahmen die beiden Kompanien Blauhelme Aufstellung, die Waffen im Anschlag.
Als die Hubschrauber aufgetaucht waren, waren bereits erste Schüsse zwischen den Kontrahenten gefallen, doch jetzt war jegliches Feuer eingestellt worden. Babel stieg als Letzte aus dem Helikopter, da drehten sich die Rotoren schon langsamer. Sie nahm das Mikrofon, das ihr einer der Blauhelme reichte, und sprach. Ihre Stimme dröhnte aus den Lautsprechern der Hubschrauber, und ihre Worte waren nun für alle Anwesenden zu verstehen, egal welche Sprache sie sprachen.
»Diese Schlacht ist zu Ende«, sagte sie. »Ihr legt nun alle eure Waffen nieder. Wenn ihr weitermacht, hat das schlimme Konsequenzen für euch.«
Der Kampf endete mit minimalen Verlusten auf beiden Seiten, und angesichts der Macht, die die Asse und die UNO-Truppen repräsentierten, brachte Jayewardene die beiden Seiten rasch an den Verhandlungstisch, auch wenn es zu sporadischen Zusammenstößen mit widerspenstigen Rebellen oder Soldaten kam, die aber alle durch das Einschreiten von Assen schnell beigelegt wurden. Jayewardene moderierte die Gespräche, doch waren es Babel und Lohengrin, die Jayewardene jeden Abend Ratschläge gaben, was er sagen sollte, um welche Zugeständnisse er bitten sollte und wo Kompromisse möglich waren und wo nicht. Im Verlauf der nächsten Wochen brachten sie die Bevollmächtigten Fujimoris und die Anhänger des Neuen Leuchtenden Pfads einander näher.
Das Flattern eines Falters holte Babel in die Gegenwart zurück. Das Insekt, das sich auf den Vorhang am offenen Fenster setzte, war schön: eine dunkle Erscheinung, locker so groß wie Lohengrins Hände. Auf seinen Flügeln prangten vielfarbige Wirbel, die aussahen wie riesige glotzende Augen. Natürlich wusste sie, was der Falter war und was er repräsentierte: Bei der Einsatzbesprechung hatte man sie über den rätselhaften Schwarzen Boten informiert, dessen Körper sich nur in einem Schwarm dieser Falter manifestieren konnte, und der hörte und sah, was die einzelnen Individuen des Schwarms sahen und hörten. Sein vorausschauender Geist lenkte die Rebellen, auch wenn er sich selbst nie als Anführer des Neuen Leuchtenden Pfads bezeichnete und sich nicht an den Kämpfen beteiligte.
Babel bedachte den Falter mit einem kurzen, schiefen Lächeln. Sie griff den Vorhang, worauf er wegflog. Babel schloss und verriegelte das Fenster. Noch einmal lehnte sie sich mit dem Rücken gegen Lohengrin. Als er die Hände auf ihre Brüste legte, ließ sie es geschehen und wandte sich um, damit sie sich anschauen konnten. Sie sah ihm ins Gesicht.
»Nicht hier«, sagte sie. »Zu viele Augen – verschiedenster Art – und Kameras mit langen Linsen.«
Klaus grinste sie an und berührte seine Augenklappe. »Ich habe nur ein Auge, und das ist auf dich gerichtet.«
Sie zeigte ihm ein halbherziges, trauriges Lächeln. »Wir müssen morgen früh raus, weißt du? Und es ist schon spät.«
»Heißt das, dass wir den Abend nicht verlängern können, meine Liebe? Morgen geht es doch nur um Äußerlichkeiten. Und was die voyeuristische Falterplage angeht: Wir ziehen einfach alle Vorhänge zu.«
»Du bist unmöglich.«
»Nichts ist unmöglich. Wenn du mich fragst.«
»Solange wir zusammenarbeiten, meinst du?«, fragte sie, und er schnaubte amüsiert.
»Dann eben, solange wir zusammenarbeiten«, knurrte er.
Sie nahm seine Hand, erwiderte sein Lächeln und führte ihn zum Bett.
Der Mond stand bereits hoch über dem Huayna Picchu, als sie endlich einschliefen.
Marcus Morgan schlängelte sich aus der Scheune. Normalerweise bewegte er sich geschmeidig und kraftvoll, angetrieben von Schlangenmuskeln, die an der Hüfte ansetzten und sechs Meter weit bis an die Spitze seines leuchtend bunt geringelten Schwanzes reichten. Mit seinem Schlangenunterleib und dem Oberkörper eines muskulösen, jungen Afroamerikaners machte er eine beeindruckende Figur.
Aber jetzt fühlte er sich nicht beeindruckend. Bei jeder Bewegung versuchte er, ein schmerzhaftes Keuchen zu unterdrücken, konnte es aber nicht. Angeschossen zu werden, war scheiße. Er war verletzt. Krass verletzt. Jetzt war ihm das klar, auch wenn er es im Durcheinander der Arena oder in der Euphorie der Flucht nicht begriffen hatte. Er wusste nicht, ob er jetzt noch zum Kämpfen taugen würde, wenn er es müsste. Die Tobsucht, die in der Arena von ihm Besitz ergriffen hatte, war verflogen. Er hoffte, dass er das Kämpfen hinter sich gelassen hatte. Erst mal musste er überleben und nach Hause gelangen. Das wäre schwierig genug.
Beim Anblick der unscheinbaren Gebäude im trüben, flackernden Straßenlicht dachte er: Sieh dir das an. Ich, angeschossen, gestrandet in Kasach-weiß-der-Teufel-wo-das-ist …
Er wandte sich um, als eine junge Frau aus der Zuflucht kroch. Sie schwankte auf ihren Pfennigabsätzen, doch wie alles, was sie tat, sah auch das verdammt sexy aus. Schon als sie zum ersten Mal in seine Zelle in Baba Yagas Jokergladiatorenlager geschlüpft war, hatte Marcus sich in sie verknallt. Sie hatte ausgesehen, als käme sie direkt aus der Vogue. Zu vollkommen, um wahr zu sein. Mit ihren hellblauen Augen und dem kurzen schwarzen Haar, das ihn an einen weiblichen Filmstar aus den 1920ern erinnerte, die er einmal auf einer Postkarte gesehen hatte. Ihr Alter einzuschätzen, war nicht leicht, doch alles an ihr hatte den Glanz reinster Schönheit und Jugend.
Und ich bin mit ihr zusammen, dachte er. Er konnte es noch immer nicht ganz glauben.
»Dafür bin ich falsch angezogen«, sagte Olena mit ihrem ukrainischen Akzent. Es war eine Untertreibung. Sie trug noch immer die Kleider, die sie in Baba Yagas Casino gebraucht hatte, nämlich als Lustmädchen, mit dem siegreiche Jokergladiatoren belohnt wurden wie mit einer exotischen Extraration Fleisch. Das kurze rote Kleid schmiegte sich hauteng an ihre Rundungen. Es war so eng, dass Marcus die Kontur ihres Bauchs und das Relief ihres Schlüsselbeins sehen konnte. Er ließ den Blick nicht auf ihren Nippeln ruhen, obwohl er es wollte. Sie war umwerfend, aber für ihn war sie nicht einfach ein Stück Fleisch. Sie war mehr. Wenn sie überleben würde, würde er es ihr beweisen.
Eine Sache stimmte nicht mit ihrer Erscheinung. Es war die Glock, die sie sich unter den Gürtel geschoben hatte. Sie war flach an ihren Bauch gedrückt.
Vorhin hatte er sie gefragt: »Wo hast du eigentlich schießen gelernt?«
Sie hatte ihm knapp geantwortet: »Von meinem Vater.« Mehr hatte sie dazu nicht gesagt.
»Bist du fertig?«, fragte Marcus und schlängelte sich ein Stück weiter.
Sie holte zu ihm auf. »Ich denke immer noch, dass wir …«
»Ich geh nicht ins Krankenhaus! Das sind lauter Leute aus dem Casino. Leute, die wegen mir dort sind.«
»Du hast das ja nicht allein verursacht«, grummelte sie.
»Du hast die Krankenwagen doch gesehen, als wir weg sind. Die Militärfahrzeuge. Bestimmt wimmelt es dort von Bullen.«
»Du bist angeschossen. Wenn Leute angeschossen werden, dann gehen sie ins Krankenhaus! Warum bist du denn so dickköpfig?«
»Ich bin Joker. Wenn ich nicht dickköpfig wäre, wäre ich schon längst tot.« Marcus stockte, als ein schwarzer Geländewagen über die Kreuzung vor ihnen fuhr. Kurz darauf raste ein Polizeiauto mit Blaulicht vorbei, allerdings nicht mit Martinshorn. Im Weitergehen fragte Marcus: »Und was ist, wenn Baba Yaga dort ist? Dann wären wir beide am Arsch.«
»Die ist tot. Wer hat schon Angst vor der?«
Das hatten sie alles schon durchgekaut. Das Krankenhaus kam nicht in Frage, Talas kam nicht in Frage, solange Baba Yagas Schläger herumliefen und sie nicht wussten, wem sie trauen konnten, zumal er als schwarzer Schlangenjoker aus New York auffiel. Nicht nur das, die ganze Stadt schien unruhig zu sein. Während sie sich im Versteck ausgeruht hatten, war Marcus hin und wieder von Schüssen aufgeschreckt worden. Einmal flog sogar etwas in die Luft, so nah, dass Marcus die Erschütterung im Schwanz spürte, und so laut, dass man das Brausen der Flammen hörte. Irgendwann hatten Einsatzhörner ihre immer gleichlautende Botschaft hinausgeplärrt. Das taten sie noch immer. Schreie und hastige Schritte, Kampflärm, Hubschrauberflappen am Himmel. Er wusste nicht, was da überall geschah, aber sie mussten weg hier.
Olena sagte: »Horrorshow hättest du auch umbringen sollen.«
»Horrorshow?«
»Das ist nur einer seiner Namen. Dieser schreckliche Alte, der immer bei Baba Yaga war.« Sie stieß einen kehligen Laut aus, der Ekel und Furcht ausdrückte. »Einmal musste ich in seiner Nähe in der Loge sitzen.« Ihr schauderte, und sie schüttelte die Finger, als würde etwas Faules an ihnen kleben. »Mein Gott. Der ist widerwärtig. Er ist … Ich weiß nicht, was. Manche sagen, das Töten hätte ihm gefallen, dass er Spaß daran hatte und dass die Baba Yaga die Arena nur für ihn organisiert hat. Andere meinten, er wäre ein Ass, das ihr dumm gekommen ist. Zur Strafe hat sie ihn so gemacht, dass er fortwährend leidet und alle es sehen. Ich weiß nicht, was stimmt. Es gab viele Gerüchte.«
Marcus dachte an den verunstalteten sabbernden Alten zurück, der an lauter Schläuchen und Atemgeräten hing. Er sagte: »Wer hat das alles über ihn gesagt?«
Olena ging ein Stück weiter, ohne zu antworten. Doch dann sagte sie knapp: »Wachen. Manchmal haben die endlos gelabert.«
Sogleich wünschte sich Marcus, er hätte die Frage nicht gestellt. Es brauchte nicht viel, damit ihm die schlimmsten Vorstellungen kamen. Wachen, die laberten und laberten, weil sie Olena für sich allein hatten, weil sie eine Hure war und sie …
Er würgte den Gedanken ab und wechselte das Thema. »Wo gehen wir eigentlich hin?«
»Da lang.« Olena zeigte auf eine Lücke zwischen den Häusern. In der Ferne erhob sich ein schneebedeckter Gipfel wie ein Schatten vor dem rötlichen Himmel. »Zu dem Berg.«
»Weshalb dahin?«
Sie schob sich das kurze Haar aus dem Gesicht. »Kennst du einen besseren Berg? Wir gehen dorthin, weil er nicht in der Stadt ist. Wir sind es. Sobald wir ihn erreicht haben, sind wir es nicht mehr.«
»Deine Logik hat was.«
»Komm. Gehen wir.« Sie nahm ihn an der Hand.
Marcus glitt neben ihr her. Sein Schwanz war schwerfällig und tat weh. Die Schmerzen waren wie kantige Scherben. Er hoffte, dass sie anderen Leuten aus dem Weg gehen konnten, sich vorsichtig bewegten und unbemerkt blieben. Doch es brauchte nicht lange, bis er diese Hoffnung aufgab.
Nachdem sie ihren verborgenen Hinterhof einmal verlassen hatten, fanden sie sich in einer mit Leben erfüllten Stadt voller Menschen und Autos wieder. Allerdings herrschte kein normaler Verkehr. Ein Fahrer heizte die Straße hinunter, kurvte wild herum und schnitt anderen den Weg ab. Ständig hupte er und schrie zu seinem Fenster hinaus. Als handelte es sich um ein Wettrennen, raste ein kleines, gedrungenes Auto den Bordstein hinauf und schoss heulend den Gehweg entlang. Marcus und Olena konnten ihm gerade noch so aus dem Weg springen.
»Was soll denn die Scheiße?«, fragte Marcus. »So eilig hat’s ja wohl keiner zur Arbeit!«
Olena gab keine Antwort. Sie begab sich in den Strom Fußgänger. Sobald die Leute seinen riesigen Schlangenleib sahen, gingen sie ihm aus dem Weg. Sperrten die Mäuler auf und machten große Augen. Marcus wusste nicht, ob sie wegen seines Schwanzes oder wegen seiner Hautfarbe staunten. Wie auch immer, sie wichen aus.
Auch unter normalen Umständen wäre Marcus die Stadt sonderbar vorgekommen. Die Häuser waren niedrig und hässlich, und ihre Betonfassaden schienen der Abschreckung zu dienen. Auf den Straßen fuhren andere Automarken, die er nicht kannte und die alt aussahen und komische Karosserien hatten. Er hatte geglaubt, in New York alle nur erdenklichen Menschentypen – und Jokertypen – gesehen zu haben, aber solche Leute wie hier hatte er noch nie gesehen. Hellhäutig und schwarzhaarig, mit asiatischen Gesichtszügen, aber ganz anders als die Chinesen und Koreaner, die Marcus aus Jokertown kannte. In mancher Hinsicht waren ihre Kleider exotisch bunt, in anderer aber eintönig und unförmig, manchmal auch ganz normal. All das nahm er vage wahr, doch was ihn verwirrte, war das Chaos.
Ein alter Mann riss an der Leine seines alten Hundes, weil er das verängstigte Tier vom Fleck bringen wollte. Es weigerte sich, und der Mann fing an, mit seinem Gehstock auf den Hund einzudreschen. Ein paar junge Leute kletterten auf einen Laster, der hoch mit Möbeln und Haushaltswaren beladen war. Einer von ihnen schwang eine Axt über dem Kopf und rief Marcus barsch eine Drohung zu. An einer Straßenecke drehte sich ein Mädchen immer wieder im Kreis und rief nach jemandem. Ein Kerl lenkte sein Fahrrad einhändig im Slalom durch den Verkehr und balancierte dabei einen Flachbildfernseher auf der Schulter. In der Luft lag eine Panik, die alle erfasst zu haben schien. Das war offensichtlich, aber was sie verursacht hatte, vermochte Marcus nicht herauszufinden. Sie rannten auch nicht alle in eine Richtung, und er hatte nicht den Eindruck, als würde etwas anderes als sie selbst das Chaos verursachen.
Als er dem slalomfahrenden Fahrradfahrer hinterher sah, fiel Marcus eine andere Sonderbarkeit auf. »Wie kommt es, dass es hier keine Joker gibt?«
»In den Städten«, erwiderte Olena, die die Menschenmasse beobachtete, »sind sie nicht willkommen.«
Eine Mutter, die sich ihr schreiendes Baby an die Brust drückte und ein älteres Kind hinter sich herzerrte, stürmte an ihnen vorbei. Als das Kind Marcus erblickte, bekam es große Augen und fing an zu heulen. Olena fasste die Frau am Arm und redete hastig auf sie ein, doch Marcus verstand kein Wort Russisch. Die Frau wollte sich losreißen, doch Olena flehte sie an. Widerwillig antwortete ihr die Frau und sprach sogar noch schneller als Olena. Dann befreite sie ihren Arm mit einem Ruck und lief davon. Ihr Baby schrie noch lauter.
»Was hat sie gesagt?«, fragte Marcus.
»Das ergibt alles keinen Sinn«, sagte Olena. »Sie meint, dass die Polizei Leute umbringe. Dass Allah sich abgekehrt habe und …«
Neben ihnen krachte ein Auto gegen eine Straßenlaterne. Der Kopf des Fahrers schlug gegen die Windschutzscheibe und platzte auf. Der blutverschmierte Fahrer blieb bewusstlos.
»Meine Fresse!«, rief Marcus. »Was ist denn los?«
Olena sprach ihren Satz zu Ende: »… dass das eine Prüfung sei.« Sie sah Marcus zum ersten Mal an, seit sie in das Chaos eingetaucht waren. »Marcus, du siehst schrecklich aus. Du wirst immer blasser. Wusste gar nicht, dass du blass werden kannst, aber … du hast zu viel Blut verloren!«
»Fang bloß nicht wieder mit dem Krankenhaus an.«
Sie atmete aus. »Wir müssen was finden, wo man dir hilft. Weg von hier. Und zwar schnell.« Sie sah sich um, die Lippen aufeinandergepresst. Da fiel ihr Blick auf einen Laster, der gerade auf die Straße eingebogen war. »Ich bin gleich wieder da.«
»Was? Wo gehst du hin?«, fragte Marcus.
Olena trat auf die Straße hinaus, zog die Glock aus dem Gürtel und ging auf den Laster zu.
Wie zum Teufel, fragte sich Detective Francis Xavier Black, war er in einem Aufzug im vierten Stock eines kasachischen Krankenhauses gelandet, wo er kalte Luft an seinem dürren Hintern spürte, weil das Flügelhemd ihn nicht bedeckte?
Weil jemand dir eine Knarre ins Gesicht gehalten und gemeint hat, du sollst dem Geschrei nachgehen.
Der fragliche Jemand war einer der drei Rambos im Dienst der russischen Gangsterbossin Baba Yaga. Beim Wort »Gangsterboss« denkt man natürlich nicht unbedingt an eine schrumpelige Achtzigjährige mit unglaublich rotem Haar. Doch nach einem Blick in Baba Yagas kalte graue Augen hatte Franny keine Zweifel mehr bezüglich ihrer Rücksichtslosigkeit und Entschlossenheit. Sollte er nicht spuren, würde sie ihn von ihren Brutalos abknallen lassen.
Im Spiegel im Bad hatte Franny sich angeschaut. Seine Augen waren eher blutunterlaufen als blau, er hatte einen Zweitagebart, und seine Haare bildeten fettige Stacheln. Er hatte sich gefragt, wann man ihm eine Dusche gestatten würde, als ein Kerl, »groß wie eine Straßenlaterne und fast so breit wie ein Bierlaster«, ihn aus dem Zimmer gezerrt hatte. Der Umstand, dass der Gorilla einen Zweitausend-Dollar-Anzug trug, wurde von der Tatsache konterkariert, dass er eindeutig kein großer Fan von Duschen zu sein schien. Er schob seine Ausdünstungen wie eine Welle vor sich her, als sie durch den Gang gingen.
In Baba Yagas Zimmer befanden sich zwei weitere Rambos und ein sehr gut gekleideter Mann mit glattem, ausdruckslosem Gesicht, manikürten Fingernägeln, einer glitzernden Rolex am Handgelenk und gegeltem braunem Haar. Er hatte etwas an sich, was Franny an Otter denken ließ. Der eine der beiden Schläger hatte eine Glatze, die im Neonlicht glänzte. Der andere hatte einen großen Rubinohrring und einen dicken Schnauzer. Franny wollte schon sagen, Hey, die Siebziger wollen ihren Schnauzer wieder zurück, doch er ließ es sein, weil Baba Yaga ihm ihre toten Augen zuwandte und ihn höhnisch einen Helden nannte. Dann hatte das Schreien angefangen.
Baba Yagas Befehl war kurz und bündig gewesen. »Gehen Sie. Sehen Sie es sich an. Kommen Sie zurück, und sagen Sie mir, was Sie sehen.«
Franny hatte widersprechen wollen. »Schicken Sie doch einen Ihrer bescheuerten Gorillas.«
»Ich werde keinen meiner Leute aufs Spiel setzen, außerdem haben Sie das alles verursacht. Jetzt gehen Sie.«
»Wenn ich das verursacht habe, dann wissen Sie ja, was das …«
Die Alte nicke dem Glatzkopf zu, und plötzlich blickte Franny in die Mündung einer SIG Sauer.
»Okay, das ist ein Argument.«
Franny hatte so lange gezaudert, bis sich die Aufzugtüren bereits wieder schlossen. Er streckte den Arm aus, um sie zu stoppen, und wurde dabei unsanft daran erinnert, dass er eine kürzlich genähte Schusswunde in der Seite hatte und eine weitere in der Schulter. Der Aufzug schien sich vor ihm aufzublähen. Er wusste, dass man ihn mit Schmerzmitteln vollgepumpt hatte, doch Medikamente allein konnten die schleichende Furcht nicht erklären, die ihm die Wirbelsäule hochkroch und seinen Bauch leer und flau zurückließ.
Aus dem Gang kam Rufen und Schluchzen. Franny humpelte aus dem Aufzug heraus, schlurfte mit seinen knisternden Papppantoffeln übers Linoleum. Zwei Sicherheitsleute gingen an ihm vorbei. Sie schleppten eine ältere Frau in Pflegerkleidung, die Unflätigkeiten ausstieß und ihnen die Gesichter zerkratzen wollte. Ihr Gesicht war zu einer wütenden Grimasse verzerrt, an den Lippen klebten ihr weiße Speicheltropfen, und ihre Jacke war auf der Vorderseite blutverschmiert.
Franny drückte sich gegen die Wand. Das Schreien brach nicht ab. Noch mehr Stimmen, Wutgeheul. »Scheiße«, flüsterte er.
Er wurde nicht mehr bewacht. Er hätte das Krankenhaus einfach verlassen und Hilfe suchen können. Doch die Absurdität dieses Gedankens wurde ihm rasch bewusst. Er sprach die Landessprache nicht, hatte kein Geld in der hiesigen Währung, keinen Ausweis, und er trug ein Flügelhemd. Wenn er sich so in New York begegnen würde, würde er sich selbst festnehmen.
Er zwang sich weiterzugehen. Auf die lauten Stimmen zu, das Zentrum des Aufruhrs. Der Druck auf seinen Schädel nahm zu, und es fühlte sich an, als würde ihm langsam etwas die Nervenbahnen entlangkriechen. Ein tiefes, bizarres Summen erfüllte die Luft. Wut auf Captain Mendelberg zu Hause in New York, die verdammt noch mal nicht zugehört hatte und nie zuhörte, Scheiße, Mann, Gedanken an Abby, die ihn ständig abblitzen ließ, selbst wenn er sich den Arsch aufriss, um ihr zu helfen. Sein Scheißpartner, der ihm diesen ganzen Mist auf dem Schreibtisch hatte liegen lassen und erst dann seine Hilfe angeboten hatte, als es zu spät war. Die anderen Polizisten von Fort Freak, von denen sich kein einziger zu einer verfickten Gratulation herabgelassen hatte, als er zum Detective befördert worden war. Neidische Arschlöcher, alle miteinander …
Was zum Teufel? Er schob die ungeordneten, wütenden Gedanken beiseite und versuchte, sich zu konzentrieren. Weshalb war er hierhergekommen? Ach ja. Er folgte weiter dem Gang und trat in ein Zimmer, in dem Ärzte panisch an einem Mann auf einer Liege herumdokterten, der einen weißen Arztkittel anhatte. In seinem linken Auge steckte ein Skalpell, sein Gesicht war voller Blut. Zwei Schwestern hielten sich gegenseitig umarmt und schluchzten. Jemand sagte etwas in einer Sprache, die er nicht verstand. Sicherheitsleute schienen die Anwesenden auszufragen.
Einige Infusionsständer standen um das Bett herum, und Schläuche führten von ihnen hinab zu … Franny schreckte entsetzt zurück. Er hatte gedacht, seine Jahre in Jokertown hätten ihn auf alles vorbereitet, doch die Gestalt in dem Bett war mehr als grotesk. Arme und Beine waren verdreht und dürr wie ein Skelett, doch der Bauch war aufgebläht wie der einer Schwangeren kurz vor der Geburt. Er war so aufgedunsen, dass das Flügelhemd ihn nicht ganz bedeckte. Außerdem pulsierte er, ein Zittern lief über seine Haut, und als würde etwas durch seine Blutbahnen und Eingeweide schwimmen, schoben sich unter der Oberfläche langsam lilafarbene und leuchtend rote Flecken.
Das Ding hatte einen Mund, aber die Lippen waren verlängert und glichen dem Rüssel eines Moskitos oder Ameisenbärs. Die gummiartigen Lippen machten Bewegungen wie ein blindes Baby, das die Brust der Mutter sucht. Aus Wangen und Hals traten graue, steinerne, rot geäderte Geschwülste hervor. Das nervtötende Summen, das sich anhörte wie Alufolie auf einer Goldzahnfüllung, kam aus diesem entstellten Mund. Unter den schrumpeligen Augenlidern blitzte es ganz schwach hervor, als wollte er aufwachen.
Der Geruch von Blut, Erbrochenem und Angstschweiß war stärker als der der Desinfektionsmittel und Bettpfannen. Franny prägte sich die Szene so gut wie möglich ein, bevor er rückwärts aus dem Zimmer taumelte. Er torkelte den Gang entlang. Dabei kam er an einem Pfleger vorbei, der an der Wand lehnte, den Hosenladen geöffnet hatte und seinen Schwanz in der Hand hielt. Er wichste kräftig, während er eine junge Krankenschwester betrachtete, die heulend in der Ecke stand.
Mit jedem Schritt, den Franny sich von dem Zimmer entfernte, nahm der Druck in seinem Kopf ab, und das unerträgliche Summen wurde weniger schlimm. Mit steigender Verzweiflung drückte er den Aufzugknopf. Schließlich ging er zum Treppenhaus. Wie sehr es auch schmerzen mochte, er musste hier weg. All seine Wut hatte sich aufgelöst. Doch die Furcht blieb.
Mollie Steunenberg, noch immer benebelt von dem Acht-Fantastillarden-Volt-Stromschlag, der sie an den Titten erwischt hatte, lümmelte auf dem Rücksitz eines Streifenwagens, während der Fahrer auf Französisch ins Funkgerät sprach. Sie verstand nicht, was er sagte, und sie verstand auch nicht, weshalb zum Donnerwetter die Bullen ihr einen Elektroschock verpasst hatten – sie hatten ihr einen verfickten Elektroschock verpasst –, bloß weil sie ein paar beschissene Ohrringe hatte mitgehen lassen. War das überhaupt verboten? Sie hätte einen verdammten Herzinfarkt kriegen können. Außerdem hatten die Elektroden zwei kleine Löcher in ihre Bluse gerissen. Ausgerechnet direkt über ihren Möpsen, die jetzt wehtaten, als hätte sie jemand in Brand gesteckt. Verfickte Franzackenpolypen.
Oh, stimmt, fiel ihr ein, Gendarmes. So hießen die in Frankreich. Ffodor hatte ihr so Kram beigebracht. Deshalb wusste sie auch, dass die Straßenlaternen, deren Licht in den Regentropfen auf den Fenstern glitzerte, diejenigen der berühmten Champs-Élysées waren.
Er hatte ihr auch beigebracht, dass ein Schaufenstereinbruch Sache von Haudraufs und Kleinkriminellen war. Und deshalb unter ihrer Würde. Aber sie war schneller als jeder Normalodieb, und sie war auch nirgends eingebrochen. Schließlich war sie die Letzte, die das nötig hatte. Also war es nicht ihre Schuld, dass sie erwischt worden war. Das würde sie Ffodor erklären: Was für ein dämliches Pech, dass ausgerechnet in dem Moment die Polente vorbeifuhr, als sie durch die Scheibe gegriffen hatte …
Sie schüttelte den Kopf, um die Benommenheit und die unangenehmen Gedanken zu verscheuchen. Dann zerrte sie an den Handschellen. Die kalte, klirrende Metallkette drückte ihr in den Rücken. Sie hätte ein Interdimensionstor öffnen und abhauen können, aber dann wäre sie auf der anderen Seite mit der Geschwindigkeit des Polizeiautos herausgekommen. Und da sie kein Tor parat hatte, das direkt über einem riesigen Kissenberg lag, wäre das ziemlich scheiße.
Der Wagen erreichte einen Kreisverkehr, und als er sich von der Champs-Élysées verabschiedete, hing er ein wenig schräg in der Federung. Die Beschleunigung stieß Mollie von der Tür weg, und sie fiel um wie ein Sack Kartoffeln. Dem Elektroschock hatte sie es zu verdanken, dass ihr Muskelapparat dem einer Qualle glich. Das Sitzpolster roch nach Schweißfüßen und altem Zigarettenrauch. Ihr flauer Magen machte einen Purzelbaum. Sie schmeckte Galle.
Mit einem Kuli oder einer Büroklammer hätte sie die Handschellen knacken können. Von Ffodor hatte sie alles Mögliche gele…
Konzentrier dich. Konzentrier dich. Wenn es ganz schlimm kam, steckten sie sie in eine Zelle, und dann würden sie ihr bestimmt die Handschellen abnehmen. Wenn es ganz schlimm kam, musste sie sich nur eine Weile gedulden. Und dann hieß es: Au revoir, Froschfresser.
Sie fuhren am Louvre vorbei, und jetzt verstand Mollie, weshalb den Bullen – Gendarmes – der Finger so locker am Taserabzug saß. Die Glaspyramide sowie große Teile der Gebäude ringsum steckten immer noch im Wiederaufbau, dabei wurden sie bereits vor Jahren von einem abgefahrenen Ass der alten Garde plattgemacht. Mollie kannte die genauen Umstände nicht. Zu der Zeit damals war sie damit beschäftigt gewesen, eine metrische Tonne verficktes Gold aus der Schatzkammer einer zentralafrikanischen Diktatur zu klauen. Und dabei hatte sie ihn kennengelernt, nämlich …
Sie schüttelte erneut den Kopf, diesmal wütend. Denn bei der Gelegenheit hatte sie auch diesen spießigen Noel Matthews kennengelernt. Noel Matthewskacke. Er hatte sie ausfindig gemacht nach ihrer kurzen Stippvisite im Fernsehen, mit der der ganze Ärger angefangen hatte. Nicht zuletzt wegen dieser Arschgeige Jake Butler, der geschummelt und sie aus der Show gekickt hatte. Aber auch weil sie durch American Hero mit diesem Hohlkopf Berman zusammengekommen war. Michael Grapschhand Berman. Michael Nadelschwanz Berman.
Eigentlich hätte sie inzwischen ein gutes Leben haben sollen, aber bisher war alles schiefgelaufen, weil wirklich alle, mit denen sie es zu tun hatte, sich als hochgradige Arschlöcher erwiesen.
Na ja, außer vielleicht einem.
Gelbes Halogenlicht und das silberne Glänzen des Vollmonds brachen sich kaleidoskopartig auf der regennassen Scheibe, als der Wagen wieder durch einen Kreisverkehr kurvte. Mollie beobachtete den Boden in der vagen Hoffnung, dass vielleicht ein Kuli, eine Büroklammer oder sonst ein nützlicher Gegenstand unter dem Sitz hervorrollen würde. Keine Würfel. Sie seufzte. Da sie wegen des Elektroschocks noch immer etwas zitterte, war es mit ihrer Feinmotorik ohnehin nicht weit her. Sie konnte weder das Schloss knacken noch die Kette zerbrechen.
Ffodor hatte beteuert, dass sie auch Tore im Innern von Gegenständen öffnen können müsste, denn es war dasselbe wie eine Öffnung in einer Wand oder in der Luft. Da hatten sie sich tatsächlich einmal beinahe gestritten. Natürlich war es etwas anderes. Luft war unsichtbar und bewegte sich. Als sie einmal versucht hatte, sich ein Tor im Innern eines Objekts vorzustellen, hatte sie das schlimmste Kopfweh ihres Lebens bekommen.
Die Handschellen klimperten. Der zweite Bulle, derjenige auf dem Beifahrersitz, Monsieur Erst-Elektroschocken-Dann-Niemals-Fragen-Stellen, warf ihr über die Schulter einen Blick zu. In diesem Blick lag nackte Enttäuschung: Sie hatten eine kleine, etwas pummelige zweiundzwanzigjährige Amerikanerin mit unnatürlich kupferroten Locken in blauer Jeans und Bluse aufgegriffen, die zu viele Sommersprossen hatte, um hübsch zu sein – und kein entlaufenes, hochgewachsenes, heroin-trendiges Pariser Supermodel mit langen Beinen im Teenageralter und einem Rock, der ihr gerade bis zum Schritt reichte.
Mollie erwiderte den Blick. »Supermodels sind Zicken und Kokser, wissen Sie?«
Er sagte etwas zu seinem Partner. Wenn man die Sprache nicht verstand, klang alles gehässig.
Der Wagen ging in eine Kurve, sodass ihr Gesicht wieder ins Polster gedrückt wurde. Wieder drehte sich ihr der Magen um, als ihr der Essensgestank in die Nase drang. Mollie schraubte sich in eine aufrechte Haltung hoch, um nicht kotzen zu müssen. Sie begnügte sich damit, die durchnässte Lichterstadt an sich vorbeiziehen zu sehen.
Der Wagen kam an einem Brunnen vorbei. Sie lächelte.
Schön, dachte sie. Dann eben auf die ganz entspannte Tour.
Obwohl ihr Gehirn von dem Taser noch ziemlich matschig war, fiel es ihr so leicht wie Atemholen. Beinahe ohne eine bewusste Willensanstrengung öffnete sie zwei Tore: eines über dem Armaturenbrett und ein viel größeres in dem Brunnenbecken.
Kaltes Wasser ergoss sich in das Auto, als hätte jemand einen Feuerwehrschlauch durch die Lüftung gelegt. Die Froschfresser schimpften unisono – »Merde!« (selbst Mollie verstand das) –, während der Fahrer auf die Bremse trat. Sie schlitterten. Das Wasser reichte ihnen schon bis über die Knie und schwappte über die Kopfstützen. Mollie stieß mit der Stirn gegen die Trennscheibe aus Plexiglas. Dann machte sie die Augen zu und konzentrierte sich darauf, den Atem anzuhalten, um bewusstlos zu wirken.
Das Wasser rauschte weiter herein. Innerhalb von Sekunden reichte es bis über ihre Hüfte, doch dann sackte es ab, denn die beiden perplexen Polizisten sprangen aus dem Wagen. Mollie ließ die Tore geöffnet, sodass das Wasser, das aus dem Armaturenbrett schoss, durch die offenen Türen nach draußen schwappte. Trotzdem sammelte sich hinten noch genug, um die Ertrunkene mimen zu können.
Es war nicht leicht, nicht aus der Rolle zu fallen, während die Gendarmes sie aus dem Wagen zerrten wie einen Sack Kunstdünger. Ihre Lunge wollte platzen, als die Idioten endlich merkten, dass sie ihr erst die Handschellen abnehmen mussten, bevor sie eine Herz-Lungen-Reanimation durchführen konnten. Sobald die Handschellen geöffnet waren, gab Mollie ihr Schauspiel auf. Sie sprang auf, taumelte ein bisschen, weil ihr von dem Taser noch immer etwas schwindelig war, und hielt den Atem an.
»Danke, Schwachköpfe«, sagte sie.
Der Fahrer bellte sie an. Er klang nicht zufrieden. Sein Partner fummelte an dem Taser an seinem Gürtel herum.
»O ja«, sagte Mollie. »Probiert das gern noch einmal.« Doch diesmal würde er sie nicht überrumpeln.
Er zielte. Sie öffnete zwei weitere Löcher: eines direkt am Ende seiner Waffe, das andere ein paar Handbreit tiefer. In der Dunkelheit und mit all dem Wasser, das ihm von den Wimpern tropfte, fiel ihm das Schimmern nicht auf. Er drückte den Abzug, kreischte und brach auf der Stelle zusammen, ein zuckendes Bündel. Er hatte sich selbst in die Eier getasert.
Mollie schuf noch zwei weitere Tore. Dem anderen Polypen streckte sie zwei Stinkefinger entgegen, bevor sie aus dem nassen, nächtlichen Paris in das geregelte Chaos des Shinjuku-Bahnhofs in Tokio sprang. Sie stieß mit einem japanischen Büroangestellten zusammen, dessen Nase in einem Manga mit einer drallen Comickarikatur von Curveball auf dem Titelbild steckte. Er schrie sie an. Sie öffnete unter ihm ein Tor und ließ den Perversling in einen stinkenden Kanal in Venedig plumpsen. Dann rannte sie durch die Menschenmenge, krallte sich dabei Geldbeutel und Brieftaschen und ließ überall wütende Pendler zurück. Ein Bahnsteigaufseher nahm die Verfolgung auf, doch sie setzte zum Sprung an und landete auf dem Sand der Cottesloe Beach bei Perth. Ihr Raubzug hatte ihr ungefähr neunundzwanzigtausend Yen eingebracht, also ein bisschen weniger als dreihundert Dollar. Nicht gerade toll, aber auch nicht schlecht für zehn Sekunden Arbeit. Sie warf die Beutel und Taschen auf den Strand und trat einmal quer über den Kontinent in ein Sträßchen in Melbourne, in dem sich eine Wechselstube befand. Fünf Minuten nachdem sie in Paris an dem Brunnen vorbeigefahren war, entdeckte sie in einem Kaufhaus in Sydney einen passenden Ersatz für ihre Bluse. Sie war sogar schöner als die, die die Gendarmes kaputtgemacht hatten.
»Nun?«, wollte die Baba Yaga wissen, als Franny wieder in das Krankenhauszimmer trat. Sie war vielleicht alt und gebrechlich, aber ihre Stimme hatte noch immer einen barschen Befehlston.
Nach einem hörbaren Atemholen erzählte Franny kurz und bündig, als würde er Maseryk und Mendelberg auf der Wache Bericht erstatten.
»Hmmm, vielleicht sind Sie nicht ganz so dumm, wie ich dachte.«
Die Greisin wandte sich an den Otter und sagte etwas, das wie Russisch klang. Der Mann mit dem glatten Gesicht nahm ein unpassendes Abendkleid aus dem Schrank, half der Alten aus dem Bett und ins Bad. Ein paar Augenblicke später kamen sie wieder heraus. Baba Yaga war angezogen. Sie trug die dürftigen Krankenhauspantoffeln statt der Absatzschuhe, die Franny im Schrank stehen sah.
Zu fünft gingen sie zur Tür. Es konnte kein Zweifel bestehen, dass sie verduften wollten. Franny blieb stehen und dachte über das nach, was er in diesen Zweikampfvideos gesehen hatte. Über das unaussprechliche Grauen, das diese Frau, die eben hinausgegangen war, auf einfache Bürger losgelassen hatte.
»Ja, Scheiße, nein«, grummelte Franny und folgte ihnen. Es tat weh, wenn er rannte, und er kam sich bescheuert vor, weil er sein Flügelhemd hinten zusammenhalten musste. Baba Yaga und ihre Gorillas waren am Haupteingang.
»He! Anhalten! Ihr seid verhaftet!« Die Leute im Foyer starrten ihn an. Eine Frau hinter einem großen Empfangsschalter stand auf und griff zum Telefon.
Baba Yaga beachtete ihn nicht. Franny pfiff auf alle Scham, drückte den Arm gegen seinen Verband und lief schneller. Auf dem Gehweg drängte sich eine Menschenmenge. Polizei, Baba Yaga und ihre Leute. Franny nahm an, dass sie einem Notruf gefolgt waren. Am Bordstein parkte ein Wagen.
Franny packte einen der Polizisten an der Schulter. »Sie müssen diese Frau aufhalten! Sie ist eine Verbrecherin. Eine Entführerin. Eine Mörderin!« Der Beamte runzelte die Stirn und stieß Frannys Hand von seiner Schulter. »Schauen Sie, ich bin auch Polizist!«
Die meisten Beamten waren ins Krankenhaus gegangen, nur ein paar waren noch draußen. Sie sahen fragend zu Baba Yaga hinüber, und Frannys Magen wurde schwer wie Blei. Er wusste zu gut, wie Begünstigung und Bestechung aussahen.
Einer der Polizisten sagte etwas. Es klang wie eine Frage. Der Otter beugte sich zu Baba Yaga herunter und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Dann antwortete er dem Polizisten, der seinen Gummiknüppel zückte.
»Ach, scheiße. Echt jetzt?«
Der Knüppel krachte auf seine Schulter. Franny warf sich herum, und der nächste Schlag traf ihn an der Seitenwunde. Sein ganzer Körper wurde von Schmerzen durchspült, und weiße Lichtblitze zuckten in seinen Augen.
Marcus konnte kaum fassen, dass Olena auf die Straße hinaustrat, um den Laster anzuhalten. Wäre er kräftig genug gewesen, hätte er sie aufgehalten. Doch das war er nicht, und deshalb konnte er nur zusehen.
Einen Moment lang war er überzeugt, dass der Laster sie überfahren würde. Und dann war er der Überzeugung, sie würde den Fahrer erschießen. Doch nichts dergleichen geschah. Stattdessen trat sie seitlich an den fahrenden Laster heran, stieg auf das seitliche Trittbrett und streckte die Pistole durchs Fenster hinein. Marcus hörte nicht, was sie sagte, doch die Knarre verlieh ihren Worten Überzeugungskraft. Der Wagen hielt an. Olena sprang herab. Der Fahrer stieg aus, während die Glock die ganze Zeit über auf ihn gerichtet war. Bei ihr sah das so einfach aus.
Sie hatte den Kopf gedreht, schnippte sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht und sagte: »Ist wahrscheinlich besser, wenn ich fahre. Steig ein.«
Von der Ladefläche aus hatte er sie durch das offene Fenster zur Fahrerkabine gefragt, wer sie war. Ihre Antwort – »Ich bin ukrainisches Mädchen« – war nicht gerade eine Erklärung. Marcus beschlich der Verdacht, dass mehr in ihr steckte, als er gedacht hatte.
Es beschämte ihn, dass sie ihn aus der Stadt herausgebracht hatte, dass sie die Führung übernommen hatte. Doch war es keine tiefgehende Scham. Er war erleichtert, dass nicht alles an ihm lag. Und da die Sache noch nicht kompliziert genug war, schämte er sich auch wegen der Dinge, die er vor ihren Augen in der Arena getan hatte. Hässliche Dinge. Mörderische Dinge. Manches davon hatte er für sie getan, aber trotzdem … Er mochte die Erinnerungen daran nicht. Er erkannte sich nicht in ihnen. Er sah lediglich ein Ungeheuer mit Blut an den Händen und Gift im Mund.
Angesichts dessen kam es ihm beinahe schon in Ordnung vor, dass er halbtot auf der Ladefläche eines Lasters lag, den ein hübsches ukrainisches Mädchen für ihn gestohlen hatte. Jemandem lag etwas an ihm, und wenn das tatsächlich der Fall war, dann gab es immer noch ein bisschen Hoffnung. Wenn er doch bloß keine solchen Schmerzen hätte. Er blutete noch immer, und ihm war so schwindelig, dass er fast das Bewusstsein verlor …
»Nicht schlafen, mein Held«, sagte Olena und weckte ihn wieder auf. »Wach bleiben, okay? Schlaf später.«
Marcus machte die Augen auf. Wieder sprang ihm die grelle Welt in die Augen. Unter ihnen fiel der Talboden in Richtung Talas ab, trocken und rau. Um sie herum erhoben sich die Vorberge, ein Kamm nach dem anderen, aufeinandergetürmt, immer höher und höher. Der Berg? Da war er, viele Meilen entfernt überragte er eine wüste, fremde Landschaft, wie er sie noch nie gesehen hatte.
Olena stand hinter dem Laster und hielt ihm einen Wasserkrug hin. Ein Stück weiter drückten sich ein Mann, eine Frau und mehrere kleine Kinder vor der Tür eines bescheidenen Hauses aneinander und starrten herüber. Zu ihren Füßen standen die Zigarettenkisten, die Olena gegen Kleider hatte eintauschen wollen. Anscheinend hatte sie erfolgreich gefeilscht.
Ihr aufreizendes Kleid hatte sie gegen eine herkömmliche Kluft getauscht. Ein bunte, aber formlose Jacke, einen Wollrock, der den Boden berührte, und einen Hut, unter dem ihr kurzes Haar vollständig verschwand. Er würde das kurze rote Kleid vermissen, und mit ihren engelsgleichen Gesichtszügen, den hohen Wangenknochen und blauen Augen ging sie nicht gerade als Einheimische durch. Aber von Weitem sah sie so aus. Ungefähr.
Als er nach dem Krug griff, versuchte er zu lächeln, um sich die Schmerzen nicht anmerken zu lassen. Die Anstrengung und dazu auch noch das Reden waren fast zu viel für ihn. »Gefällt mir«, sagte er. »Sieht nicht …« Er atmete aus und fragte sich, wo seine Puste geblieben war. »Wird dir nicht ganz gerecht, aber das ist vielleicht besser so.«
»Du meinst, dass ich jetzt nicht mehr schön bin«, sagte sie.
»Mein Gott, nein, das meine ich nicht«, sagte Marcus.
Sie bügelte ihn mit einer Kopfbewegung ab. »Egal, jetzt sind wir getarnt.«
Er wollte sie fragen, wie sie auf den Gedanken kam, dass man einen Schwarzen mit einem sechs Meter langen Schlangenschwanz einfach so tarnen könnte, zumal im hinterwäldlerischen Kasach-wie-auch-immer-das-hieß. Aber er tat es nicht. Er wollte sie nicht fragen. Er wusste nicht, wie er damit umgehen sollte, dass sie partout keine Missgeburt in ihm sehen wollte. Andrerseits wollte er bestimmt nicht, dass sich das änderte. Er sagte: »Du siehst toll aus. Wie eine Einheimische.«
»Ich weiß jetzt, wohin wir gehen.« Sie deutete auf die glotzende Familie und winkte ihnen dann zu. »Sie haben mir von einem Dorf erzählt. Das ist gut für uns.«
Sie hievte einen großen Benzinkanister auf die Ladefläche und stieg dann wieder in die Fahrerkabine. Sie startete den Motor und setzte rückwärts auf die Straße hinaus, auf der sie aus der Stadt gekommen waren, einen langen, schmalen Asphaltstreifen voller Staub. Sie fuhren weiter in die Berge hinauf.
»Was ist an dem Ort so gut?«, fragte Marcus durchs Fenster.
»Das wirst du sehen«, sagte sie.
Barbara schlief unruhig. Ein Traum – vielmehr ein Albtraum – kehrte wieder, den sie in jüngeren Jahren schon ein paarmal geträumt hatte, der sie aber lange Zeit nicht mehr belästigt hatte. Eine Erinnerung, die sich unweigerlich in einen Schrecken der Nacht verwandelte.
Sie war kaum zwölf, als ihre Mutter starb.
Als Einzelkind ohne ein anderes Elternteil oblag ihr die Rolle der shomeret für ihre Mutter im Bestattungsinstitut. Verwandte und Freunde blieben die Nacht über bei ihr, während sie beim Holzsarg ihrer Mutter saß. Ihre Mutter war am selben Nachmittag erst gestorben – Opfer eines Selbstmordattentäters im Shuk HaCarmel in Tel Aviv. Die Beerdigung sollte am nächsten Tag stattfinden.
Der Rabbi war gekommen und hatte die rituellen Worte gesprochen: »Baruch atta Adonai Elohenu melech ha-olam dajan ha-emet.« Dann vollführte er die Kria und riss ihre Bluse auf der linken Seite ein.
»Welch schrecklicher Verlust. Welch furchtbarer Tag. Wie kommst du zurecht, meine Liebe?«, hatte der Rabbi sie mit traurigen und gütigen Augen gefragt. Sie konnte nur den Kopf schütteln.
»Ich verstehe es nicht«, antwortete Barbara, und ihre Stimme wurde vom Schluchzen erstickt, das sie immer und immer wieder befallen hatte, seit sie die schlimme Nachricht erhalten hatte. »Die Polizei … Sie meinten, dass meine Mutter ihnen vor ihrem Tod gesagt hätte, dass sie diesen jungen Mann gesehen hätte, der ging auf den Markt und sah so aus, als wäre er krank oder hätte Angst, ganz bleich und verschwitzt, dass sie ihn angesprochen und gefragt hätte, ob er Hilfe benötige. Er hat sie auf Arabisch angeschnauzt und sie mit den Händen verscheucht, aber Ima spricht kein Arabisch und wusste nicht, was er gesagt hat. Er lief weiter in den Markt hinein, und sie folgte ihm, und da …« Sie schluckte. Die Trauer schmeckte wie Asche und Tränen. »Da hat der Junge oder sonst jemand die Weste hochgehen lassen. Rabbi, vielleicht hat er Ima gesagt, dass sie weggehen soll. Vielleicht hat er sie gewarnt, aber sie hat es nicht verstanden …«
»Niemand kann eine solche Tragödie begreifen«, hatte der Rabbi ihr erklärt, doch seine Worte und der Arm, den er um ihre Schultern gelegt hatte, spendeten wenig Trost. Sie ging die Szene in Gedanken immer und immer wieder durch: Ihre Mutter folgte dem Jungen, wollte ihm helfen, das Licht, die Hitze und die niederschmetternde Erschütterung der Explosion, ihre Mutter fällt hin inmitten der Trümmer und des Geschreis …
In ihrem Erinnerungsalbtraum jener Nacht näherte sie sich dem Sarg. Plötzlich war sie allein: Der Rabbi war nicht mehr da, die Verwandten und Freunde verschwunden. Nur noch das Zimmer und der Sarg. Der Deckel hob sich, aufgedrückt von den blutverschmierten Händen und Armen ihrer Mutter. Barbara konnte nicht wegsehen, sich nicht rühren, war völlig erstarrt. Als der Deckel zur Seite geschoben wurde und mit einem hohlen Schlag fiel, setzte sich die Leiche ihrer Mutter langsam auf. Ihr Gesicht war Barbara zugewandt. Eine Maske reinsten Grauens, von ihrem zertrümmerten Schädel hingen Fleischfetzen herab, ein Auge baumelte aus der Augenhöhle heraus, ein halber Kiefer und ihre Zunge hingen träge herab wie dicke, graue Würmer …
Doch in dieser Nacht in Machu Picchu änderte sich der Albtraum und nahm eine andere Richtung. Nicht der Arm ihrer Mutter hob den Sargdeckel, und es war auch nicht die Leiche ihrer Mutter, die herauskam. Es war der Arm von Klaus im Phantomharnisch, der jedoch gesprungen und geplatzt aussah. Aus dem Sarg erhob sich Klaus’ zertrümmerte Leiche und drehte sich langsam zu ihr um, um sie mit einem modernden Auge anzusehen.
Klaus. Nicht ihre Mutter.
Im Traum schrie Barbara, während Klaus’ Leiche sich vollends aus dem Sarg erhob und herausstieg. Plötzlich lag sie wach unter der Decke und zitterte vor Angst vor der Erinnerung an den Traum.
»Was ist los?«, hörte Barbara Klaus fragen, der sich schläfrig im Bett wälzte.
Sie wollte ihr rasend pochendes Herz beruhigen. »Nichts«, beteuerte sie. »Nur ein Traum, das ist alles. Schlaf weiter.«
Klaus grunzte. Sie spürte, wie er sich erneut umdrehte.
Sie war kaum zwölf, als ihre Mutter starb …
Der Albtraum von der verunstalteten, zerbrochenen Leiche ihrer Mutter, der sich aus dem Sarg erhebt, verfolgte sie als Teenagerin. Am Tag nach dem Attentat, als der Sarg in die Erde gelassen wurde, wurde Barbaras Karte aufgedeckt. Barbara heulte vor Schmerz und Qual und Angst, und währenddessen verwandelte sich das Beten des Rabbis in eine Aneinanderreihung sinnloser Silben, und die verunsicherten Trauergäste riefen Fragen, die niemand verstand.
Keiner verstand mehr den anderen. Wie ihre Mutter und der junge Mann auf dem Markt …
Etliche Minuten lang starrte Barbara in die Dunkelheit an der Decke und rätselte, was dieser veränderte Traum zu bedeuten hatte, voller Angst, dass er ein Vorzeichen, eine Warnung darstellen könnte. Sie rang mit sich, verlegte sich auf den Standpunkt, dass solche Gedanken irrational und lächerlich waren, doch das Gefühl blieb, auch wenn sie sich zur Logik zwang.
Als sie wieder Schlaf fand – diesmal glücklicherweise ohne Träume –, kam schon viel zu bald das strenge Piepen ihres Handyweckers.
Das Erste, was Franny sah, waren große Füße in Stahlkappenschuhen. Seine Augen fühlten sich gummiartig an, und er hatte den Geschmack von Blut im Mund. Anscheinend hatte er sich auf die Zunge gebissen. Langsam erkannte er in dem Geräusch, das er hörte, einen Automotor. Er lag auf dem Boden der Limousine, eingeklemmt zwischen den einander zugewandten Sitzen. Sie fuhren über eine Bodenwelle, und Franny keuchte vor Schmerz. Er sah nach oben. Glatze, Schnauzer und Mief saßen auf den Notsitzen.
Eine Hand fasste ihm ins Haar, und er wurde zu Baba Yaga herumgedreht. Dabei verschob sich sein Hemd und rutschte über die Hüfte hinauf. Sich in der Gewalt einer Psychopathin zu befinden, war schlimm genug, aber es war noch schlimmer, wenn einem dabei Eier und Schwanz entblößt wurden.
Sie tippte sich mit dem Zeigefinger an die Lippen und musterte ihn. »Sie sitzen ziemlich in der Tinte«, sagte sie.
»Und warum setzen Sie mich hinein?«
»Sie könnten sich als nützlich erweisen. Falls nicht, bringe ich Sie um. Verstanden?«
»Total.«
Sie fuhren weiter. Der Otter grummelte etwas ins Telefon, alle anderen schwiegen. Franny räusperte sich. »Wohin fahren wir denn?«
»Schnauze.«
Zehn Minuten später versuchte er es noch einmal. »Kann ich mich vielleicht hinsetzen?«
»Nein.« Baba Yaga war keine Frau vieler Worte.
Schließlich hielten sie an, und Franny wurde aus dem Wagen gezogen. Er stöhnte, weil ihm die Seite und die Schulter wehtaten. Sie waren wieder im Casino. Nicht gerade ein Ort, den er noch einmal sehen wollte.
Franny schlug vor, ihn zusammen mit dem Otter im Wagen zu lassen, doch Baba Yaga schien nicht sonderlich vertrauensselig zu sein. Glatze hatte ihm eine Knarre in den Rücken gedrückt (die sich auf der nackten Haut extrem kalt anfühlte), und Franny folgte der alten Dame ins Casino. Das war verwüstet. Umgeworfene Roulettetische, überall lagen Jetons verstreut, deren grelle Farben sich krass von dem teuren Paisleyteppich abhoben. Die Gesichter auf den herumliegenden Spielkarten wirkten erstaunt, wenn sie darauftraten. Auch das Blut machte sich nicht gut auf dem Teppich.
Zwei Typen von der Spurensicherung waren bei der Arbeit. Sie richteten sich auf und nickten Baba Yaga höflich zu, als die an ihnen vorbeiging. Die alte Dame hatte die Bullen in Talas offenkundig gekauft. Aber nachdem er auf einen Wink Baba Yagas hin von Bullen grün und blau geprügelt worden war, hätte er sich das auch vorher schon denken können.
Ein dürrer Kerl in einer gandhimäßigen Windel hastete durch eine Tür aus dem Casino. Der zähe Schleim, der seinen Körper bedeckte, spiegelte, und sein rasierter Schädel glänzte. Der beißende Geruch trieb Franny Tränen in die Augen. Das war der Joker Vaporlock alias Sam Palmer, ein bunter Hund in Jokertown. Ein erbärmlicher Versager, der den Cops als einfacher Dieb bekannt war. Und ein Verräter an seinen Jokergenossen. Laut Wally Gundersons Aussage hatte Vaporlock Baba Yaga geholfen, Joker in ihren Fight Club zu entführen. Diese Anschuldigung war nun bewiesen.
»Scheiße, Baba Yaga … Ma’am. Wir dachten, Sie wären tot. Ich meine, Mann, wir haben uns Sorgen gemacht, als diese Mordsschlange Sie vermöbelt hat. Ein paar von den Jungs haben’s auch geglaubt. Aber ich nicht. Ich wusste, Sie würden zurückkommen. Niemand kriegt Sie klein.« Seine Worte klangen flach und gepresst.
Baba Yaga ging gar nicht auf Vaporlock ein, sondern wandte sich zu Glatze und sagte: »Nimm ihn mit.«
Sie durchquerten das Casino. Vaporlock lief zuckend und hüpfend neben der Alten her. »Und, wie ist der Plan, Ma’am? Wir hauen hier ab? Ein paar von denen sind ja echt übergeschnappt, dass sie auf den Gedanken gekommen sind, sich gegen Sie aufzulehnen.« Baba Yaga ignorierte ihn.
Zwischen den Spielautomaten und unter den Tischen lagen noch die Leichen. Franny fand, dass ein Frack dem Tod keinerlei zusätzliche Würde verlieh. Manche hatten Schusswunden. Andere waren einfach tot. Wahrscheinlich Opfer von IBTs Giftzunge.
Der Gedanke an Fräcke brachte auch Frannys dringendste Sorge wieder in den Fokus. »He, ich brauche Klamotten«, sagte er.
»Wir sind kein Herrenausstatter«, versetzte Baba Yaga.
Franny zeigte auf einen Toten. »Er braucht sie nicht. Haben wir nicht ein paar Minuten?«
Baba Yaga betrachtete ihn in seinem kurzen Flügelhemd und mit den ausgefransten Pantoffeln an den nackten Füßen. Ihre runzligen Lippen verzogen sich fast zu einer Art Lächeln. »Na gut.«
Er fand die Leiche eines Mannes, der beinahe seine Größe hatte, zog ihm Mantel, Hemd, Hose, Socken und Schuhe aus. Franny beschloss, keine Unterwäsche zu tragen. Die Unterhose eines Toten anzuziehen, ging ihm einen Schritt zu weit.
»Toilette?«, fragte Franny.
Baba Yaga würdigte ihn keiner Antwort, sondern sah ihn nur scharf an. Franny kehrte ihr den Rücken zu und zog sich an. Die Hose war zu groß und das Hemd zu eng, aber er fühlte sich weit weniger ausgeliefert. Kaum hatte er die Schuhe geknüpft – eine schmerzhafte Tätigkeit, denn wenn er sich vornüberbeugte, zerrte es an der genähten Seitenwunde –, marschierte Baba Yaga auch schon weiter. Ein nicht gerade sanfter Stoß von Mief versetzte auch Franny wieder in Bewegung.
Vaporlock hatte seine Versuche, ein Gespräch mit Baba Yaga zu führen, aufgegeben. Jetzt ließ er sich zurückfallen und ging neben Franny her. »He, Sie kenne ich doch. Sie sind ein Polyp, richtig? Fort Freak?« Franny nickte. »Also, wenn ich Ihnen hier raushelfe, legen Sie ein gutes Wort für mich ein, richtig?«
»Sie sind nicht der Hellste, was?«, fragte Franny leise.
»Hä?«
»Sie sollten sich noch mal überlegen, ob Sie Absprachen mit mir treffen wollen, während sie neben uns hergeht.«
»Äh.« Vaporlock sprach deutlich lauter. »Ich meinte nur, falls sie mich nicht mehr braucht. Ich stehe ihr ganz zur Verfügung, es sei denn, sie möchte, dass ich gehe …«
»Sam.« Vaporlock sah zu Franny auf. »Lass gut sein«, sagte er leise.
Sie gingen durch eine Hintertür des Casinos und eine Treppe hinauf. Im zweiten Stock dieses Gebäudeflügels befand sich die Wohnung. Franny sagte die Einrichtung nicht besonders zu. Alles stand mit Möbeln unterschiedlicher Stilrichtungen voll. Ledersessel neben einem Louis-XIV-Stuhl mit unpassendem Lederpolster. Ottomanen mit Fransenbezug und zahlreiche Nippestische.
Baba Yaga betrat, gefolgt von zwei Wachen, ein Schlafzimmer. Von drinnen erklang offenbar ein Schwall Kraftausdrücke. Franny ging zur Tür, um hineinzuschauen. Baba Yaga betrachtete eine riesige Schmuckschatulle auf der Kommode. Sie war verdächtig leer.
Sie rauschte an ihm vorbei, zurück ins Wohnzimmer. Auf ihr Nicken hin schlug einer der Gorillas den Rand eines Orientteppichs um. Darunter kam ein in den Boden eingelassener Safe zum Vorschein. Sie kniete sich davor nieder und drehte die Einstellscheibe. Franny spürte den Blick des Gorillas auf sich, und er sah geflissentlich in die andere Richtung. So viele beknackte Möbel auf so kleinem Raum …
»Sie … kann Leute verwandeln. Und zwar in üble Dinge. Wir reden hier von Möbeln.«
Die Worte des in Ungnade gefallenen und inzwischen verhafteten Hollywood-Produzenten Michael Berman kamen ihm wieder ins Bewusstsein. Einen großen Sessel sah sich Franny etwas genauer an. Das sah nicht aus wie herkömmliches Leder. Er ging darum herum, um ihn von vorn zu betrachten. Die Sitzfläche hatte ein Gesicht. Ein vor Schreck verzerrtes Gesicht mit aufgerissenem Mund. Die Beine schienen geballte Hände und menschliche Füße mit eingezogenen Zehen zu sein. Franny wich vor dem wahnsinnigen Anblick zurück.
Ein Kichern, das klang wie trockenes Laub auf einer Betonfläche. Baba Yaga stopfte händeweise Geldscheine unterschiedlichster Währungen, Juwelenschmuck und Goldmünzen in einen Lederbeutel, doch ihr Blick war auf ihn gerichtet. »Wenn ich Sie töte, Junge, dann sterben Sie keinen leichten Tod.«
Sie genießt meinen Ekel und meine Verzweiflung, begriff Franny. Er brachte seine Mimik unter Kontrolle und zuckte mit den Schultern. »Dann kann ich nur hoffen, dass Sie auf mich schießen. Ich gebe es ungern zu, aber ich gewöhne mich allmählich dran.«
Franny bemühte sich, keines der Möbelstücke anzusehen, aber das war kaum möglich. Baba Yaga war eindeutig eine Wild Card. Er fragte sich, wie sie es machte. Sein verzweifelt umherschweifender Blick fiel auf Vaporlock, dessen Augen erst auf den Beutel, dann auf die drei Schläger und dann auf die Tür gerichtet waren. In Franny verkrampfte sich alles, und er spürte das Ziehen in Schulter und Seite.
Baba Yaga holte einen Stapel Pässe heraus, die mit einem Gummiband zusammengehalten wurden. Ehe sie sie in ihren Beutel stecken konnte, fuhr sich Vaporlock mit der Hand über die Brust und schmierte Glatze, der Baba Yaga am nächsten stand, das klebrige, stinkende Zeug ins Gesicht. Während der Kerl würgte und einknickte, schnappte sich Vaporlock seine Pistole und schoss ungestüm auf Baba Yaga. Gleichzeitig griff er nach dem Beutel.
Franny hatte sich lange vor dem Schuss in Bewegung gesetzt. Er hütete sich davor, das glitschige Ass ergreifen zu wollen. Stattdessen nahm er eine in emailliertes Metall gerahmte Ikone vom Tisch und hieb die scharfe Kante des Rahmens auf Vaporlocks Unterarm. Der Schuss ging ins Leere, traf ein Sofa. Doch statt bleicher Polsterfüllung stob eine Wolke aus roten und fleischfarbenen Partikeln in die Höhe.
Baba Yaga bewegte den Mund, sodass ihre runzligen Wangen noch mehr einsanken. Blankes Entsetzen packte Vaporlock, er warf sich herum und rannte los. Hinter ihm landete ein Speichelklumpen auf dem Boden, doch er war schon zur Tür hinaus und warf sie hinter sich zu.
Franny stürmte ebenfalls zur Tür, noch immer mit der Ikone bewaffnet. Baba Yagas Stimme durchschnitt die Luft.
»Halt!«
»Ich will den Arsch verhaften!«