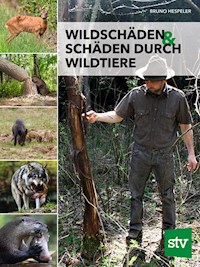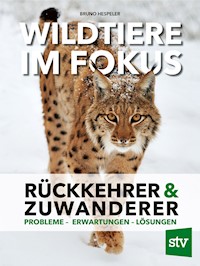
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Stocker, L
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Willkommen oder unerwünscht? •Alle Rückkehrer und die wichtigsten Zuwanderer •Artenportraits, Verhalten und Ansprüche •Hoffnungen, Probleme und Lösungen Viele einst in Mitteleuropa heimische Wildtiere sind aus verschiedenen Gründen ausgerottet worden, andere Arten wurden durch ökologische Sünden wie Landschaftsverbau, Sportler und Naturnützer ihres natürlichen Biotops beraubt. Doch die Wildtiere kehren zurück und verbreiten sich stärker. Die Ausbreitung von Wäldern, die Renaturierung von Gewässern, die intensiven Bemühungen von Naturschützern und nicht zuletzt Veränderungen der Gesetzeslage und der öffentlichen Wahrnehmung haben dies möglich gemacht. Auch Tierarten, die nie bei uns heimisch waren, wandern nun zu bzw. wurden eingeschleppt und verbreiten sich in der heimischen Natur. Sie alle bereiten nicht nur Touristen oder Naturschützern Freude, sondern sorgen auch für Schäden und Probleme bei Landwirten, Forstwirten und Teichbesitzern. Lösungen sind gefragt, die die Interessen aller Gruppierungen zufriedenstellen. Der Autor behandelt alle Heimkehrer (Biber, Luchs, Wolf, Braunbär, Elch, Fischotter, Waldrapp, Bartgeier, Gänsegeier und Habichtskauz) sowie die wichtigsten Einwanderer (Nutria, Bisam, Marderhund, Goldschakal, Waschbär, Mink, Nandu, Kanada-, Nil- und Rostgans, Türkentaube, Silberreiher, Halsbandsittich sowie die Regenbogenforelle und andere Fische). Ausführlich werden die einzelnen Arten vorgestellt und die mit ihnen verbundenen Hoffnungen, Probleme und möglichen Lösungsansätze beschrieben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bruno Hespeler
Wildtiere im Fokus
Rückkehrer & Zuwanderer
Probleme – Erwartungen – Lösungen
Leopold Stocker VerlagGraz – Stuttgart
Umschlaggestaltung:
Werbeagentur Rypka GmbH, 8143 Dobl/Graz, www.rypka.at
Fotonachweis: Foto Umschlag-Vorderseite: © iStock.com/Byrdyak
Fotos Umschlag-Rückseite (von oben nach unten): © iStock.com/laranik; © iStock.com/Anolis01; © Stock.com/sduben; © Bruno Hespeler; © iStock.com/A-Lein
Alle nicht mit einem Autorenvermerk gekennzeichneten Fotos stammen von Bruno Hespeler.
Der Inhalt dieses Buches wurde vom Autor und Verlag nach bestem Gewissen geprüft, eine Garantie kann jedoch nicht übernommen werden. Die juristische Haftung ist ausgeschlossen.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Hinweis: Dieses Buch wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. Die zum Schutz vor Verschmutzung verwendete Einschweißfolie ist aus Polyethylen chlor- und schwefelfrei hergestellt. Diese umweltfreundliche Folie verhält sich grundwasserneutral, ist voll recyclingfähig und verbrennt in Müllverbrennungsanlagen völlig ungiftig.
Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne kostenlos unser Verlagsverzeichnis zu:
Leopold Stocker Verlag GmbH
Hofgasse 5/Postfach 438
A-8011 Graz
Tel.: +43 (0)316/82 16 36
Fax: +43 (0)316/83 56 12
E-Mail: [email protected]
www.stocker-verlag.com
ISBN 978-3-7020-2014-9
eISBN 978-3-7020-2075-0
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger jeder Art, auszugsweisen Nachdruck oder Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art, sind vorbehalten.
© Copyright by Leopold Stocker Verlag, Graz 2022
Layout und Repro: Werbeagentur Rypka GmbH, 8143 Dobl/Graz
INHALT
AUF EIN WORT DAVOR
MAN MUSS STAUNEN
TEIL I: DIE RÜCKKEHRER
DER BIBER
SPÄTHEIMKEHRER
ALLGEMEINES
Nahrung
Lebensräume
Kulturfolger
Dammbauer und Landschaftsgestalter
„Spätzünder“ und „Frühreife“ – ein Vergleich
WAS SIE DAS LEBEN KOSTETE
Lebensmittel, Arznei und Eitelkeit
NEUBEGINN DER ART
BEGEGNUNGEN
DER LUCHS
EIN WALDGEIST
ALLGEMEINES
Nahrung
Lebensweise
DAS AUS FÜR DEN LUCHS
Deutschland
Österreich
Schweiz
Italien
Slowenien
ROTTET DER LUCHS DIE REHE AUS?
Muffelwild ist gefährdet
Luchsdichte & Konkurrenz
Der Luchs als jagdlicher „Erfüllungsgehilfe“
LUCHS UND ALMWEIDE
„Das Gesetz des Örtlichen“
DIE ERSTEN RÜCKKEHRER
Deutschland
Tschechien
Österreich
Schweiz
Frankreich
Italien
Slowenien
BEGEGNUNGEN
DER WOLF
ANSPRUCHSLOS UND ERFOLGREICH
ALLGEMEINES
Nahrung
Lebensräume
DIE AUSROTTUNG DES WOLFS
Rotkäppchens Erbe
Der Wolf und das liebe Vieh
Deutschland
Österreich
Schweiz
Italien
Slowenien
DER WOLF UND DER MENSCH
Konstruierte Probleme
Lösungsansätze
Problematisch: Der Umgang des Menschen mit dem Wolf
Wölfe fressen Friedhofsgärtner
Warum Wölfe den Menschen nicht fürchten
Falsche Lösungsansätze
DER WOLF UND DAS SCHALENWILD
Wölfe handeln nicht politisch
Rotwild trotz Wolf
Der Wolf und seine Auswirkung auf die Jagd
DER WOLF ALS BAUERNSCHRECK
Prävention statt Ersatz
DER WOLF AUF DEN ALMEN
Wer braucht überhaupt Weidetiere auf der Alm?
WÖLFE MIT DER FLINTE „REGULIEREN“?
Klingt logisch, ist jedoch keine Lösung
Der Tod kann abschreckend sein
ERSTE BLEIBENDE RÜCKKEHRER
Deutschland
Österreich
Schweiz
Frankreich
Slowenien
Italien
VERSCHIEDENE LÖSUNGSANSÄTZE
Jagd kann bedrohten Arten helfen
Vorweg: Schäden und Emotionen
Deutschland
Österreich
Italien
Slowenien
WÖLFE BELEBEN DEN TOURISMUS
Touristische Vermarktung
Wölfe am See von Cerknica
Wölfe in der Lausitz
BEGEGNUNGEN
DER BRAUNBÄR
ABFALLVERWERTER UND VEGETARIER
ALLGEMEINES
Nahrung
Lebensweise
Verhalten gegenüber Menschen
Vorsicht ist geboten – Angst ist kontraproduktiv
WO SIE NIE GANZ VERSCHWUNDEN WAREN
Italien
Spanien
Jugoslawien
WIE BÄREN UNS UND WIE WIR SIE SEHEN
Der Bär „beurteilt“ Sicherheit anders
Reaktion des Hundes auf Bären
BEGRENZTE LEBENSRÄUME
Wer hat mehr Angst?
Situation in Deutschland
Situation in Österreich
Ein Trauerspiel
PROBLEME UND HOFFNUNGEN
Der Bär und der Mensch
Belegte Vorfälle
Ungeklärte Vorfälle
SCHÄDEN DURCH BÄREN
Weidetiere, Bienen und Obstbäume
Ersatz von Schäden
Schutz der Weidetiere
GROSSRAUBWILD & TOURISMUS
Wildtiere haben einen Erlebniswert
Bei Miha Mlakar
BEGEGNUNGEN
DER FISCHOTTER
ANZEIGER DER WASSERQUALITÄT
ALLGEMEINES
Nahrung
Lebensräume
Lebensweise
PROFESSIONELLE AUSROTTUNG
Fischräuber, Pelz- & Fleischlieferant
DIE RÜCKKEHR DER FISCHOTTER
Trendwende
OTTERSCHUTZ
Problem Fischteiche
BEGEGNUNGEN
DER EUROPÄISCHE ELCH
EINER, DER WIEDER HEIM WILL
ALLGEMEINES
Lebensweise
Gefahrenabwehr
Ihre Nutzer
Nahrung
Lebensräume
AUSROTTUNG & RÜCKKEHR
Leichte Beute für Jäger
Erfolglose Bemühungen um Rückkehr
BEGEGNUNGEN
DER WALDRAPP
WER GUT SCHMECKT, LEBT GEFÄHRLICH
ALLGEMEINES
Lebensräume
Nahrung
ENTDECKUNG UND ABGESANG
Früheste Hinweise
Ausrottung
GROSSE BEMÜHUNGEN FÜR DIE RÜCKKEHR
Aufzucht und Flugunterricht
BEGEGNUNGEN
DER BARTGEIER
EIN GEIER, DER „EITEL“ IST
ALLGEMEINES
Nahrung
Lebensräume und Lebensweise
SEIN VERSCHWINDEN
Prämien für tote Geier
SEINE WIEDERKEHR
Die Zeit war reif
BEGEGNUNGEN
DER GÄNSEGEIER
DIE WELT IST VOLLER MISSVERSTÄNDNISSE
ALLGEMEINES
Nahrung
Lebensräume und Wanderungen
VERSCHWUNDEN UND ZURÜCKGEKEHRT
Der Tod holt eine Art zurück
RÜCKHOL-AKTIONEN
Österreich
Italien (Cornino)
Spanien
Frankreich
Portugal
BEGEGNUNGEN
DER HABICHTSKAUZ
EIN FAST AUSGESTORBENER
ALLGEMEINES
Nahrung
Lebensweise
Lebensräume
IHR VERSCHWINDEN
Pech gehabt
Bayern
Österreich
WIEDERANSIEDLUNG IN ALTEN WOHNGEBIETEN
Deutschland
Österreich
Beste Voraussetzungen?
BEGEGNUNGEN
ZUM VERWECHSELN ÄHNLICH?
Der Uhu (Bubo bubo)
Der Habichtskauz (Strix uralensis)
Der Waldkauz (Strix aluco)
TEIL II – FREIWILLIGE UND UNFREIWILLIGE ZUWANDERER
DIE NUTRIA
EIN „ZWANGS-IMMIGRANT“ AUS SÜDAMERIKA
ALLGEMEINES
Nahrung
Lebensräume
Lebensweise
DIE EROBERUNG EUROPAS
Die ursprüngliche Heimat Südamerika
Deutschland, Großbritannien, Südeuropa
Frankreich
Polen
Nutria als Lebensmittel
BEGEGNUNGEN
DER BISAM
EINE RATTE, DIE KEINE IST
ALLGEMEINES
Nahrung
Lebensweise
Lebensräume
AUS NORDAMERIKA NACH EUROPA GEHOLT
Pelz- und Fleischlieferant
ÖKONOMISCH & ÖKOLOGISCH VERTRETBAR?
„Schädling“?
Endlose Vermehrung?
PROBLEMLÖSUNGSANSÄTZE
Bisam-Bekämpfung
BEGEGNUNGEN
DER MARDERHUND
OPTISCH EIN MIX AUS FUCHS UND DACHS
ALLGEMEINES
Nahrung
Lebensräume
Lebensweise
EIN ASIATE ZOG WESTWÄRTS
BEGEGNUNGEN
DER GOLDSCHAKAL
BESTE LEBENSBEDINGUNGEN
ALLGEMEINES
Nahrung
Ähnlichkeiten
Lebensräume
Lebensweise
WO KOMMT ER HER?
Herkunft
Vom Balkan kommend
ER WIRD BLEIBEN
Einfluss auf unsere Fauna?
Selbstregulation
BEGEGNUNGEN
DER WASCHBÄR
GUT ZU FUSS, KLETTERER UND SCHWIMMER
ALLGEMEINES
Nahrungs-Generalist
Lebensweise
Lebensräume und ihre Requisiten
AUSBREITUNG
Ausgesetzt im Geiste der Zeit
DIE EU UND DER WASCHBÄR
Zerstörer der Biodiversität?
BEGEGNUNGEN
DER MINK
ER KAM UNFREIWILLIG
ALLGEMEINES
Nerz oder Mink?
Nahrung
Lebensräume
AUSBREITUNG
Der Umgang mit dem Mink
Opfer der Profitgier und der Hysterie
BEGEGNUNGEN
DER NANDU
EIN VOGEL AUS DER PAMPA
ALLGEMEINES
Verbreitung und Lebensräume
Nahrung
Lebensweise
DIE KANADAGANS
IN NORDAMERIKA ZUGVOGEL, BEI UNS STANDVOGEL
ALLGEMEINES
Lebensräume
Immigranten in Europa
Nahrung
Lebensweise
Ärgernis Kanadagans
WEITERE GÄNSEARTEN
Indische Streifengans (Anser indicus)
Schwanengans (Anser cygnoides)
Mandarinente (Aix galericulata)
Brautente (Aix sponsa)
DIE NILGANS
PROBLEME IN URBANEN RÄUMEN
ALLGEMEINES
Verbreitung/Lebensräume
DIE ROSTGANS
EINE HALBGANS AUS HALBWÜSTEN
ALLGEMEINES
Verbreitung
Lebensweise und Vorkommen
DIE TÜRKENTAUBE
KULTURFOLGER AUS DEM ORIENT
ALLGEMEINES
Verbreitung
Lebensweise
Lebensräume bzw. Nahrung
Taubenarten – Ähnlichkeiten
DER SILBERREIHER & DER SEIDENREIHER
SOMMERURLAUBER, DIE BLEIBEN WOLLEN
ALLGEMEINES
Lebensweise
Verwechslungsgefahr
Verbreitung
Nahrung
Lebensräume
FLAMINGOS ALS ZUWANDERER?
Der Chileflamingo (Phoenicopterus chilensis)
DER HALSBANDSITTICH
EIN „PAPAGEI“ EROBERT EUROPA
ALLGEMEINES
Lebensweise
Verbreitung/Lebensräume
Für und wider
Schäden
„Feinde“
DIE REGENBOGENFORELLE & ANDERE FISCHE
VERÄNDERTE GEWÄSSERÖKOLOGIE
ALLGEMEINES
Verbreitung/Problematik
Lebensräume
WEITERE FISCHARTEN
Die Ungenannten
EPILOG
DES NACHDENKENS WERT
WORTWEISER
LITERATURNACHWEIS
QUELLEN IM INTERNET
AUF EIN WORT DAVOR
MAN MUSS STAUNEN
Wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen den Eindruck haben, „Alles geht den Bach hinunter“. Wenn wir die globalen, auch uns in Mitteleuropa direkt betreffenden Probleme anschauen – die Klimaerwärmung, die bedrohlich sinkenden Grundwasserstände und gleichzeitig die immer häufigeren und katastrophaleren Überschwemmungen, die industrielle Landwirtschaft, die Anreicherung von Nahrung und Wasser mit Antibiotika, die Luftschadstoffe und die Versiegelung der Landschaft – müssen wir uns fürchten. Das Artensterben beschleunigt sich dramatisch, bei den Insekten wie bei den Vögeln. Und dennoch kommen Arten zurück, die wir längst „abgeschrieben“ hatten. Darunter sind so große und „gefährliche“ Arten wie Braunbär, Wolf und Luchs. Jahrzehnte haben wir bedauert, dass sie bei uns ausgerottet worden sind. Wir haben darüber diskutiert, wie wichtig sie gerade heute für uns wären – dass sie je zurückkommen, haben wir nicht „befürchtet“.
Andere Arten waren bis auf einige wenige letzte Mohikaner verschwunden. Niemand hatte in den 1970er-Jahren geglaubt, unsere Bäche würden je dem Fischotter wieder ausreichend Nahrung bieten. Gleichzeitig vervielfachte sich die Belastung der Landschaft allgemein und die von Gewässern durch Sport und Freizeitwahn besonders. Wo sollte ein Fischotter noch jagen oder sicher ruhen können? Wo sollte ein Biber in einer komplett durchgeplanten, auf Gewinne ausgerichteten Landschaft noch Bäume fällen und Dämme bauen dürfen? Niemand hat in den ersten Nachkriegs-Jahrzehnten an die Rückkehr von Bart- und Gänsegeier Gedanken verschwendet. Doch sie alle sind zurückgekehrt, in eine total veränderte Welt. Bloß – nach den ersten Freudenschreien wurden bei einigen Arten aus Befürwortern Bedenkenträger und aus Bedenkenträgern erbitterte Gegner einer Rückkehr. Manche trugen und tragen ihre Bedenken – ganz wie in alten, überwunden geglaubten Zeiten – mit Pulver und Blei und sogar mit Gift vor. Dabei wäre ein Rückfall für uns alle fatal!
Froh – unendlich froh sollten wir sein, dass jene, denen man einst das Existenzrecht nahm, freiwillig und – mehr oder weniger – erfolgreich zurückgekehrt sind! Man kann sie mit den geschwollenen Worten des Zeitgeistes „Bioindikatoren“ nennen. Man kann sie auch schlicht als Zeichen dafür sehen, dass – vielleicht – doch noch nicht alles verloren ist!
Es sind nicht nur Arten zurückgekehrt, es kamen auch neue zu uns. Die meisten kamen „gewaltsam“, weil wir uns satte Profite von ihnen erhofften. Zu ihnen gehören Nutria und Nerz. Andere wurden eingeschleppt, weil sie als Faunenbereicherung angesehen wurden oder weil man sie jagen wollte. So kamen Waschbär und Bisam von Nordamerika nach Europa. Der Marderhund wurde seines Felles wegen aus dem fernen Asien nach Westen verschleppt, um schließlich freigelassen zu werden. Aus den Weiten der ehemaligen Sowjetunion, wo er überall ihm zusagende Lebensräume fand und sich vermehrte, wanderte er gemächlich, aber durchaus zielstrebig bis nach Mitteleuropa.
Sie sind nicht erwünscht, diese Zuwanderer. Die EU hat aufgelistet, wen wir nicht mögen dürfen und folglich zu bekämpfen haben. Wer freilich glaubt, wir könnten Waschbär oder Bisam wieder ausrotten, der zeigt sich verdammt naiv. Ausrotten müssen wir nach dem Willen der EU freilich auch unzählige Pflanzenarten, die im Laufe der Jahrhunderte eingewandert sind, ohne uns zu fragen. Bleiben und gefördert werden dürfen hingegen all jene, an denen wir verdienen oder auf die wir kulinarisch nicht mehr verzichten mögen. Dazu gehören nahezu alle unsere gängigen Gemüsepflanzen!
Die Realität sollte – wie so oft – von mehreren Seiten betrachtet werden. So ist einerseits das Springkraut ein Neophyt, aber in vielen Gemarkungen zeitweise die letzte Nahrungspflanze der Bienen und vieler anderer Insekten. Es muss vernichtet werden, weil es ein paar Bürokraten in Brüssel so wollen und nationale Politiker willige Erfüllungsgehilfen sind. Der Mais hingegen ist für das anhaltende Sterben unzähliger heimischer Pflanzen, Insekten, Reptilien, Amphibien und Säuger verantwortlich, ebenso für die Nitratanreicherung im Grundwasser und durchaus auch für Bodenverluste. Aber sein Anbau ist höchst profitabel und wird mit Milliarden an Steuergeldern gefördert.
Wäre es da nicht höchste Zeit, ein klein wenig wohlwollender an die freiwilligen Heimkehrer wie Wolf oder Biber zu denken? Sind wir doch froh und dankbar, in einem Land leben zu dürfen, das den Ansprüchen dieser Arten noch notdürftig gerecht wird!
Bruno Hespeler
Nötsch, Jänner 2022
TEIL I: DIE RÜCKKEHRER
Im ersten Teil des Buches geht es um einen knappen Überblick über die Rückkehr von Arten, die bei uns früher heimisch, zwischenzeitlich jedoch verschwunden waren. Nicht berücksichtigt wurden solche, von denen es noch Reliktvorkommen gab, etwa Wanderfalke und Uhu.
Nahezu ausgestorben waren auch der Schwarzstorch und der Kranich. Ersterer kam nur noch im Grenzgebiet zwischen Niederösterreich und Tschechien vor. Einige ganz wenige Paare hatten im Norden Deutschlands überlebt. Der Kranich fehlt in Österreich als Brutvogel bis heute. In Deutschland ist er in weiten Teilen des Nordens und Ostens wieder Brutvogel. Ob es dabei bleibt oder ob der fast überall sinkende Grundwasserstand und damit der Verlust geeigneter Bruthabitate wieder in eine andere Richtung führt, wird die Zukunft zeigen.
Viele einst in Mitteleuropa heimische Wildtiere wurden bei uns ausgerottet, weil der Mensch sie als Nahrungskonkurrenten sah. Das betraf nicht nur die großen Prädatoren – Bär, Luchs und Wolf –, sondern auch das ganze Spektrum der Greifvögel, einschließlich der Eulen. Auch die „Fischräuber“ wurden gnadenlos verfolgt, und zwar nicht nur die großen wie Otter, Reiher und Kormoran, nein, auch die kleinsten, etwa der Eisvogel, die Wasseramsel und der Würger.
Ausrottung unerwünschter Arten war bis ins 19. Jahrhundert hinein in weiten Teilen Europas schlicht Staatsziel. Politisch unerwünscht war jede Art, die im Ruf stand, die Volkswirtschaft zu schädigen. Schließlich kassierten die Lehensherrn – vom König bis zum Kloster – Naturalsteuern. Die Bauern konnten aber nur abliefern, was sie zuvor ernten konnten. Andererseits musste sich ihr Hunger in Grenzen halten, denn sie wurden zum Frohn- wie zum Kriegsdienst gebraucht. So ist beispielsweise auch der „Spatzen-Erlass“ Maria Theresias zu verstehen. In ihm wurde den Gemeinden vorgeschrieben, wie viele Sperlinge (diese galten als Getreidefresser) ihre Einwohner jährlich abzuliefern hatten. Ähnlich erging es den Feldhamstern. Die wirkliche Gefahr für das Getreide stellte das Schalenwild dar, doch dieses genoss hingegen peinlichen Schutz. Oft war das Leben eines Bauern weniger wert als das eines Hirsches oder einer Wildsau. Das Wild diente zum Pläsier der hohen Herren und durfte vielfach nicht einmal von den Feldern verjagt werden. Darüber mag man denken wie man will, aber letztlich verdanken wir den Erhalt dieser Arten vor allem der Jagdlust!
Manche Arten wie Bär, Wolf, Luchs, Geier und Adler wurden auch schlicht deshalb gnadenlos verfolgt, weil man Angst vor ihnen hatte. Legendenbildung trug das ihre dazu bei. Erinnert sei an unzählige Schilderungen in Literatur und Kunst über blutige Überfälle von Wölfen, Legenden, die gerade wieder eine gewisse Renaissance erleben. Oder an die Hirtenbuben, die vom Steinadler gepackt, zum Horst getragen und verfüttert wurden.
Seit einigen Jahren kommen diese „Heimkehrer“ zurück, Projekte zur Wiederansiedelung führten zu einem stetig wachsenden Bestand. Grundsätzlich dürfen wir davon ausgehen, dass nur jene Arten zurückkommen und hierbleiben, deren Grundbedürfnisse hier gesichert sind. Renaturierungen und andere Maßnahmen lockten sie wieder an. Gerade für große Arten hat sich die Nahrungsbasis positiv verändert, während kleine Arten, die bisher überlebten, immer mehr Standorte aufgeben müssen.
DER BIBER (Castor fiber)
© Jiří Bohda
SPÄTHEIMKEHRER
Erscheinungsbild
Gewicht: Biber werden bis zu 25 kg schwer, wobei in der Literatur sehr unterschiedliche Angaben gemacht werden. Diese hängen eventuell mit dem vereinzelten Aussetzen Kanadischer Biber zusammen, die deutlich schwerer sind als die Europäischen Biber.
Beine: Biber haben kurze Beine mit je fünf Zehen. Diese sind zur besseren Fortbewegung im Wasser hinten mit Schwimmhäuten verbunden. Die Vorderpfoten haben – anders als jene des Fischotters – keine Schwimmhäute und dienen als Greifhände, die auch zur Fellpflege unerlässlich sind. Beim Schwimmen werden die vorderen Extremitäten am Körper angelegt.
Haarkleid: Die Bälge haben bis zu 23.000 Haare je cm2 und sind ganzjährig von sehr guter Qualität.
Zähne: Oben und unten je 2 Nagezähne, die sich gegenseitig schärfen und ständig nachwachsen. Vollständig ist das Gebiss erst mit 12 Monaten.
Nase und Ohren: Beide können beim Tauchen völlig verschlossen werden.
Besonderheit: Auch der Mundraum kann hinter den Zähnen völlig abgeschlossen werden. Nur so ist es dem Biber möglich, auch unter Wasser zu nagen.
Sinne
Sehvermögen: Biber haben kleine Augen mit geringer Leistung. Bei ihren nächtlichen Aktivitäten, im Wasser wie an Land, sind die anderen Sinne wichtiger.
Geruchssinn: Das Gesichtsfeld eines am Ufer sitzenden oder schwimmenden Bibers ist immer eng begrenzt. Er sieht nicht, was sich hinter dem Uferbewuchs abspielt, aber er kann es eventuell riechen. Daher leistet sein Geruchssinn sehr viel.
Hörsinn: Was er nicht riecht, hört er eventuell. Diese beiden Sinne ergänzen sich sehr gut.
Tastsinn: Lange Vibrissen dienen als Orientierungshilfe bei Dunkelheit, im trüben Wasser und im Bau.
Kommunikation
Duftstoffe: Der Reviermarkierung und innerartlichen Verständigung dient das Sekret der „Geildrüsen“.
Akustische Signale: Bei Gefahr schlagen Biber mit der Kelle (flacher, breiter Schwanz) heftig auf das Wasser.
Fortpflanzung
Geschlechtsreife: Biber sind „Spätzünder“. Weibchen werden mehrheitlich als Dreijährige erstmals trächtig, teilweise auch später. Daher können sie lange in der Familie leben. Männchen sind teilweise schon mit 18 Monaten zur Fortpflanzung bereit und müssen sich dann ein eigenes Revier suchen.
Paarbildung: Biber leben monogam und binden sich lebenslänglich. Die Paarung erfolgt – abhängig von der Witterung – zwischen Januar und April.
Bau: Der Eingang des Baus liegt immer unter dem mittleren Wasserspiegel, der Kessel hingegen oberhalb der Hochwassermarke. Fällt der Wasserstand stark, kann der Eingang temporär frei liegen.
Junge: Nach einer Tragzeit von rund 107 Tagen bringt das Weibchen im Kessel der Burg 2–3 sehende und voll behaarte Junge zur Welt.
Aufzucht: Die Jungen werden 8–10 Wochen gesäugt, nehmen jedoch – im Bau – schon mit etwa 8 Tagen erste feste Nahrung zu sich. Biberjunge leben die ersten 4–6 Wochen fast ausschließlich im Bau und müssen das Schwimmen erst lernen. Die Fürsorge erfolgt durch die Eltern und deren vorjährigem Nachwuchs. Nach rund 6 Monaten sind die Jungen selbstständig.
Abwanderung: Kurz vor Vollendung des zweiten Lebensjahres suchen sich die männlichen Jungbiber eigene Lebensräume und Familien. Das ist für sie eine gefährliche Zeit, denn an freien „Planstellen“ mangelt es inzwischen. Je länger die Suche dauert, umso mehr Gefahren birgt sie!
ALLGEMEINES
Das Trittsiegel des Bibers mit den fünf gespreizten Zehen ist markant. Die hinteren Abdrücke erreichen eine Länge bis zu 15 cm, die vorderen sind um zwei Drittel kürzer. Die Breite beträgt hinten bis zu 10 cm, vorne nur bis 4,5 cm. Als typischer Nager sind die vorderen Pfoten als Greifhände ausgebildet und ohne Schwimmhäute.
© Christian Deschka
Die walzenförmige Losung des Bibers ist selten länger als 4 cm und fast immer fest. Schon ihre Struktur ist – besonders im Herbst und Winter – durch kleine Späne aus Rinde und Holz auffällig. Im Sommerhalbjahr nehmen Biber auch vermehrt grüne Pflanzenteile auf. Die abgebildete Losung enthält auch Getreidekörner, die der Biber an einer nahe dem Wasser platzierten Rehfütterung aufgenommen hat.
Die breite, muskulöse Kelle (Schwanz) dient dem Biber als Antrieb und Steuer beim Schwimmen und Tauchen. Sie dient aber auch der Kommunikation. Die Tiere schlagen mit ihr flach aufs Wasser und können sich so unter und über Wasser verständigen.Die Kelle wurde den Tieren aber auch zum Verhängnis, weil die Kirche sie als „Fisch“ anerkannte und als Fastenspeise zuließ.
© iStock.com/Christina Prinn
Nahrung
Biber sind reine Pflanzenfresser. Sie sind nicht wählerisch und fressen fast alle am und im Wasser wachsenden Pflanzenarten. Im Uferbereich nutzen sie eine Fülle krautartiger Wildpflanzen, darunter auch Brennnessel, Giersch und verschiedene Ampferarten. Bevorzugt werden während der Vegetationszeit saftige Rhizome und Triebe emerser und submerser Pflanzen wie Gelbe Iris, Teichrosen oder Rohrkolben.
Biber entfernen sich ungern weiter als 20 Meter vom Wasser, machen aber Ausnahmen, wenn sich in Gewässernähe attraktive landwirtschaftliche Kulturen wie Mais-, Rüben-, Getreide- oder Gemüsefelder befinden. Dann legen sie bis zu 150 Meter zurück. Beim Mais ernten sie die Stängel wie auch einzelne Kolben, die sie ins Wasser ziehen.
Ganzjährig benagen und fällen sie nahezu alle gewässerbegleitenden Gehölzarten. Sie fällen dabei auch sehr starke und alte Bäume wie Eichen oder Pappeln. Verwertet werden die Rinde ebenso wie Blätter und dünnere Triebe. Die Nutzung von Gehölzen nimmt im Spätsommer und Herbst zu, weil die Biber Zweige und Äste vor ihren Burgen am Gewässergrund einlagern. Das Fällen erfolgt jedoch auch dann, wenn saftigere und einfacher zu erntende Pflanzen im Überfluss vorhanden sind, weil Äste ganzjährig für Bau und Reparatur von Dämmen und Burgen benötigt werden.
Lebensräume
Wasser – ihr wichtigstes Element: Biber besiedeln stehende wie fließende Gewässer, stellen aber dennoch einige Ansprüche. Vor allem darf ein Gewässer im Sommer nicht trockenfallen. Der Wasserstand muss immer so hoch sein, dass die Eingänge zu den Burgen ausreichend tief unter Wasser liegen. Das Gewässer darf im Winter nicht bis auf den Grund gefrieren. Die Biber halten ihren Ausstieg eisfrei und müssen ihre am Gewässergrund gelagerten Vorräte nutzen können. Fließgewässer gefrieren nicht so schnell wie Stillgewässer. Allerdings darf die Strömung auch nicht zu stark sein.
Deutlich zeigen die Zahnmarken in der Rinde, dass Biber das Holz quer benagen.
Uferzone: Die Größe der Wasserfläche ist nicht so entscheidend wie die Qualität der Uferzone. Gewässer, deren Ufer die Anlage von Wohnburgen begünstigen, werden bevorzugt.
Gehölze: Ausreichend Gehölze – vor allem schnell nachwachsende Weichhölzer – sind wichtig. Blätter, Rinde und dünne Holzteile dienen als Nahrung. Zweige und Äste werden im Herbst am Grund des Gewässers (bei den Wohnburgen) als Winternahrung gelagert und werden außerdem für den Bau von Burgen und Dämmen benötigt. Das gilt besonders für Bäche und Gräben mit schwankenden Wasserständen, die der Biber anstaut. Fließgewässer, deren Ufer über längere Strecken ohne Gehölze sind, meidet der Biber.
Wo die Ufer flach sind, können Biber keine Höhlen graben. Sie errichten dann im Flachwasserbereich Burgen aus Ästen und Zweigen, die mit Schlamm abgedichtet werden. Der Eingang liegt unter Wasser, der Wohnkessel liegt über dem Wasserspiegel.
Hinterland: Von Bedeutung bei der Habitatwahl ist auch das Hinterland eines Gewässers. Fast überall in der Literatur wird angegeben, der Biber entferne sich selten weiter als 20 Meter vom Ufer. Das trifft bei Gewässern im Wald häufig zu und hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass im Uferbereich Weichhölzer wachsen, während dahinter oft Nadelhölzer oder Harthölzer folgen. Wo der Biber wählen kann, bevorzugt er Weide, Erle, Esche oder Pappel. Allerdings fällt er gelegentlich auch recht beachtliche Eichen.
Wo Flachwasserzonen fehlen und der Wasserspiegel deutlich tiefer liegt als die Uferkante, graben Biber Erdbaue. Auch deren Eingänge liegen unter Wasser. Sie haben einen ansteigenden Gang, der in einen über der Hochwassermarke liegenden Wohnkessel führt. Über diesem Kessel schichten Biber Äste und Zweige auf, zwischen welche sie Schlamm schaffen. Damit verhindern sie, dass sich Fressfeinde in den Kessel durchgraben.
Biber benutzen, wenn sie an Land gehen, feste Ausstiege. Dabei graben sie sich tief in die Uferkante ein und hinterlassen Rinnen.
Hier hat der Biber seinen Bau in einen Damm gegraben, auf dem er schichtweise Äste abgelagert und mit Schlamm verdichtet hat. Deutlich ist der Aufstieg zu erkennen, auf dem er den Schlamm vom Gewässergrund hinauftransportiert.
Biber fällen Stämme mit einem Durchmesser bis knapp einen Meter. Dabei bevorzugen sie gewässerbegleitende Weichhölzer wie Aspe, Pappel, Weide und Erle.
Im Sommer lässt die Fäll-Tätigkeit nach, weil sich die Biber auf krautartige Pflanzen konzentrieren. Im Herbst fällen sie auf Vorrat. Sie müssen sich ordentlich Fett anfressen und lagern Äste und Zweige unter Wasser für den Winter ein.
Kulturfolger
Biber haben wenig Probleme mit der Nähe des Menschen. Wo sie seine Anwesenheit gewohnt sind, zeigen sie sich relativ vertraut und auch tagaktiv. Heute besiedeln Biber Flüsse wie die Donau innerhalb von Städten, wo sie angrenzende Parks und Hausgärten zur Nahrungssuche nutzen. Aus älterer Zeit ist überliefert, dass Biber auch in Hafenanlagen siedelten. Dass sie dort zuerst verschwanden, ist den Kaimauern zuzuschreiben. Da die Biber heute – von Ausnahmen abgesehen – nicht mehr gejagt werden, ist ihre Rückkehr in unbefestigte Randbereiche von Hafenanlagen zu beobachten. Die immer mehr, größer und schneller werdenden Frachtschiffe und Freizeitboote und der Mangel an Ufergehölzen bremsen jedoch diese Entwicklung aus.
Hier hat der Biber einen Wassergraben (Vorfluter) angestaut. Hinter dem Damm breitet sich das Wasser aus und überflutet die Wiesen. Aus Grünland wird Feuchtgebiet, und der Grundwasserspiegel steigt. Was ökologisch sinnvoll und notwendig ist, geht zu Lasten des Bauern.
Viele Gewässer werden von Wegen oder Straßen begleitet. Zwar hat der Biber mit diesen kein grundsätzliches Problem, das zeigen seine Verkehrsverluste, dennoch stellen besonders breite, asphaltierte Straßen so etwas wie optische Barrieren dar.
Dammbauer und Landschaftsgestalter
Es sind im Grunde positive Eigenschaften, für die wir dem Biber – wenn wir in die Zukunft blicken – dankbar sein müssen. Er staut zwar Gewässer an, arbeitet damit jedoch dem weiteren Absinken des Grundwassers entgegen. Er schafft Überschwemmungsflächen, die aber auch geeignet sind, Hochwässer aufzunehmen. Er schafft intakte Lebensräume für eine Unzahl an Pflanzen- und Tierarten. Doch wer in oder am Lebensraum eines Bibers eigenen Grund hat, der möchte vielleicht den Grundwasserstand absenken, auch wenn für die Allgemeinheit und unsere Zukunft das Gegenteil dringend notwendig wäre. Der Landwirt will nicht mit seinen schweren Maschinen in Biberbaue einbrechen und er möchte seinen Mais- oder Rübenacker nicht in eine ökologisch wertvolle Sumpfwiese oder ein Übergangsmoor umgebaut bekommen. Es ist scheinbar unser unabwendbares Schicksal, dass unser momentanes wirtschaftliches Überleben und unsere finanziellen Gewinne langfristiges Überleben und Zukunft für unsere Nachkommen toppen.
Hier wurde mit einem Bagger der Damm eines Bibers aufgerissen. Deutlich ist zu sehen, wie perfekt der Biber Holz und Schlamm miteinander verbaut und verdichtet hat.
Natürlich kann niemand zuschauen, wie der Biber immer größere Flächen umgestaltet und die sichere Verwendung von Verkehrswegen verhindert. Aber unzählige kleine Fließgewässer drohen in den immer länger anhaltenden und heißer werdenden Sommern trockenzufallen. Der Biber schafft Abhilfe und der Mensch kann – ohne allzu großen technischen Aufwand – sagen, wie weit er dabei gehen darf.
„Spätzünder“ und „Frühreife“ – ein Vergleich
Biber gehören zu den „K-Strategen“. Darunter versteht man Tierarten, deren Populationen sich nur langsam dem vorhandenen Lebensraum und der Nahrungskapazität anpassen. Sie zeichnen sich durch eine hohe Lebenserwartung, späte Geschlechtsreife und geringe Nachwuchsraten aus. Das ist die Voraussetzung dafür, dass Jungbiber lange in der elterlichen Familie bleiben dürfen.
Im Gegensatz zu den „K-Strategen“ stehen die „R-Strategen“. Sie haben eine – gemessen an ihrer Größe – eher geringe Lebenserwartung, frühe Geschlechtsreife und hohe, aber stark schwankende Nachwuchsraten. Diese sind primär abhängig vom variablen Nahrungsangebot, auf welches vor allem das Wetter Einfluss hat, und von der Zahl ihrer Nutzer.
Beispiel: Biber leben überwiegend im Wasser. Dort ist die Zahl ihrer Nutzer eher gering. Schwankende Wasserstände haben relativ wenig Einfluss, weil sie mit Dammbauten den Wasserstand zum Teil selbst regulieren können. Sie sind im Jahreslauf nur vergleichsweise geringen Temperaturschwankungen ausgesetzt. Sie sind bei der Nahrungswahl flexibel und können Vorräte anlegen. Es gibt auch keine Nutzer, die auf sie angewiesen sind.
Mäuse hingegen leben in Erdbauen, die in nassen Jahren unter Wasser stehen. Dabei gehen ganze Generationen verloren (sie ertrinken). Die Temperaturschwankungen ihrer Umwelt sind erheblich. Sie nehmen Einfluss auf die Reproduktion. Ihr Nahrungsangebot wird von der Landwirtschaft wie vom Wetter stark beeinflusst und kann erheblich schwanken. Die Zahl ihrer Nutzer ist groß, einige sind stark auf Mäuse als Nahrung spezialisiert. Um als Art zu überleben, müssen Mäuse in jeder Beziehung frühreif sein, sich mehrmals im Jahr fortpflanzen und hohe Nachwuchsraten haben.
WAS SIE DAS LEBEN KOSTETE
Lebensmittel, Arznei und Eitelkeit
Der Biber hatte es immer schwer, denn alles an ihm war begehrt, und für so manchen Aberglauben musste er herhalten. Die Kirche erklärte ihn, da er schwimmen und tauchen konnte, schlicht zum Fisch: 1754 ließen die Jesuiten von der Medizinischen Fakultät in Paris feststellen, dass der Schwanz des Bibers, weil er geschuppt ist, ganz Fisch sei, worauf die Theologische Fakultät entschied, dass Biberfleisch an Fastentagen gegessen werden darf (Piechocki, 1988). Als Gustostückerl galt seine Kelle (Schwanz), gegessen wurde jedoch der gesamte Biber.
Weggeworfen wurde von einem erlegten oder gefangenen Biber nichts. Schon gar nicht sein Fell. Dieses war, aufgrund seiner im Jahreslauf gleichbleibenden Haardichte, besonders begehrt. Als mit der Revolution von 1848 die jagdlichen Vorrechte des Adels fielen und die Jagd „verbürgerlicht“ wurde, ging es mit den Bibern steil bergab.
In Österreich galt die Art 1869 als ausgerottet (Sieber & Bauer, 2001, zitiert bei Ökoteam – Institut für Tierökologie und Naturraumplanung OG, Graz, 2017).
Hier hat der Biber einen Erlenbestand samt den angrenzenden Wiesen unter Wasser gesetzt und damit nicht nur für sich selbst Lebensraum geschaffen. Hier brüten jetzt der Kranich und die Bekassine, der Hecht findet ein Laichbiotop.
Ausrottung in Europa
Zeit
Land
Unterschutzstellung
vor 1200
England
1541
Italien
16. Jh.
Schottland
17. Jh.
Spanien
1981
17. Jh.
Tschechien
18. Jh.
Luxemburg
1820
Schweiz
1962
1824
Rumänien
1826
Holland
1830
Lettland
1838
Litauen
erster Schutz 1529
1841
Estland
1844
Polen
1923
1848
Belgien
1857
Kroatien
1865
Ungarn
1868
Finnland
1968
1869
Österreich
1871
Schweden
1873
Reliktpopulation
Frankreich
1909
Reliktpopulation
Deutschland
Reliktpopulation
Norwegen
1845
Reliktpopulation
Ukraine
1922
Daten: Schweizerisches Zentrum für die Kartografie der Fauna (SZKF/CSCF), Avenue de Bellevaux 51, 2000 Neuchâtel, Schweiz.
NEUBEGINN DER ART
Biber zogen immer schon Bewunderung und Hass gleichermaßen auf sich, wobei aus Bewunderung meist Begehrlichkeit wurde. Zu den Begehrlichkeiten gehörten Balg, Wildbret und Bibergeil, aber auch die Nagezähne, die gerne für Charivaris und anderen Schmuck verwendet wurden. Den Hass ziehen sie sich bis heute durch ihre Fäll-Aktionen zu. Werden nur Weiden, Pappeln und andere Wildbäume in unmittelbarer Gewässernähe gefällt, ist es oft nur Ärger, den sie erregen. Anders, wenn sie sich an Obstbäumen vergreifen. Da sie vor dem Menschen wenig Scheu zeigen oder zumindest wissen, wie sie mit ihm umzugehen haben, bewohnen sie längst schon innerstädtische Gewässer. Neben diesen liegen häufig Hausgärten mit Zier- und Obstgehölzen sowie Gemüse. Zäune sind selten „biberdicht“, weil sich die Tiere einfach unter dem Geflecht durchgraben. Noch ärgerlicher wird es, wenn sich Obstplantagen in Gewässernähe befinden. Da werden mitunter ganze Plantagen flachgelegt.
Erste Rückkehrer
1960er-Jahre
Einbürgerung von 120 Bibern in mehreren Kantonen.
1972
In Oberösterreich erfolgt erste Freilassung.
1979
In Baden-Württemberg werden bei Karlsruhe Biber ausgesetzt.
1980er-Jahre
In Ungarn wandern Biber entlang der Donau ein.
1980er-Jahre
In der Eifel werden Biber ausgesetzt.
1988–1992
In Hessen erfolgen Einbürgerungen.
1990
In Niedersachsen werden 8 Biber ausgesetzt.
1990er-Jahre
In Ungarn werden im Gemenc-Nationalpark 50 Biber ausgesetzt.
1990er-Jahre
In Kroatien erfolgen Ansiedlungen an Save und Drau.
1994–2000
Im Saarland werden an verschiedenen Gewässern insgesamt 50 Biber ausgesetzt.
ab 2000
In Ungarn werden im Fert-Hansag-Nationalpark Biber ausgesetzt.
um 2000
In die Steiermark wandern erste Biber ein.
2001–2008
In Ungarn werden an der Theiss Biber ausgesetzt.
2018
Österreichische Biber wandern in Friaul ein.
2020
Einwanderung aus Österreich nach Südtirol.
BEGEGNUNGEN
Als ich erstmals einen Biber sah, war seine Art in Deutschland nahezu und in Österreich völlig ausgestorben. Ich schaute mir in Schweden einen Forstbetrieb an, den zu verwalten mir angeboten worden war. Es war ein traumhafter nordischer Frühling, mit zartem Birkengrün, mit Elchen, die am Abend neben den roten Einödhöfen ästen, überall kullernden Birkhähnen und Bekassinen, welche mit ihren steilen Balzfügen halbe Nächte durchtanzten. Erstmals in meinem damals noch jungen Leben begriff ich, wie überbevölkert, wie verbaut und geradezu menschenfeindlich hektisch meine eigene Heimat nach dem Krieg geworden war.
Bei der Besichtigung des Reviers kamen wir zu einem kleinen See. Ursprünglich war es nur ein Bachlauf gewesen, der eher wenig Wasser beförderte. Doch dann kam ein Biberpaar und sperrte das Tälchen großzügig mit einem Damm ab. Boden und Umgriff des Teiches hatten die Biber gerodet. Aus Birken, Aspen und Weiden entstand der Damm. Etwas oberhalb des so entstandenen Teiches hatte der Besitzer Jahre zuvor eine kleine Hütte mit überdachter Terrasse bauen lassen.
Dort verbrachten wir, Brot und kalten Braten verzehrend, die Mittagsstunde. Plötzlich klatschte es zwei- oder dreimal heftig unten am Teich, etwa so, als würde man mit einem Paddel flach aufs Wasser schlagen. Der örtliche „Biberhäuptling“ hatte unsere Anwesenheit bemerkt. Mangels Paddel schlug er mit seiner Kelle aufs Wasser. Damit wusste jedes sich unter oder über dem Wasser befindliche Mitglied seiner Familie, dass die Luft an Land nicht rein war. Vorsicht war grundsätzlich geboten, denn Biber durften in Schweden gejagt werden.
Unser Biberhäuptling lag nach seinen Trommelschlägen einige Zeit fast unbeweglich im Wasser und beobachtete seine Umgebung. Schließlich beruhigte er sich wieder. Er schnitt mit seinen scharfen Nagern etliche noch im Wasser stehende Weidenschösslinge ab und zog sie dammwärts unters Wasser. Das war meine erste und für lange Zeit einzige Begegnung mit dem Biber.
Die nächste Begegnung hatte ich Jahrzehnte später in Brandenburg, wo ich einige Tage bei der Forstverwaltung zu tun hatte. Dabei mangelte es nicht an Gelegenheit, die „Schaffenskraft“ dieser großartigen Baumeister zu erleben. Im Osten Deutschlands waren – kurz nach der politischen Wende – auf kleinen Dienstwegen noch Dinge möglich, die sich in den Altbundesländern zu langjährigen Rangeleien zwischen unterschiedlichen Behörden, Interessenverbänden, Welt- wie Wirtschaftsrettern und politischen Parteien auswuchsen.
Während meiner Zeit bei der staatlichen Forstverwaltung im Süden der Bundesrepublik plante ich, einige unserer zahlreichen Waldbäche anzustauen. Die dabei entstehenden kleinen Teiche sollten Löschwasser zur Bekämpfung von Waldbränden bereithalten. Gleichzeitig waren sie als Bereicherung des Landschaftsbildes gedacht. Der Planungsaufwand war erheblich: Forstamt, Oberforstdirektion, Wasserwirtschaftsamt, untere Naturschutzbehörde und vorsichtshalber auch noch Anfrage beim gar nicht zuständigen Landbauamt. Der Naturschutzbeauftragte des Landratsamtes musste seinen Segen geben. Die Vegetation des künftigen Gewässergrundes sollte von einem Umweltbüro aufgenommen werden. Fischereibehörden mussten befragt werden. Ein Gutachten über den Einfluss solcher Teiche auf den Huchenbestand in der mehr als 20 Kilometer entfernten Wertach schien notwendig. Die Fischereirechtsinhaber der bachabwärts liegenden Fischereireviere sollten gehört werden und schließlich wurde ein Gutachten über die zufließenden Wassermengen im Jahreslauf verlangt. Besonders qualifizierte Bedenkenträger der eigenen Verwaltung spekulierten über die zunehmende Vernässung und das Absterben der Fichten.
Ein Jahr hindurch hörte ich mir die Bedenkenträger an. Dann nahm ich die Flora einer der zur Flutung vorgesehenen Fläche auf, maß jeweils bei Trockenheit und nach einem Starkregen den Wasserdurchfluss und ließ einen Bagger kommen. Die verlangten Pläne für Teich, Damm und Abfluss hatte ich im Winter selbst gezeichnet.
Später in Brandenburg und in Polen sah ich ganze Waldabteilungen, die der Biber – ganz ohne Verwaltungsaufwand – in Teiche umgebaut hatte. Dieser geniale Baumeister hatte sich die Sache angesehen und ging – ohne Behördenbeteiligung – unverzüglich ans Werk! Entstanden war – völlig verwaltungs- und kostenfrei – ein Stück Schweden, mitten in einer Wüste aus Sand und trostloser Föhren-Einfalt.
Natürlich hatten die Biber nicht für sich alleine gebaut. In dem versumpften Gelände rasteten fortan zahllose Kraniche, brütete die Moorente und meldete sich mit gutturaler Stimme die Rohrdommel. Toll!
Für meine Kollegen in Brandenburg waren solche Flächen und der Anblick von Bibern nichts Besonderes. Für mich war es einfach genial. Daheim in Kärnten konnte ich jederzeit Gams und Steinadler beobachten, sah Hirsche und Murmeltiere, aber Biber lebten dort – damals – noch keine. Zehn Jahre später berichteten die Medien vom ersten zugewanderten Biber in Unterkärnten. Alles fließt, alles ändert sich, wie die Havel in der Schorfheide!
DER LUCHS (Lynx lynx)
© iStock.com/Byrdyak
EIN WALDGEIST
Erscheinungsbild
Gewicht: Luchse erreichen in der Spitze ein Gewicht von bis zu 30 kg, was dem eines schweren Rehs entspricht. Mehrheitlich bleiben sie jedoch deutlich leichter.
Beine: Der Luchs ist, im Vergleich mit anderen Katzen, hochläufig, was ihm ein fast quadratisches Erscheinungsbild verleiht. Seine Pfoten haben vorne und hinten je 4 Zehen mit einziehbaren Krallen. Durch die starke Behaarung der Pfoten ist die Flächenbelastung des Luchses im Schnee mit nur 34–60 g/cm2 geringer als jene vieler seiner Beutetiere.
Haarkleid: Das Fell variiert in Farbe und Zeichnung stark. Die Fleckenmuster dienen zur Identifizierung der Tiere.
Sinne
Sehvermögen: Sein Sehsinn ist sprichwörtlich („Sehen wie ein Luchs“). Ohne die Sehleistung seiner Augen hätte er als Pirschjäger wenig Jagderfolg.
Geruchssinn: Wie bei den meisten Katzen spielt seine kleine Nase, in der nur relativ wenige Riechzellen Platz finden, keine große Rolle. Ihre Leistung ist nur mäßig.
Hörsinn: Sehr gut ist sein Hörvermögen.
Tastsinn: Der Orientierung in der Dämmerung und in der Nacht dienen seine langen Vibrissen im Gesicht.
Kommunikation
Akustische Signale: In der Ranz lässt der Kuder ein abgehacktes Miauen hören. Bei Begegnungen der Geschlechter bilden Fauchen und Knurren die Ranzlaute.
Olfaktorisch: Zur Reviermarkierung und zur innerartlichen Kommunikation dient das Reiben mit den Wangendrüsen, vorzugsweise an Holz, ferner Urinmarken und Kot.
Fortpflanzung
Paarbildung: Luchse sind polygam. Sie werden mit 18–30 Monaten geschlechtsreif. Paare treffen sich nur zur Fortpflanzung. Nach der Paarung trennen sie sich wieder. Die Ranz fällt in die Monate Februar und März.
Junge: Nach 70–75 Tagen Tragzeit werden, versteckt unter Wurzeltellern, Felsblöcken und ähnlichen „Höhlen“, 2–4 (selten 6) blinde, schwach behaarte Junge geboren. Sie öffnen mit 14–17 Tagen die Augen. Es sind typische Nesthocker, die bis zu 5 Monate gesäugt werden.
Führung: Etwa 10 Monate werden die Jungen von der Mutter geführt. Dann machen sie sich selbstständig und suchen eigene Reviere.
ALLGEMEINES
Wie die Hauskatze scharrt auch der Luchs seine Losung mit örtlichem Material (z. B. Nadelstreu, Laub, Erde, Schnee) zu. Häufig ist sie in der Nähe eines Risses zu finden. Sie ist walzenförmig und besteht meist aus mehreren Segmenten mit einem Durchmesser von 2–3 cm und einer (gestückten) Länge von 8–20 cm. Setzt der Luchs seine Losung im Schnee ab und taut dieser, liegt sie auch frei auf dem Waldboden.
© iStock.com/gatito33
Nahrung
Luchse sind reine Fleischfresser. Sie erbeuten, was sie bezwingen können – von der Maus bis zum geringen Rotwild. In den meisten mittel- und südeuropäischen Ländern stellen Rehe ihre Hauptbeute dar. In Teilen des Alpenraums können Luchse auch mehr Gämsen als Rehe erbeuten, einfach weil diese regional zahlreicher sind. Größere Beute wird verscharrt (zugedeckt) und häufig von Schwarzwild, Bär, Wolf, Fuchs, Greif- und Rabenvögel mitgenutzt.
Selbstverständlich erbeuten Luchse auch Vögel bis zur Größe eines Auerhahns. Vögel spielen jedoch insgesamt keine so große Rolle.
In Skandinavien, wo die Rehwilddichte signifikant geringer ist, Gämsen völlig fehlen und Elche vom Luchs nicht erbeutet werden können, spielen die dort häufigen Schneehasen, Füchse und Raufußhühner eine weit größere Rolle als im Alpenraum.
Wo es sehr viele Raufußhühner und Schneehasen gibt, werden diese häufiger erbeutet als die im Norden eher seltenen Rehe. Das gilt auch für Teile der osteuropäischen Luchsvorkommen. Befürchtungen, wie sie von Luchsgegnern immer wieder vorgetragen werden, Luchse würden in Mitteleuropa selten gewordene Arten wie Raufußhühner und sogar Wildkatzen ausrotten, sind durch nichts belegt und unbegründet.
Luchse erbeuten auch Weidetiere, fast ausschließlich Schafe und Ziegen. Hierbei handelt es sich bei den Luchsen – wie bei Wölfen und Bären – mehrheitlich um subadulte Tiere mit bescheidener Jagderfahrung, die sich auf der Suche nach einem eigenen Revier befinden. Häufig stehen sie zusätzlich unter Druck ansässiger Artgenossen, deren Reviergrenze sie verletzen. Während dieser Phase unterliegen Luchse einer erhöhten Sterblichkeit.
Insgesamt gesehen sind in Mitteleuropa Rehe und Gämsen die wichtigsten Beutetiere des Luchses. Wo jedoch Gämsen häufiger sind als Rehe, werden sie dem Luchs auch häufiger zur Beute. Der Vergleich zwischen den Schweizer Zentralalpen und dem Schweizer Jura macht dies deutlich. Im an Rehen reichen Jura machen diese 70 % der Beute aus, die Gämsen nur 21 %. In den Zentralalpen ist es nahezu umgekehrt. In beiden Gebieten spielen Hasen keine nennenswerte Rolle. (Daten aus „Der Luchs“ von Urs und Christine Breitenmoser-Würsten 2008, Salm Verlag)
Grafik: Karl Ronach
Noch in den 1970er-Jahren wurde behauptet, Luchse würden nur selbst erlegte Beute annehmen und Aas generell verschmähen. Das ist definitiv falsch. Um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, bedurfte es auch keiner wissenschaftlichen Untersuchungen. Schließlich hatten Jahrhunderte hindurch namhafte Autoren immer wieder berichtet, wie sie, beispielsweise in den Karpaten, Luderplätze beschicken ließen, um dort Luchse zu erbeuten.
HINWEIS!Mehr Verkehrsfallwild als Luchsrisse
In vielen Revieren ohne Luchsvorkommen sterben heute weit mehr Rehe durch den Verkehr und als Folge einer überhöhten Siedlungsdichte als in Luchsrevieren durch diese Katze!
Lebensweise
Luchse sind Einzelgänger mit großen Streifgebieten. Gelegentlich sind sie tag-, meist jedoch dämmerungs- und nachtaktiv. Die Streifgebiete männlicher und weiblicher Luchse können sich überlappen, daher gehen sich die Tiere meist aus dem Weg. Nur in der Paarungszeit suchen die Männchen (Kuder) paarungsbereite Weibchen (Katzen) auf. Nach der Kopulation gehen beide wieder getrennte Wege.
Der Schädel des Luchses (rechts) ist nur geringfügig größer als der einer Wildkatze (links). Das zeigt auch, wie unsinnig die häufig geäußerten Ängste sind, der Luchs könne selbst dem Menschen gefährlich werden.
Luchse markieren ihre Reviere mithilfe verschiedener Körperdrüsen, mit ihrem Urin sowie mit ihrem Kot. Die wohl häufigsten Markierungen erfolgen durch das Reiben ihrer Wangen (Wangendrüsen) an Bäumen und anderen festen Gegenständen. Größere Beute wird verscharrt (zugedeckt) und zusätzlich mit Urin markiert.
DAS AUS FÜR DEN LUCHS
Deutschland
In den deutschen Kleinstaaten verschwand der Luchs teilweise bereits in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Der offiziell letzte wurde 1888 in Oberbayern erlegt. Die Zahlen sind glaubwürdig, denn kein Jäger hatte damals Veranlassung, Abschuss oder Fang von „Raubwild“ zu verschweigen. Das Gegenteil war der Fall. Fast überall gab es dafür Prämien. Die Erleger wurden als Helden gefeiert. Das war so, weil man der Bevölkerung mit Schauergeschichten Angst gemacht hatte. So galt der Luchs als Bestie, als Würger, der selbst den Jäger vom Baum herunter anspringt und ihm die Kehle durchbeißt. Dem Luchs, aber auch Bär, Wolf, Steinadler und Bartgeier wurden höchstwahrscheinlich viele von Menschen begangene Verbrechen zugeordnet. Sein schlechter Ruf und die von ihm verursachte Angst der Menschen brachte den Erlegern einträgliche Gewinne. Sie zogen mit ihrer toten Beute von Dorf zu Dorf und von Haus zu Haus und kassierten, was ihnen eine dankbare Bevölkerung gab. Je rarer die Art wurde, je seltener ein Exemplar erlegt wurde, umso höher stieg der Erleger im Ansehen der Menschen und umso höher stand die tote Beute im Kurs.
Es waren die großen Waldgebirge, in denen sich der Luchs am längsten halten konnte. Sie waren am dünnsten besiedelt und kaum erschlossen. Zwar wurden bereits vor Ausrottung von Bär, Wolf und Luchs „verkehrsgünstig“ gelegene Wälder großflächig und radikal für Glasindustrie, Eisenverhüttung und Köhlerei niedergeschlagen, aber wo Bäche, Flüsse oder Talstraßen fehlten, waren zunächst auch weite Urwaldgebiete erhalten geblieben. Mit deren Erschließung, mit der Schaffung von Weideflächen und dem Bau von Gehöften ging es mit dem Luchs zu Ende.
Chronologie der Ausrottung im heutigen Deutschland
1743
letzter Luchs im Elbsandsteingebirge
1770
letzter Luchs im Schwarzwald
1774
letzter Luchs im Fichtelgebirge
1796
letzter Luchs im Thüringer Wald
1814
letzter Luchs in der Oberpfalz
1818
letzter Luchs im Harz
1834
letzter Luchs in Baden
1846
letzter Luchs im Bayerischen Wald
1846
letzter Luchs auf der Schwäbischen Alb
1850
letzter Luchs im Allgäu
1872
letzter Luchs in Oberbayern
Österreich
Auch hier überlebten die Luchse nicht signifikant länger als in Deutschland. 1872 wurde der letzte Luchs Tirols erlegt. 20 Jahre später war es für die Art auch in der Steiermark aus.
Schweiz
Hier war der Luchs um 1700 schon aus der flachen, gering bewaldeten und relativ stark besiedelten Nordschweiz verschwunden. Halten konnte er sich bis dahin in den Gebirgskantonen. Zwischen 1750 und 1800 verschwand er dann aus dem Jura, aus den südlichen Voralpen und aus den östlichen Alpen. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war er auch in den Zentralalpen bereits selten. Schalenwild gab es infolge der freien Jagd kaum noch. Der Waldanteil sank, und die landwirtschaftliche Nutzung, insbesondere die Beweidung der Hochlagen, nahm zu. Um 1900 war der Luchs auch in Graubünden und im Wallis nur noch sehr selten anzutreffen. Danach galt er als ausgestorben.
Italien
Im heutigen Italien fehlte dem Luchs schon früh die wichtigste Lebensvoraussetzung – ausreichend Beutetiere. Schalenwild gab es im 19. Jahrhundert – außer im Alpenraum – kaum noch. Die letzten Luchse südlich der Po-Ebene waren auf Schafe und Ziegen angewiesen. Das dürfte ihr Aussterben enorm beschleunigt haben.
Typischer Luchslebensraum in Friaul, das Val Resia. Der Luchs ist ein typischer Waldbewohner, der größere landwirtschaftliche Flächen meidet. Er jagt im Gebirge, aber auch oberhalb der Waldgrenze im Krummholz-Bereich. Dort sind „Lahner“ für Gams und Reh sehr attraktiv. Einerseits gute Einblicke und andererseits viel Deckung in Form von Rinnen und Felsen ermöglichen es ihm, sich der Beute relativ leicht zu nähern.
Im 19. Jahrhundert starben auch in den italienischen Alpen die letzten Luchse. 1830 in den Zentralalpen, nördlich von Sandrino in der Lombardei. 1837 in den Dolomiten, nahe der Gemeinde San Stefano di Cadore in der Provinz Belluno. Kurz vor Beginn des Ersten Weltkrieges, 1909, erwischte es schließlich den wirklich allerletzten Luchs in den Südwest-Alpen, bei Valdieri in Piemont. Alle drei wurden in Tellereisen gefangen und in diesen erschossen.
Slowenien
Im heutigen Slowenien war der Luchs in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bereits selten. Doch ob jeder einzelne irgendwo geschossene oder gefangene Luchs auch registriert wurde, wissen wir nicht. 1869 schrieb Fran Ergavec, dass der Luchs in Notranjska ständig anwesend sei. Dies wird mit einem Landtagsbeschluss untermauert, wonach fortan für jeden toten Luchskuder eine Prämie von 20 und für jede Luchskatze eine von 25 Golddukaten bezahlt werden sollte. Diese Prämie wurde erst 1909 durch Verlautbarung abgeschafft. Verbrieft ist, dass 1896 bei Logatec noch zwei Luchse geschossen wurden sowie 1900, 1905 und 1908 je ein Luchs in der Štajerska. Floericke berichtet, dass 1887 sowohl bei Slovenj Gradec als auch bei Völkermarkt, im heutigen Kärnten, Luchse gespürt wurden.
Gregori schrieb, dass zwischen 1874 und 1908 noch 26 Luchse erlegt worden seien. In Gorenjska wurde der letzte schon 1848 auf dem Sedlu Belca, also auf der heutigen Grenze zwischen Slowenien und Österreich erlegt. In Notranjska soll der letzte Luchs 1882 und in Dolenjskem 1888 den Schroten zum Opfer gefallen sein. Darüber, ob der allerletzte 1908 in der damaligen Untersteiermark oder doch erst 1913 auf der Pohorje endete, gibt es widersprüchliche Aussagen. Jonozovič nennt das Jahr 1908, Gregori hingegen 1913.
Unbestritten ist, dass der Luchs in Slowenien innerhalb eines halben Jahrhunderts ausstarb. Dass es damals wie heute Fanatiker gab, die auch noch ausrotten wollten, als es schon nichts mehr auszurotten gab, zeigt ein Bericht von Hanslovsky von 1921. Er schrieb:
„Ta huda roparica je pri nas že iztrebljena, le pav redko še natale nanj v Gorjancih in Koroškem pogorju.“ (Das teuflische Raubtier ist bei uns ausgestorben, nur selten noch begegnen wir ihm im Raum Gorenjska und Koroška.)
Auch in den südlichen Nachbarländern Kroatien und Bosnien-Herzegowina waren die Luchsvorkommen zu Beginn des 20. Jahrhunderts erloschen. Für Kroatien geben Cop und Frkovic das Jahr 1903 an und für Bosnien-Herzegowina 1911. Dass es in diesen für mitteleuropäische Verhältnisse riesig zu nennenden Waldgebieten überhaupt möglich war, den Luchs in relativ kurzer Zeit auszurotten, verwundert. Es dürfte – wenn es denn so war – vor allem dem Einsatz von Fallen und von Gift zu „verdanken“ sein.
1935 bis 1940 sollen im gesamten Süden der Republik Jugoslawien nicht mehr als 15 bis 20 Luchse gelebt haben. Danach scheint es zu einer Erholung gekommen zu sein. Fengewitsch gibt für 1963 einen Bestand von 80 Luchsen auf jugoslawischer Seite und von 100 auf albanischer Seite an. Mirič schätzte neun Jahre später auf beiden Seiten der Grenze einen Bestand von 280 Luchsen. Breitenmoser vermisst für diese Daten allerdings jede objektive Grundlage. Er befürchtet ein Aussterben des Balkanluchses.
Nur im Grenzgebiet der Teilrepublik Montenegro und dem Nachbarland Albanien konnte sich eine kleine, weitgehend isolierte Population des Balkanluchses (Lynx lynx balcanicus) halten, ebenso in der Teilrepublik Mazedonien. Bei ihm handelt es sich um eine Unterart des Europäischen Luchses (Lynx lynx lynx).
ROTTET DER LUCHS DIE REHE AUS?
Wäre der Luchs in der Lage, die Rehe auszurotten, dann gäbe es diese seit Millionen Jahren nicht mehr. Schließlich hatten die Rehe durch Jahrmillionen neben Luchs und Wolf auch noch viele andere „Feinde“. Die Angst mancher Jäger und durchaus auch Naturfreunde, der Luchs könne die Rehe ausrotten und andere Schalenwildarten stark dezimieren, besteht – ungeachtet jeder Logik – immer noch. Allerdings steigt die Zahl jener Jäger, die im Luchs nicht mehr und nicht weniger als ein Tier sehen, das viele Millionen Jahre von und mit den Rehen und anderen Beutetieren lebte, ohne sie in Bedrängnis zu bringen oder gar auszurotten. Wäre dies auch nur einem der großen Beutegreifer gelungen, gäbe es uns Menschen mit Sicherheit schon lange, lange nicht mehr! Der Mensch hatte eine Unzahl großer, ihm weit überlegener Feinde.
Bleiben wir beim Luchs. Es ist ja schon ein wenig mutig, ihn dem „Großraubwild“ zuzuordnen. Er ist schlicht eine relativ kleine Katze, zwar deutlich größer und schwerer als die Wildkatze, erreicht aber eher selten ein Gewicht von 25 Kilogramm oder gar mehr. Wildschweine erreichen das mehrfache Gewicht und sind in bestimmten Situationen für den Menschen tatsächlich gefährlich.