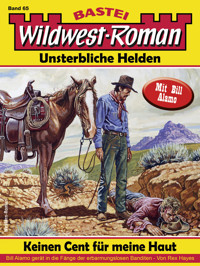1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Wildwest-Roman – Unsterbliche Helden
- Sprache: Deutsch
In einer Postkutsche fängt die Sache an, bei der Bill Alamo Kopf und Kragen riskiert: William Hurst, ein Revolvermann, wird von Banditen erschossen. Und Marshall Hang Morgan versucht, Bill Alamo die Schuld daran zu geben. Zwischen ihm und dem Texas-Ranger ist eine Rivalität, die eines Tages nur mit Gewalt beendet werden kann. Dabei wäre Bill froh, wenn Morgan ihn in Ruhe ließe. Denn auch so hat er noch genug zu tun. Trotzdem sucht er den Mann, der für den Terror im County verantwortlich ist. Nicht weniger ist er daran interessiert, den Schützen dingfest zu machen, der ihn erschießen wollte ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
Wer ihm in die Quere kommt
Vorschau
Hat Ihnen diese Ausgabe gefallen?
Impressum
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsbeginn
Impressum
Wer ihm in die Quere kommt
Von Rex Hayes
Die schwere Concord-Kutsche der Wells-Fargo erreicht die Passhöhe. Vor meinen Augen senkt sich die alte Poststraße in steilen Windungen zum Tal des Rio Brasso hinab.
Ich halte mich an den Eisengriffen des Kutschbocks fest, mache die Augen zu und verfluche Jim McNelty, den Captain des Grenzbataillons der Texas-Ranger, der mir als mein Vorgesetzter befohlen hat, mich diesem rumpelnden, schaukelnden Ungetüm auszuliefern.
Wie schön wäre es jetzt, in Shadows Sattel zu sitzen. Aber Jim meinte, der Rapphengst würde zu sehr auffallen, ich sollte mich lieber mal eine Weile auf andere Weise durch das Land bewegen. Und deshalb sitze ich heute hier auf dem Bock der »hölzernen Betsy«, welche die Route zwischen Holmes City und Blazerville befährt ...
Der Fahrer stößt einen schrillen Schrei aus, der meine Trommelfelle strapaziert, und lässt die sechs Maultiere talwärts rasen. Ich sehe uns unten schon irgendwo zerschellen, als die schwere Kutsche in voller Fahrt in die Haarnadelkurven hineinschießt und sie mehrfach auf zwei Rädern nimmt.
Eine scharfe Linkskehre fliegt auf uns zu, und ich sehe das erste Gespann in unvermindertem Tempo hineingehen. Die Kutsche legt sich schwer auf die Seite.
Mein Hemd ist am Rücken längst nass von kaltem Schweiß, und mein Haar sträubt sich unter meinem alten Stetson. Aber irgendwie kommen wir doch heil um die Kurve, und dann wird die Straße flach und läuft in die Furt am Flussufer aus.
»Fünf Minuten Aufenthalt! Damen nach rechts, Herren nach links, bitte!«, ruft der Fahrer grinsend und bringt das schwere Gefährt zum Stehen. Meine Knie zittern mächtig, während ich absteige.
Natürlich haben wir keine Damen an Bord. Ein dicker Futtermittelreisender aus Boston, der die Kavallerieposten entlang der Grenze abklappern will, ein zerknittert aussehender Mann in Weidekleidung und ein großer, hart aussehender Mensch mit einem tiefgeschnallten Colt auf dem linken Oberschenkel sind meine Mitreisenden.
Der Futtermittelonkel nimmt seinen grauen Seidenhut ab und wischt sich die Schweißtropfen von der spiegelblanken Glatze, während der alte Rindermann sich dem Inhalt einer gebauchten Flasche widmet, die er aus seinem Rock hervorgezaubert hat. Der Kerl mit dem Colt macht einen unruhigen Eindruck. Er geht nervös auf und ab, und seine schmalen, kühlen Augen sind ständig auf der Wanderschaft. Endlich wendet er sich an den Kutscher, der seine Maultiere im seichten Wasser saufen lässt.
»Wie weit ist es noch bis Blazerville?«
Der Kutscher säbelt einen mächtigen Brocken von einer Platte gepressten Tabaks herunter.
»Noch zwei Stunden, falls kein Rad bricht oder ein Tier zu lahmen beginnt.«
»Zum Teufel mit Ihnen!«, flucht der Mann wütend. »Warum sagen Sie nicht gleich dazu, falls Ihre verdammte Fuhre nicht gestoppt wird?«
»Auch möglich.« Der Fahrer zuckt gleichmütig mit den Schultern und spuckt braunen Tabaksaft in das Wasser des Rio Brasso. »Kutschenüberfälle sind ein lohnender Erwerbszweig für manchen Burschen, der nichts anderes gelernt hat, als mit einer Knarre umzugehen.«
Der Mann mit dem tiefhängenden Revolver wendet sich mir zu. Wahrscheinlich entdeckt er eine Ähnlichkeit mit sich, weil ich zwei Revolver trage und sicherlich nicht wie ein blutiger Anfänger aussehe.
»Ich heiße William Hurst. Und Sie?«
»Bill Andersson«, sage ich schnell. Dabei weiß ich selbst nicht, was mich daran hindert, meinen richtigen Namen zu nennen. Ich trage keinen Stern und nichts, was auf meinen wahren Beruf als Ranger hinweist, und auch der Name Alamo dürfte im Tal des Rio Brasso bisher kaum bekannt sein.
Hurst lächelt säuerlich. »Schwede?«
»Einer meiner Vorfahren soll mal dort gelebt haben«, erwidere ich. »Das ist aber schon sehr lange her.«
Hurst nickt. »Man sieht es Ihren Haaren und Augen an.«
Plötzlich nimmt er meinen Arm und zieht mich auf die Seite: »Andersson, was würden Sie tun, wenn wir gestoppt würden?«
»Was denn?« Ich streife seine Hand ab. »Sie rechnen doch nicht mit einem Überfall, oder?«
»Doch, das tue ich!« Schweißtröpfchen stehen auf Hursts Stirn.
Ich erkenne, dass dieser Mann Angst hat, und nicke.
»Wie würden Sie sich verhalten, Andersson?«, fragt er drängend.
Ich zucke mit den Schultern. »Das käme auf die Umstände an. Wenn die Kutsche Gold an Bord hätte, würde ich keinen Finger rühren. Das Gold wäre versichert, und ich habe keine Lust, mich für das Geld anderer Leute erschießen zu lassen.«
Dann versuche ich, in Hursts Augen zu lesen. Letztere sind schmal und unpersönlich. Sicherlich haben sie schon eine Menge Blut und Tod gesehen. Jetzt aber flackern sie unruhig.
Was beunruhigt diesen Mann? Vor was hat er Angst?
Er scheint etwas von meinen Gedanken zu erraten, denn plötzlich straffen sich seine Schultern. Ein flüchtiges Lächeln erscheint auf seinem mageren Gesicht, in dem ein raues Leben seine Spuren hinterlassen hat.
»Ach, zum Teufel, ich rede Unsinn. Vergessen Sie es.«
Der Fahrer knallt mit seiner Peitsche. »Einsteigen, Herrschaften, wenn Sie zum Dinner in Blazerville sein wollen!«
Hurst nickt mir zu und besteigt den Wagen. Er sieht jetzt ruhig und gelassen aus.
Ich nehme meinen alten Platz neben dem Fahrer ein, und dann setzt sich die Kutsche in Bewegung und durchquert die Furt des Rio Brasso. Das braune Wasser reicht den Maultieren bis zum Bauch und überspült die Radnaben, aber wir kommen glücklich hinüber und wieder auf die Poststraße.
Nach zwei oder drei Meilen verändert sich die Landschaft. Die Vegetationszone des Flusstals bleibt zurück, und braune, sandige Hügel mit spärlichem, verdorrtem Graswuchs schieben sich heran. Noch später geraten wir in eine Region kahler Felsen, die sich in den bleifarbenen Himmel erheben.
Und hier, in dieser kahlen Felswildnis, geschieht es.
Der Weg steigt an, die sechs Maultiere fallen in Schritt. Dann geht es um eine Kurve. Das erste Paar des Sechsergespanns hat sie gerade erreicht, als ein Schuss fällt.
Die Kugel zischt an meinem Gesicht vorbei, und ich sehe, wie der Kutscher sich duckt. Augenblicklich erkenne ich, dass dies ein Warnschuss gewesen ist. Wir beide bilden hier oben auf dem Bock der Kutsche ein so prächtiges Ziel, dass kein Schütze es verfehlen kann, wenn er es nur treffen will.
Dem Schuss folgt eine kurze bleierne Stille, dann erreicht eine harte Stimme unsere Ohren: »Halt, Gents! Lasst die Finger von euren Schießeisen!«
Der Kutscher wirft mir nun einen klagenden Blick zu und zieht die Zügel an. Er hat noch keine Lust, in der Blüte seiner Jahre zu sterben. Und ich auch nicht, ehrlich gesagt. Darum schnellen meine Hände in die Höhe.
Zwei Reiter brechen kurz darauf hinter einer Kehre hervor und postieren sich neben den Vorderpferden. Die Colts in ihren Händen sind auf den Fahrer und mich gerichtet. Halstücher, bis über die Nasen heraufgezogen, machen ihre Gesichter unkenntlich, und weite, helle Staubmäntel verhüllen ihre Figuren.
Eine dumpfe Stimme mahnt: »Keine Tricks, ihr beiden, oder ihr werdet es bereuen!«
Wieder kommt die kalte Stimme hinter den Felsen hervor: »Abschnallen, Jungs!«
Wir gehorchen. Meine Hoffnungen schwinden, als meine Colts in den Staub fallen.
Jetzt teilen sich die Ocotillobüsche neben der Fahrbahn, und ein dritter Reiter erscheint auf dem Plan, ebenso vermummt wie seine Partner. Er reitet einen hübschen, lohfarbenen Palomino. In seiner Armbeuge liegt ein achtschüssiger Spencer-Repetierer.
Er reitet bis auf zehn Meter an die Kutsche heran und hält dann an.
»Hurst! Wer ist Hurst?«
Meine Gedanken überschlagen sich. Also Hurst gilt dieser Überfall. Und er hat es vorausgesehen.
Die eisige Stimme befiehlt: »Aussteigen, Hurst! Oder wollen Sie, dass wir Sie herausholen?«
Ich kann mir gut vorstellen, wie William Hurst jetzt zumute sein muss. Kein Mensch rennt gern offenen Auges in sein Unglück. Trotzdem zeigt er Mut. Der Kutschenschlag öffnet sich nun, und er springt heraus.
»Hier bin ich. Was wollen Sie?«
Hursts Gesicht ist blass, aber er sieht gefasst aus. Wie einer, der weiß, wann es ans Sterben geht.
Und ich sitze hier, muss die Hände über den Kopf halten und kann nichts tun.
Jetzt dreht Hurst den Kopf mir zu. Unsere Blicke kreuzen sich. Er nickt und lächelt leise.
»Andersson, denken Sie an mich, wenn Sie nach Blazerville kommen.«
»Hurst, Sie sollten jetzt besser an sich selber denken!«, ruft der vermummte Reiter.
Langsam geht Hurst auf den Reiter zu.
»Warum wollen Sie mir keine faire Chance geben?«
Der Reiter lacht.
»Hurst, Sie verdammter Narr, warum mussten Sie unbedingt nach Blazerville kommen?«
Hurst geht ruhig weiter. Die Entfernung zwischen ihm und seinem vermummten Gegner verkürzt sich rasch.
Noch fünf Meter ...
Die Spencer im Arm des Reiters brüllt plötzlich auf und speit Feuer und eine weiße Rauchwolke aus.
Hurst wird zurückgestoßen. Er dreht sich einmal halb um sich selbst und stürzt dann steif zu Boden.
Der Reiter zieht sein Pferd herum und treibt es auf die Ocotillos zu.
»Erledigt, Jungs!«
Schon schlagen die Büsche hinter ihm zusammen.
Die beiden anderen Banditen feuern ihre Colts zweimal über die Köpfe der scheuenden Maultiere ab.
Der Fahrer und ich haben alle Hände voll zu tun, die Tiere wieder zu beruhigen. Als es uns endlich gelungen ist, sind die Reiter verschwunden.
Ich springe übers Vorderrad auf den Boden und greife nach meinen Revolvern. Aber da ist niemand mehr, der uns bedroht.
Fern hinter den Felsen verhallt knatternder Hufschlag.
Ich laufe zu Hurst, knie nieder und drehe ihn auf den Rücken.
Der Fahrer kommt von seinen Gespannen herübergelaufen. Hinter ihm sehe ich die erschrockenen Gesichter des alten Züchters und des dicken Futtermittelreisenden.
»Was ist los mit ihm?«
Ich drücke Hursts Augen zu. »Durchs Herz geschossen. Tot.«
»Hol's der Teufel, das war glatter Mord!«, schimpft der alte Rindermann.
»Wer immer das getan hat, er gehört an den Galgen!«
»Helft mir, ihn in den Wagen zu bringen«, sage ich, Hurst unter den Achseln fassend. Dabei höre ich das Rascheln von Papier in seiner Brusttasche.
Während wir den Toten auf eine Bank betten, gelingt es mir, mit spitzen Fingern in seine Brusttasche zu greifen. Es ist tatsächlich ein Brief, klein zusammengefaltet und schon etwas schmutzig vom vielen Lesen. Ich lasse ihn in meiner Rocktasche verschwinden und klettere wieder nach draußen.
»Gentlemen, wir müssen weiter! Wir haben schon eine halbe Stunde Verspätung!«, drängt der Fahrer.
»Eine Sekunde noch.« Mir ist ein neuer Gedanke gekommen.
Hurst ist mit einem Gewehr erschossen worden. Männer hier im Westen ziehen jedoch meistens den Revolver vor. Vor allem, wenn auf so kurze Distanz geschossen wird, wie es hier der Fall war.
Der Mann, der Hurst ermordet hat, war ein Gewehrschütze, und das ist schon der erste Ansatz einer Spur. Ich muss einen Mann suchen, der lieber ein Gewehr benutzt als einen Colt.
Ich dringe in die Ocotillos ein und finde die Stelle, an der sein Pferd gehalten hat. Von hier aus hat er den ersten Schuss auf uns abgegeben. Um Hurst zu töten, musste er repetieren. Also muss die leere Hülse hier irgendwo zu finden sein.
Ich rutsche auf den Knien durchs Unterholz, und dann entdecke ich ein gelbliches Flimmern im verdorrten Gras. Gleich darauf halte ich die Messinghülse der abgefeuerten Patrone in der Hand.
Hurst ist nicht mit dem hier draußen üblichen .44er-Kaliber getötet worden, sondern von einer viel kleineren Kugel, einer .30/30, dem Kaliber, das lange Jahre hindurch von der Unionskavallerie geführt wurde.
Der Fahrer erwartet mich mit mürrischem Gesicht.
»Verdammt, wo bleiben Sie so lange? Ich werde heilfroh sein, wenn ich diese verwünschte Fuhre endlich in Blazerville abgeladen habe.«
Ich schwinge mich auf den Bock, und er löst die Fußbremse und lässt die Maultiere laufen. Erst als wir die Felsregion hinter uns haben, mäßigt er das Tempo und dreht mir sein immer noch blasses Gesicht zu.
»Das war knapp eben. Ich dachte schon, diese Verbrecher würden uns auch durchlöchern.«
»Kommen Überfälle in dieser Gegend öfters vor?«, frage ich.
»Das letzte Mal vor beinahe zehn Jahren.« Er grinst säuerlich. »Harry Davis wird Feuer spucken, wenn er davon erfährt.«
»Wer ist Davis?«
»Der Sheriff des Brasso Countys. Er hat in Blazerville seinen Sitz. Aber für die Stadt ist Marshal Hank Morgan zuständig.«
»Da ist also eine ganze Menge Gesetz in Blazerville«, stelle ich fest.
Der Fahrer schüttelt den Kopf und spuckt in den Staub.
»Nicht genug, um diesen Mord zu verhindern.« Er deutet mit dem Daumen über die Schultern. »Dieser Mann da hinten. Ich meine Hurst. Er hat gewusst, was ihn erwartet. Schon bei der Abfahrt in Holmes City war er so unruhig.«
»Ja«, sage ich, »er hat es gewusst. Und er ist trotzdem gekommen. Er ist mit offenen Augen in sein Unglück gerannt. Und dabei sah er nicht wie ein frommer Pilger aus. Ich möchte darauf schwören, dass er schon eine Menge Pulverdampf gerochen hatte.«
»Sie haben recht«, bestätigt der Kutscher. »Er trug seinen Colt wie einer, der auch mit ihm umgehen kann. Im Ziehen war er sicherlich nicht so leicht zu schlagen. Deshalb hat man ihm auch keine Chance gelassen.«
Ich nicke aufmerksam.
Nachdenklich den Kopf schüttelnd, fährt er fort: »Da muss etwas sein, was ihn nach Blazerville gezogen hat. Was es war, werden wir vermutlich nie herausfinden.«
Ich bin da anderer Meinung, wenn ich an den Brief in meiner Rocktasche denke.
Ich rechne damit, dass ich in ihm den Grund finden werde, warum William Hurst nach Blazerville kommen wollte, obwohl er ahnte, dass man versuchen würde, ihn abzufangen.
Auf einer Anhöhe deutet der Fahrer durch die von den Maultieren aufgewirbelten Staubwolken nach vorne.
»Blazerville, Ihr Ziel. Dort werde ich abgelöst.« Er seufzt. »Ich fahre gern und kenne diese Route wie meine Westentasche. Aber wenn die Überfälle wieder beginnen, hänge ich diesen Job an den Nagel und werde Viehtreiber irgendwo draußen in der Ebene. Ich habe keine Lust, mich eines Tages vom Bock schießen zu lassen.«
Das kann ich gut verstehen. Schließlich stirbt kein Mensch gern. Zumindest nicht, wenn er noch nicht die Hälfte der Achtzig hinter sich hat.
Wir biegen in die lange, staubige Main Street von Blazerville ein und halten vor dem Stage-Depot an. Männer drängen sich auf den hölzernen Gehsteigen, wie immer, wenn eine Kutsche von draußen hereinkommt und Neuigkeiten mitbringt. Doch auch die bunten Kleider einiger Frauen leuchten zwischen den rauen Männertrachten.
»Warum so spät, Sam?«, fragt ein Mann in einer grauen Weste, der sich durch die Menge drängt. Es ist der Posthalter. Er hält eine dicke Messinguhr in der Hand und vergleicht die Zeit. Im Hintergrund werden neue Gespanne herangeführt, und auch die Ablösung für unseren Kutscher steht schon bereit. Von Blazerville aus führt die Linie der Wells & Fargo-Company weiter nach Fort Brooks und Dallas.
Der Fahrer schaut nachdenklich drein, ohne aber ein Wort zu sagen.
»Zum Teufel, du hast unseren ganzen Fahrplan durcheinandergebracht, Sam«, fährt der Wells-Fargo-Agent fort.
Der Kutscher klettert nun vom Bock und verzieht mürrisch das Gesicht.
»Ist Sheriff Davis hier?«
»Hier bin ich. Was gibt's?«
Ein drahtig aussehender, grauhaariger Mann, nicht größer als ein Meter sechzig, schiebt sich durch die Menge.
Er trägt hohe Stiefel, die Hose in die Schäfte gestopft, ein weißes Hemd, dazu eine schwarze Weste und einen runden, ebenfalls schwarzen Stetson. Der Stern eines County-Sheriffs glänzt auf seiner Brust. An seiner Hüfte hängt ein schwerer Revolver der Marke »Leech & Rigdon Rebell«, eine jener ausgezeichneten, wenn auch veralteten Waffen, die während des Bürgerkrieges von Leech & Rigdon in den Südstaaten hergestellt wurden.
»Was ist los, Sam?«, fragt Davis, sich mit den Armen einen Weg durch die Menge bahnend, welche die Kutsche umsteht.
»Überfall am Calumet-Rock«, erklärt der Fahrer knapp. »Wir wurden gestoppt. Ein Passagier ist erschossen worden. Wenn du mich fragst, Harry: Es war der gemeinste Mord, den ich je gesehen habe.«
Davis ist betroffen. »Was sagst du da? Das kann doch nicht wahr sein!«
»Es ist wahr, Sheriff«, werfe ich ein und deute auf die beiden anderen Männer, die aus dem Wagen gekrochen sind, froh, die Nachbarschaft des Toten los zu sein. »Wir alle waren Zeugen des Überfalls.«
Davis furcht die Stirn. »Ich denke, dass ich Sie noch für das Protokoll brauche. Wie heißt der Erschossene, Sam?«
»William Hurst, wenn ich ihn richtig verstanden habe.«
Bevor Davis etwas erwidern oder eine Anordnung treffen kann, ertönt im Hintergrund der erschreckte Schrei einer Frau: »William? Oh, du mein Himmel!«
Langsam drehe ich mich auf den Absätzen um und fasse die Frau ins Auge, der sich jetzt alle Köpfe zuwenden.
Sie ist nur mittelgroß, schlank, aber fest gebaut. Kupferfarbenes Haar umrahmt ihr Gesicht, das nicht eigentlich schön zu nennen ist, aber doch seine Wirkung auf Männer nicht verfehlt. Die großen Augen leuchten smaragdgrün unter dunklen, geschwungenen Wimpern, der Mund ist schmal und energisch.
Die Frau trägt eine fransenbesetzte Buckskin-Bluse, einen Hosenrock und hohe Stiefel, dazu einen kleinen, grauen Sombrero. Das ist genau die Kleidung, die von den Frauen der Züchter in der Ebene bevorzugt wird, wenn sie viel unterwegs sind. Auch die Farbe ihres Gesichts verrät, dass sie sich viel im Freien aufhält. Es ist sonnenbraun und zeigt nicht die eigenartige Blässe der Rothaarigen. Jetzt allerdings ist es erblasst, und Tränen schimmern in den großen Augen.
»William ... das kann doch nicht möglich sein!«, ruft sie.
»Mrs. Brand, kannten Sie diesen Mann?«, fragt Sheriff Davis scharf, sich an sie wendend.