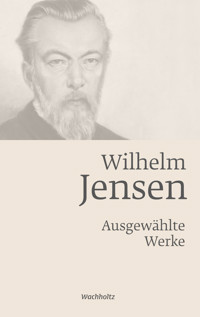
Wilhelm Jensen. Ausgewählte Werke. E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wachholtz Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Der in Schleswig-Holstein geborene Wilhelm Jensen zählte im späteren 19. Jahrhundert zu den berühmten und vielgelesenen deutschen Autoren. Sein umfangreiches Werk wird hier erstmals in einer Auswahl vorgestellt. Die präsentierten Texte sind fantasievoll erzählt, stellen zwischenmenschliche Konflikte ins Zentrum und weisen plastische Naturschilderungen auf – von der idyllischen Bergeinsamkeit bis zu den rauen Meergewalten. Oft ist die Stimmung gefärbt von einer herben Melancholie, und die Texte sind durchzogen von einem starken Zweifel am christlich-religiösen Glauben. Das vorliegende Buch holt den weitgehend vergessenen Berufsschriftsteller wieder zurück ins Gedächtnis, indem es ihn aus verschiedenen Richtungen beleuchtet: Eine Auswahl von Gedichten, Erzählungen, Aufsätzen, Prosaskizzen und bisher unveröffentlichten Briefen lädt dazu ein, einen Berufsschriftsteller wiederzuentdecken, der die Literatur seiner Zeit nicht nur bediente, sondern auch mitprägte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 901
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wilhelm Jensen
Ausgewählte Werke
Herausgegeben von
Felix Schallenberg
INHALTSVERZEICHNIS
Gedichte
Erzählungen
Die braune Erica
Unter der Linde
Der Oleanderschwärmer
Iris und Genziane
Gradiva. Ein pompejanisches Phantasiestück
Aufsätze, kleine Prosa, Briefe
Vom Schreibtisch und aus dem Atelier
Aus meinen Kriegsjahren
Heimat-Erinnerungen I – Emanuel Geibel
Heimat-Erinnerungen II – Theodor Storm
Heimat-Erinnerungen III – Klaus Groth
Wilhelm Raabe. Zum 8. September 1901
Heinrich Heine und Herr Eduard Grisebach
Eine falsche Humanität unserer Zeit
Ein Weckruf
Über Schneefall, Erstlinge u.s.w.
Vom Wegrand. Kleine Bilder
Atra cura
Der Falter
Die Frau
Die Toten
Eine Korrespondenz aus dem Leben
Vor der Gartentür
Briefkorrespondenz Wilhelm und Marie Jensen – Ida Boy-Ed
Editorische Notiz
Kommentar
Nachwort
Anmerkungen
Gedichte
Leben (Ein Brief)
Das Leben ist, o Freund, ein seltsam Ding.
Ob man es wertvoll achtet, ob gering,
Du musst, um dir es richtig abzuschätzen,
Vorerst mit ihm dich auseinandersetzen.
Was ist's? Ein Traum nur? Dafür deucht's zu lang,
Und zu viel wache Stunden bringt sein Gang.
Ist's nur ein Nebeltag, auf dessen Schluss
Man gähnend wartet? Grauer Regenguss
Und Wolkentrübsal? Manchmal hat's den Schein,
Doch fällt zu heller Sonnenglanz hinein.
Ist's herbe Pflicht und Zwangsnotwendigkeit?
Nur wollen brauchten wir und wär'n befreit.
Ist's eitel Narretei und Possenspiel?
Gewiss, der Narrenpossen gibt es viel:
Der Staatsmann spricht: Der Mensch lebt für den Staat;
Der General: Der Mensch sei nur Soldat;
Der Pastor redet ernst: Der Mensch ist Christ;
Sein Höchstes ist das Recht, spricht der Jurist;
Der Forscher zuckt ob dem die Achsel nur,
Der nicht mitnützt zur Kenntnis der Natur;
Der Menschheit Köstlichstes, ruft der Geschichte
Beflissener, sind vergang'ner Zeit Berichte;
Nein, heißt der Philolog sie lehrreich schweigen:
Des Lebens Zweck ist, aus der Sprache Zweigen
Die Einheit ihrer Wurzel aufzuzeigen.
Doch alle dünken, trotz den wichtigen Mienen,
Mir Kärrner nur, die einer Königin dienen.
Sie alle predigen laut uns, was wir sollen;
Doch in uns mahnt die Herrin uns, zu wollen,
Und lächelt allem, was da gräbt und strebt:
Was ihr mit Mühsal ineinander webt,
Hat nur den Zweck, damit das Leben lebt!
Das ist nach meiner Wenigkeit Ermessen
Die einzige Kleinigkeit, die sie vergessen.
Sie schmieden rastlos Werkzeug, sich zu nützen,
Und Waffen, um ihr Dasein sich zu schützen,
Doch über diesem Arbeitstun vergisst,
Verlernt ein jeder, was das Leben ist.
Er nährt sich für erneute Arbeitskraft,
Dass Geld und Rang und Würden er errafft –
Wozu? Des Lebens Mittel ward ihm Zweck –
Er weiß es nicht, und ihn befällt's mit Schreck,
Wenn einer fragt, für was dies Mittel sei.
Ihm ist das Höchste seine Plackerei;
In ihr sieht stumpf er Tag um Tag verrinnen,
Mit jedem Morgen neu sie zu beginnen.
Sein Leben sickert hin, man scharrt ihn ein,
Er war und wusste nichts von seinem Sein.
Er spielte mit in einem Schauspielstück,
Das schönen Namen trug: ›Der Weg zum Glück‹;
Der Vorhang fällt, nach Hause ziehn die Leute,
Und keiner ahnte, was das Stück bedeute.
Das nennt, mein Freund, sich ›die reale Welt‹,
In die durch Zwangspaß wir hineingestellt.
Gleich allen müssen wir uns mit ihr fügen,
Um unsrer Lebensnotdurft zu genügen:
Wir müssen auch am Werkelstuhl uns messen,
Damit wir nicht durch andrer Arbeit essen,
Uns mit zum Besten der Gesamtheit plagen,
Nach Fug mit ihr die gleichen Lasten tragen –
Dann aber, nach dem Werktag, sind vorbei
Die Gleichheit und die Last, und wir sind frei.
Und frei sind wir, von heitrem Licht umhellt,
In einer andern, ›idealen Welt‹,
In einer Welt, von Duft und Glanz umgeben,
Die nur den einen Zweck besitzt: zu leben!
Und Schatten gleich sinkt ab von ihrem Strand
Des Werkeltags Verdienst, Betrieb und Stand.
Nur Genien mit himmelslichten Flügeln
Empfangen uns auf ewigen Sonnenhügeln:
Es herrscht in ihrem Tempeldomgebäude
Die Liebe nur, die Schönheit und die Freude –
Des Geistes Flug, hoch über niederen Breiten,
Gedanken, die auf Sternenbahnen schreiten –
Der Hoffnung selig klopfendes Empfinden,
Des Glückes süß erfüllendes Umwinden,
Und als das Höchste, stets doch ungestillt,
Die Sehnsucht nach des Herzens Götterbild.
Ich fühl's, das einzig ist's, wofür gegeben
Das Leben uns, und das allein heißt leben.
----------
Frühlingswind
Die Augen geschlossen,
Tief atmend mit lechzendem Mund –
Umrauscht und umflossen
Wie von wiegender Welle –
Umwirbelt, umflüstert
Wie von Kindergespielen –
Umstreift und umringelt
Wie von weichem, flatterndem Haar
Erster, selig törichter Jugendliebe – –
In zerspringend sich dehnende Brust,
Hinein in jeden Tropfen des Blutes,
Bis in die Seele schauernd
Über die Berge braust
Der Frühlingswind.
Ich möcht' auf Flügeln
Mit ihm stürmen,
Ihn niederringen
Wie einen Todfeind,
Mich um ihn schlingen,
Wie um den wiedergefundenen Freund –
In unendliche Weite davon,
Und ruhen am sonnigen Rain,
Von seinem Hauch überrieselt,
Schlafend, träumend,
Gedenkend, vergessend,
Alles zugleich –
Lachen, jubeln, weinen,
Über unermessliches Glück,
Über unsagbares Weh.
----------
Herbstdämmerung
Ein trübes Dämmerlicht beginnt,
Die Hand hält an vom Schreiben;
Mit Blättern draußen jagt der Wind,
Und Regen klirrt an die Scheiben.
So saß ich einstmals auch als Kind
Und sah die Blätter treiben –
Mir ist, als ob es die gleichen sind –
Und Regen schlug an die Scheiben.
Es treibt sein ewiges Spiel der Wind;
Wie lang' werd' ich noch bleiben?
Der Pendel tickt, die Stunde rinnt,
Und Regen klirrt an die Scheiben.
----------
Winteranfang
Die Wolken treiben dunkel und schwer,
Ein letztes Verdämmern, und bald nichts mehr.
Ich schreit' im herbstlichen Feld einher,
Ein letztes Verwelken, und bald nichts mehr.
Die Welt ist einsam, die Zukunft leer,
Ein letztes Gedenken, und bald nichts mehr.
Ein Stein, wo ein Herz geschlagen, umher
Verwilderndes Unkraut, und dann nichts mehr.
----------
Vogelflug
Die Welt lag jung im Sonnenschein,
Wir saßen zusammen am Ufergestein,
Gar treue Genossen –
Die Möwen schossen
Vorüber mit rauschendem Flügelschlag –
Deute den Flug, wer zu deuten vermag.
Auf Glück und Liebe, Ruhm und Ehr',
Es deutete jeder des Herzens Begehr
Nach seiner Weise,
Laut oder leise,
Und harrt' entgegen dem bringenden Tag –
Harre des Tags, wer zu harren vermag.
Was habt ihr gewonnen, was habt ihr erdacht?
Wohin euch der rauschende Flügel gebracht?
Die Welt ward älter,
Die Sonne wird kälter,
Zur Abendruh' neigt sich der mühvolle Tag –
Ruhe mit ihm, wer zu ruhen vermag.
----------
Es war ein Tag im jungen Mai
Es war ein Tag im jungen Mai, am weißen Strande saßen
wir,
Und träumerisch mit stummem Blick die Abendfernen
maßen wir;
Die Sterne zogen langsam auf, die Augen irrten mählich ab
Und fanden sich und hielten sich, und Welt und Stern
vergaßen wir.
----------
Gutnacht
Nun leg' dich um und schlafe,
Mein Kind, schlaf' ruhig aus!
Der Schäfer treibt die Schafe
Nun ohne dich nach Haus;
Du kommst nicht mehr zur Schule
Zu spät im grauen Licht,
Und vom Kathederstuhle
Droht dir kein streng Gesicht.
Deck mit dem schwarzen Brettchen
Dich zu, mein liebes Kind,
Dich weckt in deinem Bettchen
Nicht Regennacht und Wind;
Dich schreckt kein Sturmgeklopfe
Am Fenster mehr vom Pfühl,
Im kleinen heißen Kopfe
Ward alles schmerzlos kühl.
All' deine kleinen Sorgen
Sind nun für immer aus,
Du liegst so gut geborgen
In deinem stillen Haus;
Dir mag's gar töricht scheinen
In deiner sichern Hut,
Dass wir so tödlich weinen,
Weil's dir so gut – so gut –
----------
Zuletzt
Nun heißt es sterben.
Wunderlich. Warum?
Kein Schmerz; der Leib fühlt sich nicht krank, nur matt.
Ein Müdesein, gleich wie nach langem Weg;
Die Lider schwer; ein wenig zwitternd-trüb
Das Licht vor ihnen, und nach Ruhe, Schlaf
Ein tief Verlangen – morgen frischgestärkt
Zum stets gewohnten Tagwerk aufzustehn.
Und doch, es ist.
Warum denn? Niemand sagt's.
Wie? Oder sprach's ein Schluchzen da? Verriet
Ein halberstickter Ton –? Nein. Alles still.
Ein leiser Schritt nur, eine Stimme: Liegt
Dein Kissen gut? Wenn du zu trinken wünschst,
Du brauchst die Hand nur – wir sind alle hier. –
So war es oft. Im Fieber klang's an's Ohr,
Beschwichtend, tröstlich.
Doch kein Fieber klopft
Mit heißem Blut. Vielmehr die Decke scheint
Ein wenig dünn – die Luft ist heut' wohl kühl?
Wie leichter Regen klingt's. Es zieht vom Fuß
Ein bisschen kalt herauf – auch auf die Hand.
So, das tut wohl.
Wer, sagtest du? Warum
Seid Ihr denn alle hier? Ihr habt zu tun –
Geht! Ihr versäumt die Zeit. Es ist noch Tag
Und Arbeitslicht. Ich brauche ja nicht viel –
Wenn einer bei mir bleibt, das ist genug.
Ja, morgen – nach dem Ausruhn – was zunächst?
So viel ist angefangen, muss durchdacht
Und fertig werden. Niemand könnt' es sonst.
Der Plan – das Wissen – hier im Kopf allein;
So viele Vorarbeit, nun der Genuss,
Der Lohn dafür – es muss – am liebsten gleich –
Nur ist die Hand zu schwer heut – auch der Geist
Nicht voll bei Kraft. Es schwebt ihm vor, doch weicht,
Wenn er es greifen will. – Was war es doch?
Das – dort – ja, nun – ein dunkler Schmetterling.
Wo blieb er? An der Decke – riesengroß –
Habt Ihr die Fenster zugehängt? Es wird
So dämmrig – und die Wissenschaft – sie fliegt
So schnell – ich sehe sie nicht mehr. Nein, lasst!
Ich will sie nicht. Was soll sie? Sie ist nichts,
Ein Knabenspielzeug. Kindisch war's, so hoch
Von ihr zu denken.
Liegt die Straße noch
Grad' so? Vor'm Nachbarhaus, der große Hund –
Bellt er? Wer sprach von ihm? Ihr träumt – Ihr könnt
Ihn ja nicht sehn. Er muss jetzt – wartet – ja,
An Siebzig muss er sein jetzt.
Seid ihr da?
Mich deucht, Ihr atmet nicht. Es ist so still.
Die Uhr läuft ab; ich bitt' Euch, zieht sie auf.
Gar nichts, ganz gut, mein Kind. Ja, trinken – gern.
Der Weg war weit. Nein, lass! Die Mutter meint,
Ich bin zu heiß noch.
Morgen – närrisch, was
Die Menschen morgen wollen. Habt Ihr schon
Das Abendblatt? Sagt's offen nur – mir gilt's
Ganz gleich, ob Frieden bleibt, ob Krieg. Das sind
Nur Namen – alles – Himmel, Erde, Welt
Nur Namen. Ihr versteht das heut' noch nicht.
Es weiß auch keiner sonst; erst eben wird's
Mir klar. Ihr habt noch einen – führt im Mund
Ein Wort noch – gleich – Gott – ja, das ist es – Gott.
Wie kalt – die Decke –
Hört, die Drossel schlägt.
Ganz weit – am Waldrand. Tut den Vorhang weg
Und lasst die Sonne – Ihr behandelt mich,
Als wär' ich krank – ich will nur – o, wie schön!
Die Blumen – da, die rote – ja, zum Kranz
Für den Geburtstag! Hedwig, Wolfgang, schnell!
Die großen Schwestern sind schon dort – lauft zu –
Sie pflücken Euch die besten fort. Marie –
Du auch? Bist Du mit ihnen – das ist hübsch –
Ich such' für Dich – die schönsten –. Es wird Nacht –
Wo bist Du? Komm! Gib mir die Hand – ich führ'
Im Dunkel Dich. Die liebe, kleine Hand –
Nein groß – wie warm – wie weich! Lässt Du sie mir
Für immer – immer –?
Das ist Nachtgeläut.
Was gibt's? Bist Du's, Marie? So dunkel wird's,
Ich seh' dich nicht mehr recht – Dein blondes Haar,
Als wär' es weiß. Ihr alle, Kinder? Wie?
So groß? Ihr gingt ja eben noch so klein
An meiner Hand. Wo hab' ich sie? Ja, fest –
Halt sie recht fest – ein Schatten will sie mir
Aus Deiner ziehn. Hab Dank, Du liebes Weib –
Ich möchte gern – noch einmal – kommst Du nach?
Du musst allein – da, an der Mauer – dann –
Dann links – so müde – schlafen – gute Nacht –
----------
Das Schwerste
Dass ein Tag einst kommt,
Wo ich von dir gehe,
Oder du von mir,
Auf immerdar –
Dass einer den andern
Allein dann lässt
In einer schauernd
Leeren Welt –
Und dass dem einsam
Zurück Gebliebnen
Doch Tage dann
Noch weitergehn –
Jahre vielleicht
Unlöschlicher Sehnsucht,
Brennend stäter
Erinnerung –
Und dass die Tage
Dennoch das Recht
Des Lebens begehren,
Ihre arme Gewohnheit –
Wer von uns beiden
Kann solches Angsttraums
Fieberschreckbild
Mit dem Herzen fassen?
Und ob es undenkbar,
Dass Liebe so
Von Liebe sich trennt
In ewigem Abschied –
Doch wird es sein.
----------
Abendträume
Wie die letzten roten Säume
Nun am Horizont verglimmen
Und auf weichen Windesstimmen
Abendträume
Durch das Sommerdunkel schwimmen –
Denk' ich Eurer, deren Wangen
Blühend einst um mich gelacht,
Die mein volles Herz umfangen,
Die gegangen
Vor mir in die stille Nacht.
Eure leisen Schatten schweben
Um mich auf wie Geisterflüge,
Und die lang verblichenen Züge,
Sie beleben
Sich zu süßer Traumeslüge –
Doch sie rinnen, sie entgleiten,
Wie die Hand sich streckt, in Nacht,
Nur der Jugend Sterne schreiten
Durch die Weiten
Über mir in alter Pracht.
----------
Die Nacht
Nächtige Stille
Hoch über der Welt;
Ein mächtiger Wille
Lenkt und hält
Das Sterngewühle,
Das kein Denken ermisst.
Steh' schweigend und fühle,
Wie nichtig du bist!
Die Nacht ist weich – wie deine Wangen,
Wie deine Stimme der Windeshall,
Es flimmern die Sterne, wie deine Blicke –
Ich wollt' entrinnen meinem Geschicke
Und bin von dir gegangen
Und bin von dir gefangen
Allüberall.
----------
Allein
Geh' hinaus mit deinem Leid,
Geh' hinaus in die Einsamkeit!
Was willst du mit deiner welken Blume
In dem Tanzsaal unter den Tänzern!
Was willst du mit deinem Heiligtume
Unter den Schwätzern und den Scharwenzern,
Unter den Roben und unter den Fräcken,
Unter den gaffenden Laffen und Gecken!
Geh' hinaus mit deinem Leid
In die heilige Einsamkeit!
Geh' hinaus in die Nacht, in den Sonnenschein,
In den Sturm, in die Stille – doch geh' allein!
Hin über die Heide, das schwankende Moor,
Durch den rinnenden Sand, durch das sausende Rohr!
Und nur mit dir selber, weiter hinaus
An des Meeres unendliches Wogengebraus,
Wo Wellen kommen und Wellen geh'n,
Wie es vor dir geschah, wie's nach dir wird gescheh'n,
Und sie rauschen ins Herz dir und grüßen sein Leid
Mit den ewigen Stimmen der rollenden Zeit.
Und hinaus geh' zum Wald, in den murrenden Tann,
Auf dem einsamen Bergpfad durch's Dunkel hinan,
Bis der Tristen grünes Licht dir winkt,
Bis die Lippe die kühlende Hochluft trinkt!
Dort erklimme der Felswand graues Gestein,
Wo dir zu Häupten der Himmel allein,
Wo nur der Wind dir die Stirn noch umrauscht,
Den Stimmen des Weltalls dein Ohr noch lauscht.
Und dann blick' auf die Welt, die zu Füßen dir siecht,
Die du drunten verlassen, die unter dir kriecht
Wie Gewürm, das den Kehricht der Gassen belebt,
Das den Moder durchgräbt, bis sich's in ihm begräbt –
Und ruh' wird dir werden,
Und stolz wird das Herz, und die Seele wird weit,
Von Ahnung umschauert: Ein großes Leid
Sei das Höchste der Erden.
----------
Am ersten Sarge
Es war in schwüler Julizeit; die Gassen
Im Städtchen draußen lagen stumm verlassen,
Und schläfrig klang vom Turm das Glockenspiel
Ins Schulgemach, wo schmal, wie goldener Duft,
Ein Sonnenstreif ans Wandgetäfel fiel.
Die Fliegen summten müde durch die Luft,
Und müde lag es auf den Knabenlidern,
Die auf des alten Römers Weisheit tief
Herniedernickten, nur ein Flüstern lief
Verstohlen rund, ein Blick, ein kurz Erwidern,
Und alles still, und selbst der Lehrer schlief.
Die Blicke aller aber streiften scheu
Den Platz zur Rechten mir, der leer heut war;
Dort saß mein Nachbar sonst; wir hielten treu
Zusammen stets in Not und in Gefahr,
Wie Kinderspiel und Ernst es mit sich bringen.
Wir hatten's nie gesagt und kaum gedacht,
Dass unsere Herzen aneinanderhingen,
Dass unsere Augen nacheinander gingen,
Und wer's gesagt, wir hätten drob gelacht.
Und langsam von der Wand herniedersank
Der Sonnenstreifen auf die leere Bank,
Es war der Zeiger der erharrten Stunde;
Wir ließen Cäsar mitten in der Schlacht,
Der Lehrer schloss, fast eh' wir's noch gedacht,
Das Buch, und blickte flüchtig in die Runde
Und sagte: »Heinrich Wolf ist heute Nacht
Gestorben; wer ihn etwa sehn noch will,
Der muss es heut, die Eltern lassen's sagen.«
Er ging; sonst drängte wohl in wildem Jagen
Jedweder nach der Tür, heut blieb es still;
Der Klang der letzten Worte nur lief schrill
Noch an der Wand entlang und wie im Traum
Verklangen leise auf dem Flur die Schritte;
Ich selbst gedankenlos in ihrer Mitte –
Tot war er – tot – was war's? Sie wussten's kaum,
Doch lag es seltsam auf den Kinderwangen,
Wie Neugier halb und halb wie heimlich Bangen.
Nur mir war's so, als ob der warme Strahl
Des Sonnenlichts mit kaltem Flor verhangen,
Und drinnen fühlt' ich's, dass zum ersten Mal
Ein Schauer durch die warme Welt gegangen.
Am Rand der stillen Gasse lag das Haus,
Ein Garten dran, und in ein dicht Gewirr
Von Blumen sah sein Fenster stumm hinaus.
Ringsum ein sonnenwogendes Geschwirr –
Sie standen lautlos an des Sarges Rand,
Nur weißer war als sonst sein Angesicht,
Nur seine blauen Augen lachten nicht,
Und nacheinander seine kalte Hand
Erfassten sie und legten hastig wieder
Sie auf des Bettes weiße Linnen nieder.
Es war der Tod, der keinen wiedergibt,
Sie sahn's und schauten doch ungläubig drauf;
Nur mir schrie plötzlich es im Herzen auf,
Als hätt' ich nichts sonst auf der Welt geliebt,
An diesen stummen Lippen nur gehangen,
Als müssten sie nach mir zurückverlangen,
Als müsste dieses Aug', eh' es gebrochen,
Nur einmal sprechen, was es nie gesprochen,
Nur einmal hören, was es nie vernommen,
Was über meine Lippen nie gekommen.
Und wie die toten Augen auf mich sah'n,
Da mit der Jugend wundersamem Wahn
Ergriff es mich, als wär' allein von allen
Dem Tod ich mächtig in den Arm zu fallen,
Als müsste eines Menschenherzens Sehnen
Allmächtiger sein als Tod und Grabeshallen;
Und mit der Liebe glaubensstarkem Wähnen
Bog ich mich auf das kalte Angesicht
Und schloss die Lippen auf den starren Mund.
Umsonst – die blauen Augen sah'n mich nicht,
Und keine Antwort gab die Lippe kund. –
Und wie in jener sagenhaften Stunde,
Da Gott verschied am Kreuz zu Golgatha,
Fühlt' schaudernd ich in ihrem festen Grunde
Die Erd' um mich erbeben, und ich sah
Die Sonne stürzen, Nacht umzog die Welt,
Ein Riss zerspaltete des Himmels Zelt,
Auflodernd schlugen um mein Haupt die Flammen,
Und an dem Totenbett brach ich zusammen.
----------
Dünung
Fern bis zum Himmel, schweigsam, weit und groß
Liegt still die See. Sie schläft und, odemlos,
Regt sie kein Hauch, hebt ihr, wie traumgebannt
Kein Atemzug das schimmernde Gewand.
Nur dann und wann mit immer gleichem Klang
Rollt eine lange Welle auf den Strand.
Ein dumpfes Schauern ist es, todesbang,
Und kommt daher und lischt im öden Sand;
Ein Herzschlag, der aus nächtigem Dunkel quillt,
Wo ruhelose Flut der Tiefe schwillt;
Ein Schluchzen ist es aus verhaltner Brust,
Ein Atemkampf des Lebens, unbewusst,
Mit einer Todesstarre, schwer und leer –
Dann spricht des Schiffers Mund: Es dünt das Meer.
Ich kenne deine Dünung, stumme See,
Der dunklen Tiefe ruheloses Weh.
Müd' ist die Stirn und wortlos ist der Mund –
Da plötzlich kommt's und sprengt die Brust – warum?
Ein Schlag, ein einziger aus des Herzens Grund
Bebt auf und stockt – und alles wieder stumm – –.
----------
Am Herbstabend
In eines Herbsttags nebelfeuchter Dämmerung
Schreit' ich im Geist mitunter noch den alten Weg,
Den oft als Knaben mich ein dunkler Zug geführt.
Am Gartenrand durch zwielichtgraues Ackerfeld
Wand sich der Steig, von Dohlenschwärmen überkreischt;
Sie tauchten auf und schwanden in der trüben Luft.
Durch Stoppeln pfiff nun seufzend der Novemberwind,
Des Städtchens spitzer Turm versank, der Pfad bog ab
In Zaungestrüpp, auf dessen rasselnd dürres Laub
Der Nebel tropfend vom Gezweig herunterfiel.
Des Sommers letztverbliebner Gast im leeren Feld,
Ein Spannerfalter weißlich schimmernden Gewands –
Brumata heißt er, der »den Winter Kündende« –
Flog da und dort in müdem Flattern um den Dorn.
Aus dunklen Höh'n scholl über mir der Rottgans Schrei,
Zuweilen schlug das dumpfe Strandgebraus der See
Von fern herauf und schwand im Wind. Dann kam der Wald,
Entlaubt und reglos, doch mit knarrendem Geäst
Der grauen Stämme. Nun von Schatten schwarz verrankt,
Zog sich der Weg am bleiern bleichen Spiegellicht
Des schilfumzittert lautlos stillen Teichs vorbei,
Von dem die Märe raunend sprach, dass manchmal draus
Im Vollmondschein ein weißes Mädchenangesicht
Aufrudernd aus der Tiefe schweigsam seinen Blick
Erheb' und sinke. Rechtshin fort, ein Weilchen noch,
Da fiel vom Rand des Tannichts wie ein irrer Stern
Ein flimmernd Licht. Den Atem haltend, auf den Zeh'n
Trat ich hinan; vom alten Moosdach überwölbt
Sah'n schmale Scheiben rötlich, unverhängt heraus.
Drin traf mein Blick seit Monden stets das gleiche Bild:
Am runden Tisch des alten Forstwarts straffes Haar
Vom Dampf der kurzen Pfeife dicht umwölkt, sein Weib,
Gleich alt und grau, geschäftig strickend neben ihm.
Sie sprachen nicht, die Alte hob nur dann und wann
Zum blöden Aug' ihr Strickzeug auf. Zur Linken saß
Verschattet halb, die Stirn gebückt, ihr Enkelkind,
Ein schlankes Mädchen, schwarzgelockt, die feine Hand
Gleichfalls in hastig fieberhafter Emsigkeit.
Still war's, ich hörte deutlich drin der Wanduhr Gang
Wie einer Brust unrastend harten Hammerschlag,
Lang, immerdar, gleich schwerem Herbstestropfenfall.
Dann wohl, vielleicht nach einer Stunde, sank einmal
Des Mädchens Hand mit ihrer Arbeit in den Schoß,
Und plötzlich schlug ein linnenweißes Angesicht
Zu mir sich auf, mit Augen, zweien Kohlen gleich,
Drin flackernd noch ein letzter Rest von Glut sich birgt.
Sie sah'n mich nicht, sie blickten weit durch mich hinaus
Ins nächtige Dunkel, reglos, brennend, unverrückt –
Ein Grausen fuhr, als ob gespenstisch nasse Hand
Mich angepackt, vom Wirbel bis zur Sohle mir,
Und atemlos lief ich durch Nacht und Wind nach Haus.
----------
Im Eilzug
Der Schaffner wirft die Tür ins Schloss; Geläut
Und Pfiff ertönt, der Zug setzt langsam sich
Aufs Neu in Gang. Der Ort, vor dem er hielt,
Verschwindet hinter braunem Kieferwald,
In alter Hast fliegt bald das Drahtgeleit
Am Schienenrand vorbei. Ein grünes Band
Von hohen Pappeln rollt sich hurtig auf,
Durch Wiesen blinkt ein vielgekrümmter Bach,
Doch, kurz von Nacht umdunkelt, schon durchbricht
Der Zug die Felswand. Neues steigt empor,
Das Auge blendend. Weißes Kalkgestein
Und dürre Berge; gelb und einsam flammt
Die Mittagssonne drauf. Ein Bussard kreist
Um alten Trümmerrest, sonst regt sich nichts;
In heißer Märchenstille liegt die Welt,
Leblos und fremd. Nur unfern, mit dir selbst
Im gleichen Wagenraum, bewegt sich leis
Ein Flimmerschein. Es kommt dir wie im Traum,
Dass sich die Tür beim letzten Anhalt kurz
Geöffnet hat und noch ein Gast mit dir
Den Wagen teilt. Nun blickst du auf und siehst:
Am Fenster drüben nickt im Windeszug
Wie seidne Fäden braunes Haargelock
Um junge Mädchenstirn. Sie beugt sich ab,
Und des Gesichtes weicher Umriss nur
Hebt von der Öde sich, die draußen fliegt.
So steht's, ein reglos Bildnis in der Hast
Ruhlosen Flugs. Dann, dass du fast erschrickst,
Mit plötzlicher Bewegung wendet sich
Das Antlitz um, und lockenübernickt
Schau'n dich zwei Augen an, auch märchenhaft,
Der Mittagssonnenstille draußen gleich.
Doch leblos nicht und fremd; dir ist's, als sei
Vertraut ihr Glanz aus frühen Tagen dir,
Als führst du einzig durch die Fremde hier,
Die wundersamen, lang verlorenen
Zurückzusuchen. Doch wie nun dein Mund
Sich hastig auftun will, da blicken scheu
Und bittend dich die stummen Augen an.
Sie reden deutlich, dass geheime Furcht
In dieser brausend leeren Einsamkeit
Vor einem fremden Laut sie zagen lässt;
Und unter ihrem Blick erstirbt das Wort
Dir auf den Lippen, und den engen Raum
Seltsam durchwebt ein Traumeszauberbann
Lautlosen Schweigens, bis du plötzlich wie
Ein jäh Erwachender die Stirne hebst.
Verhallend, einem Klagruf ähnlich, klingt
Ein langgestrecktes Pfeifen dir im Ohr;
Es hält der Zug vor einer braunen Stadt
Mit altersgrauem Turm und Mauerkranz
Verschollener Zeiten. Sonnenblendend, leer
Liegt der Perron des kleinen Haltepunkts,
Nur sie geht leisen Schritts jetzt drüber hin.
Du bückst im Traum dich vor und schaust ihr nach;
Geläut und Pfiff ertönt, ein Wagentrain
Sperrt dir den Blick und endet nun. Da steht
Am Eingang einer alten Straße sie,
Die hochumgiebelt lang ins Innre zieht.
Sie wendet nach dem rollenden Gefährt
Den Kopf noch einmal, und noch einmal nickt
Das braune Haar auf ihre feine Stirn
Und schau'n die Augen drunter märchenhaft
Durch's stille Mittagslicht. Nun schiebt ein Haus
Mit gelber Lehmwand rasch sich über sie,
Ein Nelken-überblühter Mauerrand,
Der dürre Kieferwald, Gebirg und Tal,
Das alles fliegt vorüber wie zuvor,
Der Sitz am Fenster drüben nur ist leer,
Und weiter rollst du in die fremde Welt.
----------
Ein Neubau
Vor meinem Fenster drüben bauen sie
Ein Haus empor. Geschäftig rege Hand
Legt Stein auf Stein; der weiße Mörtel spritzt
Kalktupfen ringsumher, es quirlt der Staub,
Und mit den Mauern steigt das Baugerüst.
Es wird ein breitgelagert mächtiges Haus,
Vielfenstrig, nicht auf Zier bedacht, es scheint,
Ein Maurermeister baut's, nicht Künstlergeist.
Doch stehn bewundernd viele Leute still
Und schau'n der Arbeit wohlbefriedigt zu;
Stadträte nicken ernst und würdevoll,
Der allgemeine Beifall lohnt dem Werk.
Nur selten eilt ein Fuß daran vorbei
Und wendet achtlos seitwärts sich ein Blick;
Und wenn's geschieht, sieht man den Augen an,
Sie sind nicht sachverständig, und es wär'
Ihr Urteil ohne Wert. Was man dort baut,
Ich weiß es nicht. Vielleicht ein Arbeitshaus,
Fabrik, Maschinenwerkstatt, ein Spital,
Vielleicht eine Kaserne. Was es sei,
Zum Nutzen dient's.
Nur wie die Mauer so
Sich höher aufhebt, deckt sie meinem Blick
Ein Rasenstück, drauf Frühlingssonnenschein
Und Sommerschatten lag. Es kam im März
Ein Veilchenduft dorther, und heimlich klang
Ein Quellgemurmel aus dem Wiesengrund.
Auch weiße Blütenbäume nickten drauf,
Und Amsellied begrüßte draus den Mai.
Und wie die Kelle fleißig streicht und fugt,
Verkürzt sich meinen Augen, Stein um Stein,
Die grüne Bergwand drüben; es versinkt
Der Kieferrand, der sonst mit dunklem Haar
Im Wind gerauscht; nun schwindet eilig ihm
Der letzte hohe Tannenwipfel nach,
Drauf sonst zuletzt das Abendspätrot lag.
Und hurtig deckt das steile Sparrendach
Mit Ziegeln sich und deckt des Himmels Blau
Mir tönern zu; die Sterne löschen hin,
Kein Sonnenstrahl besucht mein Fenster mehr,
In frostigem Schatten liegt's und kühler Luft.
Was änderst du? Ruf dir, was war, zurück
Und leb' im Einst! Dein Sondertrachten hält
Den neuen Nutzbau deiner Zeit nicht auf.
----------
Der Zähler
Wie nun die Sonne den Zenit
Lang überstieg und schräger fällt,
Und eine abendliche Welt
Die Schatten mählich länger zieht,
Da kommt's dir wohl so ab und an:
An deiner Seite schreitet dicht
Mit dir ein stummer Wandersmann;
Du siehst ihn nicht und hörst ihn nicht,
Nur fühlst du, dass er niemals fehlt
Und heimlich ein Geschäft betreibt,
Als ob er deine Schritte zählt.
Und wenn du stehen bleibst, so bleibt
Er neben dir an deiner Rast,
Er sitzt mit dir zu Tisch als Gast,
Sein Dasein wird dir niemals kund;
Nur manchmal auf der Lippe stockt
Ein Scherz dir, der zu laut frohlockt,
Das Lachen bricht dir ab vom Mund;
Dir ist, als ob im goldenen Wein
Die Zunge bitt'res Kraut gespürt;
Dir ist's, als ob im Sonnenschein
Ein eisiger Hauch dich angerührt.
Und kommt mit ihrer Ruh die Nacht,
Du fühlst, dass er auch dann nicht wich;
Er sitzt an deinem Bett und wacht
Und bückt sich horchend über dich;
Und so, wie in ein Rechnungsbuch
Er deinen Schritt gezählt am Tag,
So zählt er deinen Atemzug
Und zählt nun deines Herzens Schlag.
----------
Wer?
Wer bist du,
Der den Schwalbenflug
Durch die Lüfte leitet,
Der im Wolkenzug,
Der im Winde schreitet?
Der im Meere schwillt,
Im Blitze sprüht,
Der im Keime quillt,
In der Sonne glüht –
Wer bist du?
Wer bist du,
Der zusammenbewegt
Die toten Atome,
Der sie geregt
Zu lebendigem Strome?
Der das Wundernetz
Des Lebens spann
Und ihm Gesetz
Und Ordnung ersann –
Wer bist du?
Was bist du,
Der dennoch die Welt
Seiner Kunsterkenntnis
Mit Mängeln entstellt,
Dass kein Verständnis
Die Triebkraft fasst,
Die ungezähmt
In irrer Hast
Sich wechselnd lähmt –
Was bist du?
Wer bist du,
Der das Menschengemüt
Vom Staub gehoben,
Mit Liebe durchglüht,
In Sehnsucht gewoben?
Der ihm mit Licht
Die Stirn erhellt
Und ihm die Pflicht
Zum Halt bestellt –
Wer bist du?
Was bist du,
Der Leiden ohne Zahl
Ihr Wirken gestattet,
Mit Jammer und Qual
Das Leben umschattet?
Der zum Gebot
Den Mord verkehrt,
Dass sich vom Tod
Das Leben nährt –
Was bist du?
Ewige Macht,
Du wechselnde Flut,
Nach unserm Benennen
Grausam und gut –
Wer will dich erkennen?
Ob sie Natur
Dich heißen, ob Gott,
Ein Bekennen ist's nur,
Ein Wort, ein Spott
Unsrer Blindheit.
----------
Wahrheit?
Was ist Wahrheit? Seltsam Fragen!
Alles ist sie und ist Nichts;
Ist ein Strahl des Weltalllichts,
Der durch dunklen Raum getragen.
Ist ein kalter Himmelsbote
Einer götterlosen Welt;
Ist ein Stern, der niederfällt
Und erlischt im Gassenkote.
Warum willst du zu ihr streben?
Wahrheit ist nicht Glück, nicht Leid,
Ist nur Todeseinsamkeit,
Ohne Liebe, ohne Leben.
Über allem Zeitgebilde
Reglos thronend gleich der Zeit,
Abglanz nur der Ewigkeit,
Ohne Zorn und ohne Milde.
Deine flüchtigen Sekunden
Miss mit deines Herzens Schlag!
Deine Wahrheit ist dein Tag,
Und mit ihm ist sie entschwunden.
Antwort forderst du vergebens,
Wo kein Puls des Blutes schlägt –
Was dein Innerstes bewegt,
Ist die Wahrheit deines Lebens.
----------
Ein Rätsel
Eine Kette hängt hernieder,
Die im Dunkel rasch entschwindet,
Drei, zum Höchsten vier der Glieder
Vor dir ineinander windet.
So mit unsichtbarer Länge,
Doch von der kein Maß dir spricht,
Scheint's, dass in der Luft sie hänge;
Was sie hält, gewahrst du nicht.
Leis nur siehst an ihrem Ende
Du ein Glimmern ausgeschieden,
Als ob dort geschäftige Hände
An der Kette weiterschmieden;
Langsam rundet sich ein Bogen,
Bis der Blick dann plötzlich sieht:
Fest dem letzten eingezogen,
Hängt an ihm ein neues Glied.
Aber seltsam, als ob weiter
Niemand dran geschmiedet hätte,
Eine rätselhafte Leiter,
Wird doch länger nicht die Kette.
Denn nun schwand noch oben wieder
Fort ein Glied, und immer dir
Bleiben vor dem Blick der Glieder
Dreie nur, zum Höchsten vier.
----------
Am Sarge Theodor Storms
Und nun auch du – der Letzten Einer –
Auch du in jene tiefe Nacht,
Aus der zu neuem Morgen keiner,
Zu neuem Wort und Werk erwacht.
Vorbei – der dunklen Stunde nahen,
Vollendet ward's. Geschlossen ruh'n
Die Augen, die das Schöne sahen,
Und Herz und Hände ruhen nun.
Du warst – noch ist es wie ein banges,
Vom Traum geborenes Angstgesicht;
Du warst – ein Wort so wehen Klanges,
Wie keines diese Zeit mehr spricht.
Vom alten Stamm des Menschenlebens
Sank eine seiner Blüten ab,
Und die Beschwichtung tönt vergebens,
Sie blühe fort auf deinem Grab.
Für unsrer Seele tiefstes Beben
Ist noch nicht Trost, dass du uns bliebst,
Dass unvergänglich du dein Leben
In tausend Menschenherzen schriebst;
Wir fordern dich mit bitt'rem Weinen,
Dein sanftes Wort, den milden Blick,
Wir fordern dich mit allem Deinen,
Du lieber Toter, dich zurück.
Umsonst; es tönt kein neues Werde! –
Ein hoher Geist ins Nichts entfloh'n –
Den Leib nur senken wir zur Erde,
Dich, deiner Heimat treuen Sohn.
Wo du erwacht, kehrst du ins Bette,
Wie in vertrautes Schlafgemach
Zurück an heilige Heimatstätte,
Und unsere Tränen fallen nach.
Schlaf still! Der Kranz, den dein Jahrhundert
Dir mit in deine Ruhstatt gibt,
Ist reich; doch mehr noch als bewundert
Warst du – du warst, du bist geliebt.
Die Krone aller Lebensgüter
Errangst du dir, und höher klingt
Kein Ruhm; du ließ'st uns dir als Hüter
Der Liebe, die den Tod bezwingt.
----------
An Friedrich Hebbel
Armer, dem Boden der Heimat entrückt, die dich
nimmer verstanden,
Hier an das fremde Gestad' warf dich die Welle
der Zeit.
Staunend betrachteten sie den Gewaltigen, aber sie
scheuten
Was dir zu eigenstem Wert göttliche Präge verlieh.
Weit und tief durchschaute dein Aug' die Gestaltung des Lebens,
Während mit tändelndem Fuß jene die Fläche gestreift,
Und sie vergaben dir nicht den erhab'neren Flug, deine
Schwingen
Zogen mit neidischer Hand sie in den eigenen Staub.
Schlafe drum unter dem Fels, den, ein Bild deiner
einsamen Größe,
Ragend aus niederem Kreis, dankbare Hand dir
erhob.
Und dein Name gesellt sich der uralt ewigen Klage,
Welche die edlere Gruft immer aufs Neue gebiert:
Lässt denn die Besten ein Gott verarmen im Beifall
der Mitwelt,
Weil in der Nachwelt sie, weil sie im Herzen zu reich?
----------
Heinrich Heine
Den großen Lebenden verboten sie,
Ein Denkmal weigerten dem Toten sie,
Sich ihrer Väter würdig zu bezeigen:
Die Heuchler, Schranzen, Frömmlinge und Feigen,
Die reiche Horde jener armen Seelen,
Die nie das »Klügere« zu tun verfehlen.
Wie scheinbar auch die Zeit sich wandeln mag,
Deutschland hält fest an seinem »Bundestag«,
Und löblich mit der Kirche und dem Staate
Wetteifern auch die Magistrate.
Nur solche, die aus Rom nicht, noch Byzanz
Herleiten makellosen Namensglanz.
Das Volk nur, dem der richtige Sinn gebricht,
Das seiner Christen-Untertanen-Pflicht
Gedenk nicht, will den Toten nicht vergessen,
Der lebend seiner Väter Herz besessen.
Ihm, dem als einem seiner Größten blind
Anhängen wird noch Kind und Kindeskind,
Verlangt ein Standbild dieses Volk zur Ehre,
Als ob ein »Edler der Nation« er wäre.
Ihn lächelnd sah ich: Deutsche Träumerei!
Wozu aus totem Stein mein Konterfei?
War ich ein General der Kavall'rie?
Ein Säulenheil'ger der Orthodoxie?
Ich lebe ja in euch, werd' in euch allen
Fortleben noch, wenn Erz und Stein zerfallen.
Denkmäler mögt ihr, wollt ihr mich ergetzen,
Für Rosegger und Adolf Bartels setzen.
Dem deutschen Volk ins Herz hineingedichtet,
Hab' ich das meinige mir selbst errichtet.
----------
Prolog zur Münchner Raabefeier
An deiner Gruftstatt hab' ich nicht gestanden.
Mir ist's, als trät' ich hier zu ihr hinan.
Die das Geleit dir gaben, sie verschwanden,
Ihr Tagwerk rief die Lebenden vondann.
Was laut sie sprachen, was sie stumm empfanden,
Vorüber ging's. Noch einmal überspann
Ihr Nachruf dich wie letztes Abendglänzen,
Nun liegst du einsam da – bedeckt mit Kränzen.
Nur ich allein blieb bei dir, Wilhelm Raabe.
Mein Blick ruht auf dem Lorbeer, der dich deckt:
Sein bitteres Laub, was will's an deinem Grabe?
Hat es ein bitteres Sinnbild dran bezweckt?
Räumt fort den Trug, die Schmach der Ehrengabe!
Denn Ihn, der hier zum Ruh'n sich hingestreckt,
Der Größten Einen unter Deutschlands Söhnen,
Ihn soll kein spöttischer Leichenprunk verhöhnen.
Die Wahrheit sprach er, und die Wahrheit werde
Ihm nachgesprochen in die Grabesnacht:
Die sich die Großen nennen auf der Erde,
Nicht haben dankbar seiner sie gedacht.
Kein »Edler der Nation« war's; schlichtem Herde
Entnahm die Kraft er, eine Wundermacht,
Dem deutschen Volke Herrlichstes zu geben. –
Das deutsche Volk – weiß nichts von seinem Leben.
Es kennt ihn nicht. Ein Wort von herber Strenge,
Mit dem kein lindernd mildrer Hauch versöhnt.
Ein Fremdling schritt er hin durch taube Menge,
Die nur dem Gassenruf des Alltags fröhnt.
Ein Hoherpriester, dessen Weiheklänge
Aus tiefster Seele seinem Volk ertönt,
So stand zu dieses Volkes tiefster Schande
Ein Hungerpastor er im deutschen Lande.
Er wusst's und schweigend hat er's so ertragen,
Wie stumm-gelassen jedes Leid er trug.
Doch wusst' er auch und durft' es stolz sich sagen:
Er tat den Besten seiner Zeit genug.
Nicht feierten bei prunkenden Gelagen
Sie reichgewandet ihn; es lud sein Buch
In schlichtem Kleid zu höchsten Andachtsfesten
Beim stillen Lampenscheine sie – die Besten.
Und heut' mit dem Gedenken dran umfasse
Ein halb Jahrhundert ich, das uns entschwand,
Seit jenes Frühlicht deiner Sperlingsgasse
Uns jung zur langen Freundschaft einst verband.
Und wo den Blick ich auf dir ruhen lasse
Im Zeitenwandel, seh ich unverwandt,
Was fremd um uns die Welt heraufgetrieben,
Dich wandellos dir selbst getreu verblieben.
So standest du und lauschtest der Camöne,
Als Morgenrot der Jugend um dich lag,
So hütest du ihre echten Töne
Durch deiner Dichtung reichen Schöpfungstag.
Dir blieb des Lebens Innerstes das Schöne,
Geboren aus des Herzens Wechselschlag,
Du fandest es im Großen und im Kleinen,
Im Ernst und Scherz, im Lachen und im Weinen.
Und so, wo noch der Dichtung heiliger Schauer
In des Gemütes Tiefe Wellen regt,
Wie Wenige nur, mit Frohsinn und mit Trauer
Hast lächelnd du das Menschenherz bewegt.
Du schufst ein Leben dir von langer Dauer,
Das ferne Zeit noch als ihr Erbteil hegt,
Denn unverwelklich wird auf deinem Grabe
Der Besten Dank dir fortblühn, Wilhelm Raabe.
----------
Abend
Wie die Häuser all' sich leeren,
Wie sie ausziehn, Groß und Klein!
Neue, fremde Gäste kehren
In die alten Zimmer ein;
Und wir lachen, tanzen, spielen
Drinnen wieder wohlvertraut,
Nur zuweilen aus den Dielen
Knarrt ein geisterhafter Laut.
Ward es denn so spät schon heute?
Drängt's doch auf den Gassen sich –
Die Gesichter nur der Leute
Werden fremd und wunderlich.
Wie in geisterhaftem Scheine
Öd' die alten Wände stehn!
Abend wird's, du bliebst alleine,
Halt' dich auch bereit, zu gehen.
----------
Gelbe Blätter
Alte Briefe hab' ich grad' gelesen,
Fand darin manch' lang vergessene Sachen,
Las, wie pudelnärrisch wir gewesen,
Musste heut nach vierzig Jahren lachen:
Welch schillernd leere Seifenblase!
Welch ein Wirbelsturm im Wasserglase!
Doch allmählich wurden seltsam trüber
Mir die Augen bei dem Blätterschlagen,
Sahen durch ihr Lachen weit hinüber,
Weit zu unbegreiflich fremden Tagen:
Welch ein Glück in diesem ersten Sehnen!
Welche Seligkeit in seinen Tränen!
----------
Im Wellengetriebe
Unerreichbar lag das Ziel
Vor mir in der Meeresweite,
Wie undenkbar, dass der Kiel
Je zu ihm hinübergleite;
Nur der Traumgedanke trug,
So erschien's, zu jenem Strande,
Nur der Sehnsucht Schwingenflug
Trug zu seinem Wunderlande.
Kann's denn sein? Mein Auge blickt,
Starr, als wenn es trügen müsste:
Aus dem Meeresspiegel nickt
Hinter mir die Zauberküste;
Wie sie kaum mit ihrem Glück
Vor mir lag in Glanzeshelle,
So versinkt sie schon zurück
Hinter mir im Spiel der Welle.
Trat mein Fuß denn dort ans Land?
Hielt ich denn das Glück in Händen?
Zitternd nach dem Sonnenstrand
Muss zurück den Blick ich wenden;
Selige Stunden, ach, wie Traum
Kamen, waren sie und rannen,
Und mein Herz begriff sie kaum,
Und mich trug die Flut von dannen.
----------
Fortschritt
Einst hielten in freudiger Andacht wir
Ein Büchlein mit grobem, gekörntem Papier,
Drauf wohl ein Rostfleck, gelb und braun,
Fast wie ein Muttermal zu schau'n;
Ein simpler Umschlag, vor dem Buch
Auf dem Titel ein Greif oder Aschenkrug,
Das Ganze so kunstlos, einfach und schlicht,
Wie einfach schlichte Lippe spricht.
Doch aus der Blätter geheimem Bann,
Da sah es mit Märchenaugen uns an,
Die Dichtung sah uns ins Angesicht,
Wie goldenen Erzgangs schimmerndes Licht.
Es pochte herauf eines Herzens Schlag
Und rief das eigene Herz uns wach.
Es dehnten die Blätter die Brust uns weit,
Wir lebten mit in Lust und Leid,
Wir schwebten mit in fremdem Traum;
Es wandelte sich des Büchleins Saum
Zu leuchtender Himmelsbogen Duft
Und enthob aus der Erde bedrückender Luft.
Wie schritten wir vorwärts! Nun haben wir
Die Dichtung auf kunstvollstem Büttenpapier
Mit auserlesenstem Typendruck;
Der Einband funkelt von goldnem Schmuck.
Aus schmalem Büchlein werden Folianten,
Es eifern illustreste Illustranten
Mit riesigen Bildern die Dichtung zu zieren
Und höchsten Preis ihr aufzunotieren.
Denn alle müssen für ihre Feste,
Für ihre Teuren, für ihre Gäste
Die teuersten Prachtausgaben haben.
Sie sind alle ja selber Prachtausgaben
Der neuesten Mode des glitzernden Scheines,
Des goldumfunkelten Similisteines.
----------
Vielschreiberei
Schreibt einer täglich Jahr für Jahr
Mit Lust, Bedacht und Fleiß,
Was heut' er ist, was einst er war
Und fühlt und denkt und weiß –
Halb mit Bedauern, halb mit Hohn
Zuckt man die Schulter dabei
Und heißt es Überproduktion,
Zu Deutsch: Vielschreiberei.
Ein Wort, von der Kritik erdacht,
Mit dem kurz alles abgemacht,
Dass zu dem schlechten Prädikat
Man Weitres nicht mehr nötig hat;
Vor allem, nicht sich zu befassen
Mit diesen ›sinnlos dicken Massen‹,
Bei denen man auf solche Art
Viel Lesenszeit und -Müh' erspart,
Auf die zu Würdigung und Rat
England und Frankreich Anspruch hat,
Norwegen, Russland auch indessen,
Wie Dänemark nicht zu vergessen.
Und auch das liebe Publikum
Zuckt seine Schultern mit herum
Und spricht: Wie anders muss das sein,
Wenn einer jährlich stets nur ein,
Ein einziges dünnes Büchlein schreibt,
Darin er völlig lebt und leibt!
Das ist die ächte Quintessenz,
In jedem Wort Extraktsentenz
Des Herrlichsten, was jeder führt,
Wie sich's allein für uns gebührt.
Hör' ich dies Lob der Herrn Kollegen,
Da gönn' ich's ihnen voller Segen
Und denke ruhig, sonder Neid:
Sie machen wohl von ihrer Zeit
Bessern Gebrauch für Mund und Magen
Und haben wohl nicht viel zu sagen.
----------
Übliche Kritik
Über dies Buch unser Urteil zu fällen:
Besitzt es wirklich recht hübsche Stellen,
Bekundet nicht selten Geschmack und Geist,
Auch von der Kenntnis, die drin sich erweist,
Haben wir gern Notiz genommen.
Doch vieles natürlich ist unvollkommen,
Als Beispiel fällt zunächst uns ein:
Gar manches hätt' können kürzer sein,
Dagegen vermissen wir, zu lesen,
Wie dies und jenes weiter gewesen
Auch kam die Geduld uns füglich abhanden,
Weil mehrere Dinge wir nicht verstanden,
Und drum die Schuld der Autor trägt,
Dass er sie nicht klar genug dargelegt.
Im Ganzen und Großen müssen wir sagen:
Das Buch hat uns in müßigen Tagen
Verdruss bereitet und Vergnügen;
Denn aus der Art, wie wir loben und rügen,
Gewahrt aufs klarste jedes Kind,
Was wir für kluge Leute sind,
Und dass, läg's so in unserm Belieben,
Wir sicherlich besser das Buch geschrieben.
----------
Kunst und Naturalismus
Mühvoll schreitet der Fuß auf den staubigen Straßen
des Lebens,
Aber zum Fluge beschwingt hebe die Kunst ihn empor!
Dem nicht danken wir Trost und die Heilkraft edleren
Aufschwungs,
Der uns des Niedrigen Bild treu vor den Sinnen entrollt;
Der uns Gestalten erzeugt, die mit Ekel das Auge zurückstößt,
Wenn es im Schmutz ihres Seins sie auf der Gasse betrifft;
Der uns mit Misslaut das Ohr und mit Abscheugefühlen
die Brust füllt
Und aus der Welt ein Spital eiternder Wunden uns schafft.
Hässliches bietet sie dar, doch es nütze zum Mittel die Kunst
nur,
Dass in verklärterem Licht ihm sich die Schönheit enthebt.
Sie nur leuchtet als Ziel, und es kündet den Wert einer
Schöpfung
Einzig der höhere Geist, der das Gemeine besiegt.
Nicht der Natur entfremdet damit sich die Kunst, denn
das Vorbild
Ihrer Gestaltungen bleibt edlere Menschennatur.
Mag sie Erhab'nes zum Sieg oder mag sie's zum
Untergang leiten,
Heiligen Schauer entströmt immer ihr göttlicher Hauch.
Das ist ihr Merkmal allein und der Prüfstein nur ihres
Goldwerts,
Ob sie mit Glück oder Gram höher die Brust dir geschwellt;
Ob im Gemüte sie dir, wie der Atem des Windes vom
Meergrund
Schlummernde Perlen erschließt, Wunder der Seele
geregt.
Buhlen im Gassengedräng' um den jauchzenden Beifall
des Pöbels,
Welcher sich selber beklatscht, lass den Entweiher der
Kunst!
Schwellen die Gossen auch an, es enthebt sich den
schlammigen Wassern,
Ewigen Sieges gewiss, Anadyomene stets.
----------
Cave!
Suchst du das Wissen der Menschheit zu mehren,
Ewiges mit irdischem Wort zu erklären,
Strebst du begeistert zum Urquell des Schönen,
Sei es im Bilde, sei es in Tönen,
Lösest die Seele du in Gesänge –
Fürchte den Lobspruch der Menge!
Wenn ihr Klatschen dir Beifall kündigt,
Hast du an deinem Altare gesündigt.
----------
Jung-Bismarck
Bewundert viel
Und viel gescholten –
So hat's am hohen Ziel
Von je gegolten;
Was Freundesstimme
Auch rühmend schuf,
Der beste Mannesruf
Scholl stets vom Feindesgrimme.
Zwar wie Sein Bild
Wir hier gewahren,
Den Scheitel dicht umhüllt
Von blonden Haaren –
Ein Antlitz milde
Und jugendweich,
Traumhaften Zug's fast gleich
Novalis jungem Bilde –
Gibt Fremdes kund
Sein sanft Gebaren
Uns, die aus Zeugenmund
Gar oft erfahren:
In frühen Tagen
Schuf manchem schon
Der kecke Musensohn
Kein sanftes Wohlbehagen.
Der Zunge Witz
Mit lustigem Schweifen,
Und hinterdrein wie Blitz
Der Klinge Pfeifen!
Gleich tat's ihm keiner
An raschem Blut,
Wie einst an hurtigem Mut
Albrecht dem Wallensteiner.
So wird man auch
In späten Tagen
Von Seinem Jugendbrauch
Noch singend sagen,
So wird einst allen
Sein junger Tritt
Vor Seinem Weltenschritt
»Besonders noch gefallen«.
Dies Bildnis schwand;
Auf Jovis Sitze
Ergriff des Mannes Hand
Die Schicksalsblitze:
So, viel bewundert,
Gescholten viel,
Hob er zum hohen Ziel
Sein Volk und sein Jahrhundert.
Uns alle trägt,
Hält Seine Stärke –
Uns alle heut' bewegt
Bei Seinem Werke
Nur Eins: zu sagen:
Mög' Er noch weit,
Mög' Er durch lange Zeit
Noch Deutschlands Zukunft tragen.
----------
Im Abenddunkel
Willst du ohne Orgelpfeifen
Und Posaunen die Weltgeschichte
Und dich selber mit begreifen,
Sitz' ein Weilchen im Dämmerlichte!
Sieh, wie noch die Sonne blendet,
Wie sie letztes Rot entsendet,
Sieh die Wolken wehn und wallen,
Sieh die Schatten wachsen, fallen,
Bis im Dunkel alles endet.
----------
Im Abendschimmer lauschten wir
Im Abendschimmer lauschten wir
Des Meeres leisen Grüßen,
Es schmiegte, wie ein schmeichelnd Tier,
Sich still zu unsern Füßen.
Die Welle kam, die Welle ging,
Es zogen leis die Sterne
Herauf; doch unser Auge hing
An grauer Nebelferne.
Zwei Sterne blickten dicht gesellt,
Als ob sie uns gegolten,
Und mit dem Strahl, der uns umhellt,
Uns Glück bedeuten wollten.
Wir sah'n uns an, wir sah'n empor
Und sah'n sie langsam scheiden,
Wie jeder sich in Nacht verlor –
Sternschnuppen waren die beiden.
----------
Kampf ums Dasein
Der Kampf ums Dasein glüht ohn' Unterlass,
So hier, wie dort. In stetem Gleichmut bleibt
Die unsichtbare Kraft, die alles treibt,
Und lässt der Willkür Spiel, neu bildend, was
Im Kampf verging. Ob sie ein welkes Gras,
Ob sie ein volles Menschenglück zerreibt,
Sie gleicht dem Stern, der ewigen Kreis beschreibt
Und Licht entsendet ohne Lieb' und Hass.
Das ist die große Losung alles Lebens
Und das Geheimnis, dem das Sein entstieg:
Ein Recht besitzt das Ganze nur, vergebens
Verlangst du es für dich, den Teil. Dein Sieg
Ist Zufall nur, nicht Lohn des eignen Strebens,
Und deines Daseins Zweck Vernichtungskrieg.
----------
Staub und Welle
Was ich gewesen? Ein Stäubchenatom,
Das geflimmert im Sonnenprangen;
Ein winziges Wellchen im wallenden Strom,
Das ein Weilchen gerauscht und zergangen;
Ein Einzelblättchen im endlosen Wald,
Herabgefall'n aus den Zweigen;
Ein Ton, der flüchtig mit aufgehallt,
Verklungen zu ewigem Schweigen.
Gibt man Namen dem Stäubchen, der Welle, dem Blatt?
Lasst ruh'n auch verschollen den meinen!
Ein Regen im Safte des Lebens fand statt,
Ein Flimmern, ein Klingen, ein Scheinen.
Wozu, was erloschen im Schattenreich,
Noch mit nichtigen Namen erhellen?
Es kehren im ewigen Wechsel ja gleich
Die Stäubchen, die Blätter, die Wellen.
----------
Ein Epitaph
Ob dann, wenn man zum letzten Schlaf
Mich in die Erde tragen wird,
Fortdauern Einiges von mir
Noch in der Nachwelt Tagen wird –
Ich weiß es nicht, ich glaub' es kaum.
Die Welt will andre Gabe heut',
Und jene Welt, drin ich gelebt,
Man trägt sie auch zu Grabe heut'.
Doch wie's geschieht, es dringt kein Ton
Davon in meinen Schlaf hinab,
Und einzig wertvoll nehm' ich selbst
Mit mir als Epitaph hinab:
Dass nie von meiner Hand ein Kranz
Um Gunst und Gut gewunden ward,
Dass nie ein Wort ich schrieb, das nicht
Von mir als wahr empfunden ward.
Erzählungen
Die braune Erica
Im Dufte das Meer und der Wald im Duft,
Vom murmelnden Ufer ein Möwenlaut:
Ein Falkenschrei hoch aus der schimmernden Luft,
Und rings rotwogendes Heidekraut.
Da fand ich ein braunes Menschenkind,
Ob Knab' oder Mädchen, wer hätt' es gewusst?
Das bläuliche Haar flog gelöst im Wind
Und deckte die sorglos entblößte Brust.
Kaum reichte zum Knie das zerriss'ne Gewand,
Ein Flechtwerk daneben aus Binsen und Ried:
Eine Rose darauf in verbrannter Hand,
Und ein süßer Traum auf dem Augenlid – –
Der Wald im Duft und im Dufte das Meer,
Ein Falkenschrei und ein Möwenlaut,
Und ein Schlaf, wie Tod – und der Wind kam daher
Und begrub es im wogenden Heidekraut.
Die vormittägige Maisonne schien in ein enges Studierzimmer. Über einen alten Hofraum kam sie, über Gerümpel aller Art und stahl sich schräg durch die halbverhängten Scheiben. An der Wand beleuchtete sie allerhand Bilder aus fremden Weltgegenden. Hohe Bäume mit langen Früchten daran, üppig wuchernde Gewächse, zwischen denen wunderliches Getier hervorlauerte. Aber nirgends waren Menschen darauf. Reptilien hingen ausgestopft an der Wand und starrten mit Glasaugen in hohe Spiritusbehälter auf totes Gewürm. Glas befand sich vor allem, auch vor den breiten Kästen, in denen aufgespannte Schmetterlinge sich wie lebend im Frühstrahl wiegten. Auch vor den Augen des Besitzers, der zusammengebückt über einen Folianten an dem schwerbepackten Arbeitstische saß, grünes Glas. Er las und sah an seinen Wänden umher und las wieder. »Erica janthina«, sagte er nachdenklich, »sie fehlt mir noch immer. Sie ist schlanker als die übrigen und wächst auf der Heide, aber sie ist selten.« Die Sonne bog um den verschossenen Vorhang und spielte über die gemalten Blumen auf dem Blatte, das er aufgeschlagen hielt. Der Gelehrte stand unwillig auf und streckte die Hand aus, um die Gardinen noch dichter zusammenzuziehen. Er war größer gewachsen, als man ihn der Stellung im Sessel nach hätte vermuten sollen, noch jugendlich schlank und zierlich, nur steif in seiner Haltung und unbehilflich in den Bewegungen, dass er an die Eidechsenmumien an der Wand erinnerte. Hinter ihm ging die Tür auf und eine ältliche Frau von gesundem und resolutem Aussehen trat ein. Sie trug ein Frühstück in der Hand, für das sie ohne besondere Rücksicht auf die zusammengeordneten Tierleiber und Pflanzen den Ecktisch abräumte. Der Gelehrte sah sich erschreckt um. »Um Gotteswillen, Frau Margret!« sagte er.
»Ja, um Gotteswillen, Herr Professor«, erwiderte die Frau, »was machen Sie denn da? Herrjemine, soll denn die liebe Sonne nie herein? Es ist ja, als ob ein Sarg hier stände, und Sie sehen wahrhaftig auch wie die Leiche aus, die hineingehört. Man erstickt ja bei Ihnen« –
Sie ging schnell auf die Fenster zu und riss sie weit auf, dass die grünen Vorhänge krachten. Eine goldene Sonnenwoge brach herein, Duft von tausend Blüten kam aus dem Nachbargarten, eine verirrte Biene summte ins Zimmer, schwirrte suchend an den ausgestopften Tieren vorüber und hastig wieder hinaus.
Der Professor blickte die Haushälterin schüchtern an. »Morgen, liebe Frau Margret«, sagte er, die Hand an den Fensterflügel legend. Aber sie drängte ihn energisch wieder zurück.
»Morgen?«, wiederholte sie, »das wollt' ich mir ausbitten, und heute dazu bleiben sie den ganzen Tag offen, damit es trocken wird, denn das ganze Haus wird gescheuert.«
Der Professor seufzte tief und machte eine abwehrende Bewegung –
»Und hier vor allem«, setzte die Gefürchtete nachdrücklich hinzu, »in jeder Ecke, überall. Meinen Sie, dass eine rechtschaffene Frau es mit ansehen kann, dass es hier am Pfingstmorgen wie in einem Hundestall aussieht?«
Er hob verwundert den Kopf. »Pfingstmorgen?« fragte er gedankenlos. Die Frau schlug entsetzt die Hände über den Kopf zusammen. »Herr du meine Güte, Sie wissen nicht einmal, dass morgen das heilige Pfingstfest anfängt? Das kommt davon, wenn man immer unter diesem unchristlichen Gewürm sitzt und nicht einmal die liebe Sonne hereinlässt.«
Sie schlug verächtlich den Folianten auf dem Schreibtisch zu und wischte mit der Schürze den Staub von seinen Rändern. Der Professor seufzte noch tiefer als vorher und blickte furchtsam und prüfend in das entschlossene Gesicht, aus dem ihm eine Sündflut, über einen Seifenchimborasso zusammenschäumend, entgegendrohte. In der Angst und Verwirrung, die ihn überkommen, hatte er die grüne Brille abgenommen und die Sonne lachte freundlich in die schönsten blauen Augen hinein, die ein Mann je besessen. Die Frau bekümmerte sich nicht um ihn und fing an, Bücher und Pflanzenkartons rücksichtslos zusammenzuräumen. Eine Weile sah er ihr schmerzlich zu, dann entsank ihm die Hoffnung und sein Blick wanderte zum Fenster hinaus.
»Ich will über die Heide gehen«, murmelte er halblaut, »und die braune Erica suchen.«
Frau Margarete hielt in ihrer Beschäftigung inne und sah zu ihm auf. »Dummes Zeug«, sagte sie, »wollen Sie noch mehr vertrocknete Stängel holen? Sie sollten in einen Garten gehen, wo es Wein oder gutes Bier gibt, damit sie wieder einmal etwas Rot auf die Backen kriegen.«
Er musste lachen und sie lachte mit. »Ist's nicht wahr?«, fuhr sie besser gelaunt fort, »eine Frau kriegen Sie sonst in Ewigkeit auch nicht, mit Ihrem Leichenbittergesicht, und ohne die bleib' ich hier nicht lang' mehr im Hause. Dann möcht' ich sehen, wie's hier zugeht.«
Sie setzte es wie einen Trumpf darauf. Der Gescholtene hatte stumm eine große Karte hervorgezogen und stand darüber gebeugt. »Da ist die Heide von Timaspe«, murmelte er, »da muss die Erica wachsen.«
Die Frau machte ein erstauntes Gesicht. »Herrjemine, woher wissen Sie denn, dass meine Base Rieke auf der Timasper Heide wohnt?« fragte sie.
Seine ernsten Lippen lächelten schelmisch über das Missverständnis. »Das steht in den großen Büchern« antwortete er.
Frau Margarete betrachtete mit Scheu den Folianten, den sie gerade bearbeitete, und legte ihn sorgfältiger als die übrigen vorher wieder an seine Stelle. In den Augen des Gelehrten leuchtete ein glücklicher Triumph. »Sehen Sie, wie nützlich die dicken Bücher sind« betonte er; »wie kommt man denn auf die Heide, wo Ihre Base lebt?«
Die Haushälterin sah ihn misstrauisch an. »Steht denn das nicht in den Büchern?« fragte sie.
Er erwiderte, er wisse nicht gleich, wo es zu finden. Sie fiel ihm schnell ins Wort: »Es wäre auch kein Nutzen dabei. Ich habe gehört, dass jetzt die Eisenbahn nicht weit vorübergeht, aber ich bin niemals da gewesen. Auch die Base Rieke habe ich seit vierzig Jahren nicht wiedergesehen; wir waren damals Kinder und zankten uns immer. Jetzt soll sie halb verrückt sein und ihre ganze Sippe auch.«
Der Professor hatte Hut und Stock genommen und eine Blechkapsel umgehängt. Die Karte steckte aus seiner Rocktasche hervor. »Also Sie gehen sorgsam mit den Sachen um, Frau Margret« sagte er. »Leben Sie wohl, ich komme heute wohl nicht zurück, und morgen wird doch alles trocken sein?«
Sie nickte. »Wollen Sie denn nicht erst frühstücken?« Es war, als sei etwas mit Hast über ihn gekommen. »Ich gehe in einen Wirtsgarten an der Eisenbahn. Adieu, ich will die Erica von Ihnen grüßen.«
Die Haushälterin sah ihm verwundert nach. »Was hat denn der heute auf einmal mit meiner Base Rieke?«, murmelte sie, »da kämen zwei Unkluge zusammen. Aber gut, dass er weg ist, damit es hier einmal wieder menschlich wird«, und sie häufte Exzerpte und Herbarien wie alten Plunder zusammen, dass der Staub aus ihnen aufwirbelte. Nur die dicken Bände rührte sie nicht mehr an und warf manchmal einen misstrauisch nachdenklichen Blick darauf.
Draußen durch die Straßen der großen Stadt wanderte der Professor. Der Frühling lugte ihn aus allen Ecken an und lachte ihm fröhlich ins Gesicht. Auch die Menschen lachten ihm gutmütig ins Gesicht. Sie trugen alle leichte Sommerkleider und er sah wunderlich genug in seinen schweren Winterstoffen zwischen ihnen aus. Nicht ärmlich, denn alles, was er an sich hatte, war reich und kostbar, aber kurios und fast altmodisch. Dazu kam, dass er jeden Augenblick an einem Busche stehenblieb und mit sich selbst sprach. »Ich hätte mir die Vegetation noch nicht so weit gedacht«, sagte er, »es wird fast für die Blüte der Erica janthina zu spät sein. Da sitzt schon eine Bombyxart, die eben aus der Puppe gekrochen.« Er schritt über den Rasen an den alten Weidenstamm, an welchem er die Phaläne von weitem bemerkte. »Es ist die Sphinx convolvuli, der Windenschwärmer« fuhr er, den bei der Berührung flatternden Nachtvogel in seine Büchse sperrend, vergnügt fort, »auch ein frühes und noch ganz unlädiertes Exemplar.« Die Spaziergänger umher ärgerten sich, dass er den bunten Falter seiner jungen Sonnenfreiheit beraubte, aber er gab nicht darauf acht. Endlich kam ein Aufseher dazu und verwies ihn barsch von den Rasenplätzen. der städtischen Anlagen. Der Professor sah verwundert auf und erwiderte freundlich: »Sie müssen den roten Dornstock hier besser von der Raupe der Pieris crataegi säubern, lieber Freund, sonst wird er nicht zur Blüte kommen. »Lieber Freund«, knurrte der Anlagewächter, »ich bin nicht Ihr lieber Frehund. Machen Sie, dass Sie von dem Rasen wegkommen, sonst nehme ich Sie in Brüche.«
Mit einem verbindlichen Gruß, aber kopfschüttelnd ging der Gelehrte weiter. Er vergaß die Zusage, die er Frau Margret gemacht, und schritt an den Wirtsgärten, die einladend ihre deutenden Arme nach ihm ausstreckten, vorüber. Dicht vor ihm ertönte jetzt ein Pfiff, eiliger als zuvor lief er in die wimmelnde Bahnhofshalle hinein.
»Geht der Zug an der Timasper Heide vorbei?« fragte er einen Kondukteur, der wartend vor dem Perron stand.
»Timaspe?«, schnarrte der Angeredete, »Nebenstation, eine halbe Minute Aufenthalt. Einsteigen, der Zug geht ab!«
Der Professor stürzte zurück an die Kasse und löste ein Billet zweiter Klasse nach Timaspe; als er den Perron wieder erreichte, setzte der Zug sich bereits in Bewegung. »Zu spät« rief der Bahnhofswärter; der Schaffner des letzten Waggons, der noch im Begriff stand, die Tür zu schließen, fasste ihn indes noch am Rockkragen und schob ihn hinein. Freilich hatte der Professor Schaden gelitten und war in ein Coupé dritter Klasse geraten, doch er bemerkte es kaum und setzte sich vergnügt in eine Ecke. »Sie haben zweite Klasse, auf der nächsten Station können Sie umsteigen« sagte der Kondukteur, das Billet kupierend. Der Gelehrte dankte; »wie lange fahren wir nach Timaspe?« fragte er. »Zwei Stunden, fünfunddreißig Minuten«, und die Tür flog zu. Der Zug rollte schnell an den letzten vereinzelten Häusern vorüber ins grüne Feld hinaus.
Der Professor hatte, um nicht müßig zu sein, die Karte hervorgezogen und orientierte sich darauf. Neben ihm im Coupé saß ein halb Dutzend junger Burschen, deren Kleidung ihren ländlichen Beruf und den Zweck ihrer Reise in die Residenzstadt verriet. Sie hatten sich schmuck zum Pfingstfest ausstaffiert, manche trugen buntfarbige Bänder auf dem Hute. Auf den Knien hielten sie dickbäuchige mit Fuchs- oder Seehundsfell überzogene Taschen, aus denen allerlei Stadtpräsente für die Muhme oder den Schatz hervorlauerten. Alle Gesichter waren fröhlich wie die sonnige Gegend draußen und sie lachten und schwatzten durcheinander. Aber sie rauchten auch Tabak aus kurzen, silberbeschlagenen Meerschaumpfeifen, das war dem Professor ein Gräuel. Vorzüglich war einer der im Eifer der Diskussion den braun angerauchten Kopf stolz emporhob und eine dichte Wolke ausstieß, die in der Zugluft über die Karte des Gelehrten durchs Fenster zerflatterte. Unruhig streckte dieser seinen Kopf hinaus, um zu erspähen, ob die Station, die ihn aus der Gesellschaft des ominösen Glimmkrautes erlösen sollte, nicht bald herannahe. Dabei fiel ihm zum ersten Male auf, wie lustig und lachend die Welt draußen aussehe. Es wechselte wie kaleidoskopische Bilder: Buchenwälder flogen im ersten Grün vorbei, Häuser mit weitgeöffneten Fenstern, Mühlräder klapperten durch silbersprühendes Wasser. Einen Augenblick wollte der Telegrafendraht, der sich bald hob, bald blitzgeschwind wieder an den Rand des Bahnkörpers hinabsenkte, sich der Gedanken des Professors bemeistern. Physikalische Formeln zogen wie Schatten über seine Stirn herauf, sie begann Ziffern zu addieren, galvanische Gesetze zu kombinieren – da stieg eine Lerche dicht an dem vorübersausenden Zuge auf und schmetterte alle Zahlen und Systeme mit einem hellen Tirili auseinander. Wie ein elektrischer Funke fuhr sie selbst in die physikalischen Gedankenfäden des Gelehrten hinein und schrieb wie ein unsichtbarer Telegrafenbeamter des Frühlings ein Lächeln um seinen Mund. Er wandte den Kopf zurück; die Karte glitt von seinen Knien, er nahm sie, packte sie ins Futteral und steckte dies in die Tasche. Er fühlte einen leisen Schmerz, den das Sonnenlicht ihm in den lange von der grünen Brille beschützten Augen erregt hatte, und legte den Kopf an die Wand, aber vor den geschlossenen Lidern gaukelten ihm noch allerlei lustige Frühlingsgestalten fort. Einige von den jungen Burschen hatten es wie er gemacht. Sie mochten einen tüchtigen Wegtrunk zu sich genommen haben und schliefen. Zwei waren noch wach und plauderten beide miteinander. Endlich verstummte auch der eine von diesen und hörte nur zu, während der andere erzählte. Es war eine lange Geschichte, für den Gefährten, dem sie bestimmt war, vielleicht alt, aber für den Professor, der allmählich aufmerksam hinhorchte, wie etwas von einem anderen Weltteil. Nicht einmal so, denn er war in Australien und Guinea sicher besser zu Hause als in der abgelegenen Dorfwelt, von welcher der Bursche erzählte.
»Die Lisbeth ist früher mit dem langen Franz von der Krummbecker Mühle gegangen, Klopfhans«, sagte er jetzt, »der sprach schon immer davon, sie hat's in die Stadt und möcht' zu Herrschaften. Freilich, wer kann's ihr arg nehmen, weil sie hübscher ist als die andern, will sie sich auch mehr putzen. Aber ich wollt' sie freute sich einmal ebenso, wenn ich abends allein zu ihr komme, als wenn ich ihr etwas Hübsches aus der Stadt mitbringe.«
Dem ehrlichen Burschen tropfte eine Träne auf die Hand mit der er nach seiner Tasche griff. Doch seine Betrübnis verflog und machte einem beifälligen Schmunzeln Platz, wie er ein sorgfältig zusammengepacktes Umschlagetuch von strohgelber Farbe herauszog. Es mochte der geschmackloseste Ladenhüter gewesen sein, den ein Kommis der ländlichen Einfalt unter den preiswürdigsten Lobsprüchen angehängt hatte, aber seine Augen und die seines Gefährten ruhten leuchtend darauf.
»Nun soll sie mir kommen und sagen, dass ich für ihren Putz nicht so viel aufwende, wie die reichsten Bauersöhne für ihren Schatz«, fuhr er selbstbewusst fort, »wenn nur die verfluchte Hexe, die braune Rieke nicht wäre –«





























