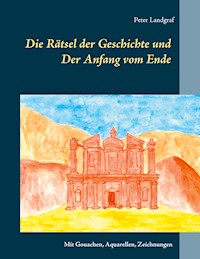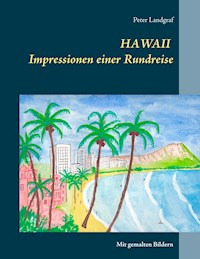Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf allen Kontinenten traf der Autor Menschen, die im zuversichtlichen Glauben eine Antwort auf die Frage nach einem ‚Leben danach‘ in einem jenseitigen Paradies suchten oder auf eine Auferstehung und Wiedergeburt hofften. Bestattungsrituale, Totenkult und Ahnenverehrung, Gottesvertrauen und Gottesfurcht, Jüngstes Gericht, Oberwelt und Unterwelt, Geisterglaube, Hexerei, Zauberei und Fetischismus fand Peter Landgraf auf seinen vielen Reisen in Worten, Schriften, Handlungen und künstlerischen Werken in sehr vielfältiger Weise ausgedrückt, was ihn bewegte, seine Wahrnehmungen, Eindrücke und Empfindungen in diesem Buch festzuhalten. In einundzwanzig unabhängigen Erzählungen führt der Autor den Leser um die Welt und an die unterschiedlichsten kulturellen Schauplätze, wo er außergewöhnlichen Ereignissen beiwohnte und nachhaltige Begegnungen und Beobachtungen erlebte – in seiner deutschen Heimat, im skandinavischen Norden, in Italien, Ägypten, Mesopotamien und Persien, in Zentralasien, Indien und China, auf den Inseln Sri Lanka, Sumatra und Sulawesi, im Outback Australiens, am Titicacasee, bei den Mayas und Azteken, bei den indigenen Völkern Nordamerikas, in Schwarzafrika und schließlich bei den Juden, Christen und Muslimen in Jerusalem.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorgedanken
Kinderträume
Sixtinischer Bilderbogen
Auf den Spuren der Kelten
Sagenumwobenes Nordeuropa
Im Land der Nofretete
An den Ufern von Euphrat und Tigris
Blühende Gärten Persiens
Beim Sufi Ahmed Yasawi in Turkestan
Türme des Schweigens in Baktrien
Eine Träne auf der Wange der Zeit
Im Schatten des Sri Mahabodi
Buddhas Wege durch China
Begegnungen im Regenwald von Sumatra
Ein Leben mit den Toten auf Sulawesi
Im Abseits beim Uluru
Sonne über dem Titicacasee
Das Blut der Maya und Azteken
Macht und Kraft des Manitus
Verzaubernder Kontinent
Stadt des einzigen Gottes – Jerusalem
Gospel Inspiration
Schlussgedanken
Von diesem Kreis, in dem wir hier uns drehen,
Kann ich nicht Anfangspunkt, nicht Endpunkt sehen.
Noch keiner sagt’ mir, wo wir kamen her,
Und keiner weiß, wohin von hier wir gehen.
Omar Khayyam, 1048-1131
Persischer Dichter, Philosoph und Mathematiker
Vorgedanken
Die nur im zuversichtlichen Glauben zu erfahrende Antwort auf die Ungewissheit nach dem ‚Leben danach‘ in einem jenseitigen Paradies, die Frage nach einer Auferstehung oder Wiedergeburt beschäftigte die Menschheit von ihrem Anbeginn bis heute.
Bestattungsrituale, Totenkult und Ahnenverehrung, Gottesvertrauen und Gottesfurcht, Jüngstes Gericht, Himmel und Hölle, Oberwelt und Unterwelt, Geisterglaube, Hexerei, Zauberei und Fetischismus fand ich auf meinen vielen Reisen in Worten, Schriften, Handlungen und künstlerischen Werken in vielfältiger Weise und von Völkern aller Kontinente ausgedrückt, was mich bewegte, meine Wahrnehmungen, Eindrücke und Empfindungen in diesem Buch festzuhalten.
Kinderträume
Als Kind überlebte ich die Qual der Hölle. Das Heulen der Sirenen weckte mich allzu oft aus tiefem Schlaf, zerriss meine Kinderträume vom Naschen der Süßigkeiten am Weihnachtsbaum oder aus der Bonboniere an der Kasse des elterlichen Geschäftes. Die Royal Air Force und die US Army Air Force flogen neunundfünfzig Luftangriffe auf Nürnberg, sechs Mal am helllichten Tag, dreiundfünfzig Mal in der Nacht. Die Mutter stürzte ins Zimmer aus Sorge, mein Bruder und ich könnten weiterschlafen. „Schnell, schnell“, rief sie uns zu. Notdürftig zogen wir uns an. Draußen herrschte bittere Kälte, als wir am 2. Januar 1945 losrannten. Der Luftschutzkeller im Wohnhaus der Familie schien der Mutter nicht sicher genug. Oma und Opa blieben mit ein paar älteren Mietern dort. „Gott wird unser Haus und uns beschützen“, bemerkte Opa mit dem Gebetbuch in der Hand öfters. Er nahm es mit in den mit Eisentüren abgeschotteten Raum, ohne darin lesen zu können. Es herrschte Verdunkelungspflicht, drinnen wie draußen. Wir erreichten den tief in die Erde gegrabenen öffentlichen Luftschutzkeller in wenigen Minuten; den Wodan-Bunker, er war nur etwa einhundertfünfzig Meter von unserem Haus entfernt. Die langen Wollstrümpfe waren mir heruntergerutscht, da ich in der Eile mein Leibchen nicht anzog. Noch bevor wir die lange Treppe in den Keller hinunterstürzten, heulten Abfangjäger über uns hinweg. Die Flaks gaben Schüsse auf die Angreifer ab. Dann dröhnte der Knall der ersten zerberstenden Bombe in unseren Ohren. Sekunden darauf waren wir in Sicherheit, umgeben von fünf Meter dicken Mauern unter einer sieben Meter starken Betondecke in einem von mehreren Stahlschleusen gesicherten Raum. Eine Notbeleuchtung zeichnete schemenhaft die Gesichter der sich ängstlich zusammendrängenden Menschen; meist Mütter mit Kindern und ältere Frauen und nicht mehr wehrtaugliche Männer.
Plötzlich bebte die Erde. In unmittelbarer Nähe schlugen mehrere Bomben ein. Waren es zehn, oder zwanzig oder gar dreißig? Die Detonationen dröhnten unten im tiefen Bunker nur dumpf. War auch unser Haus getroffen worden? Die Frage ging nicht nur mir durch den Kopf. Die Mutter drehte für Sekunden mit besorgt fragendem Blick ihr Gesicht in Richtung unserer Wohnung. Noch einmal zitterten die Wände; und noch einmal. Dann herrschte Ruhe.
Die Minuten vergingen quälend langsam. Die Unruhe wuchs. Endlich wurden die Türen geöffnet. Der lang anhaltende, einförmige Ton der Sirene signalisierte Entwarnung. Wir hasteten die Treppen hinauf ins Freie, vorneweg die Mutter, den Hebel der Dynamotaschenlampe mit zuckenden Fingern drückend, was nicht erlaubt war, sie aber nicht kümmerte.
Entsetzen lag in unseren Augen. Ringsum herrschte ein Inferno. Die Häuserzeile der Hagenstraße brannte lichterloh. Dachstühle stürzten in sich zusammen, Ziegel und Balken flogen auf die Straße, Deckengewölbe barsten und begruben das Innere der Häuser unter sich. Der nächtliche Himmel über Nürnberg war rot gefärbt, alles Entflammbare in der Stadt brannte. Wir atmeten Rauch und Staub.
Wie die Chronisten berichteten, warfen in dieser Nacht fünfhunderteinundzwanzig Bomber der Royal British Air Force in dreißig Minuten sechstausend Sprengbomben und eine Million Brandbomben ab. Es war der schwerste Angriff auf meine Heimatstadt im Zweiten Weltkrieg; eintausendachthundert Menschen starben, einhunderttausend wurden obdachlos, die Altstadt lag in Trümmern. Der flächendeckende Abwurf von Stabbrandbomben entfachte glühende Feuerstürme. Die Großbrände sogen unersättlich die Luft und mit ihr den Sauerstoff in rasendem Tempo aus den Straßen und Kellern und die damit einhergehenden hohen Temperaturen und thermischen Orkane ließen die durch Trümmer und Luftdruck zu Boden geworfenen Opfer durch Verbrennen, Ersticken oder Austrocknung sterben.
Bereits aus der Ferne sahen wir Flammen aus dem Dachstuhl unseres Hauses züngeln. Wir eilten hin, die Treppen hinauf bis ins dritte und vierte Stockwerk. Dort standen während der Kriegsjahre mit Wasser gefüllte Putzeimer und ein Trog mit Sand bereit, um von Brandbomben entfachte kleinere Feuer bekämpfen zu können. Alle Bewohner des Hauses bildeten eine Menschenkette, die von Person zu Person volle Eimer in das Dachgeschoß zum Löschen handelte und die leeren hinunter gleiten ließ, um sie erneut zu füllen. Zwei Feuerlöscher und eine Handspritzpumpe reichten glücklicherweise aus, die beiden Brandherde der Phosphorbomben zu ersticken.
Sieben Wochen später griff die US Army Air Force zweimal hintereinander am Tag an. Während des Hastens zum rettenden Bunker wurde das Geheul der Sirenen von knallenden Schüssen der in Aktion tretenden Flakbatterien begleitet. Noch ehe wir in Sicherheit waren, brach die Hölle los. Erste Bomben detonierten. Eine Luftmine schleuderte hinter uns um ihr Leben rennende Mütter und Kinder zu Boden. Abgeworfene Phosphorkanister entfachten bereits Feuersbrünste, als wir die Treppe zur Sicherheitstür hinunterstürzten.
War es Glück im Unglück? Waren es die von Oma und Opa angerufenen Schutzengel, die das großelterliche Haus retteten?
Inmitten der Straße war eine Sprengbombe explodiert, die einen riesigen Trichter von Bürgersteig zu Bürgersteig riss, zwei Alleebäume fällte, die Schienen der Trambahn wie ein modernes Kunstgebilde hoch in die Luft bog und ringsum alle Fensterscheiben zersplittern ließ. Aus unserem Wohnzimmers im ersten Stock hing die eine Hälfte des bordeauxroten Samtvorhangs, den der dem Luftdruck folgende Sog hinauszog; die zweite Hälfte lag von Glassplittern zerfetzt und zusammengeknüllt in einem der eingedrückten Schaufenster des elterlichen Geschäfts.
Auf der Hofseite des Hauses klaffte ein gewaltiges Loch. Eine der Bomben hatte den Balkon über Opas Werkstatt gestreift und zertrümmert, wobei sie von dem aus der Wand ragenden Eisenträger an der Wange neben dem Zünder aufgerissen und gedreht wurde, so dass sie mit dem Leitwerk zuerst die Hauswand und dann die Decke zum Keller durchschlug, ohne zu explodieren und ihre diabolische Kraft entfalten zu können.
Wie ein Lauffeuer machte die Nachricht von der totalen Zerstörung der nahen Holzgartenschule, in der ich gerade die erste Klasse besuchte, und der Einstellung des Unterrichts die Runde. Die Freude währte nicht lange. Der Betrieb wurde in die Scharrerschule ausgelagert und der Schulweg verlängerte sich von einer viertel Stunde auf fünfzig Minuten.
Dreimal mussten wir noch vor den Angriffen der British und der US Air Force in den Wodan-Bunker flüchten. Dann war der Krieg zu Ende. Am 20. April 1945 kapitulierte Nürnberg, am 7. Mai Deutschland, ab dem 8. Mai herrschte Frieden.
Soldaten der 3. US Infanteriedivision durchkämmten die Stadtviertel Nürnbergs nach Widerstandskämpfern, auch die Wodanstraße. Ich stand vor unserem Haus, als der erste Panzer langsam vorbeirollte, gefolgt von offenen Jeeps und Lastwagen mit Soldaten und Maschinengewehren auf der Pritsche. Fußsoldaten begleiteten den Zug, die ersten mit Waffen im Anschlag, die danach folgenden winkend und Süßigkeiten zu den Kindern werfend – kleine Täfelchen mit Schokolade von Hershey’s und Wrigleys Kaugummi. Einige Soldaten hatten schwarzbraune Gesichter. Wir nannten sie Neger, ohne dabei herabwürdigende Gedanken zu haben.
Das als Kind erlebte infernalische Dröhnen der Bomber und das Aufheulen der Sirenen hinterließen über Jahre hinweg traumatische Störungen, die, oft von Blitzen begleitet, zu Albträumen führten, aus denen ich schweißgebadet und von panischer Angst getrieben aufschreckte.
In der Schule hörten wir von Pfarrer Müller aus unserer Gemeinde, dass einst Gott die Erde schuf und darüber den Himmel wölbte, Licht werden ließ, die Pflanzen und Tiere hervorbrachte und schließlich als Vollendung im Garten Eden den Menschen als Mann und Frau formte. Folgsam und busfertig sollten wir sein, ehrfürchtig vor Gott und gute Werke Dritten gegenüber tun, damit wir das Himmelreich erlangen könnten. Das waren seine mahnenden Worte bei der Vorbereitung auf die Erstkommunion.
Es fiel schwer, in einer Welt der Wüste, der Entsagung und manchmal auch des Hungers daran zu glauben und doch hegte ich im Kindesalter die zarte Hoffnung, dem Fegefeuer im Vorhof zur Hölle gerade entronnen, dass mir in fernen Zeiten weitere Qualen erspart blieben und am Ende aller Tage der Weg in das himmlische Paradies offen stünde.
* * *
Meine Mutter war für mich und unsere kleine Familie allgegenwärtig. Meinen Vater kannte ich nicht. Er befand sich von Anfang an als Soldat im Krieg und meine Vertrautheit zu ihm beschränkte sich auf das Betrachten von Bildern in den Fotoalben. Mit Erfrierungen an Zehen und Fingern aus den Kampfgebieten des Kaukasus zurückgeschickt, geriet Vater während der letzten Kriegstage in russische Gefangenschaft. Über das Rote Kreuz erfuhren wir nach ein, zwei Jahren der Ungewissheit, dass er noch lebte und zuerst im Ural und dann in einem Straflager in Wyschni Wolotschok interniert war. Ich schlug sofort seinen Atlas auf, Andrees Allgemeiner Handatlas von 1930, und fand den Ort auf halber Strecke zwischen Moskau und St. Petersburg. Am 3. März 1948 erfüllte sich das bange Hoffen. Nach dem Aufstehen bemerkte ich einen Mann in der Tür, den ich als meinen Vater erkannte. Er schloss mich in seine Arme und hielt mich lange schweigend fest. Mein großes Glück begann.
Sixtinischer Bilderbogen
Als Vater empfand ich Freude an jedem noch so kurzen Urlaub oder Ausflug übers Wochenende mit unseren Kindern. Ich versuchte, ihnen sehenswerte Ecken unserer Heimat zu erschließen – die Pfalz, Franken, Oberbayern, das Tal der Mosel und Hamburg zum Beispiel – oder den Adriaurlaub mit einem Abstecher nach Venedig zu verbinden und von der Costa del Sol aus mit ihnen Granada, Cordoba und Sevilla in Andalusien zu entdecken.
Im Sommer 1983 machten wir uns auf den Weg nach Rom, meine Frau und ich und unsere beiden Kinder. Aus Angst vor dem in den italienischen Landen unermüdlichen Autoklau ließen wir den Mercedes in der Garage und fuhren mit unserem Kultgefährt los, einem roten Manta mit schwarzem Vinyldach. Das schnittige Coupé war mit einem 1,9-l-Motor und 90 PS bestückt. Die oben liegende Nockenwelle lieferte eine hohe Drehzahl mit verstärktem Drehmoment bei angenehmer Laufruhe durch die Kurzhubtechnik, alles zusammen ausreichend, um uns vier in den Süden zu bringen.
Das eigentliche Ziel waren der Golf von Neapel und Sorrent mit Pompeji an den Hängen des Vesuvs und die sich anschließende amalfitanische Küste, wo wir in Positano ein geräumiges Apartment in einer privat geführten Pension gemietet hatten – sechshundertvierzig Stufen über dem Meer, was täglich zum intensiven Training herausforderte.
In Rom machten wir Zwischenstation. Wir wohnten im vorweg gebuchten Hotel Imperiale in der Via Vittorio Veneto. Der Concierge überraschte mich beim Eintreffen mit der Mitteilung, dass ich am nächsten Vormittag an einer Vorstandssitzung teilnehmen sollte, um das vorzutragen, was ich vor meiner Abreise nach eingehender Analyse in eine Empfehlung kleidete, die den Entscheidungsträgern als formgerechte Beschlussvorlage auf dem Schreibtisch lag.
In leuchtenden Farben hatte ich mir seit Wochen den ersten Abend in der Via Veneto, wie die Einheimischen sie kurz nennen, ausgemalt – ein Bummel zum Park der Villa Borghese, auf dem Rückweg Essen mit den Kindern in einem schicken Restaurant und danach ein abschließender Besuch, allein mit meiner Frau, vielleicht in der Bar des damals im Rampenlicht stehenden Hotels Excelsior. Die Via Veneto war die Straße des ‚Dolce Vita‘, der irdischen Verwirklichung paradiesischer Lebensträume, wo liebeshungrige Gigolos und Papagallos aller Altersklassen im Rolls Roys, Maserati, Lamborghini, Ferrari, Porsche und anderen luxuriösen Karossen mit aufreizenden Frauen aller Haar- und Hautfarben auf und ab fuhren, alle ständig im Visier der Paparazzi, die nach exzentrischen Fotomotiven der nächtlichen Szene Ausschau hielten. Frederico Fellini hatte in seinem Film nicht nur dieser Straße und dem nahen Trevi Brunnen, sondern der ganzen damaligen Zeit ein Denkmal gesetzt.
Marcello Mastroianni verkörperte den Paparazzo und Frauenheld auf den Spuren der Prominenz der ‚vornehmen Gesellschaft‘, des Jetsets, der Schickeria; Anita Ekberg den Vamp, die Diva, die ihre verlockenden Reize apfelgleich aus dem Dekolletee hervorquellen ließ.
Marbella, Monte Carlo, Gstaad und St. Tropez hießen die weiteren Tummelplätze des Süßen Lebens, von Aga Khan bis Gunter Sachs reichten die Namen der sich dort zur Schau stellenden.
Doch aus meiner Absicht, wenigsten einmal in die Salons und Bars des Großen Fressens und orgastischer Gelage hineinzuschnuppern, wurde nichts. Ein Taxi brachte mich zum Flughafen Fiumicino und die Spätmaschine der Alitalia von Rom nach Frankfurt.
Der Rest meiner Familie vergnügte sich tags darauf mit einer Runde über die Piazza Barberini zur Fontana di Trevi, wo sich Frank, damals zehnjährig, über die Brüstung ins Wasser springend die Taschen mit Münzen aus aller Welt vollstopfte, von dort zum Kolosseum, weiter zum Forum Romanum und schließlich zur barocken Piazza Navona mit den drei Brunnen Berninis, wo sie eine Pizzeria aufsuchten, anschließend zum nahen Pantheon gingen und zum Schluss wie weiland schon Goethe im Café Greco bei der Piazza di Spagna einkehrten und dort auf meine späte Rückkehr warteten.
Mit Giuseppe war ursprünglich eine Führung durch den Petersdom und die Museen des Vatikans verabredet, die wir leider um einen Tag verschieben mussten, was nicht in seinen Zeitplan passte. Maria würde uns an seiner Stelle am Obelisken um 12 Uhr erwarten – erfuhren wir von der Agenzia Nationale del Turismo, mit der sich der Concierge in Verbindung setzte – aber nur drei Stunden zur Verfügung stehen.
So spielte ich den Guide, nahm mit meinen Lieben in der Mitte des von Kolonnaden eingerahmten Petersplatzes Aufstellung und ließ, das Heer der von Bussen ausgespienen Touristen ignorierend, die gewaltige Fassade des größten und schönsten Doms der Christenheit mit der dahinter himmelwärts strebende Kuppel auf uns wirken, die von einem weiteren Tambour mit einer kleineren Kuppel und einem vergoldeten Kreuz gekrönt wird. Auf zwei Sockeln thronen rechts und links der zum Hauptportal führenden Stufen der Hl. Apostel Petrus und der Hl. Paulus – der Kirchengründer und der um das östliche Mittelmeer gereiste erste Verkünder der Frohen Botschaft. Beide fanden wegen ihres missionarischen Eifers wenig weltlichen Lohn, sie starben den Märtyrertod in Rom. Über dem Grab des Hl. Petrus wurde der nach ihm benannte Dom von Kaiser Konstantin I erbaut, die Ruhestätte des Hl. Paulus blieb bisher unauffindbar.
Mir lag daran, meinen Kindern nicht nur die in allen Büchern gepriesenen Höhepunkte zu zeigen – den Hochaltar des Papstes mit dem Tabernakel und den gewundenen Säulen, darüber den Licht durchfluteten Kuppelraum mit dem vergoldeten Rippengewölbe, Michelangelos Pietà mit der Madonna und dem Leichnam des Heilands auf dem Schoß – sondern sie dorthin zu führen, wo ich vierzehn Jahre vorher bleibende Empfindungen verspürte. Bei den beiden vorderen Pfeilern der Vierung stiegen wir hinab zur Cappella dei Papi und Sacre Grotta Vaticano wo wir vor den Grablegen der letzten Päpste standen – mit Travertin und Marmor verkleidet oder mit kostbarem Porphyr umhüllt. Auch Kaiser Otto II fand hier seine letzte Ruhestätte, der Glücklose, der nach militärischer Niederlage in Süditalien von der Malaria dahingerafft wurde.
Unterhalb der Krypta, vom Innenraum des Doms nicht zu erahnen, befindet sich die antike Nekropole und in ihr die Confessio Sancti Petri direkt unter dem Hochaltar, das Grabmal des Heiligen Petrus, zu dem Cardinal Angelo Comastri im Internet auf einer virtuellen Pilgertour führt. Das ursprünglich hinter einer roten Stuckwand angelegte schlichte Grab wurde nach seiner Wiederentdeckung kostbar verkleidet. Verständlich die Sehnsucht der Päpste, ebenfalls möglichst nahe bei ihm begraben zu sein.
Petrus war es, der den Grundstein legte, dem Auftrag Christi folgend: „Du bis Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und dir gebe ich den Schlüssel zum Himmelreich.“ Diese von Matthäus in seinem Evangelium überlieferte Botschaft steht in großen Lettern am inneren Rand der Kuppel, zu der wir sodann hinaufstiegen.
Zwischen dem ersten und zweiten linken Säulenpaar des Langhauses führte ein Wendelgang auf das Dach des Doms, das Frank über die einhundertneunzig Stufen noch vor uns erreichte, die wir den Aufzug nahmen. Was für ein faszinierender Blick hinunter auf den Petersplatz und über die Engelsburg hinweg auf die Dächer Roms!
Ich drängte weiter, hinüber zum Aufgang auf die Kuppel, zu deren obersten Rand weitere dreihundertzwanzig Stufen zu gehen waren, zuerst in einer Art Treppenhaus, zuletzt zwischen der inneren und äußeren Kuppelschale in Schräglage, die auf den letzten Metern ein Vorwärtskommen nur auf allen Vieren ermöglichte.
Der Blick von der inneren Galerie der Kuppel einhundertdreiundzwanzig Meter hinunter auf die Vierung mit dem Papstaltar wurde zum unvergesslichen Erlebnis. „Tu es Petrus…“, wir waren hier der in Latein gehaltenen Botschaft aus dem Evangelium des Matthäus ganz nahe, und auf der kleinen Galerie draußen drängten sich Besucher, die dem den Petrus sinnbildlich übergebenen Schlüssel zum Himmelreich nicht so nahe zu stehen schienen – ihre Sehnsucht galt den besten Fotomotiven.
Wir hatten noch Zeit für den Besuch einer weiteren außergewöhnlichen Sehenswürdigkeit, bevor wir von Maria erwartet wurden. Ich ging voran die Freitreppe hinunter zur Westseite des Doms. Am Tor und Durchgang zur Piazza Circo Neroniano standen zwei Wächter der Schweizergarde. „Wir möchten den Campo Santo Teutonico besuchen“, sagte ich und die beiden Gardisten gaben den Weg frei. Die Kinder staunten. Lächelnd zuckte ich nur mit den Achseln.
Zuerst querten wir den Platz, der ursprünglich Teil eines römischen Zirkus war, auf dem der Obelisk stand, den Papst Sixtus V in die Mitte des Petersplatzes versetzen ließ. Dann tat sich linkerhand ein Park auf, bestanden mit Palmen und exotischen Pflanzen unter denen Grabsteine zu sehen waren, umgeben von einem alten Palast und einer Kirche – wir befanden uns auf dem exterritorialen Gebiet der Deutschen im Vatikan. Hier erlitten im Jahr 67 die ersten Christen den Märtyrertod, las ich auf einer Tafel meinen Kinder vor. Die Gebäude wurden erstmals 799 als „Scuola Francorum“ erwähnt, als Karl der Große in Rom weilte. Seit 1454 befindet sich das Areal im Besitz einer Erzbruderschaft, die eine Kirche erbaute, in der deutschsprachiger Gottesdienst gehalten wird. Ein Priesterkolleg und ein Institut für Christliche Archäologie sind hinzugekommen.
„Wer wird hier beerdigt“, wollten die Kinder wissen?
„Dieses Recht haben nur Mitglieder der auf dem Campo Teutonico ansässigen Einrichtungen.“
* * *
Sie als auch wir waren pünktlich. Maria entpuppte sich als Römerin mit großem Wissen, das sie, ohne uns zu überhäufen, auf Fragen von sich gab, und sie flocht Anekdoten ein. Sixtus V ließ den Obelisken, an dessen Basis wir uns verabredet hatten, hier aufstellen. Die genaue Bedeutung der vierkantigen Säule, die keine Hieroglyphen trägt, gibt Rätsel auf. Der Präfekt Roms in Ägypten soll sie in Auftrag gegeben haben, zu Ehren Augustus, Caesars Stiefsohn, der zum ersten Kaiser Roms aufstieg – anders als Caesars leiblicher Sohn, Caesarion genannt, der aus einer Liaison mit Kleopatra hervorging und als Ptolemaios XV lediglich Mitregent an der Seite seiner Mutter wurde. Alles keine Gründe zur Aufstellung des Obelisken auf dem Petersplatz durch einen Papst. Eine Verbindung zu den Kopten, den ersten Christen in Ägypten gäbe auf Grund der Meinungsverschiedenheiten mit den christlichen Päpsten auch keinen Sinn; eher schon die Tatsache, dass der Obelisk ehemals in Alexandria stand, wo der Evangelist Markus den Märtyrertod erlitt, und später in Rom nahe der Stelle an der Petrus gekreuzigt wurde.
„Über Sixtus V werde ich mehr berichten, wenn wir in der von Sixtus IV erbauten und nach ihn benannten Kapelle sind“, gab Maria zu verstehen und führte uns durch die Kolonnaden des Platzes zur Via dei Porta Angelica, um den Vatikan zu umrunden, bis wir in der Viale Vaticano an der unscheinbaren, rückwärtigen, von tristen Mauern gesicherten Seite den Haupteingang zu den Vatikanischen Museen erreichten.
Drinnen erwarteten uns zahllose Museumsräume mit Büsten und Skulpturen, Bibliotheken, Pinakotheken, Loggien gleiche halb offene Bogenhallen, Säle, die Stanzen genannte Folge kleinerer Räume und die Sixtinische Kapelle. Drei Kunstwerke fesselten mich besonders: der Sarkophag der Hl. Helena aus rotem Porphyr, der Mutter Konstantins des Großen, die in Jerusalem die Grabeskirche, in Bethlehem die Geburtskirche und auf dem Sinai am Fuße des Mosesberges die Marienkapelle erbauen ließ, die sich nach späterer Überbauung unter der Apsis der Kirche des Katharinenklosters befindet; die aus Marmor geschlagene Gruppe Laokoons, der auf Geheiß des von ihm beleidigten Apollos mit seinen beiden Söhnen von zwei Riesenschlangen gewürgt und getötet wird; und in den Stanzen Raffaels die Schule von Athen, ein überdimensionales Wandgemälde, mit dem der Künstler den Fürsten des Geistes ein Denkmal setzte, unter ihnen Plato, Aristoteles, Sokrates, Diogenes, Ptolemäus und Euklid.
Maria führte uns noch durch zwei kleinere Räume, denen wir trotz weiterer Kunstwerke Raffaels wenig Beachtung schenkten, dann in ein achteckiges Gewölbezimmer, um dahinter treppauf treppab endlich durch einen schmalen Gang zum zweiten großen Ziel des Tages zu gelangen, in die Sixtinische Kapelle.
Maria zog mit spitzen Fingern ein Notizbuch aus ihrer Jackentasche. „Ich habe eine Übersetzung der wichtigsten Bibelstellen ins Deutsche dabei“, sagte sie und begann daraus vorzulesen: „Gott sprach: Es werde Licht...“ So wurden die Fresken am Deckengewölbe für uns zu Bildern der heiligen Schrift, die ihren Wahrheitsgehalt verständlicher machten.
Die erste Gemäldegruppe handelte von Gott und der Schöpfung des Universums, der Scheidung von Licht und Finsternis, der Trennung von Land und Wasser und der Erschaffung der Gestirne und Pflanzen, erzählte sie und las dabei die Texte aus der Genesis.
Sie ging weiter und blieb in der Mitte der Kapelle stehen. „Die wohl bekannteste und ebenso aufregende wie ergreifende Darstellung sehen sie hier, die Erschaffung Adams.“ Sie blickte in die Notizen und rezitierte: „Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn“. Gott schwebte von Engeln begleitet vom Himmel herab und berührte mit seinen Fingern jene Adams, auf den sich dadurch sinnbildlich der Lebenshauch Gottes übertrug.
„Die Bildgeschichte daneben mit der Erschaffung Evas“, fuhr Maria nach oben deutend fort, „stellt den Übergang zum nächsten Ereignis, dem Sündenfall dar“.
Sie griff wieder zum Notizbuch: „Gott, der Herr, schickte den Menschen aus dem Garten Eden weg. Er vertrieb den Menschen und stellte östlich des Garten Edens die Cherubim auf und das lodernde Flammenschwert, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachten.“ „Für Adam und Eva gab es kein zurück“, schloss sie die Worte der Genesis.
Gott war unnachgiebig und unbeugsam. Er hatte gerade einmal zwei Menschen erschaffen und da vertrieb er sie schon wieder aus dem Garten Eden, dem irdischen Paradies, nur weil sie vom verbotenen Baum aßen, weil sie sich verführen ließen, weil die Frau den Verlockungen erlag und ihren Mann in den Sündenfall mit hineinzog. Das für alle nachfolgende Menschen Unverständliche war geschehen. Zwei hatten gesündigt und alle Nachkommen mussten darunter leiden. Sie leiden noch heute und müssen einen Weg voll Mühsal gehen.
Was ihnen blieb, war und ist die Hoffnung auf den Jüngsten Tag, auf das Große Gericht, und damit verbunden die Sehnsucht, dass den Christenmenschen bei guter Führung und reichlich praktizierter Nächstenliebe das himmlische Paradies sich eröffnen könnte.
Nachdenklich wandte ich meinen Blick von Michelangelos Meisterwerk der Malerei im Gewölbe der Sixtinischen Kapelle. Um uns herum scharten sich Touristengruppen, von italienisch, englisch, französisch, deutsch, russisch und sonstige Sprachen sprechenden Führern zu den besten Standorten geschleust; vereinzelt auch betende, allein schauende, fotografierende, in sich gekehrte, aber auch laut sprechende und wild gestikulierende Besucher.
Maria machte uns auf die Seitenwände der Kapelle aufmerksam, wo Geschichten aus dem Leben Moses und Jesus dargestellt wurden, und ging weiter zur Altarwand mit Michelangelos bildhafter Interpretation des Jüngsten Gerichts. In Erwartung des Urteilsspruchs scharen sich Maria, Heilige und Auserwählte um Christus, der aus dem Zentrum nach vorn schreitend die Darstellung dominiert. Mit einer würdevollen Geste scheint er die Glorifizierten auf sich zu ziehen und die Verdammten zu besänftigen. Engel der Apokalypse untermalen mit Fanfarenklängen die Szene, in der die Auferweckten zum Himmel aufsteigen, während die Verstoßenen von engelgleichen Wächtern und Dämonen in die Hölle getrieben werden.
Die Führung war zu Ende und wir bedankten uns am Ausgang bei Maria. An gleicher Stelle zog viele Jahre später ein anderer Reiseführer ein kleines bedrucktes Faltblatt aus seiner Tasche hervor, und, bevor er es uns als Andenken übergab, las er daraus die Worte einer Predigt, die Papst Johannes Paul II am 8. April 1994 hielt: „Wenn wir vor dem Jüngsten Gericht stehen, geblendet von seiner Herrlichkeit und dem Schrecken, bewundern wir die glorifizierten Körper und die ewig Verdammten. Dann begreifen wir die Gesamtansicht, die ganz von einem einzigartigen Licht und künstlerischer Logik durchflutet wird – das Licht und die Logik des Glaubens, die die Kirche im Gebet verkündet: Ich glaube an einen einzigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde und aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge.“
Zurück zu Maria: Beim Hinausgehen kam sie nochmals auf die Päpste Sixtus IV und V zurück. „Ich erzählte Ihnen, dass Sixtus V den Obelisken versetzte. Er war ein strenger Papst, der sich gegen die ausufernden Sitten wandte und für Kuppelei, Ehebruch, Inzest, Abtreibung und Homosexualität einen Katalog scharfer Strafen aufstellte.
Von ganz anderem Charakter war Papst Sixtus IV, der Erbauer der Sixtinischen Kapelle. In ihm sei keine Liebe zu seinem Volk gewesen, schrieb ein damaliger Senatsschreiber, er war von Wollust, Geiz, Prunksucht und Eitelkeit getrieben und aus Geldsucht habe er Ämter gegen bare Münze verkauft und Vetternwirtschaft betrieben.
Beide werden am Jüngsten Tag wohl vor das gleiche Gericht treten müssen“, sagte es und verließ uns winkend.
Auf den Spuren der Kelten
Als Großvater lud ich die beiden älteren Enkelkinder, Annika und Lukas, zu einem Ausflug ein, als sie in der Schule hörten, dass im Raum Köln, wo sie zu Hause sind, einst die Ubier siedelten und im Taunus, wo wir wohnen, und in ganz Hessen die Chatten. Ich wollte ihnen die stillen Zeugen einer noch früheren Besiedlung zeigen – Schutzgräben und Ringwälle – und sie auf die bei Grabungen entdeckten großartigen künstlerischen Werke aufmerksam machen, die bis in die Jungsteinzeit zurückreichen.
Am Bürgelstollen vorbei, einer tief im Inneren des Altkönigs gefassten Quelle, gingen wir den Kaiserin-Friedrich-Weg, bogen nach geraumer Zeit in den Forstmeister-Valentin-Pfad und stapften nach etwa einer halben Stunde, vorbei an der Joseph-Jäger-Eiche, den schmalen Pfad hinauf zum Hünerberg. Von Hünen sei er bebaut worden, mit Hühnern habe er nichts zu tun, sagt die Legende.
Wir näherten uns von der steilen, von schroffen Felsen geschützten Nordwestflanke, die stellenweise von Menschenhand mit einer Trockenmauer befestigt und verlängert wurde. Auf der 375 Meter hohen Kuppe herrschte im 8. und 9. Jahrhundert zur Zeit der Karolinger reges Leben, das sich mit dem Bau der Kronberger Burg und der Gründung einer kleinen Stadt talwärts verlagerte.
Der Ausblick reichte weit in die Mainebene. Die auf einer hölzernen Wandtafel anlässlich eines Partnerschaftstreffens mit Vertretern Gilboas in Israel niedergeschriebenen Verse stimmten nachdenklich:
Schamanentrommeln schlagen
Glockengeläut am Kirchturm
Vom Minarett ruft der Muezzin
Zimbeln erklingen im Tempel
Schofartöne in der Synagoge
Das einfache Gebet
eines einfachen Menschen
in einem einfachen Haus
oder einfach
unter freiem Himmel
Sie alle richten ihr Suchen nach
dem selben nur Ahnbaren,
nicht Wissbaren
ihrer Hoffnung
R. K.
Wer sich hinter den Initialen verbarg, wurde nicht verraten, sowenig wie eine Antwort auf die versteckte Sehnsucht versucht wurde, die den Leser, die bisher alle Menschen bewegte und immer wieder zu der Frage führte, woher wir denn kommen, wohin wir gehen und was uns jenseits erwartet.
Der licht bewaldete, sanft nach Osten fallende Höhenrücken wurde mit einem Ringwall begrenzt, der, dem Gelände angepasst, ehemals etwa fünf Meter breit war und die Anlage vor angreifenden Feinden schützte.
Eine Öffnung ließ auf die Reste eines Eingangstores schließen, ein Aushub ein paar Schritte weiter auf einen alten Steinbruch und die in einer Kuhle in der Nähe gefundenen Gräber und Artefakte zeigten, dass die Geschichte des Hünerbergs bis in die Zeit vor Christus zurückreicht. Wahrscheinlich hatten die germanischen Rheinfranken, die Vorgänger der Chatten, der heutigen Hessen, den Grundstein einer ersten Siedlung auf der Bergkuppe gelegt.
Ob bereits die Kelten vor ihnen hier ansässig waren, ist nicht belegt. Deren Spuren finden sich auffällig sichtbar auf dem Gipfel des Altkönigs, dem dritthöchsten Berg des Taunus, den sie schlicht ‚alkin‘, Höhe, nannten, woraus im Lauf der Zeit der klangvolle Altkönig wurde. Rings um das Gipfelplateau bauten die Kelten um 400 vor Christus aus groben Steinen zwei Ringwälle, die mehr als zwei Kilometer messen und die Bergkuppe zu einer Fliehburg machten.
Da die Enkel diese wehrhafte Anlage bereits kannten, verzichteten wir an diesem Tag auf den Aufstieg und nahmen den Weg nach Osten.
Die Hohemark im Norden Oberursels erwanderten wir in dreiviertel Stunden mit dem Versprechen, für den Nachhauseweg die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen.
Im Taunus und in der Wetterau siedelten keltische Stämme bereits zur Eisenzeit – das war im ersten Jahrtausend vor Christus. Stille Zeugen ihrer frühen Kultur haben sie an der Ostflanke des Feldbergs hinterlassen, auf dem Bleibeskopf und im oberen Urselbachtal.
Wir stiegen zur Anhöhe hinauf, der Goldgrube, wo die Kelten das größte von drei befestigten Dörfern erbauten, die sie mit Ringwällen schützten. Oppidum nannten die Römer diese wehrhaften Anlagen, als sie einen Teil Germaniens besetzt hielten.
Die Enkel lasen eifrig die Schautafeln, die Auskunft über das Leben gaben, das in der Natur und mit ihr stattfand, kaum nachvollziehbar in unserer technisierten Welt des bequemen Überflusses. Kleidung, Nahrung, Wohnung, Feuer – alles musste von allen Tag für Tag von Hand gemacht, gepflegt und bewahrt werden.
Die „Drei“ und das „Rad“ spielten in ihrer Mythologie eine zentrale Rolle: dem Ende – der Abfolge von Werden, Sein, Vergehen – folgt ein neuer Beginn; Erde, Wasser und Luft widerstehen dem Feuer, denn das Sonnenrad dreht sich und bringt jeden Tag neues Leben hervor. Diese Weisheiten hielten die kunstfertigen Kelten in filigranen Ornamenten auf Schließen, Fibeln, Halsringen, Armreifen und als Helmzier in der Darstellung von drei offenen Spiralen oder kreisenden Sonnen fest.
Zwei in sich verschlungene Tropfen symbolisierten – vergleichbar dem Yin-und-Yang-Symbol – den Anfang und das Ende, das Gute und das Böse, und spiegelbildliche Mehrfachknoten und endlose Schleifen deuteten auf die Verwobenheit des Lebens hin.
Der Wind sang ein Lied in den kahlen Ästen des Herbstes. Wir waren die einzigen Besucher der befestigten Höhensiedlung. Viel Fantasie war gefragt beim Anblick langer Erdwälle, die vom Regen über zweitausend Jahre hinweg klein gespült waren. Die Trockenmauern aus Pfählen und Steinen und geschüttetem Erdreich sollen vier bis fünf Meter hoch gewesen sein. Einige wenige Zangentore erlaubten den Zugang.
Hoch entwickelte Handwerkskunst war Voraussetzung, um eine Siedlung dieser Größe mit zahlreichen Häusern und Stallungen errichten zu können. Werkzeuge aller Art waren dazu notwendig und Kenntnisse des Ackerbaus und der Viehzucht zur Sicherung der Ernährung der dort wohnenden Menschen.
Die Kelten kannten keine Schrift. Von den Römern wurden sie als kühn, energisch und kämpferisch beschrieben. Erstaunlich groß sollen sie gewesen sein, mit wilder Barttracht und hellen, strubbeligen Haaren, die sie im Krieg weiß kälkten, um ihren Furcht einflößenden Eindruck zu verstärken.
Ihre geistigen Führer übten großen Einfluss aus. Sie pflegten die Sitten und Gebräuche, schlichteten Streit zwischen Stämmen und Personen, überlieferten Sagen und Legenden, bestimmten die Gesetze, die Lage der Kultstätten in heiligen Eichenhainen und die Zeit der Verrichtung feierlicher Rituale, die mit Gebet und Opfer aber auch Weissagungen verbunden waren.
Druiden wurden sie von den Römern genannt und Caesar selbst berichtete in seinen Werken: „Den Druiden obliegen die Angelegenheiten des Kultes, sie richten die öffentlichen und privaten Opfer aus und interpretieren die religiösen Vorschriften. Eine große Zahl von jungen Männern sammelt sich bei ihnen zum Unterricht, und sie stehen in großen Ehren.“
Waren die Kelten in unserem Verständnis religiös? Das Sterben und das Gedenken der Toten spielte auf jeden Fall in ihrem sozialen Verständnis eine zentrale Rolle.
Am nächsten Morgen unternahmen wir einen zweiten Ausflug. Mit dem Wagen fuhren wir in die Wetterau, der fruchtbaren Landschaft zwischen dem Taunus und dem Vogelsberg, einem Herzstück keltischer Siedlungstätigkeit in den Jahrhunderten vor der Zeitenwende. Regionale Fürstentümer entstanden, die für den Zusammenhalt kleinerer Stämme sorgten und die Aufgaben an Bauern, Handwerker, Händler und Krieger vergaben. In den Salinen beim heutigen Bad Nauheim verdampften sie die unterirdisch geförderte Sole, gewannen Salz in großen Mengen, das ihnen Reichtum brachte. Mit dem ‚Weißen Gold‘ konnten im Handel mit fernen Ländern wertvolle Güter eingetauscht werden.
Unterwegs überquerten wir die Nidda, wie schon die Kelten den Fluss nannten, der durch die Wetterau fliest und sich in den Main ergießt, parkten den Wagen am Ortsrand von Glauburg und stiegen hinauf zur ‚Keltenwelt am Glauberg‘.
Nach kurzem Fußmarsch gelangten wir auf ein erstes Plateau. Direkt vor uns lag das Museum – ein mit verrosteten Eisenplatten verschalter scheußlich-schöner kubischer Bau, der im Kontrast zu den Artefakten Moderne ausstrahlen sollte. Links davon führte ein Weg auf die flache Kuppe des Glaubergs. Dort befand sich einst eine stark bewehrte Siedlung, deren Überreste den Aufstieg nicht lohnend erscheinen ließen.
Rechter Hand unter uns sahen wir auf eine kreisrunde Erhebung, das große Keltengrab, dem wir uns zuwandten. Rein zufällig wurden die Konturen dieses archäologischen Schatzes bei Luftaufnahmen zur Kartierung des Geländes entdeckt.
Bei den Grabungen kamen zwei außerordentlich reich ausgestatte Grabstätten zu Tage, deren prunkvolle Beigaben auf die herausragende Stellung der Beigesetzten schließen ließen. Von Fürstengräbern wird gesprochen, weil den Verstorbenen die Insignien ihrer Macht und Rangordnung sowie Zeugnisse ihres Reichtums mitgegeben wurden.
Zu Spekulationen gaben die rings um den Hügel gefundenen Pfostenlöcher Anlass. Sie wurden wieder mit langen Stangen bestückt, die himmelwärts ragen, ohne befriedigend die Fragen zu beantworten, ob sie der Erforschung der Sterne und ihrer Bilder und damit astronomischen oder astrologischen Erkenntnissen dienten, dem Auf und Ab der Jahreszeiten folgten oder gar eine Art Kalender darstellten.
Wir stiegen hinauf auf den Grabhügel und sahen von oben auf die von den Archäologen ausgehobenen Gräben, in denen sie auf die absolute Sensation stießen – eine monumentale, aus Stein gehauene Skulptur eines Keltenherrschers, die wir sogleich im Museum bewunderten.
Neugierig, fast ungläubig bestaunten wir den augenfälligen Kopfschmuck. „Ein Zeichen dafür, dass der Keltenfürst zugleich spiritueller Führer war, Schamane, Medizinmann, auch Druide genannt“, gab auf meine Frage der dabeistehende Wärter zu verstehen. „Die beiden Fächer stellen keine Ohren dar, sondern die Blätter des Fruchtstandes der Mistel und die runde Kappe die weiße Frucht selbst. Aus ihren Wirkstoffen wurden Heilmittel gewonnen, die sie auch bei kultischen Handlungen verabreichten.“ Nach einer Pause schlug er den Bogen in die Jetztzeit: „In England hängen sie an Weihnachten einen Mistelzweig über die Eingangstür als Zeichen stetigen Lebens und in der Schweiz gilt die Mistel als Fruchtbarkeitssymbol.“
Der Keltenfürst war mit einem Panzer bekleidet, von einem Schild geschützt und mit einem Schwert bewaffnet. Lukas begutachtete das gut erhaltene Original einer derartigen Waffe in der Vitrine nebenan, während Annika auf den aus Gold getriebenen Halsschmuck zeigte. Einen Fingerring zierten filigrane Spiralen und kreisförmige Ornamente, deren Symbolkraft wir bereits im Urselbachtal im Taunus begegneten. Versinnbildlichten die goldenen Spiralen womöglich das immerwährende Entstehen neuen Lebens, wie dies die sich entfaltende Knospe eines jungen Farns ankündigt?
Weitere Gräber wurden am Glauberg gefunden und Fragmente drei weiterer Steinskulpturen. Wir begegneten einer Welt, die vor rund 2500 Jahren geschaffen wurde. Vermutlich handelte es sich hier um einen heiligen Bezirk der Kelten, einen Ort der Ahnenverehrung und kultischer Handlungen.
An was die Kelten in der Wetterau glaubten, wissen wir nicht genau. Träumten sie von einer Anderswelt? Von himmlischer Belohnung oder höllischer Bestrafung gingen sie nicht aus. Eher davon, „dass die Seele nach dem Tod nicht untergehe, sondern von einem Körper in den anderen wandere.“ So schrieb jedenfalls Julius Caesar in seinem Bericht ‚De bello Gallico‘.
Sagenumwobenes Nordeuropa
Als Berufseinsteiger erhielt ich den Auftrag, in der dänischen Niederlassung des mich beschäftigenden Unternehmens die Elektronische Datenverarbeitung einzurichten – ich, der Absatzwirtschaft, Marketing, Markt-, Verbrauchs-, Motivforschung und Werbung studiert hatte. Jobrotation und Projektmanagement kennzeichneten den Führungsstil in den 1960-er Jahren. Ich fügte mich, stellte mich der Aufgabe und realisierte die organisatorische Neuerung termingerecht.
Die Niederlassung in Dänemark befand sich in Kopenhagen zentrumsnah im Roskildevej, dem ich an einem freien Wochenende bis in die gleichnamige Stadt folgte, um das Wikingermuseum am Ufer des dortigen Fjordes zu besuchen, der den Seekriegern als Versteck diente und von dessen Grund mehrere dort versenkte Langschiffe gehoben wurden, die einst auf Raubzügen bei benachbarten Völkern im Einsatz waren, bevor sie als Barrieren im seichten Wasser gegen feindliche Angreifer ihren letzten Dienst taten.
Der mich begleitende Leiter der Verwaltung unserer Niederlassung schilderte mit flammenden Worten die großen Taten dieser skandinavischen Vorfahren, die bis Island, Grönland und von dort bis zum amerikanischen Kontinent vordrangen, England verunsicherten, den Rhein hinauffuhren und über das Mittelmeer bis ins Schwarze Meer und von dort als auch über Schweden nach Russland vordrangen.
Sie sollen tapfere Krieger und im Umgang mit dem Schwert bei ihren Überfällen in fremden Ländern nicht zimperlich gewesen sein, was bei mir die Frage nach ihren Moral- und Glaubensvorstellungen aufwarf.
„Darüber ist so gut wie nichts bekannt“, wurde mir bedeutet. „Für sie zählten nur die eigene Kraft und der Erfolg im Kampf. Vor risikoreichen Angriffen sollen sie Orakel befragt haben – wie auch immer dies geschah. Aber eine Religion in unserem Sinne kannten sie nicht.“