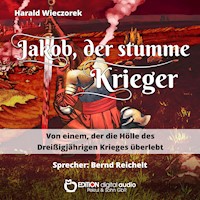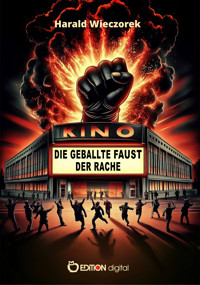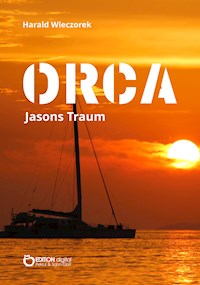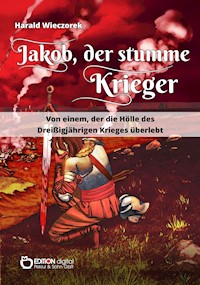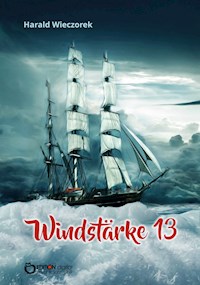
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Junge aus einem kleinen fränkischen Dorf wollte schon immer die große weite Welt kennenlernen und entschloss sich – natürlich gegen den Willen seiner Eltern – Seemann zu werden. Dieses Buch beschreibt seinen Weg von der Pike auf, d.h. von der Seemannsschule vom Moses bis zum Bootsmann. Ein Abenteuer, das man schwer vermitteln kann, man muss es selbst erlebt haben. „WINDSTÄRKE 13“ versucht, Menschen aller Altersgruppen ein Leben auf See, wie es in den Fünfzigerjahren des vorigen Jahrhunderts war, nahe zu bringen. Denn wie es damals war, wird es keiner mehr erleben, da diese Zeit unwiederbringlich vorbei ist. Der wahre Seemannsberuf ist ausgestorben, was bleibt sind Bücher wie dieses.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 159
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Impressum
Harald Wieczorek
Windstärke 13
ISBN 978-3-96521-509-2 (E-Book)
ISBN 978-3-96521-511-5 (Buch)
ISBN 978-3-96521-512-2 (Hörbuch)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2021 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
In Liebe für M.F. „Körnchen“
und unsere Kinder
Konstantin, Alexandra, Naima und Max
DREI DINGE – GEDANKEN
Über drei Dinge habe ich mir, bevor ich dieses Buch begann‚ Gedanken gemacht.
Erstens, dieses Buch soll kein Lehrbuch über die Seefahrt werden. Es geht grundsätzlich um das Erlebte eines Seemanns mit Herz und Seele, nicht um das Erlernte.
Zweitens, jedes Schiff, mit seiner im Schnitt viermonatigen Fahrzeit, den Kameraden an Bord, den Menschen an Land, könnte ein Buch füllen. Es würde sich irgendwann abschleifen. Also habe ich aus jeder Episode, die mir ausnahmslos etwas bedeutet hat, ein Konzentrat gemacht.
Drittens, alles, was irgendwie mit Sex zu tun hat, ist nicht sexistisch gemeint. Ich war mir nicht ganz sicher, aber ich denke, um glaubhaft zu sein, muss man schreiben, wie es war. Allen Leserinnen möchte ich versichern, dass ich mich sehr zurückgehalten habe.
Vorwort
Windstärke 13 – viele, die sich auskennen, werden verwundert den Kopf schütteln. „Es wird doch nur bis Windstärke 12 gemessen.“ Richtig! Bis Stärke 12 wurde gemessen, alles darüber hinaus kommentierten wir intern als Windstärke 13.
Der Seemann hat noch eine andere Messlatte in Bezug auf die Windstärke:
„Was ist denn heute angesagt?“ „Wir kriegen einen auf den Arsch!“ Damit ist von Windstärke 9 bis 12 die Rede. Heißt es aber: „Wir kriegen gewaltig einen auf den Arsch!“, dann haben wir Windstärke 13.
Natürlich sind Windstärken relativ, das heißt, ob man sie in der Nordsee oder auf dem Atlantik erlebt oder ob man sich auf einem Kümo (Küstenmotorschiff), einem Fischkutter oder auf einem großen Frachtschiff befindet. Während der Frachter bei 6 leicht durchgeschüttelt wird, spielen Kümo und Kutter bereits U-Boot.
Ich wurde oft gefragt: „Warum schreibst du ein Buch über die Seefahrt?“ Nun, weil ich sie erlebt habe! Und weil sie das letzte große Abenteuer, der letzte Abenteuer-Beruf war. War? Das Abenteuer Seefahrt, wie es in meinem Buch beschrieben wird, gibt es nicht mehr. Der Beruf ist tot. Gemeuchelt von der Wirtschaftspolitik.
Welcher Junge träumt nicht von der großen weiten Welt. Dafür sorgen schon die alten Piratenfilme, die Bounty, Kolumbus, Sir Francis Drake, der Seewolf, Graf Luckner, Störtebeker und viele andere. Die Shantys, die Seemannslieder, die mit Romantik und Abenteuer locken.
Dabei war die Seefahrt in den Anfängen, sagen wir mal ab Kolumbus (die Seefahrt an sich ist viel älter), alles andere als romantisch. Die ersten Seeleute waren keine Abenteurer oder gar Romantiker. Sie waren nicht einmal Freiwillige. Die Seefahrer, bleiben wir bei Kolumbus, waren Verbrecher, zum Tode verurteilte Mörder, denen man die Wahl ließ, aufs Schiff oder an den Galgen. So groß war die Angst vor dem Ungewissen. Dazu kommt der damalige Aberglaube, den der Seemann zum Teil bis in die Neuzeit behielt, Dämonen, Geister usw. Der berühmteste: der Klabautermann. Nicht zu vergessen die größte Angst, nämlich hinter dem Horizont ins Nichts zu fallen. Ja, Leute, die Seefahrt hat bewiesen, dass die Erde keine Scheibe ist.
Dass die anfängliche Seefahrt ein Horror war, kann nur derjenige nachempfinden, der das Glück hat, im 20. Jahrhundert zur See zu fahren.
Das ist auch der Grund, warum es damals keine oder nur wenige freiwillige Seeleute gab (Offiziere, Bootsmänner). Der Seemann wurde einfach rekrutiert. Männer wurden betrunken gemacht oder niedergeschlagen und wachten auf See wieder auf.
Ich jedenfalls war ein Freiwilliger, ein Seemann, der zu den Letzten seines Standes gehörte, die von sich behaupten können, die schönste und auch die letzte Zeit der Seefahrt erlebt zu haben.
Zum Thema Sex und Gewalt: Wer das Buch liest, könnte auf den Gedanken kommen: „Das sind ja immer noch sexistische, gewalttätige Typen“, aber ich kann versichern, dass dies nicht der Fall ist. Den Seemann auf Heimaturlaub erkennt man nur an dem gebräunten Gesicht und an seinem Gang. Sonst ist er nett und friedlich wie ein Urlauber. Alles andere sind nur Momentaufnahmen.
An das Leben mit Angst und Gefahr gewöhnt man sich früher oder später, wird aber immer wieder daran erinnert. Man stellt sein Leben voll und ganz darauf ein und lebt danach. Nach dem Motto: „Morgen kann es schon abwärts gehen!“
MIT GEWALT AUF DIE WELT – MEIN PERSÖNLICHER URKNALL
1948, am 21. Juni, wurde für die kriegsgeschädigte Bevölkerung eine positive Neuerung, das sogenannte Kopfgeld in Höhe von DM 40,00, eingeführt, heute sagen wir Kindergeld dazu.
1948, am 21. Juni, kam ich auf die Welt. So konnte ich meine Ausstattung zum Teil schon selbst finanzieren. Das war auch das einzig Positive.
Irgendwie muss ich geahnt haben, was mich da draußen erwartete, denn ich weigerte mich strikt, das Paradies zu verlassen. Ohne Erfolg. Auch ging das Ganze nicht so spektakulär ab, wie die Bibel es beschreibt. Statt dem flammenden Schwert benützte man eine gewöhnliche Zange, statt des Erzengels kam ein gewöhnlicher Arzt, der nicht die geringste Rücksicht auf die noch leichte Verformbarkeit meines Kopfes nahm.
Das Ergebnis muss furchtbar gewesen sein. Vier Tage kämpften die Mediziner mit der Re-Formierung meines Kopfes und dem Gedanken, mich wegzuschmeißen. Ausschlaggebend für mein Weiterleben war wahrscheinlich der hippokratische Eid. Ich glaube, dass mit mir auch die Verniedlichung von Kopf, nämlich Birne, geboren wurde. Jedenfalls bekam meine Mutter mich erst nach vier Tagen zu sehen.
Von mir hielt man jeden Spiegel fern. Bis dato war noch nichts von Babyselbstmorden bekannt. Dieses kleine fränkische Krankenhaus wollte sicher, dass es so bleibt.
Auf alle Fälle war ich ein großer, bleibender Schock für meine Mutter, den sie nie überwand. Als ich fünf Jahre alt war, verließ sie mich, nicht ohne meine schönere Schwester mitzunehmen.
Obwohl, wenn ich mich so im Spiegel betrachte, na ja, das rechte Auge ist ein paar Millimeter höher als das linke, oder ist das linke etwas tiefer? Wie auch immer, ich bin der Meinung, dass ich die gewaltsame Vertreibung äußerlich ganz passabel überstanden habe. Vielleicht liegt es auch nicht am Äußerlichen.
Aber zurück zur Windel. Nach sechs Tagen verließ meine Mutter mit mir die sterile Einfachheit des Krankenhauses und brachte mich in eine rustikale Holzbaracke eines Flüchtlingslagers in Oberfranken. Da ich den harten, kalten, rostigen Rand des Blecheimers nicht leiden konnte, lernte ich schon als Kleinkind den täglichen Kampf um das einzige „Plumpsklo“ zwischen den zwei Barackenblöcken kennen.
Und obwohl ich damals noch nicht lesen konnte, ging ich mit der Zeitung ins Häuschen und kam mit Druckerschwärze am kleinen Hintern wieder raus.
Dem Ghetto entronnen, brachte ich es mit meinem geliebten Vater auf vier Umzüge. Wahrscheinlich wurde damals meine Reiselust geweckt.
In dieser Zeit hatte ich mehrere „Tanten“. Das war gar nicht übel, leider auch eine „echte“, die fest bei uns lebte. Sie war mein erster „Wegweiser“. War es Eifersucht oder einfach Boshaftigkeit? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, als ich fünfzehn war, behauptete sie, ich hätte ihr von ihrem Ersparten, das sie im Schrank aufbewahrte, eine sehr hohe Summe gestohlen.
Diese Situation veränderte unser Zusammenleben, denn seitdem hing der Haussegen schief. So war es nur eine Frage der Zeit, bis ich ging.
Bevor ich in diesem Buch die große Reise ins Leben und in die weite Welt antrete, eine Hommage an den besten und liebsten Menschen am Anfang meines Lebens: MEINEN VATER.
Mein Vater hatte vor dem Krieg eine Essigfabrik in Oberschlesien. Nach dem Krieg musste er, wie viele andere, mit meiner Mutter fliehen. Die Flucht endete in den Baracken eines kleinen fränkischen Dorfes, in Streitberg in der Fränkischen Schweiz.
Erst kam meine Schwester auf die Welt, dann ich.
Nach der Trennung von meiner Mutter brachte mein Vater uns mehr schlecht als recht als freier Journalist durch, scheute sich aber auch nicht, als Nachtwächter einer großen Fabrik zu arbeiten.
Ich weiß, dass er mich über alles liebte und alles versuchte, aus mir einen guten, ordentlichen Menschen zu machen. Als Kind ist man etwas „geiziger“ mit dem Begriff „Liebe“. Doch ich habe ihn auch sehr geliebt und denke heute noch oft mit diesem Gefühl an ihn.
Wie sehr ich meinen Vater liebte, wurde mir bewusst, als er mich von unserem Wohnort Forchheim nach Nürnberg zum Direktzug nach Hamburg brachte.
Wie alle dummen Jungs in diesem Alter, fünfzehn, sperrte ich mich gegen die Umarmung des Vaters. Es war mir peinlich. Als ich dann aus dem offenen Fenster meinen Vater in seinem hellen Anzug, einer Fliege und dem hellen Sommerhut, allein am Bahnsteig, mir nachwinken sah, musste ich weinen.
In diesem Moment wurde mir „schlagartig“ bewusst, wen ich da zurückließ.
Die Trauer, das Heimweh waren sehr groß, halfen mir aber gleichzeitig, die harten drei Monate Seemannsschule zu über- und zu bestehen. Denn ich wusste, auch wenn ich den großen Wunsch meines Vaters, Banker oder Beamter zu werden, nicht erfüllte, dass er danach auf mich stolz sein würde.
„Danke, Papa!“
MIT 15 ZUR SEEMANNSSCHULE
Mein Gott! Wie hab ich gestaunt, als ich kleiner Provinzler ehrfürchtig durch den Hamburger Hauptbahnhof schlich. Gut, dass es nicht Winter war. Bei meinem geöffneten Mund wäre mir sicher die Zunge erfroren. Mutig kaufte ich mir einen Becher Kaffee und stellte mich an einen Stehtisch.
Es dauerte nicht lange und schon hatte ich Gesellschaft von einem älteren, seriös wirkenden Herrn. Er gab mir gleich die Hand, hielt sie lange fest und kratzte ständig mit seinem Finger in meiner Handinnenfläche.
Bevor er sich zum Handrücken durchkratzte, konnte ich ihm meine Hand entziehen. Ich hielt das damals für eine mir unbekannte, norddeutsche, besonders freundliche Handbegrüßung. Welch ein Trugschluss! Als ich später zu einem Matrosen genauso freundlich sein wollte, hatte ich mein erstes seemännisches blaues Auge. Innenhandkratzen war damals ein internes Zeichen der Homosexuellen.
Und so begann es:
DIE SEEMANNSSCHULE – BREMERVÖRDE
Die Moses-/Decksjungenfabrik, wie sie intern genannt wurde, war die einzige Seemannsschule in Deutschland. Wer die Seefahrt zum Beruf machen wollte, drei Jahre Lehrzeit, Decksjunge, Jungmann, Leichtmatrose, Matrose, Bootsmann bis zum Kapitän, musste drei Monate durch Bremervörde. Drei Monate fachliche Grundausbildung, wie beim Militär, nur ohne Waffen.
Junge „Männer“ zwischen fünfzehn und neunzehn aus allen Teilen Deutschlands, voller Hoffnung, Sehnsucht und Träume, und ich war dabei!
Die Seemannsschule war das Schiff und wir die Besatzung. Das Einchecken, ganz klar vorgegeben, von 16 bis 18 Uhr. Danach waren die Schotten dicht, das Schiff ausgelaufen. Wer später kam, konnte wieder nach Hause fahren.
Das Erste, was der junge Seemann lernen und kapieren musste, war Disziplin. Dazu waren Voraussetzung: Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Lernfähigkeit, Kameradschaft und Ehrlichkeit. Einiges konnte man lernen, anderes musste man besitzen, wie z.B. Ehrlichkeit. Kameradendiebstahl kam gleich nach Mord und wurde nie verziehen. Wer geklaut hat, hatte verschissen bis in die Steinzeit und zurück.
Gelegenheit macht Diebe. Das dachten sich auch Neumann und Peters, beide Offiziere. Deshalb musste alles Geld abgegeben werden. Selbst die Post wurde geöffnet und mitgeschicktes Geld dem Einzelnen gutgeschrieben. Es gab nur 5 Mark Taschengeld in der Woche, den berühmten Heiermann. Für die Raucher war das ein Problem, alle stiegen auf Drehen um. Not macht erfinderisch. Die Jungs hatten immer eine Sicherheitsnadel dabei. Wenn man die Kippe nicht mehr mit den Fingern halten konnte, steckte man die Nadel rein. Selbst der kleine verbleibende Rest wurde wieder ins Päckchen gekrümelt. Auf dem gesamten Schulgelände fand man nicht eine einzige Zigarettenkippe.
Jedenfalls war der Empfang in der Seemannsschule „sehr herzlich“. Es wurde kein Wort gesprochen. Wer ankam, wurde stumm auf den großen Antreteplatz, vor einem 30 Meter hohen, originalen Rah-Mast mit Wanden und Ausguck, verwiesen. Ich gehörte zu den Pünktlichen und stand mit den anderen Pünktlichen mit Koffer und Tasche in der Junihitze und wartete auf den letzten „Arsch“, der tatsächlich erst fünf Minuten vor „Auslaufen“ ankam. Er hieß Dietrich oder so ähnlich und lief ein, wie Hans Albers grinsend, „hoppla, jetzt komm ich“. Dieses Grinsen ist ihm bald vergangen, denn die „Bosse“ und wir Jungs waren ziemlich angefressen.
Die „Bosse“, nämlich der Bootsmann, der Dritte, der Zweite und der Erste Offizier und der Alte (Kapitän). Alles erfahrene Seeleute. Wir wurden in Wachen aufgeteilt. Backbord – mittschiffs – Steuerbordwache. Für jede Wache war ein Offizier verantwortlich. Darüber wachte, wenn auch nur selten zu sehen, der Kapitän. Aber der wahre Chef war „Old Papendieck“, der Bootsmann. Schon rein äußerlich eine Respektsperson. 1,90 Meter groß, 100 Kilogramm schwer, ein Oberkörper ohne Hals. Ein Mann wie eine Walze, mit Händen wie Kohlenschaufeln. Er sprach nie viel, aber was er sagte, war Gesetz und hatte Hand und Fuß. Niemand wusste, wie alt er war. Aber es war bekannt, dass er schon als Junge mit den „Dreimastern“ um Kap Hoorn gesegelt ist.
Wir alle, ausnahmslos, auch die Offiziere, hatten höllischen Respekt vor ihm, aber keine Angst. Denn er war trotz seines respektvollen Aussehens eine Seele von Mensch. Ein echter Seemann. Treu und gut. Doch wenn einer bei ihm verschissen hatte, dann endgültig.
Old Papendieck hatte ein großes Herz für die kleinen Kameraden. Einen Jungen, sechzehn, hatte er besonders gern, 1,65 Meter klein und 60 Kilogramm leicht. Beim Antreten gab es immer ein gleichbleibendes Zeremoniell.
„Fiede, wie groß bist du?“, dröhnte Old Papendieck. „Zwei Meter!“, piepste Fiede. „Wie viel wiegst du?“ „100 Kilo!“ „In Ordnung!“ Old Papendieck war zufrieden.
Drei Monate waren einerseits verdammt lang, andererseits sehr kurz. Lang, weil die Praxis sehr hart war. Körperlich, aber auch seelisch. Morgens um 6 Uhr wecken, eine Stunde Sport, danach waschen und Frühstück, dann praktischer und theoretischer Unterricht, die gesamte Palette, z.B. Nautik, Schiffskunde, Kompass, Morsen, Feuerbekämpfung, seemännische Arbeiten wie Spleißen, Knoten, Segelnähen.
Zu kurz, weil das, was von uns verlangt wurde, sehr viel war. Abends um 18:30 Uhr gab es Abendbrot, dann Freizeit „an Bord“. Man konnte lernen, Spiele machen, Tischtennis spielen oder Radio hören. Ab 22 Uhr „Ruhe im Schiff“. Landgang nur am Wochenende. Samstag durfte, wer keinen Mist gebaut hatte, von 14 Uhr bis 21Uhr „an Land“ gehen. Sonntag war um 20 Uhr Schluss.
Wir wurden sehr hart rangenommen, bis hin zur Schikane, unter der absoluten Prämisse „Disziplin“. Vielen war das zu viel. Bei einigen war ich froh, bei anderen traurig, als sie gingen. Zum Schluss waren wir nur noch wenige. Später, als Seemann, habe ich diese Linie verstanden.
Aber es gab auch Spaß. Vor allem im Shanty-Chor. Unser Erster Offizier Peters spielte Akkordeon, ein Junge Mundharmonika, wir anderen sangen.
Mein Vater hatte mir mit zwölf Jahren eine Gitarre gekauft, aber ich hatte nie Lust zu lernen. Ich kannte drei Griffe, hatte aber keine Ahnung, wie man sie einsetzt. Jedenfalls bat ich meinen Vater, sie mir zu schicken, in der Hoffnung, hier zu lernen.
Als die Gitarre ankam, fragte der Peters vor versammelter Mannschaft, wem die Gitarre, die bei der Post war, gehörte. Stolz erhob ich mich. Bevor ich mich outen konnte, war ich Bandmitglied. Den ganzen Tag ging ich mit erhobenem Kopf umher. Abends, als es losging, ging mir der „Arsch auf Grundeis“. Ich hatte zwar nicht gesagt, dass ich spielen könne, aber auch nicht, dass ich es nicht könnte. Also machte ich das Beste daraus. Ich stellte mich so, dass die Mundharmonika zwischen mir und dem Akkordeon stand, mit der Griffhand hinter dem Rücken der Mundharmonika, und gab mein Bestes, wobei ich die falschen Töne durch lautes Singen zu übertönen versuchte. Nach drei Shanty-Abenden, ich glaubte inzwischen schon selbst, dass ich spielen könnte, kam der Erste Offizier zu mir, nahm mich zur Seite und sprach leise: „Sag mal, Junge, kannst du überhaupt spielen?“
Ich schrumpfte auf Bolzengröße und sagte: „Nein.“ Jetzt sah ich mich als „Falschspieler“ im wahrsten Sinne des Wortes schon im Zug nach Hause. „Kann ich nicht!“ Er lachte schallend, klopfte mir mit Tränen in den Augen auf die Schulter. „Aber das kannst du gut.“ Er verriet mich nicht, ich blieb sogar in der Band unter einer Bedingung: „Leiser klimpern, lauter singen!“
Nach drei Monaten wurden stolze junge „Seemänner“ verabschiedet und sie verabschiedeten sich untereinander. Wir schworen uns ewige Kameradschaftstreue.
Die Seemannsschule hat uns noch etwas Wichtiges gelehrt. Freundschaft ist unweigerlich verbunden mit Trennung. Ich habe nicht einen der Jungs wiedergesehen.
Drei Dinge werden mir immer in Erinnerung bleiben:
Das sogenannte „offen scheißen“. Es gab keine Klotüren.
Das Wettpullen mit den Rettungsbooten, das grundsätzlich nach jeder Bootsausbildung circa zwei Kilometer bis zum Anlegeplatz veranstaltet wurde. Die Riemen waren etwa zwei Meter lang und mussten mit beiden Armen bedient werden, galeerenmäßig. Kam der Hintermann aus dem Rhythmus, bekam man den harten Holzgriff voll ins Kreuz gedonnert. Da ich noch im Wachsen war, hat sich das Pullen auch auf meine Armlänge ausgewirkt. Nach der Seemannsschule konnte ich mich aufrecht stehend in den Kniekehlen kratzen.
Die ganze Woche freute man sich auf Landgang. Frisch gewaschen und mit Ausgangspäckchen standen wir in der Vorhalle. Dann ging’s los: „Morsealphabet und Kompass“. Wer es nicht draufhatte, konnte sich gleich wieder umziehen und lernen.
MEIN ERSTER HEUERVERTRAG
Decksjungen, die die Seemannsschule bestanden hatten, waren sehr begehrt, die Reedereien äußerst scharf auf uns. Klar! Die Ausbildung in Bremervörde war hervorragend, aber wichtig war, dass der junge Seemann die billigste Allround-Arbeitskraft war. Zumindest die ersten zwei Lehrjahre bis zum Leichtmatrosen.
Nach Bremervörde mussten alle zum Seefahrtsamt. Letzter Gesundheitscheck und dann der große Augenblick: die Aushändigung des Seefahrtbuches. Jetzt war es perfekt! Ich war Seemann!
Der Mann vom Amt gab mir den Rat, nicht gleich auf große Fahrt zu gehen, sondern erst mal auf einem Kümo Nord-/Ostsee anzuheuern. „Wenn du dich geschickt anstellst, sparst du ein viertel Jahr Lehrzeit.“ Er hatte natürlich gleich ein Schiff für mich. Die „E. S.“. Ein nagelneues Kümo, schon mit „Versaufloch“, eine dritte Ladeluke vorn, unterhalb der Back. Sie war tiefer gelegt als die anderen Luken und das Vorschiff. Von der Seite sah es aus wie ausgesägt, deshalb der Spitzname „Versaufloch“.
Später erfuhr ich, dass der Mann vom Seefahrtsamt mit dem Kapitän und Eigner verwandt war. Doch er hatte nicht gelogen. Der Alte machte mich schon nach einem halben Jahr zum Jungmann. Aber schön der Reihe nach.
Mein Kümo war noch ganz oben in Schweden, in Gävle, und erst in drei Wochen wieder in Hamburg. „Fahr noch mal nach Hause und lass dich feiern, Junge!“, meinte der gute Ämtler. „Brauchen Sie eine Gitarre?“, fragte ich ihn. Verblüfft fragte er mich: „Warum?“ „Ich hab keine Kohle!“ Ich bin sicher, er machte Spaß, als er sagte: „Spiel auf dem Kiez! Die zahlen gut. Freddy Quinn hat auch so angefangen.“ Ich zuckte die Achseln. „Ja, aber Freddy konnte spielen.“ Ich verstand nicht, warum jeder sich ablachte, wenn ich das sagte. Jedenfalls gab er mir, nachdem er sich die Tränen abgewischt hatte, 150 Mark. Das war eine Menge Holz. Eine halbe Monatsheuer. 50 Mark kostete meine Fahrkarte nach Bayern.
An dieser Stelle möchte ich mal etwas richtigstellen. Die allgemeine Meinung war damals, dass alle Seeleute Norddeutsche seien. Dazu sage ich nur: Wenn alle süddeutschen Seemänner aufgehört hätten, wären 60 Prozent der Handelsschiffe liegengeblieben.
Ich erinnerte mich an Old Papendiecks Abschlussrede, die längste in drei Monaten: „Jungs!“ PAUSE. „Jetzt seid ihr Seeleute!“ PAUSE. „Fahrt nach Hamburg zum Schiffsausstatter, kauft euch eine blaue Schlaghose, einen weißen Sweater mit blauem Kragen.“ PAUSE. „So geht ihr an Bord.“ PAUSE. „Das macht 'nen guten Eindruck!“ Wie sicherlich alle anderen befolgte ich diesen Rat. Ich packte alles in meinen neuen Seesack.
Ich hatte noch sechs Stunden Zeit und 20 Mark. Also zog ich meine neue „Uniform“ an, hängte mir den Seesack um und ging, „ein Bilderbuch-Seemann“, auf die Reeperbahn in eine Seemannskneipe. Als ich eintrat, war es augenblicklich still. Ich habe großen Eindruck gemacht. Ich ging an die Bar, stellte meinen Seesack auf den Barhocker neben mich, legte mein neues Seefahrtsbuch vor mich auf den Tresen und bestellte ein Bier. Der alte Barkeeper, wie ich später erfuhr, ein Ex-Seemann, stellte das Bier vor mich hin. „Prost, Moses!“ Woran hat der das erkannt! Ein Matrose kam zu mir, er war freundlich und gab mir die Hand. Weil er so nett war, wollte ich das auch sein. Ich erinnerte mich an den herzlichen Händedruck vor drei Monaten am Hauptbahnhof und kratzte dem Mann mit dem Mittelfinger die Handfläche. Bevor ich mich versah, war mein Auge so blau wie meine neu gebügelte Schlaghose.
Zwei andere Seeleute und der alte Barmann beschützten mich. Nachdem das Missverständnis geklärt war, wurden wir alle Freunde. Sie füllten mich nach allen Regeln der Kunst ab. Einer brachte mich dann mit dem Taxi zum Bahnhof und setzte mich in den Zug nach Bayern. Mit meiner neuen Uniform und meinem neuen Seesack. Meine Hose war blau, mein Matrosenkragen am Sweatshirt war blau, mein Auge war blau, ich war blau. So lief ich zu meinem ersten Heimaturlaub in Oberfranken ein. Eben ein echter Seemann.