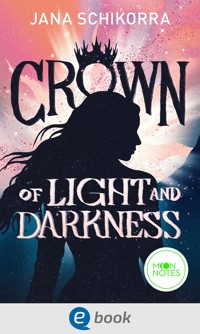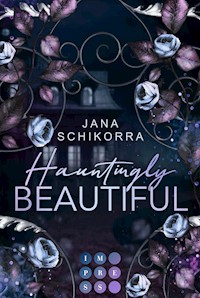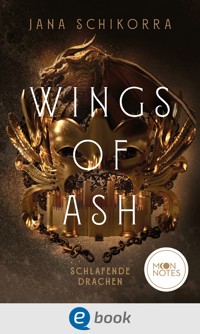
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Moon Notes
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die Macht des Drachenfeuers Am Hof des Winterkönigs ist Gylda Endurian eine Gefangene, denn sie trägt eine seltene und verbotene Gabe in sich: Mit ihrem Gesang kann sie das Feuer von Drachen kontrollieren. Nacht für Nacht ist es ihre Aufgabe, den Fae-Adel mit ihren Künsten zu amüsieren - bis der Winterkönig sie auf einem Maskenball unter seinen Gästen versteigern lässt. Ausgerechnet der grausamste von ihnen erhält den Zuschlag: Lord Neven mit dem schiefen Lächeln, der scharfen Zunge und den grünen Augen, die bis in Gyldas Innerstes zu blicken scheinen. Noch ahnt sie nicht, dass Neven ihre Gabe für einen ganz bestimmten Zweck braucht und dass sie in größter Gefahr ist, nicht nur ihr Leben, sondern auch ihr Herz zu verlieren... Wings of Ash 1. Schlafende Drachen: Eine knisternde Fantasy-Romance in der gefährlichen Welt der Drachen und Fae - Drachen-Fantasy trifft Romantasy: Spannendes New Adult-Buch über eine mutige junge Frau, die Drachen gefügig machen kann. - Eine ganz besondere Gabe: Gemeinsam mit dem mysteriösen Neven bricht Gylda auf, um das Reich des bösen Winterkönigs mit dem Drachenfeuer zu zerstören. - Knisternde Leidenschaft: Im Kampf gegen den gnadenlosen Herrscher verlieben sich Gylda und Neven ineinander. - Voll im Trend: Ein packendes Fantasy Romance-Buch mit den beliebten Tropes "Enemies to Lovers", "Forced Proximity" und "Morally grey Characters". - Im Reich der Drachen und Fae: Die fesselnde Romantic Fantasy ist die perfekte Lektüre für New Adult-Leser*innen, die Bücher von Rebecca Yarros lieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch
Die Macht des Drachenfeuers! Am Hof des Winterkönigs ist Gylda Endurian eine Gefangene, denn sie trägt eine seltene und verbotene Gabe in sich: Mit ihrem Gesang kann sie das Feuer von Drachen kontrollieren. Nacht für Nacht ist es ihre Aufgabe, den Fae-Adel mit ihren Künsten zu amüsieren – bis der Winterkönig sie auf einem Maskenball unter seinen Gästen versteigern lässt. Ausgerechnet der grausamste von ihnen erhält den Zuschlag: Lord Neven mit dem schiefen Lächeln, der scharfen Zunge und den grünen Augen, die bis in Gyldas Innerstes zu blicken scheinen. Noch ahnt sie nicht, dass Neven ihre Gabe für einen ganz bestimmten Zweck braucht und dass sie in größter Gefahr ist, nicht nur ihr Leben, sondern auch ihr Herz zu verlieren …
Jana Schikorra
Wings of Ash
Schlafende Drachen
Manchmal wär ich gern mehr,
ohne zu wissen, wovon.
Wär gern dies, obwohl ich doch jenes bin.
Lieber eine Antwort als eine Frage.
Aber irgendwie wär ich dann ja nicht mehr ich.
Und das fänd ich schade.
Ein bisschen jedenfalls.
Aber ein bisschen ist gut.
Ein bisschen ist genug.
Für alle, die sich davor fürchten, von ihrem Weg abzukommen.
Habt keine Angst.
Abseits des Pfades blühen die schönsten Blumen.
Prolog
Nascania war ein herrscherloses Land auf einem herrscherlosen Kontinent. Es kannte weder Kriege noch Könige. Nur einen ewigen Sommer, der die Nascanier Barmherzigkeit und Güte lehrte. Menschen und Tierwesen lebten lange in friedvollem Einklang miteinander.
So lange, bis der Kontinent erbebte und die Gesetze der Natur sich veränderten. Die Erdkruste brach auf, und winzige Risse zogen sich durch die Flora des Landes. Fortan war freigesetzt, was sich zuvor im Kern dieser blühenden Welt verborgen hatte: Magie.
Und diese ausströmende, unkontrollierte Magie suchte nach Gebietern. So kam es, dass sie sich an das erste Lebendige heftete, was ihr begegnete: jene Menschen, die entlang der Risse siedelten. Die Magie fand Gefallen an ihnen, und auch die Menschen erfreuten sich an den neugewonnenen Fähigkeiten. Von Generation zu Generation verstärkte sich nun der Zauber in ihrem Blut, und auch ihr Erscheinungsbild passte sich dieser Veränderung ihrer Genetik an.
Das Volk der Fae ward geboren und mit ihm ein Machtgefälle, das jede Einheitlichkeit unmöglich machte.
Schon bald begannen die Menschen, die Fae zu fürchten. Die Fae hingegen sehnten sich danach, ihren Status als Krone der Schöpfung zu etablieren.
Am besten mit einem Thron.
Um festzustellen, wer von ihnen am geeignetsten dafür war, der erste Herrscher Nascanias zu werden, veranstalteten sie landesweite Wettkämpfe, bei denen mehr als die Hälfte aller Teilnehmenden starb.
Als Sieger aus diesem grauenerregenden Kräftemessen ging schließlich ausgerechnet der körperlich schwächste Fae von allen hervor. Seit dem Tag seiner Geburt litt er unter der Hitze des Sommers. Wo sie den anderen Fae und sogar den so gewöhnlichen Menschen nichts anzuhaben schien, verbrannte sie ihn regelrecht von innen.
Er kannte kein Leben ohne Schmerz.
Doch ein Gutes hatte seine schier endlos andauernde Pein: Sie stärkte seine Magie.
Aus Gründen, die er sich selbst nicht erklären konnte, schien sie unter seinem Leid geradezu zu gedeihen.
So also wuchs seine Macht unbemerkt von allen und brachte ihm an jenem alles entscheidenden Tag den Platz auf dem ersten Thron Nascanias ein.
Doch obwohl er erreicht hatte, wonach so viele andere strebten, war er noch nicht zufrieden.
Nicht, solange der Sommer ihn nach wie vor demütigte.
Also beschloss der König, dass der Sommer enden musste.
Er bemühte jeden Funken seiner über die Jahre angereicherten Kräfte, damit sie seinem Wunsch nachkommen mochten.
Und es dauerte nicht lange, bis genau das geschah.
Eis und Schnee flossen aus seinen Fingerspitzen und kleideten seine Heimat in ein weißes Gewand, dem der König den Namen ›Winter‹ verlieh.
Die Kälte, die dieser Winter mit sich brachte, machte jedes körperliche Leid des Königs ungeschehen. Schon bald hatten Fleisch und Knochen den Sommer vergessen.
Der König aber, nun auch äußerlich jene Macht demonstrierend, die ihm seit jeher innewohnte, konnte diesen Triumph nicht in Gänze genießen.
Schließlich gab es auf dem Kontinent eine Art von Wesen, die ihm ebenbürtig – oder unter den richtigen Umständen gar überlegen – war. Wesen, die sein ewiges Eis in Teilen des Landes schmelzen ließen und denen sogar nachgesagt wurde, auch sie hätten nach dem großen Beben an Stärke gewonnen: Drachen.
So sehr der König sich auch wünschte, sie befehligen zu können, war dies doch einzig den Feuersängern vorbehalten.
Eine magiebedingte Verwachsung ihrer Kehlköpfe schenkte ihnen die Gabe, Drachen mit ihren Liedern zu zähmen und sie Feuer speien zu lassen. Nur ein Drache, der besungen wurde, war imstande, die in seiner Kehle schwelende Glut folgenlos in Flammen zu verwandeln. Zum großen Verdruss des Königs trat diese Gabe nicht bei Fae, sondern ausschließlich unter Menschen auf.
Um seine Alleinherrschaft zu manifestieren, beschloss er also, dass Drachen und Feuersänger weichen mussten.
So wurde aus einem Land, das nie zuvor Könige und Kriege gesehen hatte, ein anderes.
Eines, das beides kennenlernen sollte.
Auf die verheerendste Art und Weise, die man sich vorstellen konnte.
Kapitel 1
Ich hatte schon immer gewusst, dass meine Stimme eines Tages mein Todesurteil sein würde.
Vermutlich seit dem Tag, an dem meine Eltern in Tränen ausgebrochen waren, als sie mich das erste Mal singen hörten.
Ziemlich sicher, seit sie daraufhin alles in ihrer Macht Stehende taten, um mich aus der Hauptstadt in ein Dorf zu schaffen, das den Namen Gandarra trug.
Und unumstößlich, seit sie ihr Leben opferten, um mich zu schützen.
Trotzdem war ich jetzt, da der Tod auf meiner Schwelle stand, überrumpelt.
Ich wollte noch nicht gehen.
Es war zu früh.
Viel zu früh.
»Gylda Endurian?«, fragte mich ein Gardist mit grollender Stimme. Ein Helm verdeckte einen Großteil seines Gesichts, aber die Aussparungen an den Augen offenbarten das sadistische Glitzern darin.
Gylda.
Ich hatte ihn zwanzig Jahre lang nicht mehr gehört, diesen Namen. Nicht, nachdem meine Eltern all ihr Vertrauen und Vermögen in die Dorfgemeinschaft gesetzt hatten, in der ich aufgewachsen war – als Lysandra Nuviree.
Betont lässig warf ich mir die langen dunkelroten Haare über die Schulter. Ihre Farbe war ebenso wenig echt wie der Name, den ich angenommen hatte.
Rayanne, meine Ziehmutter, hatte mir gezeigt, wie ich das seidige Gold meiner Geburt in Burgunder verwandelte.
Doch meine Haarfarbe würde mich kaum vor dem bewahren, was mir bevorstand.
»Gylda Endurian?«, fragte der Gardist erneut. Die Art, wie er es tat – lauter und drohender als zuvor –, ließ keinen Zweifel daran, dass seine Geduld bald erschöpft war.
Meine letzten Minuten in Gandarra waren angebrochen.
Und ich hatte gewiss nicht vor, sie fügsam zu verbringen.
»So jemanden kenne ich nicht, tut mir leid. Ich heiße Lysandra. Lysandra Nuviree.«
Die Lüge, bereits unzählige Male ausgesprochen, kam mir auch heute erfreulich leicht über die Lippen.
Mein Herz schlug in gewohntem Tempo vor sich hin; verhöhnte die darin eingesperrte, grässliche Angst mit mühsam erlernter Abgeklärtheit.
Etwas, das auch die geschärften Sinne des Gardisten erfassen mussten – und von dem ich mir erhoffte, dass es ihn zumindest ein wenig irritierte.
»Lysandra. Natürlich.« Kein bisschen irritiert, dafür aber durch und durch bösartig, lachte er. Als würde der schneidend kalte Wind mit einstimmen, schickte er sogleich eine Böe an der bulligen Statur des Fae vorbei. »Du kannst dich nennen, wie du willst, Mädchen. Das ändert nichts daran, dass du mich heute in die Hauptstadt begleiten wirst.«
Er deutete mit dem Daumen über die Schulter. Dorthin, wo ein wenig abseits von meiner Hütte der vergitterte Karren stand, vor den er sein riesiges Pferd gespannt hatte.
Wegen des Zaubers, der sich darum wie eine milchige Membran kräuselte, konnte ich nicht sehen, ob sich bereits andere der Gabe Verdächtigte im Inneren befanden.
Stumm flehte ich darum, die Einzige zu sein.
»Aber davon einmal abgesehen«, fuhr der Gardist in süßlichem Tonfall fort, »ist diese Beschreibung hier mehr als eindeutig.« Er wedelte ungeduldig mit dem Stück Pergament, das er in den behandschuhten Fingern hielt. Bisher hatte ich den Blick darauf bewusst vermieden. Jetzt zwang ich mich, hinzusehen. Wie befürchtet, entdeckte ich sofort das königliche Wappen auf der Rückseite des Papiers:
eine Krone, deren mittlerer von insgesamt sieben Zacken eine Rose aufspießte, und davor zwei gekreuzte Zepter, deren Griffe wie Eisblumen geformt waren.
Darunter stand eine Zahl: 1738.
Das Jahr meiner Geburt.
Nascania existierte schon länger. Bedeutend länger sogar, wenn man historischen Aufzeichnungen Glauben schenkte. Aber mit der Herrschaft des Winterkönigs hatte eine neue Zeitrechnung begonnen.
Eine von Schnee, Eis und Grausamkeit.
»Gylda Endurian, Tochter von Syra und Reignar Endurian. Menschenstämmige Mutter, Vater ebenfalls von gewöhnlichem Blut. Abgerundete Ohren, keine verlängerten Eckzähne oder sonstigen Fae-Merkmale. Goldene Haare, blaue Augen, herzförmiges Muttermal links über Oberlippe.« Beim Verlesen des letzten Punktes geriet er ins Stocken.
Ich widerstand dem Drang, mir an die Lippe zu fassen, wo sich zwar kein solches Muttermal mehr, aber dafür eine Narbe befand. Längst nicht die einzige Narbe, die ich trug. Meine Eltern hatten mir noch weitere kleine Schnitte im Gesicht hinzugefügt – damit die Entfernung meines Leberflecks nicht allzu offensichtlich war.
Wahrscheinlich sollte ich mich gar nicht an so vieles erinnern können, wo ich doch noch ein kleines Kind war, als all das passierte. Und doch tat ich es.
»Ich habe kein Muttermal im Gesicht«, wies ich den Gardisten auf die von ihm selbst bemerkte Unstimmigkeit hin.
»Was du nicht sagst«, knurrte dieser in tiefstem Bariton.
Das Pergament gab ein klägliches Rascheln von sich, als er seine Faust darum schloss und es zerknüllte. Ich hoffte, dass der König ihn angemessen für diesen Verlust seiner Beherrschtheit bestrafte. Immerhin handelte es sich bei dem Schreiben um ein amtliches Dokument: einen Auszug aus dem Register, in dem jedes in Nascania geborene Lebewesen namentlich vermerkt und äußerlich beschrieben war.
Einmal jährlich ließ der König diese Beschreibungen erneuern, indem er zu offiziellen Sichtungen vor den Toren der Hauptstadt aufrief.
Sichtungen, denen ich als Kind zuletzt beigewohnt hatte.
Diesen Umstand würde ich mir nun zunutze machen – vorausgesetzt natürlich, der Gardist brachte mich nicht vorher um.
Wie um mir zu demonstrieren, dass er diese Möglichkeit durchaus in Betracht zog, packte er mich mit der freien Hand an der Schulter und drängte mich ins Innere der Hütte. So weit, bis die Kante meines Esstischs mir in den Rücken drückte.
Ich schluckte einen sich ankündigenden Schmerzenslaut mit zusammengebissenen Zähnen hinunter.
Gemeinsam mit der Furcht, die sich meiner Kontrolle langsam, aber sicher entzog.
Der Gardist konnte mir mühelos die Wirbelsäule entzweibrechen, wenn er wollte. Mich weiter vor sich herschieben, bis meine Knochen knackend nachgaben und mein Oberkörper hinter mir auf die Tischplatte klappte.
Es war demütigend.
Um mir den Garaus zu machen, bräuchte er weder das an seinem Waffengurt befestigte Schwert noch die Kraft seiner absurd großen Hände.
Ein einzelner Funke seiner Fae-Magie wäre ausreichend. Trotzdem bohrten sich seine Finger tiefer in den dicken Stoff meines Fellmantels.
»Du hältst dich für besonders gerissen, was? Aber ich lasse mich von dir nicht täuschen, Endurian.«
Ich keuchte, als er den Druck auf meine Schulter noch verstärkte. Der Schmerz war heftig, nah an der Grenze des Unerträglichen, aber er würde mich nicht zum Reden bringen.
Ein Geständnis würde bedeuten, meine Ziehfamilie offiziell des Verrats an der Krone anzuprangern und somit zum Tode zu verurteilen.
Dass sie sich im Augenblick nicht in Gandarra aufhielt, war daher wohl der gnädigste Zufall, den ich mir hätte erträumen können.
Ich konnte nur hoffen, dass meiner Familie nach meiner Hinrichtung ausreichend Zeit zur Flucht blieb.
»Ich. Bin. Eine. Nuviree«, presste ich stur hervor, während ich gegen die Tränen anblinzelte, die mir unter dem Brennen und Stechen in meiner Schulter nun in die Augen schossen.
»Hör auf zu lügen!« Der Gardist knurrte so laut, dass die Dielen, die ich nur noch mit den Spitzen meiner Lederstiefel berührte, erbebten. »Und jetzt sing, verdammt noch mal.«
Der Moment war gekommen.
Eine letzte winzige Gelegenheit, das eigentlich Unvermeidbare doch noch abzuwenden.
Denn der Gardist musste sich meiner Gabe ganz sicher sein, um mich auszuliefern. Sein König tolerierte keine Fehler.
Sichtlich widerwillig ließ er von mir ab, damit ich mich aufrichten konnte. Ich versuchte, nicht an das Messer zu denken, das in meinem linken Stiefel steckte.
Oder daran, was ich mit diesem einzigen Erbe meiner leiblichen Eltern machen würde, wenn mein verzweifelter Notfallplan aufging.
Grimmig befingerte ich meinen Pelzkragen, räusperte mich und stimmte eine düstere Melodie an.
Nach und nach flocht ich Worte darin ein, fügte sie zu wohltönenden Reimen zusammen.
Und dabei hörte ich mich ganz wie erhofft vollkommen fremd an.
Die besondere Mixtur aus Nesseln, Kräutern und Wintergräsern, die ich dreimal täglich einnahm, raubte meinem Gesang die für die Gabe charakteristisch-rauchige Note. Gewiss nichts, was mich bei einem Vorsingen vor dem Winterkönig vor dessen Urteil gerettet hätte.
Aber für jene Kostprobe, die sein Gesandter von mir verlangte, könnte der täuschende Effekt womöglich ausreichen.
Ohne zu blinzeln beobachtete ich, wie die Augen des Gardisten sich hinter seinem Helm in aufkeimender Skepsis verengten.
»Das reicht.« Er hob eine Hand, und ich hielt fügsam inne.
Er drehte mir den Rücken zu – und wandte sich zum Gehen. »Ich denke, ich habe vorerst genug gehört.« Der so ersehnte Ausspruch hing griffbereit in der kalten Luft, und dennoch traute ich mich nicht, ihn als Wahrheit zu verinnerlichen.
Aber das musste ich auch nicht.
Mir das Messer aus dem Stiefel zu ziehen und es dem gepanzerten Ungeheuer in den Rücken zu treiben, reichte vollkommen aus.
Doch noch während ich mich danach bückte, schoss meine kostbarste Waffe ganz ohne mein Zutun aus Leder und Schnürung heraus.
Geradewegs in die Hände des Gardisten, der auf der Schwelle stehen geblieben war und sich nun wieder zu mir umdrehte.
»Hübsch. Ich wüsste zu gern, wie du an einen solchen Schatz gekommen bist.« In einer provokanten Geste fuhr er mit seinem behandschuhten Zeigefinger über die Klinge, die im richtigen Winkel geworfen sogar Stahl und Bronze der Fae-Rüstungen durchtrennte.
Dann befestigte er das Messer an seinem Waffengürtel.
»Aber ich bin sicher, das wirst du unserem König bereitwillig erzählen, sobald du ihm gegenübertrittst. Denn weißt du was?« Er gluckste. »Diese reizenden Herrschaften haben ebenfalls für mich gesungen, Lysandra. So lange, bis sie sich daran erinnern konnten, dass du gar nicht ihre leibliche Tochter und Schwester bist.«
Eben noch hatte seine Gestalt die immer noch offenstehende Hüttentür versperrt. Nun trat der Gardist in wölfischer Geschmeidigkeit zur Seite, den linken Arm erhoben und beschwörend mit den Fingern wackelnd.
Ich wollte nicht hinsehen.
Aber er zwang mich dazu.
Seine Magie verhinderte, dass ich die Lider schließen oder auch nur blinzeln konnte.
Mit weit aufgerissenen Augen starrte ich die hereinschwebenden Gesichter meiner Familie an.
Gesichter, die in ewiger Qual verzerrt waren.
Wächsern, eingefallen, stumpf.
Nacheinander polterten die körperlosen Köpfe auf den Boden: zuerst der meiner Ziehmutter, dann der meines Ziehvaters und danach beinahe zeitgleich in einer makabren, den Tod überdauernden Verbundenheit, die meiner Schwestern.
Rayanne, Oras, Namila und Shai.
Oder das, was von ihnen übrig war.
Kapitel 2
Ein Schrei zerfetzte die Luft.
Mein Schrei?
Ich wusste es nicht.
Jedwede Kontrolle über meinen Körper war mir entglitten, mein Verstand nur noch ein sterbendes Konstrukt zwischen meinen pochenden Schläfen.
Ich konnte nicht atmen.
Wollte nicht.
Wut, Schmerz und Entsetzen quetschten meine Lunge zusammen.
Irgendwann verklang der Schrei, und mit ihm das Leben der Lysandra Nuviree.
»Gehen wir, Endurian.«
Dieselbe Macht, die auch meine Lider offengehalten hatte, zog mich nun vorwärts. So unvermittelt, dass ich ins Straucheln geriet und beinahe über den Kopf meiner Ziehmutter stolperte.
Mutter, korrigierte ich mich und verspürte plötzlich eine solche Übelkeit, dass ich am liebsten nicht nur meine letzte Mahlzeit, sondern sämtliche Organe erbrochen hätte.
Rayanne war mir eine echte Mutter gewesen.
Und sie hatte meinetwegen sterben müssen.
Ich taumelte an ihr vorbei, verfing mich jedoch mit der Spitze meiner Stiefel in den silbergrauen Locken – und versetzte dem Schädel meines Vaters bei dem Versuch, mich loszureißen, versehentlich einen Tritt.
Das neuerlich dumpfe Geräusch, mit dem er über die Dielen rollte, stieß mich in einen Abgrund, aus dem es kein Entkommen geben würde.
Der Gardist musste nicht weiter Gebrauch von seiner Magie machen, damit ich mich in seine Richtung bewegte.
Ich überwand die zwischen uns liegende Distanz mit einem einzigen Sprung; verwandelt in ein Raubtier, das nach Blut dürstete.
Ich kratzte und biss, trat und schlug.
Dort, wo meine Fingernägel auf die Rüstung des Gardisten trafen, splitterten sie, und jeder Hieb meiner Fäuste wurde mit einem Knacken meiner nutzlosen menschlichen Knöchel quittiert.
Doch der Schmerz, den ich hätte empfinden sollen, verlor sich irgendwo außerhalb meiner Wahrnehmung.
Mein Rausch fand erst ein Ende, als der Gardist mich in seinen Karren warf und mein Knie Bekanntschaft mit einem rostigen, aus den Bodenbrettern hervorstehenden Nagel schloss.
Noch immer spürte ich keinen Schmerz – nicht richtig.
Mehr ein von nasser Wärme begleitetes Kitzeln, das mich zurück auf die andere Seite des Schleiers lockte.
»Sind wir wieder zu uns gekommen?« Die Stimme des Gardisten troff nur so vor Häme.
Vollkommen unversehrt beobachtete er mich durch die geschlossenen Hecktüren des Karrens.
Seinen Helm hatte er abgenommen.
Das Gesicht, das sich darunter offenbarte, sah genauso aus wie seine boshaften Augen es hatten vermuten lassen.
Kantig, vernarbt, durch und durch brutal.
Die den Fae eigene Schönheit war sorgsam hinausgeprügelt und -geschnitten worden.
Anstelle einer Antwort malte ich mir aus, wie es wäre, meinen Hass ebenfalls auf diesem geschundenen Antlitz zu verewigen.
»Es hat dir also die Sprache verschlagen. Bedauerlich, diese nicht vorhandene Belastbarkeit. Und wie tragisch, dass ich dir keine Schonfrist gewähren kann, Endurian.« Er seufzte theatralisch und strich sich über die blonden, kurz geschorenen Haare. »Ich habe hier nämlich einen kleinen Gruß des Königs für dich. Er dachte, du fändest es vielleicht schön, gemeinsam mit deinen Eltern nach Hause zurückzukehren. Also, mit deinen richtigen Eltern.«
Ich hatte keine Zeit, die Bedeutung dieser Worte selbst zu entschlüsseln. Bereits im nächsten Moment sauste eine Handvoll schwarzer Gegenstände durch die Gitterstäbe.
Meine Reflexe setzten aus. Ich duckte mich nicht, und so bremste ausgerechnet meine Stirn ihren Flug.
Sofort platzte die dort so dünne Haut auf.
Blut rann mir in die Augen und trübte meine Sicht.
Ein Akt der Gnade, den ich erst zu schätzen wusste, als ich erkannte, worum es sich bei den Gegenständen handelte:
Knochen.
Der Gardist hatte Knochen nach mir geworfen.
Nicht irgendwelche, sondern, wie es schien, jene meiner leiblichen Eltern.
Einzig die Taubheit in mir bewahrte mich davor, zu zerbrechen. Zuverlässig schwächte sie das, was eigentlich unausstehliche Qual sein müsste, zu einem dumpfen Kribbeln ab.
»Ihr habt ihre Gräber geschändet.«
Ich erkannte meine eigene Stimme kaum. Da war kein Ton mehr, keine darin liegende Melodie. Sie war nicht bloß auf jene Art verfälscht, wie es die Kräutertinktur zu tun vermochte, sondern tot – genau wie jeder, den ich je geliebt habe.
»Geschändet. Aber, aber.« Der Gardist lachte spöttisch. »Es wurden lediglich Untersuchungen auf Geheiß des Winterkönigs veranlasst, Endurian. Notwendige Maßnahmen, um sicherzustellen, dass bei der Säuberung auch niemand übersehen wird. Und wie du siehst, lohnt es sich. Am Ende fliegt jeder noch so alte Schwindel auf.«
Er klopfte in einer beinahe zärtlichen Geste gegen die Gitterstäbe, ehe er den Karren umrundete. Im nächsten Moment ließ das Tier ein schrilles Wiehern vernehmen. Ein Ruck ging durch mein Gefängnis. Vermutlich hatte der Gardist dem Ross die Stiefel in die Flanken getrieben oder ihm sonst wie Schmerzen zugefügt.
Ich wurde so fest gegen die metallenen Streben gedrückt, dass ich kurz nach Luft rang. Die Knochen meiner Eltern rutschten ebenfalls haltlos durch das rädernde Gefängnis; folgten mir wie gestaltlich gewordene Schatten.
Mein Puls rauschte unaufhörlich in den Ohren, während wir Gandarra immer weiter hinter uns ließen. Ich kniff die Augen zusammen.
Meine Sehkraft brauchte ich nicht, um zu wissen, welche Wege der Gardist und sein vor Anstrengung schnaufendes Pferd einschlugen. Die bekannten Gerüche verrieten mir genau, auf welchem der drei durch den Kiefernwald führenden Pfade wir uns befanden.
Es hieß, die Magie des Winterkönigs machte die Fae-Hochburg nur auffindbar für ihre Bewohner – und für von ihm eigens ausgewählte Gäste.
Vor langer Zeit einmal hatten meine Eltern zu diesen Gästen gezählt.
Namenloses Grauen schabte mit seinen Klauen über die Schwelle meines Bewusstseins, doch ich hielt die dahinter liegende Tür ebenso eisern geschlossen wie meine Augen.
»Reizende Gegend«, befand der Gardist. Seine Stimme drang unerbittlich laut und störend in meinen meditativen Zustand vor. »Wenn man genau hinhört, vernimmt man noch die Schreie der Sterbenden. Jedenfalls mit Sinnen wie den meinen.«
Dass heute ausgerechnet der westliche Pfad nach Turbitha führte, war ob seiner gefährlichen Vorgeschichte wenig überraschend. Oft schon waren hier Frostwölfe gesichtet worden, und meist hatte eine solche Sichtung tödliche Konsequenzen zur Folge.
Doch nichts und niemanden störte die zunehmend holprig werdende Fahrt.
Ich kniff meine Lider stoisch zusammen, während die vertrauten Gerüche nach und nach schwanden.
Bald war der Duft des Waldes gänzlich verflogen.
Schließlich ratterte der Karren so heftig über ein Hindernis, dass ich zur Seite geworfen wurde.
Beim Versuch, den Sturz abzufangen, riss ich die Augen auf.
Gegen die nun grelle Helligkeit anblinzelnd, sah ich die Knochen meine Eltern unmittelbar neben mir gegen die vergitterten Seitenwände prallen. Einer von ihnen rutschte hindurch, und aus irgendeinem Grund war sein Verlust noch schwerer zu ertragen als seine Gegenwart.
»Verzeih mir, Endurian«, höhnte der Gardist. »Da muss ich wohl ein kleines Steinchen übersehen haben.«
Noch ehe ich mich aufrichten konnte, holperte das Gefährt über die nächste Hürde.
Und die wiedernächste.
Das ruchlose Spiel fand erst ein Ende, als Turbitha von der einen auf die andere Sekunde in Sicht kam.
Turbitha – oder vielmehr deren hinter einer Mauer aufragende Umrisse.
Durchsichtig wie geschliffenes Glas und dick wie zehn hintereinander aufgestellte Männer fasste sie die Stadt ein.
Einschüchternd waren vor allem die vielen bereits aus der Entfernung erkennbaren Namen, die in das Eis graviert waren und die sich beim Näherkommen zu vervielfachen schienen.
Plötzlich hatte ich das untrügliche Gefühl, dass diese Namen zu Toten gehörten.
Verräter vielleicht, Rebellen und Geflohene …
Und jene Unglücklichen, die meine Gabe teilten.
Bald würde auch von mir nichts mehr bleiben als fünf zur Schau gestellte Lettern im ewigen Eis.
Der Gardist dirigierte sein Pferd zu einem Torbogen, der sich jäh vor uns auftat.
Beim Passieren schrammte der Karren mit den Kanten gegen Decke und Wände des engen Tunnels und ließ einen Splitterregen auf mich herabrieseln.
Splitter, auf denen vereinzelt Buchstaben zu erkennen waren.
Zerstörte Namen zerstörter Seelen.
Plötzlich schoss mir ein unerträglicher Schmerz in Hals und Lungen. Als hätte jemand ein unsichtbares Seil um meine Kehle geschlungen, schnürte sie sich vollkommen zu.
In blinder Panik um mich tretend riss ich an meinem Kragen, um mir Luft zu verschaffen. Doch es half nichts.
Ich erstickte. Starb jämmerlich auf diesen schmutzigen, blutbefleckten Dielen, noch bevor ich den Winterkönig überhaupt zu Gesicht bekam …
Und dann, so unvermittelt wie Atemnot und Schmerz mich befallen hatten, verschwanden sie wieder.
Auch der Splitterregen war versiegt.
Das Pferd des Gardisten hatte den Karren erfolgreich durch Tor und Tunnel gezogen.
Würgend holte ich Luft. Das boshafte Lachen des Gardisten mischte sich in mein Röcheln.
»Auf der Südseite der Mauer befinden sich die Namen der durch die Krone Strangulierten. Jeder, der nicht unter dem Schutz des Königs steht, erlebt beim Passieren der Mauer die Pein der Sterbenden noch mal.« Er schnalzte mit der Zunge.
»Wenn seine Majestät dein Kommen nicht sehnlichst erwarten würde, hätte ich den Umweg zu den Gevierteilten in Kauf genommen. Dann hätte ich dich wenigstens noch einmal schreien hören können. So wie vorhin.« Der Gardist ließ einen hingerissenen Laut vernehmen. »Ich fürchte, diese Ehre wird dem König vorbehalten sein, wenn er sein Ritual an dir durchführt. Aber vielleicht … vielleicht habe ich ja Glück und höre dich über die Palastmauern hinaus singen und sterben, Gylda Endurian.«
Kapitel 3
Ich würde lautlos sterben.
Diesen Schwur leistete ich vor mir selbst, während wir in den Kern der Stadt vordrangen.
Würde die Behandlung des Königs stumm ertragen, und sei es nur, um den Gardisten seiner verderbten Frohlockung über mein Leid zu berauben.
Mit aufeinandergepressten Lippen beobachtete ich das, was Turbitha mir von seinem Antlitz durch die Gitterstäbe hindurch offenbarte. Die Stadt sah anders aus als bei meinem letzten Aufenthalt – noch einschüchternder, größer und vor allem kälter. Farblos wie der Schnee, der sich außerhalb der Tore emportürmte und der hier, auf den breiten Straßen, nur eine glitzernd-feine Pulverschicht über grauem Pflasterstein war.
In Turbitha gab es nur das – Weiß und Grau in unterschiedlichen Abstufungen.
Die Bauten, die spitz zulaufend aus dem hügeligen Untergrund ragten, waren eine triste Mischung aus beidem. Der Winterkönig war dieser eigentümlichen Architektur auch beim Errichten seines Palasts treu geblieben, dessen achtundzwanzig Zinnen in ihrer Anordnung an das Gebiss eines gigantischen Raubtiers erinnerten. Eines reichlich blassen Raubtiers, wohlgemerkt.
Die Stadt war allerdings nicht nur farblos, sondern auch völlig ausgestorben.
Gemeinsam mit den verbliebenen Knochen meiner Eltern rutschte ich gen Hecktür, als der Gardist sein Pferd am Fuße des steil ansteigenden Zuweges zum Palast plötzlich noch schneller antrieb.
Was mich erwartete – das Ritual, von dem der Gardist gesprochen hatte –, war das, wovor meine Eltern mich um jeden Preis hatten beschützen wollen. Und anstatt dieses Opfer in Ehren zu halten, saß ich blutüberströmt und mit hohlem Herzen in diesem Wagen, der mich geradewegs in die Arme meines Henkers führte.
»Aussteigen«, herrschte der Gardist mich an, kaum dass wir die Hügelkuppe erreicht hatten.
Widerstand war zwecklos, das wusste ich.
Zwecklos, aber dennoch etwas, das ich meinen Familien schuldig war.
Allen beiden.
Also robbte ich von den aufschwingenden Türen des Karrens fort, anstatt der Aufforderung zu folgen und hinauszuklettern.
»Du magst Schmerzen, Mädchen, nicht wahr?« Der Gardist wartete meine Antwort nicht erst ab. Magie riss an meinen Schultern und schleuderte mich nach vorn; mit dem Kopf voran raus aus dem Wagen. Ich schlug mit Wange und Schläfe so hart auf dem Boden auf, dass mein Sichtfeld schwarz wurde.
Mich an meinen gerade erst geleisteten Schwur zur Lautlosigkeit erinnernd, versuchte ich, aufzustehen.
Einmal. Zweimal.
Dann wich die Schwärze ausreichend weit zurück, um meinen Gleichgewichtssinn wieder herzustellen und mich auf die Beine zu hieven.
Ich hob die Finger an mein Gesicht, betastete vorsichtig die Abschürfungen auf der linken Seite.
Sie brannten wie Feuer, genau wie meine Knie.
»Hätten wir das also geklärt. Gut. Also dann: mitkommen. Oder erhebst du noch einmal Einwände, Endurian?« Der Gardist musterte mich mit einem Ausdruck widerwärtigen Entzückens. Vermutlich wartete er nur darauf, mir den nächsten Schlag versetzen zu können. Und obwohl ich gewiss lieber auf weitere Blessuren verzichtet hätte, verweigerte ich auch jetzt den Gehorsam.
Mit aller Leidenschaft, die ich aufbringen konnte, spuckte ich vor dem Handlanger des Königs auf den Boden.
»Oh. Du erhebst tatsächlich Einwände.« Er verzog die Lippen zu einem hässlichen Grinsen. »Wie praktisch für dich, dass ich dein Bedürfnis nach Leid stillen kann wie kein Zweiter.«
Dieses Mal verzichtete er auf Magie und ließ stattdessen seine Faust vorschnellen.
Bevor die Kraft seines Hiebes mir das Nasenbein zertrümmern konnte, wich ich mit einer Seitwärtsbewegung aus.
Die stählernen Knöchel seiner Hand streiften mein Ohrläppchen, und allein diese flüchtige Berührung reichte aus, um mich ins Taumeln zu bringen. Ich konnte mich nicht schnell genug fangen, um auch dem nächsten Schlag zu entgehen. Mit voller Wucht traf er mich im Magen, und sofort spritzte mir Galle aus dem Mund.
Pfeifend zog ich die Luft ein, krümmte mich zusammen und kämpfte gegen das Bedürfnis an, auf meine zerschrammten Knie zu sinken. Innerlich wappnete ich mich bereits für die nächste Tracht Prügel, als unvermittelt ein Klatschen von irgendwo hinter meinem Peiniger erklang.
»Bravo, Ivar. Wirklich beeindruckend.«
Durch flatternde Lider konnte ich die Silhouette einer hochgewachsenen Gestalt ausmachen, die aus den nun geöffneten, blendend weißen Toren des noch weißeren Palastes trat.
»Während der König ungeduldig auf deine Ankunft wartet, hast du hier draußen ein bisschen Spaß mit seinem Ehrengast. Ich bin sicher, er wird seine liebe Freude an dieser Tatsache haben.«
Die Silhouette wurde zu einem jungen Mann mit dunklen, welligen Haaren, die ihm bis auf die Schultern fielen.
Seine Gesichtszüge wirkten wie gemeißelt; von den hohen Wangenknochen und der geraden Nase bis hin zum perfekten Schwung seiner Brauen. Ein selbst unter Bartstoppeln gut erkennbares Grübchen im Kinn vervollkommnete sein gutes Aussehen. Nicht einmal das sichelförmige Muttermal unter dem linken seiner absurd grünen Augen tat dieser Schönheit einen Abbruch. Vielmehr war es ihrer noch zuträglich.
»Artemius. Welch Vergnügen, Euch hier anzutreffen.« Der Gardist – Ivar – lächelte schmallippig. »Es wundert mich, dass der König Eure Leine derart lang lässt, dass Ihr Euch ohne ihn aus dem Palast bewegen dürft.«
Der ›Artemius‹ genannte Fae erwiderte das unechte Lächeln. »Mich hingegen wundert so gar nicht, dass du dich wunderst. Wo dir doch das Konzept von Freundschaft und Vertrauen völlig fremd ist.«
Während Ivar eine zweifellos gezwungene Höflichkeit an den Tag legte, duzte Artemius ihn.
Das und die Erwähnung seiner Verbindung zum König machte klar, dass er bei Hofe eine höhere Position als der Gardist innehatte. Ähnlich wie das schimmernde, edel anmutende Gewand, in das er gekleidet war.
»Und jetzt zu dir.« Artemius richtete seinen stechend grünen Blick auf mich. Dabei verströmte er eine so irritierende Aura der Macht, dass ich um ein Haar vor ihm zurückgewichen wäre. Soweit es mir das durch den Schlag verursachte Ziehen im Magen gestattete, richtete ich mich auf – und glich mit erhobenem Kinn aus, was mein geschundener Körper durch Erschöpfung an Größe einbüßte.
Ich wartete darauf, dass Artemius irgendetwas sagte oder tat, aber er starrte mich nur an.
Auf eine Weise, die meine Seele skelettierte.
»Sie hatte einen Fae-Spalter bei sich«, unterbrach Ivar diesen unangenehm intensiven Moment. »Das wird den König sicher weit mehr interessieren als meine notwendigen Erziehungsmaßnahmen.«
Erziehungsmaßnahmen.
Ich lachte bitter auf. Im selben Moment warf der Gardist Artemius mein Messer zu – verdächtig akkurat auf dessen Hals zielend. Ohne hinzusehen und in geradezu lächerlicher Mühelosigkeit griff dieser die Waffe aus der Luft, bevor sie seine Haut durchdringen konnte.
»Fae-Spalter. Wie dramatisch du doch heute wieder bist, Ivar.« Artemius löste seinen Blick von mir und musterte die Waffe mit vollkommener Gleichgültigkeit.
Dann schleuderte er sie zurück in Richtung des Gardisten, der sie ungleich schwerfälliger auffing.
»Du weißt doch, wie kritisch unser Herrscher Legenden und Mythen gegenübersteht«, tadelte Artemius ihn, ehe er zu Wort kommen konnte. »Die Malandhit-Steine sind nicht mehr als das – und nur gefährlich für jene, die an ihre Wirkung glauben.«
Malandhit-Steine. Daraus also war das Messer gefertigt, das meine Eltern mir vermacht hatten. Ich nahm die Neuigkeit auf, ohne dass sie irgendetwas in mir auslöste. An dieser Stelle spielte es keine Rolle mehr, ob die Klinge meiner Waffe durch Stahl hindurch glitt oder nicht.
Nicht für mich.
»Hört auf, mich ständig belehren zu wollen«, bellte Ivar unvermittelt, begleitet von unkontrolliert aus seinem Mund stiebenden Speicheltropfen. Dahin war seine Selbstbeherrschung. »Ihr seid nichts weiter als ein neunmalkluger Jungspund, der –«
Artemius hob eine Hand. »Tue dir selbst einen Gefallen und erinnere dich deiner Manieren. Du weißt, was ich sonst gezwungen wäre zu tun.« Sein Tonfall strotzte nur so vor Überheblichkeit.
Der Gardist indes wurde puterrot vor Wut.
Ich hoffte, er würde einen verdammten Herzinfarkt erleiden.
Oder daran scheitern, sein loses Mundwerk zu zügeln.
»Sehr weise«, lobte Artemius die selbst forcierte plötzliche Zurückhaltung des Gardisten. Eine Provokation, unter der dieser rasselnd Luft holte. Bedauerlicherweise verlor er nicht noch einmal die Beherrschung.
»Wohin nun damit?«, presste er zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor und hielt mein Messer mit spitzen Fingern empor.
»Oh. Behalte es. Ich bin sicher, du findest Verwendung dafür. Und sei es nur, um dich damit zu verteidigen. Ich kenne kaum jemanden, den Mensch und Fae so gern gespalten sehen wollen wie dich.«
Ich kam nicht umhin, dieser Feststellung zuzustimmen – und jenseits der Taubheit in meinem Inneren einen Hauch von Erleichterung darüber zu verspüren, dass der Gardist sein Pferd ohne eine weitere Erwiderung abführte.
»Na bitte. Da waren es nur noch zwei.« Artemius wandte sich mir erneut zu, woraufhin die gerade noch empfundene Erleichterung zerstob.
Ich schluckte. Das Grün seiner Augen schien das unscheinbare Graublau der meinen verschlingen zu wollen. Je länger ich hineinsah, desto mulmiger wurde mir. Zuerst hatte es mich an das satte Grün der gandarrischen Nadelbäume erinnert, das hin und wieder unter den Schneemassen zutage trat.
Nun aber weckte es in mir die Assoziation an ein tödliches Gift.
»Komm mit mir«, forderte Artemius mich auf.
Sein Tonfall war sanft, doch davon ließ ich mich nicht täuschen. Ebenso wenig wie von der Tatsache, dass dieser geheimnisvolle Schönling, im Gegensatz zu seinem übellaunigen, jegliche Impulskontrolle vermissenden Artgenossen auch ohne offensichtliche Drohungen auskam.
Denn dass er derlei Drohungen offenbar gar nicht erst nötig hatte, verhieß nichts Gutes.
Ganz und gar nichts Gutes.
Also neigte ich den Kopf in einem Winkel, der mein Einverständnis signalisieren sollte, und kämpfte gegen den unsichtbaren Widerstand, der dabei gegen meinen Kiefer drückte, an. Wenn ich schon nicht entkommen konnte, würde ich im Palast einen anderen Weg finden, das Opfer meiner Familien zu ehren.
Vielleicht gelang es mir sogar, den König zu verletzen.
Immerhin würde er während des Rituals meine Kräfte entfesseln. Und wenn er das tat, würde ich ihm zeigen, wie zerstörerisch Feuer wirklich sein konnte.
»Gut.« Ein beunruhigendes Glitzern schlich sich in Artemius’ Blick.
Vorfreude auf das bevorstehende Spektakel? Entzücken darüber, dass ich spurte?
Vielleicht beides. Oder nichts davon. Ich konnte ihn nicht lesen, so sehr ich es auch versuchte.
»Dann auf zu deinem letzten Gang, kleine Drachenbändigerin. Und willkommen im Herzen des Winters.«
Kapitel 4
Die Palasttore schwangen auf; ein gähnender Schlund, in dem ich für immer verschwinden würde.
Artemius trat zur Seite, wie um mir volle Sicht auf das zu gewähren, was sich im Inneren offenbarte: geschliffenes Eis, Säulen aus festem Schnee und Kristallgestein. Ich musste die Augen zusammenkneifen, so intensiv war das Glitzern und Funkeln, das die Tristesse Turbithas plötzlich überstrahlte.
»Wenn du kooperierst, verzichte ich darauf, dich zu fesseln«, teilte mir Artemius mit und machte eine ausladende Handbewegung in Richtung der pompös anmutenden Eingangshalle. »Was meinst du?«
Ich warf einen letzten Blick über die Schulter; hinweg über Turbitha, die Mauer und das dahinter liegende Brachland.
Und obwohl ich Gandarra nicht sehen konnte, fühlte sich dieser Blick wie der Abschied an, den ich dem kleinen Dorf am Rande des Waldes schuldete.
Der Abschied, den ich benötigte, um mich erhobenen Hauptes in das Herz des Winters zu begeben, in dem Artemius mich gerade willkommen geheißen hatte.
Ich straffte die Schultern und schritt an ihm vorbei.
Artemius folgte mir auf dem Fuße.
Hinter uns fielen die Tore scheppernd ins Schloss, und die Endgültigkeit, die dieses Geräusch vermittelte, bildete das perfekte akustische Gegenstück zu jenem Gefühl, das mich eben bei meinem letzten Schulterblick überkommen hatte.
»Fürchte dich nicht, kleines Menschenwesen.«
Ich zuckte zusammen. Die Worte, gesprochen mit einer tiefen, beruhigenden Stimme, schienen ihren Ursprung geradewegs in meinem Kopf genommen zu haben. Wie zur Bestätigung kribbelte es hinter meiner Stirn. Verstohlen musterte ich Artemius. Er schien die Stimme nicht vernommen zu haben – ein weiteres Indiz dafür, dass sie tatsächlich in mir erklungen war.
Vermutlich verlor ich nun nach allem, was jüngst geschehen war, den Verstand.
»Es schmerzt mich, dass wir einander auf diese Weise kennenlernen müssen. Und dass ich gezwungen sein werde, dir wehzutun. Nichts liegt mir ferner als das, glaube mir.«
Ich blinzelte. Nein, das hier war zu real, um bloß Gespinst meines Gehirns sein zu können. Dennoch hütete ich mich, Artemius danach zu fragen. Wenn das hier ein perfides, der Magie des Königs geschuldetes Spiel war – oder gar Artemius selbst sich einen Scherz mit mir erlaubte –, wollte ich gar nicht erst darauf eingehen.
In der Hoffnung, dass die Stimme mich in Ruhe ließ, wenn ich sie ignorierte, nahm ich einen tiefen Atemzug und hüstelte unter dem kratzigen Gefühl, das sich dabei in meinem Rachen ausbreitete.
Hier drinnen fiel das Atmen ungleich schwerer als unter freiem Himmel. Vielleicht, weil die herrschende Kälte so viel trockener war. Nicht so feucht und bis tief in die Knochen dringend, dafür aber jegliche verbleibende Energie aus meinem menschlichen Organismus dorrend.
Beklommen sah ich mich um.
Die Eingangshalle reichte über zwei miteinander durch breite Treppen verbundene Ebenen.
Um die insgesamt vier von der Decke pendelnden Lüster rankten sich weiße Rosen und über das wie Glas schimmernde Geländer der geradezulaufenden Galerie ergoss sich ein gefrorener Wasserfall.
Durch die Wände schien goldenes Sonnenlicht in den Raum und leuchtete ihn auf ätherische Weise aus.
Unter anderen Umständen hätte ich dieses Bildnis winterlichen Prunks womöglich sogar als schön empfunden.
Wissend aber, dass dieser Anblick zu den letzten meines Lebens zählen würde, erschlug er mich förmlich.
Also verschloss ich meine Sinne vor all dem mich umgebenden eitlen Glanz, so gut ich konnte.
»Hier entlang.«
Unnötig dicht schob Artemius sich an mir vorbei und streifte mich dabei mit der Schulter. Ich zuckte zusammen. Die machtvolle Aura, die ich bereits draußen wahrgenommen hatte, war durch die Berührung nun auch körperlich spürbar.
Wie der kurze, aber schmerzhafte Stich eines Insekts, bevor sich die betäubende Wirkung seines Gifts entfaltete.
Ohne sich noch einmal zu mir umzudrehen, steuerte er auf den linken von drei aus der Halle führenden Gängen zu.
Er schien nicht den leisesten Zweifel daran zu hegen, dass ich mit ihm kommen würde – und diese Tatsache allein reichte aus, um ihn zu hassen. Nicht nur für die Überheblichkeit, die seinem Gebaren innewohnte, sondern vor allem der Wahrheit wegen, die ich mir deswegen eingestehen musste.
»Dein Mut umgibt dich wie ein einzigartiger Duft.«
Ich unterdrückte einen verzagten Seufzer. So viel dazu, dass sich das Problem meines möglicherweise bröckelnden Verstandes von selbst lösen würde. »Bewahre ihn dir, Menschenwesen. Bewahre ihn dir bis zum Schluss.«
Menschenwesen.
Obwohl streng genommen auch ein Fae von ihr Gebrauch machen konnte, um die Unterschiedlichkeit unserer Spezies hervorzuheben, kam mir erstmals in den Sinn, dass auch ein Tier sie benutzen könnte.
Und zwar nicht irgendein Tier, sondern das eine, das Teil des mich zu erwartenden Rituals sein würde.
»Ich würde dir empfehlen, mir zu gehorchen. Wiederholungen wirken sich nicht allzu gut auf meine Stimmung aus.«
Nun, diese Stimme erklang eindeutig außerhalb meines Kopfes. Genauso durchdringend wie der Blick desjenigen, zu dem sie gehörte, zerschnitt sie mühelos den Nebel meiner Gedanken.
Ich lächelte schmallippig gegen das Bedürfnis an, Artemius in meine gesammelte Kenntnis an Schimpfwörtern und Verwünschungen einzuweihen, und setzte mich in Bewegung. Mir blieb keine Wahl, als seiner Aufforderung Folge zu leisten, auch wenn ich mich ihr liebend gern widersetzt hätte.
Das wusste er genauso gut wie ich.
»Geht doch. Aber ruhig etwas zügiger, wenn ich bitten darf. Wir sind spät dran. Und man lässt den Winterkönig nicht warten.« Kraftvoll und tief hallte Artemius’ Stimme von den hohen Wänden des Korridors wider. Dieses Mal verweigerte ich mich seinem in eine vermeintliche Bitte gekleideten Befehl, wenn auch nicht willentlich.
Mein Körper schien sich an die Strapazen der vergangenen Stunden zu erinnern und begann allmählich, kombiniert mit der in diesen Mauern so anderen Kälte, seinen Dienst zu versagen.
Ich humpelte mehr, als dass ich ging.
Artemius’ Bewegungen hingegen waren auf eine Weise fließend-elegant, die mich an einen langsamen, sinnlichen Tanz denken ließen. Genau wie jene der übrigen Höflinge, die unseren Weg kreuzten. Wie auch Artemius waren sie ganz in Weiß gekleidet. Das fehlende Bunt in ihren Gewändern war der städtischen und höfischen Kleiderordnung geschuldet – Stoffe, die vom königlich verfügten Farbspektrum abwichen, galten als verboten.
Grün, Blau, Rosa, Rot: All das erinnerte den König, so hieß es, zu sehr an den Sommer, der einst in Nascania geherrscht haben soll. Ich fragte mich, ob der König mich für das Ritual in eine seine Vorschriften erfüllende Robe stecken würde, oder ob er es mir gestattete, im Grau meiner eigenen Kleidung zu sterben.
Hatte ich mir eben noch gewünscht, die fremde Stimme in meinem Kopf würde verstummen, sehnte ich sie nun förmlich herbei.
Im Angesicht des nahenden Todes war mir jede Ablenkung recht.
»Ich denke, was die Bedeutung des Wortes ›zügig‹ betrifft, gehen unsere Auffassungen ein wenig auseinander.« Artemius tauchte so unvermittelt neben mir auf, wie seine Silhouette sich zuvor aus der blendenden Helligkeit der Palasttore geschält hatte.
Offenbar war er stehen geblieben – und ich derart in düsteren Gedanken versunken, dass ich es nicht einmal bemerkt hatte.
Nun hakte er sich bei mir unter.
Genauso, wie meine Schwester Namila es immer getan hatte.
Ich versteifte mich, doch Artemius zog mich einfach mit sich.
So schnell, dass meine Füße nutzlos über den Boden schleiften.
Das neuerliche Stechen, das ich infolge der Berührung erwartete, blieb aus.
Oder vielleicht wurde es auch nur von dem anderen, viel schlimmeren Stechen überschattet, mit dem die Erinnerung an meine Schwester mein Herz aus dessen Apathie zu wecken versuchte.
»Finger weg«, protestierte ich schwach gegen die Erniedrigung an, der Artemius mich mit dieser Fortbewegungsmethode aussetzte. Wie ein nasser Sack hing ich an seinem rechten Arm, und genau wie einen solchen Sack beförderte er meinen geschundenen Körper über das Eis des Palastbodens.
Artemius schien mich einer Antwort nicht als würdig zu erachten. Die Ahnung eines Lächelns auf den Lippen, setzte er seinen – unseren – Weg fort, bis er vor einer breiten, klinkenlosen Tür stehen blieb.
Holzgefertigt, wie ich mit einem Hauch irrationaler Freude feststellte.
Mit weißer Farbe bemalt, um sich in das geltende Farbschema einzufügen – und dennoch nach Wald, Freiheit und Heimat duftend.
Eilends nahm ich wieder einen festen Stand ein, doch Artemius ließ nicht zu, dass ich mich an diesem winzigen Stück zurückgewonnener Eigenständigkeit erfreuen konnte.
Die Tür schwang auf, und er stieß mich geradewegs hindurch.
So heftig, dass ich der Länge nach hinfiel.
Noch während ich stürzte, stellte ich mich darauf ein, über denselben geschliffenen Eisboden zu schlittern, der bisher auch den Rest des Palastes ausgekleidet hatte.
Doch es war Stein, der mich begrüßte.
Stein – und der Gestank nach Tod und Feuer.
Kapitel 5
Fluchend rappelte ich mich auf.
Wenn meine zahlreichen Abschürfungen zwischenzeitlich überhaupt zu bluten aufgehört hatten, waren sie nun wieder ganzheitlich aufgerissen.
Alle bis auf die von den Knochen meiner Eltern rührende Platzwunde auf der Stirn – auch wenn ich mir nun auf makabre Weise die durch einen roten Schleier verborgene Welt zurückwünschte.
Denn das, was ich sah, wollte ich am liebsten in derselben Sekunde vergessen.
Der Raum war kesselförmig angelegt und bis knapp unter die eine Kuppel formende Decke mit Rängen ausgestattet, die für gewöhnlich wohl Zuschauer beherbergten. Unterhalb dieser Ränge tat sich ein in schummrigem Zwielicht liegendes Becken auf, in dem ein rußgeschwärzter Altar und eine in einigem Abstand davon positionierte Empore errichtet worden waren.
Beide Konstruktionen waren mit schweren Ketten versehen, die wie schlafende Schlangen auf dem Boden lagen.
Und oberhalb der Ränge – auf einem abgegrenzten Rundbalkon – saß er: der Winterkönig.
Wobei ›sitzen‹ ein zu schlichtes Wort für das war, was er tat.
Vielmehr thronte er auf seinem breiten Stuhl mit der hochaufragenden, spitz zulaufenden Lehne.
»Da ist ja die kleine Feuerzunge.«
Der König sprach mit einer tiefen, uralt klingenden Stimme, die in harschem Kontrast zu seinen jugendlichen Zügen stand. Seine Haut war so rosig wie die eines Heranwachsenden. Augen, Mund und Nase wie von fähiger Künstlerhand gezeichnet.
Seine ihm bis knapp über die Schultern wallenden Haare schimmerten in einem Kupferton, der wohl eher an Feuer denn an Eis erinnert hätte – wäre er nicht hie und da von auffallend weißen Strähnen durchzogen. Vielleicht waren diese Strähnen der einzig sichtbare Hinweis auf sein wahres Alter, das sich hinter dem sonst so jung gebliebenen Gesicht verbarg. Oder aber der Winter kennzeichnete ihn auf diese Weise als seinen Propheten. Was es auch war, es verfehlte seine einschüchternde Wirkung nicht.
»Majestät.« Artemius verbeugte sich tief und verharrte so lange in dieser ungesund aussehenden Krümmung seines Oberkörpers, bis der König das Wort an ihn richtete. »Neven Artemius. Ich wusste, auf dich Verlass.«
Neven.
Ich schüttelte mich innerlich.
Doch dieser viel zu lieblich klingende Vorname war längst nicht alles, was mir die Nackenhaare zu Berge stehen ließ.
So wie der Winterkönig es sagte, weckte es den Anschein, als hätte der Schönling mich aus meinem Dorf entführt und meine Familie abgeschlachtet.
Nicht der Gardist, der vor dem Palast seiner Wege gezogen war und nun weiterleben durfte, ohne jemals für diese Gräueltat zu büßen.
Weiterleben, während ich in diesen Mauern sterben würde.
Ich spürte, wie die betäubende Wirkung des Schocks weiter nachließ und eine heiße Wut hinter meinem Brustbein erwachte. Eine Wut, die vielleicht sogar heißer war als das Feuer, das der König mich mit meinem Gesang beschwören lassen würde.
Sein stahlgrauer Blick durchbohrte mich förmlich.
Anders als auf die Art, wie Artemius’ es vor dem Palast zu tun vermocht hatte und doch gewiss nicht weniger unangenehm.
Wenn er allerdings glaubte, dass ich dessen unterwürfige Geste imitierte, konnte er lange warten.
»Selbstverständlich, Euer Gnaden. Soll ich den Drachen holen?«
»Nur zu, mein Freund. Auch wenn ich wahrlich ungern auf deine schmeichelhaften Anreden verzichte. Aber vielleicht hat ja unser Gast auch ein paar Lobpreisungen für mich übrig.«
»Vielleicht. Aber ich habe vielmehr das Gefühl, als würdet Ihr Euch an diesem Gast die Zähne ausbeißen … Eminenz.«
Der Winterkönig lachte rau, und Artemius stimmte mit ein.
Der Umgang, den beide miteinander pflegten, weckte in mir eine Ahnung davon, was Artemius vorhin mit seiner Ivar gegenüber ausgesprochenen Drohung gemeint hatte. Es war zweifellos ein Leichtes für ihn, jeden, der ihm mit mangelndem Respekt entgegentrat, vor dem Oberhaupt der Fae zu denunzieren. Inklusive aller blutiger Konsequenzen.
»Nun aber los.« Der König machte eine wedelnde Handbewegung. Sein Lachen war zu einem Grinsen abgeflaut, das die von Artemius gerade noch scherzhaft erwähnten Zähne raubtierhaft in Szene setzte. »Lass mich nicht länger warten, mein Freund. Nur weil dieser Tage kein Publikum mehr anwesend ist, bedeutet das nicht, dass niemand das Spektakel herbeisehnt. Ich freue mich genug für hundert Seelen.«
»Keine Sorge. Ich eile.«
Ich hatte erwartet, dass Artemius wieder aus der Holztür verschwinden würde, durch die er mich gestoßen hatte.
Stattdessen huschte er an mir vorbei; glitt lautlos wie ein Schatten in den Bauch des Kessels und verschmolz mit dem dort herrschenden Halbdunkel.
Offenbar befand sich dort ein Durchgang, den ich von meiner Position aus nicht erkennen konnte.
Plötzlich wurde der schwere Geruch nach Eisen und Rauch, der in der Luft hing, unerträglich.
In einem Versuch, meinen rebellierenden Magen mit dem Duft von Heimat zu beruhigen, drehte ich mich doch noch einmal zur Holztür um. Doch hier drinnen erreichte mich das Aroma des Waldes nicht.
Dafür eine Erkenntnis:
Die Holztür war das einzig Brennbare in diesem Raum.
Dass der König sie nicht dem Rest seines steinernen Foltersaals angepasst hatte, war für mich nur ein weiterer Ausdruck seiner unsäglichen Arroganz.
Symbolisch dafür stehend, dass er am Ende die Oberhand hatte.
»Du siehst aus wie deine Mutter, Gylda Endurian.«
Einen aberwitzigen Moment lang hatte ich die Anwesenheit des Winterkönigs beinahe vergessen. Sein mit dröhnender Stimme vorgebrachter Vergleich aber traf mich mit der Kraft eines Peitschenknalls.
Ich wirbelte zu ihm herum.
»Ja, ganz genau wie sie.« Der König kniff ein Auge zusammen, hob den Zeigefinger und vollführte dabei eine Reihe bedächtiger Bewegungen. »Nase, Lippen, Augen … Ihr Ebenbild.«
Er ließ den Finger wieder sinken. Fröstelnd realisierte ich, dass er die Konturen meines Gesichts nachgezeichnet hatte.
»Nur das Gold auf deinem Kopf erinnert an deinen Vater«, ergänzte er flüsternd.
Unwillkürlich berührte ich meine Haarspitzen. Sie waren noch immer durch Rayannes Tinktur verfärbt, bis hinauf zum Ansatz. Doch wie es schien, war der König imstande, die Täuschung zu durchschauen.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
»Hört auf, über meine Eltern zu sprechen, als würdet Ihr sie kennen.« Ich zitterte unter dem Versuch, meinen Hass zu bändigen – und fragte mich im selben Moment, warum ich diesem mächtigen Gefühl nicht mehr Raum verlieh.
Welche Strafe hatte ich als ohnehin Todgeweihte schon zu befürchten?
Der König legte den Kopf schief und hob in vermeintlichem Bedauern die Brauen. »Aber das tue ich, Gylda. Ich muss einen Menschen nur einmal ansehen, um genau zu wissen, wer er ist. Und deine Eltern habe ich mir ganz besonders gut angesehen, wann immer ich sie am Stadtrand zu Gesicht bekommen habe.« Er seufzte. »Es hätte nicht auf diese tragische Weise enden müssen. Für keinen derer, die nun nicht mehr unter uns weilen.«
Meine Beherrschung fiel in sich zusammen. Ich stolperte nach vorn, die Zähne bleckend und einen animalischen Laut von mir gebend. Ich wollte nichts sehnlicher, als den König von seiner Balustrade zu reißen und mit meinen Fäusten zu traktieren.
Ganz gleich, ob meine Knöchel bereits aufgeplatzt und geschwollen waren oder nicht. Und dass es mir nicht gelingen würde, ihm auch nur ein Haar zu krümmen, steigerte meinen Zorn ins Unermessliche.
Feuer, erinnerte ich mich.
Feuer war die einzig effektive Waffe, die ich im Kampf gegen diesen Tyrannen einsetzen konnte. Und würde.
Auch wenn mir noch nicht klar war, wie ich das anstellen sollte.
»Es ist aber tragisch geendet!«, bellte ich, während der Puls in meiner Schläfe trommelte. »Verdammt tragisch sogar.«
»Ja«, pflichtete der König mir seufzend bei. Er löste die Überkreuzung seiner Beine und brachte damit sein Gewand zum Rascheln. Ein Laut, der mich an den schneidenden Wind erinnerte, der daheim durch die Fichten vor meiner Hütte fuhr.
»Das ist es in der Tat. Ein Jammer, dieser Lauf der Ereignisse. Aber das kommt dabei heraus, liebes Kind, wenn jene nach Großem streben, die nicht dafür geschaffen sind. Besondere Gaben und Menschen … Das verträgt sich nicht miteinander.«
Ich schnaubte. Als hätte ich – oder irgendjemand sonst – die Wahl gehabt, ob er sich der Fähigkeit des Feuerbesingens annehmen wollte oder nicht.
Allmählich schwante mir, dass hinter der Auslöschung aller Drachen und Feuersänger nicht nur die Furcht vor einer Rückkehr des Sommers stand, sondern außerdem purer Neid.
Neid auf die Macht, über die all jene, die meine Gabe teilten, verfügten, indem sie – und nur sie – einem Drachen das Feuer schenken konnten.
Und somit auch Neid auf die daraus entstandene Verbundenheit; die einzigartige Symbiose, die zwischen Drachen und Menschen geherrscht haben musste.
Drachen nämlich mussten Feuer speien, wenn sie nicht Gefahr laufen wollten, ihren Organismus zu überhitzen. Und da sie dies aufgrund einer Irrung der beim Beben freigesetzten Magie nur dann folgenlos tun konnten, wenn es ihnen von ebenfalls magiegeküssten Zungen befohlen wurde, brauchten sie die Meinen. Genau, wie meine Vorfahren sie brauchten, um sich in dem einem dunklen Wandel unterliegenden Nascania zu behaupten.
Das nahende Geräusch rasselnder Ketten unterbrach meinen Gedankenstrom.
Im nächsten Moment trat Artemius aus den Schatten, in denen er zuvor verschwunden war.
Und neben ihm an einer grobgliedrigen Kettenleine …
»Ich würde lieber mich selbst verbrennen, als dir Leid anzutun.«
Mir stockte der Atem.
Obwohl ich genau das bereits vermutet hatte, war die Gewissheit, dass der Drache tatsächlich zu mir sprach, überwältigend. Bei allem nämlich, was meine Familie mir über meine Gabe erzählt hatte, war eine solche Verbindung nie erwähnt worden. Gleichermaßen faszinierte es mich, den Drachen überhaupt zu sehen.
Ihn, das allerletzte für die Rituale des Königs eingesetzte Exemplar einer Art, die ganz und gar von der Bildfläche verschwunden war.
Aus goldgelben Augen starrte es mich an.
Der Drache war nicht größer als ein Pony, wenn auch durch den mit Stacheln bewehrten Schwanz ungleich länger. Die Schuppen, die seinen Körper wie einen Panzer schützten, mussten einmal grün gewesen sein, waren aber sicher im Laufe seiner Gefangenschaft krankhaft verblichen und ließen nur noch eine Ahnung ihrer einstigen Farbkraft zu.
Überhaupt sah der Drache, soweit ich das beurteilen konnte, geradezu verkümmert aus. Immerhin auf Zeichnungen hatte ich die ehrfurchtgebietenden Kreaturen schon bewundert, und auf keiner davon waren ihre Schwingen in einem derartigen Zustand gewesen.
Kaum richtig ausgebildet, die dünne Haut zwischen den verästelten Flügelknochen rissig und durchscheinend, hie und da sogar deutlich eingerissen.
Vielleicht hatte man sie gestutzt, oder der kleine Drache war schon mit ihnen geboren worden.
Sicher war, dass diese Anomalie, gekoppelt mit der geringen Größe des Drachen, dem König zugutekam.
Allein schon deshalb, weil er leichter zu kontrollieren sein dürfte als seine normalwüchsigen Artgenossen.
Wie lange er sich wohl schon in der Gewalt der Fae befand? Gezwungen, seine einstigen Verbündeten als solche zu enttarnen und Zeuge ihrer Hinrichtungen zu werden?
Ich spürte, wie mir die Brust eng wurde.
Dieses Tier musste mehr Schmerz erduldet haben, als ich es mir auch nur ansatzweise vorstellen konnte.
Das ließ allein schon der eng sitzende, breite Halsring vermuten, der geradezu mit seiner Haut zu verwachsen schien.
Plötzlich kam mein eigenes Schicksal mir beinahe gnädig vor.
»Nun denn. Beginnen wir«, durchbrach der König die drückende Stille und schien damit den jegliche Geräusche unterdrückenden Bann aufzuheben. Denn plötzlich empfand ich nicht nur meinen eigenen Atem als störend laut, sondern auch den desjenigen, der wieder hinter mir stand.
Desjenigen, der viel zu dicht hinter mir stand und dessen Präsenz in meinem Rücken sich einen verwirrenden Herzschlag lang sogar bedrohlicher anfühlte als die Anwesenheit des Königs.
»Los«, raunte Artemius, platzierte die Finger zwischen meinen Schulterblättern und dirigierte mich vorwärts.
Die glatten Stufen hinunter und in den Bauch des Kessels, der mit der Asche unzähliger Feuersänger bedeckt sein musste.
Als wir den Altar erreichten, bedeutete Artemius mir mit einem festen Schulterdruck, anzuhalten.
Dann fuhr Leben in die zuvor reglos auf dem Boden ausharrenden Ketten. Von Zauberhand erweckt, schnappten die Eisenschellen um meine Hand- und Fußgelenke zu.
Sofort ergriff eine seltsame Ruhe Besitz von mir.
Vielleicht, weil es von diesem Punkt an wirklich und wahrhaftig kein Zurück mehr gab.
Oder aber, weil der Drache mich noch immer fixierte.
»Denk an etwas Schönes. Das Schönste, an das du dich erinnerst.«
Gern hätte ich diesen Rat befolgt, doch ich konnte längst keinen klaren Gedanken mehr fassen. Jedenfalls keinen, der sich auch nur annähernd in die Richtung von etwas Schönem bewegte. Seine Nüstern blähend, schnupperte er in meine Richtung.
Ich war so von den offensichtlichen Makeln des Tieres abgelenkt gewesen, dass mir erst jetzt auffiel, wie schön es eigentlich war. Jedenfalls, wenn man nur seinen gebogenen Hals und den wohlgeformten Kopf betrachtete, aus dem heraus zwei goldene Hörner wuchsen.
Die Wülste über den gelben Augen schimmerten ebenfalls golden, und auch die seine Schnauze bedeckenden Schuppen erstrahlten in diesem edlen Glanz.
Ich erwischte mich dabei, wie ich dem Tier zunickte.
Eine stumme Geste des Respekts, die ihm vorzuenthalten ich schlicht nicht vermochte. »Einst nahm ich diese kleinen Rituale zum Anlass für ein großes Spektakel, zu dem ich die halbe Stadt einlud«, eröffnete der König mir im Plauderton, während Artemius die Ketten straffzog und mein Körper daraufhin gegen das rußgeschwärzte Gestein des Altars gepresst wurde. »Aber inzwischen genieße ich es lieber für mich allein. Oder eher fast für mich allein. Beachte meinen werten Assistenten einfach gar nicht, liebste Gylda. Er sieht nur zu, um zu lernen.«
Noch einmal ging ein Ruck durch meine Ketten.
Die scharfkantige Mensaplatte des Altars bohrte sich knapp oberhalb meines Beckens in meine Wirbelsäule und meine Arme lagen hinter meinem Rücken auf dem Gestein auf.
Sobald das Feuer des Drachen mich erreichte, würde ich über diesem Opfertisch einfach zerschmelzen.
Wieder wartete ich vergeblich darauf, dass die Furcht über diese Aussicht mein Bewusstsein stahl.
Stattdessen spürte ich, wie Artemius sich mitsamt seiner dunklen Präsenz von mir entfernte. Entweder, um sich in die Schatten des Raumes zurückzuziehen oder um die jeden Moment einsetzende Darbietung ebenfalls von den Zuschauerrängen zu verfolgen.
So oder so, gewiss geiferte er bereits vor lauter abscheulicher Vorfreude.
»Seid Ihr sicher, dass Euer Publikum nicht aus freien Stücken entschieden hat, auf das hier zu verzichten?« Ich sah den König nicht an, während ich diese Frage stellte. Die Vorstellung nämlich, dass sein Stolz sich unter dieser Missachtung in Qualen wand, ließ mich vor Freude geifern. »Ihr wisst schon«, setzte ich meine Provokation fort. »Dieses lange Gerede, ohne dass irgendetwas Nennenswertes passiert.«
»Das …« Der König unterbrach sich selbst. Sein Zögern war ein Sieg, an den ich mich in den letzten Augenblicken meines Lebens erinnern würde.
»Gerede«, wiederholte ich so laut, dass der Raum meiner Stimme ein Echo verlieh. Warum nur war ich nicht gleich auf die Idee gekommen, den König auf verbale Weise zu verunglimpfen?
Körperlich würde ich einem Fae – erst recht einen, der die Krone des Winters trug – niemals ernstlich zusetzen können. Erst recht nicht unter diesen Voraussetzungen.
Worte aber konnten mühelos mit der Schärfe einer geschliffenen Klinge mithalten. Und allemal mit der Kraft eines Faustschlags.
»Vergiss, was ich eben über das Schöne und das Denken gesagt habe. Das hier ist besser. So viel besser.«
Ein irrwitziges Glücksgefühl zupfte an meinen Mundwinkeln und das Lob des Drachen straffte meinen ganzen Körper.
»Schweig, Endurian.«
Schon war der Moment des Triumphes wieder vorüber. Der nun aufkommende Gestank nach Magie übertünchte sogar jenen nach verbrannten Knochen, der die Luft bisher verpestet hatte. Ein schneidender Windzug fuhr durch den fensterlosen Raum und ließ mir den Speichel auf der Zunge gefrieren.
Sogar meine Sicht trübte sich unter dem heftigen Temperaturabfall, der die Feuchte meiner Augen mit winzigen Eiskristallen bedeckte.
»Ich würde nichts lieber tun, als deinen Körper in eine Umarmung des ewigen Eises zu schließen. Aber versiegelt nützen deine Lippen mir nichts.«
Der Wind erstarb, und mit ihm die grässliche Kälte.
Blinzelnd schluckte ich hinunter, was davon in meinem Mund übrig geblieben war … und stellte fest, dass mit dem Geschmack nach Frost und Tod noch etwas anderes verschwand: meine gerade erst entdeckte Aufmüpfigkeit.
»Ich merke, wir verstehen uns«, erkannte der Winterkönig, dem dieser jähe Umschwung meiner Stimmung offenbar nicht entgangen war. »Wunderbar. Lass mich also weiter erläutern, Endurian – und sieh meine Bereitschaft dazu als das Zeugnis von Gnade an, das es ist. Ich an deiner Stelle wüsste meine Redseligkeit zu schätzen, wo sie doch alles ist, was dich noch von deinem Ende trennt.«
Ich wollte etwas erwidern, doch so schnell, wie ich sie gewetzt hatte, war die Klinge meiner Worte wieder stumpf geworden.
»Es ist wie folgt, mein Goldkehlchen: Kein Drache bei Verstand würde jemals einen Feuersänger verbrennen. Glücklicherweise ist das Exemplar, das du hier vor dir siehst, schon längst nicht mehr bei Sinnen – ganz zu schweigen davon, dass es noch so etwas wie einen eigenen Willen besäße.« Der König lachte verächtlich. Aus dem Augenwinkel nahm ich wahr, dass er mit den Fingern in die Luft schnipste.
Daraufhin biss der Drache sich selbst in sein linkes Vorderbein. Entsetzt beobachtete ich, wie er ein Stück Fleisch herausriss und vor sich auf den Boden spie.
Übelkeit schwappte in Wellen durch meinen Körper – nicht etwa des blutigen Fetzens oder der Wunde wegen, sondern der nackten Verzweiflung geschuldet, die im Blick des Drachen aufflackerte.
Und dann setzte sie endlich ein:
die Todesangst, die bisher um mein betäubtes Herz herumgeschlichen war.