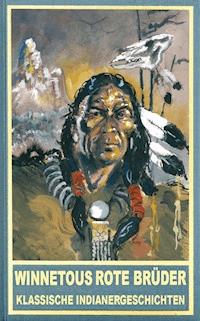
Winnetous rote Brüder E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Karl-May-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Seit mehr als zwei Jahrhunderten begeistern sich Jung und Alt für den "Roten Mann", der mit seinem abenteuerlichen Dasein, der ungebundenen Freiheit in der Wildnis, seiner Tapferkeit und seinem Ehrgefühl besonders den zivilisierten Stadtmenschen in seinen Bann schlägt. Autoren in der Alten und vor allem in der Neuen Welt sind dieser Faszination erlegen und erzählen unermüdlich in Romanen und Kurzgeschichten aus dem Leben der Indianer, nach dem sie sich mit ihren Lesern insgeheim sehnen. Die Anthologie "Winnetous rote Brüder" erschließt die Klassiker der Indianererzählung einem breiten Leserkreis, wartet mit mancher Überraschung und Wiederentdeckung auf, befriedigt dabei die Lust am Schmökern und das nie erloschene Interesse an Chronik und Mythos des indianischen Wilden Westens. Mit zehn Erzählungen von James Fenimore Cooper, Charles Sealsfield, Gabriel Ferry, Mayne Reid, Armand, Franz Treller, Karl May, Fritz Steuben, Jack London und Friedrich Gerstäcker. Eine allgemeine erklärende Einführung von Prof. Dr. René Oth in die Indianerliteratur deckt die Spannweite der Thematik ab: die Auseinandersetzung zwischen Rot und Weiß - Sitten und Bräuche, Alltagsleben, Feste und religiöse Riten der Indianer - wirkliche und erdachte indianische Helden - und vieles mehr. Nur noch als E-Book erhältlich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 624
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
WINNETOUS
ROTE BRÜDER
Klassische Indianergeschichten
aus der Feder von Karl May,
seinen Vorläufern und
Zeitgenossen
HERAUSGEGEBEN
UND EINGELEITET
VON
RENÉ OTH
Inhalt
Vorwort von René Oth: DER PRÄRIEREITERNOMADE – UNSER ALLER „ROTER FREIZEITBRUDER“
James Fenimore Cooper: DER LETZTE MOHIKANER (Auszug)
Von Gefahren umlauert
In der Höhle des Löwen
Die Macht der Medizin
Vom Stamme der Schildkröte
Charles Sealsfield: DER GEFANGENE DER SQUAWS (Aus Der Legitime und die Republikaner)
Der Gefangene der Squaws
Die weiße Rose
Die Flucht
Gabriel Ferry: VON APACHEN GEJAGT (Aus Der Waldläufer)
Auf der schwimmenden Insel
Die Rettung des Gefangenen
Der Angriff der Indianer
Die Flucht
Mayne Reid: DIE SKALPJÄGER (Auszug)
Armand: TAYO oder DIE GROSSE LIEBE AN DER INDIANERGRENZE (Aus An der Indianergrenze)
Franz Treller: DER KÖNIG DER MIAMI (Auszug)
Der Marterpfahl droht
Ni-kun-tha – der Fuchs
Die weiße Squaw
Karl May: AUF TOD UND LEBEN (Aus Der Schatz im Silbersee)
Fritz Steuben: DER PFEIL IST VON DER SEHNE GESCHNELLT (Aus Der Sohn des Manitu)
Der erste Kongress
Der Tag ward grau
„Der Pfeil ist von der Sehne geschnellt“
„Es ist Tecumsehs Wille!“
Jack London: DER BUND DER ALTEN MÄNNER
Friedrich Gerstäcker: DAS FORT AN DER SALZFURT
Nachwort von René Oth: DER FREIHEITSKAMPF DES ROTEN MANNES – DIE INDIANER ALS DIE GESCHUNDENEN, VERFOLGTEN UND ENTRECHTETEN DER GESCHICHTE
Der längste Holocaust der Geschichte
Fast vierhundert Jahre Krieg: Warum die Indianer den Weißen immer unterlagen
Krieg und Frieden: Die Waffen der Indianer
Weitere Literatur zum Thema – eine Auswahl
Meinen Kindern Jocelyn, Adrien und Elodie in Liebe gewidmet
Vorwort von René Oth: DER PRÄRIEREITERNOMADE – UNSER ALLER „ROTER FREIZEITBRUDER“
Wer hat in seinem jugendlichen Drang und Eifer nicht davon geträumt, als berühmter Indianerhäuptling mit seinen tapferen roten Brüdern auf feurigen Mustangs über die Prärie zu sprengen, dem Büffel nachzusetzen und die Feinde des Stammes in einer großen Schlacht zu besiegen?
Sirrend bohrte sich Pfeil um Pfeil in die Leiber der Soldaten. Schuss um Schuss knallte in die zusammengeschmolzenen Bataillone der Blauröcke. Zu Dutzenden fielen die Weißen aus den Sätteln, Pferde überschlugen sich und erbitterte Nahkämpfe flammten auf. Kriegsgeschrei, Pulverdampf, Blutgeruch, Staubnebel, Schusswaffengeknatter, Wolken von Pfeilen und Lanzen hüllten das Schlachtgetümmel ein. Tomahawk und Messer, Gewehr und Bogen räumten furchtbar unter den Soldaten auf. An der Stelle, wo der letzte Widerstand geleistet wurde, stand Lieutenant Colonel George Armstrong Custer „wie eine Getreidegarbe inmitten gefallener Ähren“, bis auch er den tödlichen Streich empfing und schwer zu Boden schlug.
Dies war kein im Schlaf heraufbeschworenes Wunschbild eines jungen Indianerschwärmers, der nachts seiner Fantasie freien Lauf ließ und einmal mit dabei gewesen sein wollte, sondern die raue Wirklichkeit, die das weiße Nordamerika aufschreckte, als die Nachricht von der für die US-Armee so verhängnisvollen Schlacht vom 25. Juni 1876 am Little Bighorn im amerikanischen Bundesstaat Montana sich wie ein Lauffeuer verbreitete. Die vereinigten Präriestämme der Sioux, Cheyennes und Arapahos hatten unter der Führung des Sachems[1] Sitting Bull und dessen Kriegshäuptlingen Crazy Horse und Gall das 7. US-Cavalry Regiment bis auf den letzten Mann aufgerieben. Die Nachricht, die wie ein Blitz aus heiterem Himmel einschlug, war unfassbar: 225 Tote in knapp zwanzig Minuten.
Das „Massaker am Little Bighorn“ verstörte das offizielle Amerika umso mehr, als man damals die Indianerfrage eigentlich schon für gelöst ansah. Vor 137 Jahren schlugen die Sioux und ihre Verbündeten die letzte siegreiche Schlacht der roten Rasse. Trotzdem verloren die Indianer den Krieg. Denn im Ringen um die Vorherrschaft unterlag der rote Mann – stark dezimiert, umgesiedelt in Reservate, demoralisiert.
Als der kämpferische Widerstand der Rothäute gebrochen war, hatten die Weißen sie noch nicht für die abendländische Zivilisation gewonnen. Mit aller Macht sträubten sich die Indianer gegen die Integration, wollten sie doch unbedingt ihre Eigenheit behalten. Sie waren Individualisten im Rahmen ihrer Sippenverbände. Obwohl sie sich von Stamm zu Stamm, von Nation zu Nation durch ihre Sitten und Gebräuche, ihre Sprachen und Dialekte unterschieden, war ihnen jedoch allen ihr Nonkonformismus gegenüber den Weißen gemeinsam, ihr Wunsch, in Ruhe gelassen zu werden, ihre Freiheit so auszuleben, wie sie es verstanden.
So ist es nicht erstaunlich, dass sich unter den Sippen- und Familienverbänden der nomadisierenden Völkerschaften eine staatliche Organisation erübrigte. Bei allen indianischen Völkern wurde eine regelrechte Basisdemokratie gepflegt, was sich schon allein in der Tatsache spiegelt, dass nur der Tüchtigste, Erfahrenste und Einsatzfreudigste zum Anführer berufen wurde und dieser seine Stellung wieder abgeben musste, wenn er die Zustimmung des Stammes nicht mehr besaß. Da diese Basisdemokratie zwangsläufig größere indianische Zusammenschlüsse verhinderte, kam sie der durch die Entdeckung des Kolumbus ausgelösten Westwärtsbewegung der Weißen natürlich zugute.
Der Konflikt zwischen den auf Eigenständigkeit bedachten Indianern und den sie zur Eingliederung anhaltenden Weißen wird wohl so lange weitergehen, bis es uns vielleicht eines Tages gelingen wird, die Kluft zwischen Ur- und Neuamerikanern, zwischen Rot und Weiß zu schließen. Bücher wie das vorliegende tragen hoffentlich dazu bei, dass nach und nach die von den Weißen gegenüber den Indianern gehegten Vorurteile abgebaut werden und dass der amerikanische Ureinwohner, der dem modernen Leistungsdruckmenschen so viel literarische Kurzweil verschafft, sich vom bleichgesichtigen Nachbarn mehr Verständnis erhoffen kann.
Die heutigen Autochthonen[2] sind selbstbewusster geworden, vielleicht auch fordernder, sie sind dabei, ihre Vergangenheit zu bewältigen und sich der Zukunft zuzuwenden, sie sind bemüht, die Apathie zu überwinden, die ihnen als den Geschlagenen, Verfolgten und Entrechteten der Geschichte zu Eigen war – und noch ist, vielerorts.
Das Bild, das sich die meisten Europäer heute von den Indianern machen, ist schlicht gesagt ein Klischee, geprägt von den romantisierenden Darstellungen des 19. Jahrhunderts, von James Fenimore Cooper oder von Karl May, in deren idealisierenden Werken das Porträt eines stolzen Kriegers entsteht, mit der Adlerfeder im Haar und den hochherzigen Gedanken im Kopf. So verfestigte sich zum einen die Vorstellung vom edlen Naturmenschen, einst als Zivilisationskritik gedacht, und zum andern das Bild vom grausamen Bewohner der Prärien und Felsengebirge, dem unerbittlichen Feind der westwärts ziehenden Siedler.
Den „edlen Wilden“ mit der ihm angedichteten unschuldigen Natürlichkeit und unverbildeten Ursprünglichkeit gab es in Wirklichkeit nicht. Auch die Indianer haben einander bekriegt und vertrieben, und dies nur allzu gründlich. Deswegen waren sie aber noch lange keine unterentwickelten Schlagetots, die nur aus Spaß an der Freud’ genüsslich skalpierten und am Marterpfahl folterten. Obwohl dem Marterpfahl in der Indianerliteratur eine wichtige Rolle zufällt, kamen die Rothäute im alltäglichen Leben oft ohne ihn aus.
Die Indianer waren weder Heilige noch Teufel, sondern Menschen wie wir, deren Entwicklung in grauer Vorzeit eine völlig andere Richtung genommen hatte.
Als schöne Seelen und als Bösewichte sowie als Durchschnittswesen, die dem Mittelmaß verhaftet sind und so der historischen Wirklichkeit eher gerecht werden, treten die Indianer in den in diesem Band gesammelten klassischen Kurzgeschichten und Romanauszügen auf, die teils realistisch, teils romantisierend die Welt des roten Mannes erschließen und bis heute lebendig geblieben sind. Sie schildern den Indianer als tapferen Mann der Wildnis, aber auch als verschlagenen und grausamen Widersacher. Sie erzählen von der Jahrhunderte währenden Auseinandersetzung zwischen Rot und Weiß; vom täglichen Dasein der Indianer, von ihren Dörfern, ihren Sitten und Bräuchen, ihren Festen und religiösen Riten; vom Zauber eines freien Lebens in der Natur mit seinen Aufregungen, Schönheiten und Strapazen...
Ihre Autoren begeistern seit über hundert Jahren Jung und Alt für den roten Mann, der mit seinem abenteuerlichen Schicksalskampf, der ungebundenen Freiheit in der Wildnis, seiner Tapferkeit und seinem Ehrgefühl besonders den zivilisierten Stadtmenschen in seinen Bann schlägt. James Fenimore Cooper, Charles Sealsfield, Gabriel Ferry, Mayne Reid, Armand, Franz Treller, Karl May, Fritz Steuben, Jack London und Friedrich Gerstäcker garantieren für so viel Lesefreude und Entspannung, dass der Indianer im Laufe der Jahre unser aller „Roter Freizeitbruder“ geworden ist.
Aber der „Rote Bruder“ ist nicht nur der typische Präriereiternomade, jener Jäger zu Pferd, dem seit Winnetou hier zu Lande und seit den Hollywood-Filmkonserven überall in der Welt die romantische Schwärmerei des modernen Menschen zuteil wird. Die Pueblo-Völker, die Küsten- und Flussfischerstämme, die Reis und Mais anbauenden Ackerbaukulturen, die binnenseefahrenden Nationen, die zivilisierten Stadtstaat- und Städtebundkulturen, die Berg-, Wald- und Wüstenregionbewohner sind ebenfalls als rote Brüder anzusehen, auch wenn sie nicht jenem Bild vom stolzen, wilden Sohn Manitus entsprechen, dessen Untergang sich heute so schön engagiert betrauern lässt.
James Fenimore Cooper: DER LETZTE MOHIKANER (Auszug)
James Fenimore Cooper (15.9.1789–14.9.1851) lebte als Knabe auf dem von seinem Vater 1790 erworbenen Landbesitz am Otsego-See im Westen des Staates New York, vor der Kulisse herrlich romantischer und wildreicher Urwälder, an der damals bereits sagenumwobenen „Grenze“ zum Indianertum. Noch nicht einmal zwei Jahrzehnte davor war die ganze Gegend um den Otsego, Quellsee für den Susquehanna-Fluss, Jagdrevier des inzwischen verfallenen Stammesbundes der Irokesen gewesen, der vom legendären Mohawk-Sachem Hiawatha zwischen 1559 und 1570 gegründeten Fünf-Nationen-Konföderation, die sich zum Sechs-Völker-Bund ausweitete, als sich 1722 die Tuscaroras zu den Senecas, Onondagas, Cayugas, Mohawks und Oneidas hinzugesellten.
Am Otsego-See sah der junge Cooper die Siedler, Holzfäller, Jäger, Fallensteller, Pelz- und Pferdehändler sowie die freien „wilden“ Indianer, die später im Mittelpunkt seiner zwischen 1823 und 1827 entstandenenLederstrumpfgeschichten (Der Wildtöter, Der letzte Mohikaner, Der Pfadfinder, Die Ansiedler und Die Prärie) standen.
Mit breiter Feder entwarf James Fenimore Cooper das unvergessliche Bild edler Indianergestalten, vom weisen alten Häuptling Chingachgook bis zum hochherzigen jungen Uncas, über denen auch immer die leise Ahnung vom unabwendbaren Verlöschen schwebte. Beide Rothäute gehörten dem Algonkin-Volk der Mohikaner an, das sich als Verbündeter der Delawaren an den militärischen Auseinandersetzungen zwischen den französischen und englischen Kolonialmächten beteiligte, wobei es fast völlig aufgerieben wurde.
Von Gefahren umlauert
Siebzehn Jahre waren verflossen. Neuerdings war der Krieg zwischen England und Frankreich um den Besitz eines Landes ausgebrochen, das keinem von ihnen auf die Dauer zu Teil werden sollte. Wah-ta-Wah ruhte längst im Schatten der delawarischen Fichten. Ihren Platz im Herzen Chingachgooks nahm Uncas ein, der tapfere Sohn beider. In Gemeinschaft mit Lederstrumpf, der unter dem Namen „Falkenauge“ weit und breit gefürchtet war, durchstreiften die beiden letzten Krieger des mohikanischen Stammes die Wälder. Sie lebten mit den Delawaren zwar immer noch in Freundschaft, doch waren sie schon längst nicht mehr bei dem Stamm ansässig. Der mohikanische Häuptling mochte sich niemandem unterordnen, deshalb schweifte er lieber frei und ledig mit dem alten, bewährten Freund und seinem Sohn, der zum tapferen Krieger herangewachsen war, in den Wäldern umher.
In tiefem Frieden lag der Wald da. Chingachgook hatte sich mit seinen Freunden am Ufer eines kleinen Bachs gelagert und ein Feuer angezündet, um einen frisch erlegten Hirsch zur Abendmahlzeit zuzubereiten. Plötzlich sprang Uncas unruhig auf. Falkenauge sah ihn mit fragendem Erstaunen an, doch der Jüngling winkte ihm heftig zu. „Ich höre Tritte“, flüsterte er seinem Vater zu. „Es müssen Weiße sein, die auf unseren Lagerplatz zukommen, denn der Boden erzittert wie unter dem Hufschlag von Rossen. Kein Indianer wird den Weg durch die Wildnis zu Pferde zurücklegen.“
Chingachgook pflichtete ihm schweigend bei. In atemloser Spannung erwarteten die drei Männer das Herannahen des Fremden. Immer näher tönten die Huftritte, bis endlich die Gebüsche, die den Lagerplatz umgaben, von einer kräftigen Hand auseinandergeschlagen wurden. Eine glänzende Uniform wurde sichtbar, deren Träger beim Anblick der drei regungslosen Gesellen erschreckt zurückwich.
„Wer da?“, ertönte die Stimme Falkenauges. „Wer wagt sich hierher unter die Tiere und Gefahren der Wildnis?“
„Fremde, die seit Sonnenaufgang den Wald durchstreift haben, ohne Nahrung zu sich zu nehmen“, lautete die Antwort.
„So habt Ihr Euch verirrt?“, fragte Falkenauge weiter. „Wohin wollt Ihr denn?“
„Nach William Henry“, gab der Gefragte zurück.
Falkenauge lachte laut auf. „Alle Wetter“, rief er, „einen schlechteren Weg konntet Ihr da nicht wählen. Geht ihn nur wieder zurück, dann werdet Ihr eher ans Ziel gelangen. Wie war es überhaupt nur möglich, dass Ihr Euch derart verirrtet?“
Der Fremde kehrte, statt eine Antwort zu geben, ins Gebüsch zurück. Gleich darauf erschien er wieder in Begleitung von zwei erschöpften, todmüden Damen, die sich kaum noch auf ihren Pferden halten konnten. Erstaunt blickten die drei Männer auf die zarten Gestalten, denen ihr Gefährte beim Absteigen behilflich war. Falkenauge sorgte dafür, dass den fremden Gästen die erbetene Gastfreundschaft erwiesen wurde, und richtete bequeme Plätze am Feuer her. Als die Ankömmlinge sich niedergelassen hatten, bot er ihnen saftige Stücke von dem Wildbraten an und freute sich über ihren Appetit. Nachdem sie gesättigt waren, wiederholte Falkenauge seine früher an den Offizier gerichtete Frage.
„Ihr seht in diesen beiden Damen die Töchter des Obersten Munro auf Fort William Henry“, erklärte der junge Mann, indem er auf seine Gefährtinnen deutete. „Ich selbst bin der Verlobte der einen dieser Damen. Mein Name ist Heyward. Im königlichen Heer bekleide ich den Rang eines Majors. Wir brachen heute früh von Fort Edward auf, um nach William Henry zu Oberst Munro zu eilen, da der Vater in diesen unsicheren Zeiten seine Töchter in seiner Nähe zu haben wünscht. Ein Indianer, Magua – von seinen Stammesgenossen ‚der schlaue Fuchs‘ genannt – erbot sich, uns einen näheren Weg zu führen, auf dem wir nicht Gefahr liefen, feindlichen Rothäuten zu begegnen. Da er uns schon öfter als Kundschafter gedient hatte, so gingen wir darauf ein. Doch mitten im Waldesdickicht verloren wir unseren Führer auf eine ganz unerklärliche Weise und eilten nun aufs Geratewohl durch die Büsche.“
Falkenauge hatte aufmerksam zugehört. Nachdem Heyward geendet, wandte sich der Jäger zu Chingachgook und sagte zu ihm in delawarischer Sprache: „Wir müssen auf unserer Hut sein. Der schlaue Kundschafter hat den Major mit seinen Schützlingen in das Dickicht gelockt, um ihnen die Skalpe zu rauben oder sie gegen ein teures Lösegeld nach William Henry abzuliefern. Ich bin fest überzeugt, der Schurke ist mit seinen Gefährten dem Major auf den Fersen.“
Chingachgook nickte zustimmend. „Sie haben sich in unsern Schutz begeben“, äußerte er, „wir müssen sie retten.“
„Wohlgesprochen“, rief Falkenauge erfreut, „wir müssen den Plan des Kundschafters zu Schanden machen, selbst wenn unser Zufluchtsort dabei entdeckt würde.“
Nach diesen Worten wandte er sich an den Major und teilte ihm mit, was sie besprochen hatten. Heyward, der weniger für sich als für die beiden Mädchen fürchtete, dankte ihm mit warmen Worten für seine Bereitwilligkeit, ihnen Hilfe zu leisten, und bat ihn, keine Zeit zu verlieren, sondern unverzüglich den Weg anzutreten.
Chingachgook und Uncas nahmen die Pferde am Zügel und schritten längs des Bachs dahin. Die übrigen Mitglieder der kleinen Gesellschaft folgten den Voraneilenden. Bald erweiterte sich der Bach und mündete endlich in einen nicht unbedeutenden Fluss mit starker Strömung. Die Pferde wurden von den Indianern ins Wasser getrieben, während Falkenauge aus einem Versteck ein aus Baumrinde verfertigtes Kanu hervorzog. Die beiden Frauen stiegen zuerst hinein, ihnen folgten Heyward und Uncas, den Abschluss bildeten Falkenauge und Chingachgook. Die Pferde schwammen neben dem leichten Fahrzeug her. Schon nach kurzer Fahrt zogen die Männer auf Falkenauges Befehl die Ruder ein. Ein lautes Brausen wurde hörbar, das von Minute zu Minute an Kraft zunahm. Ängstlich schmiegte sich Alice, Heywards Braut, an ihre Schwester Cora.
„Habt keine Furcht“, rief ihr Falkenauge tröstend zu, „der Wasserfall, dessen Tosen Euch erschreckt, soll uns vielmehr vor den hinterlistigen Feinden retten.“
Ein jäher Aufschrei Alice’ machte Heyward, dessen Blick gedankenvoll auf dem Boden des Kanus ruhte, erbeben. Er sah empor und bemerkte zu seinem Schrecken, dass das Kanu direkt auf einen weit in den Fluss hineinragenden Felsblock zusteuerte. Noch einen Augenblick, und das Fahrzeug musste mit all seinen Insassen verloren sein.
„Nur keine Angst!“, rief Falkenauge, der am Vorderteil des Kanus stand, dem Brautpaar zu. Mit beiden Händen packte er das starke Ruder, und als das Boot nahe genug an den Felsblock herangekommen war, stieß er kräftig die Ruderstange gegen das Gestein. In weitem Bogen umschiffte das leichte Fahrzeug den gefährlichen Vorsprung und steuerte direkt auf das Ufer los. Abermals erhob Falkenauge das Ruder und fuhr damit in das Geäst eines weit überhängenden Baums. Mit einem kräftigen Ruck zog er dann das Boot bis dicht an das Ufer hin und band es an einem Gestrüpp fest, das er vom Kanu aus erreichen konnte. Hurtig sprang er sodann aus dem Fahrzeug und war seinen Gefährten beim Aussteigen behilflich.
„Wir sind gerettet“, sagte Heyward seufzend. „Aber unsere armen Pferde?“
„Beruhigt Euch“, erwiderte Falkenauge, nachdem er eine kurze Ausschau gehalten, „die Tiere haben das jenseitige Ufer gewonnen.“
„Sie werden den Huronen in die Hände fallen“, versetzte Heyward besorgt, „und dadurch unsere Spur verraten.“
„Dem ist vorderhand leider nicht abzuhelfen“, war die kurze Antwort.
Die drei Fremden waren von den mancherlei Ereignissen des Tages erschöpft und ließen sich auf dem Rasen nieder. Inzwischen schritt Falkenauge mit den beiden Mohikanern der dunklen Wand eines Felsens zu, der sich unweit des Ufers erhob. Hinter diesem verschwanden alle drei gleich darauf. Erstaunt blickte ihnen Heyward nach. Schon nach kurzer Zeit vernahm er gedämpfte Männerstimmen, die aus dem Innern der Erde zu kommen schienen, und wenige Sekunden später zeigte sich in der Felswand ein Spalt, durch den aus dem Innern ein Lichtschimmer drang. Gleichzeitig ertönte die Stimme Falkenauges:
„Schlüpft durch die Felsenspalte, aber beeilt euch, denn die Huronen können möglicherweise schon auf unserer Spur sein.“
Heyward kam mit seinen Gefährtinnen der Aufforderung möglichst schnell nach. Hinter ihnen schloss sich der Felsen, Chingachgook und Uncas hatten wieder einen Block vor die Öffnung gerollt.
Die kleine Gesellschaft befand sich in einer geräumigen Höhle, die einen zweiten Ausgang nach dem Wald zu hatte, was das Gefühl der Sicherheit sehr erhöhte.
Falkenauge bedeutete den Fremden, sich zur Ruhe zu legen, damit sie am Morgen zu neuen Anstrengungen gestärkt seien. Gern folgten die ermüdeten Mädchen dieser Weisung. Sie standen vom Feuer auf, das Uncas in der Mitte der Höhle angezündet hatte, und waren eben im Begriff, sich im Hintergrund der Höhle ein Lager zu bereiten, als plötzlich ein markerschütternder Schrei die Luft durchbebte.
„Was ist das?“, flüsterte die erschreckte Alice nach einigen Augenblicken bangen Schweigens.
Doch weder Falkenauge noch die beiden Mohikaner gaben eine Antwort. Sie lauschten angestrengt und ihre Mienen verkündeten eine gespannte Erwartung. Auf einen Wink Chingachgooks hin verließ Uncas durch die dem Wald zugekehrte Öffnung vorsichtig die Höhle. Falkenauge aber unterbrach jetzt die herrschende Stille, indem er sagte: „Ich hegte bisher die feste Überzeugung, jeden Laut in der Wildnis zu kennen, mochte er nun von Tieren oder Indianern stammen. Allein der vorhin vernommene grässliche Schrei war mir fremd.“
Diesen Worten folgte wiederum tiefe Stille. Endlich erschien Uncas in der Öffnung. Er teilte in delawarischer Sprache dem Vater mit, was er beobachtet hatte.
„Es hat sich draußen nichts Verdächtiges gezeigt“, verdolmetschte Falkenauge den Fremden Uncas’ Worte. „Darum legt euch zur Ruhe, denn es führt zu nichts, uns wegen des seltsamen Schreis den Kopf zu zerbrechen. Überlasst euch ruhig dem Schlaf! Wir werden wachen.“
Alice und Cora kamen der Weisung nach. Heyward begleitete sie zu ihrem Ruhelager, dort klammerte sich Alice an ihn an. „Bleib in meiner Nähe“, flüsterte sie mit vor Furcht zitternder Stimme, „schlafen könnten wir doch nicht, da immer...“
Weiter kam sie in ihrer Rede nicht. Derselbe grässliche, markerschütternde Schrei durchzitterte die Höhle. Entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen, erhob sich Falkenauge und trat in die Öffnung. Da ertönte noch einmal der fürchterliche Schrei. Keiner der Anwesenden wagte sich zu rühren, selbst die beiden Mohikaner schauten mit bangen Blicken nach dem Ausgang. Nur Heyward ließ sich nicht vom Schrecken überwältigen. Er trat an Falkenauges Seite und sagte:
„Ich vermag mir jetzt den Ursprung des grässlichen Tons zu erklären, denn ich habe den Schrei, den ich so oft in heißer Schlacht vernommen, wiedererkannt. Es ist der Angstschrei eines Pferdes im Todeskampf. Meinem Ross werden wohl die Bestien des Waldes, vor denen kein Entrinnen möglich ist, den Garaus machen.“
Die Wahrscheinlichkeit dieser Erklärung leuchtete den andern ein.
„Fahr mit dem Kanu über den Fluss, Uncas“, befahl Chingachgook seinem Sohn, „und wirf einen Feuerbrand unter die hungrigen Wölfe, die wahrscheinlich das Tier bedrängen.“
Der junge Krieger hatte sich noch nicht lange entfernt, als sich vom jenseitigen Ufer ein lautes Geheul vernehmen ließ, das sich schnell im Innern des Waldes verlor. Es kam von den Wölfen, die, durch den geworfenen Feuerbrand erschreckt, ihre Beute im Stich ließen und ihr Heil in der Flucht suchten. Uncas blieb als Wache vor der Höhle. Chingachgook und Falkenauge setzten sich ans Feuer, um gleichfalls Wache haltend die Nacht zu verbringen, während die Fremden sich niederlegten und bald, müde von den Anstrengungen, sanft einschlummerten.
Mehrere Stunden vergingen, ohne dass die nächtliche Stille unterbrochen wurde. Da plötzlich – eine Stunde nach Mitternacht – ließ sich ringsum im angrenzenden Wald ein so entsetzliches Geheul vernehmen, als wären alle Dämonen der Hölle losgelassen. Erschreckt fuhren die beiden Mädchen aus dem Schlaf empor. Chingachgook und Falkenauge aber griffen zu ihren Büchsen, denn dieser Klang war ihnen nicht unbekannt. Oft schon hatten sie ihn vernommen: Es war das wilde Kriegsgeheul der Huronen.
Im gleichen Augenblick erschien der Wache haltende Uncas an der Außenseite des Spalts, der in die Höhle führte, und meldete leise herein, dass die Feinde das Kanu entdeckt hätten, das am Gestrüpp angebunden war. Sie bereiteten nunmehr offenbar einen Angriff vor. Daraufhin verließen Chingachgook und Falkenauge das Versteck, und auch der Major folgte ihnen, nachdem er den beiden Mädchen Mut zugesprochen und möglichste Stille anempfohlen hatte. Vorsichtig schlichen die vier Männer nach dem Ufer. Sie hielten sich bei dem hell leuchtenden Vollmond immer im Schatten der Bäume, um den Feinden ihre Anwesenheit nicht zu verraten. Sie kamen gerade zum rechten Zeitpunkt am Fluss an, denn vier der Wilden versuchten tollkühn mit ihrem leichten Kanu über den Wasserfall zu gelangen. Ruhig erhob Falkenauge seine Büchse und zielte bedächtig auf den vordersten der Feinde.
Chingachgook und Uncas folgten seinem Beispiel und gleich nachher krachten drei Schüsse auf einmal.
Von den vier Wilden war nur einer unverletzt geblieben, die andern stürzten mit lautem Schrei auf den Boden des Kanus. Ein gellendes Wutgeheul drang vom andern Ufer herüber. Flintenschüsse wurden abgegeben, doch keine der vielen Kugeln vermochte Schaden anzurichten, da die Bäume den vier Männern hinreichend Deckung boten. Der allein unversehrt gebliebene Hurone ruderte eilig zurück, um nicht das Schicksal seiner Genossen teilen zu müssen.
Jetzt änderten die Wilden ihre Taktik. Während ein Teil von ihnen die gegenüberstehenden vier Gegner durch ein Feuergefecht beschäftigte, unternahm eine andere Abteilung von ihnen eine zweite Fahrt über den Strom. Diesmal aber versuchten sie es mit größerer Vorsicht. Sie setzten so entfernt vom Standpunkt ihrer Gegner über das Wasser, dass diese sie unmöglich mit ihren Kugeln erreichen konnten. Die vier Männer rückten etwas zurück, um bei dem Kampf, der unvermeidlich kommen musste, vor dem Feuer der Huronen geborgen zu sein, die sich am jenseitigen Ufer aufgestellt hatten. – Es dauerte nicht lange, so erreichten die Rothäute, fünf an der Zahl, das Ufer und stürzten auf die Feinde los. Ruhig erwarteten diese den Angriff. Ein heißer Kampf entspann sich. Doch die tödliche Treffsicherheit Falkenauges und die unerschrockene Tapferkeit des Majors und der beiden Mohikaner gewannen bald den Sieg über die Feinde. Drei von ihnen waren schon gefallen. Die beiden andern flohen dem Kanu zu, um zu den Gefährten zurückzurudern.
„Schnell ins Versteck!“, gebot jetzt Falkenauge, als sich die Feinde außer Hörweite befanden. „Wir können uns gegen die Überzahl, die nun gegen uns anrücken wird, nicht behaupten.“
Die Gefährten gehorchten und waren bald in der Höhle verschwunden. Die beiden Mädchen hatten indes angstvoll ihres Erscheinens geharrt. „Wie steht es?“, fragte Cora, die sich bemühte, vor der Schwester ihre Furcht zu verbergen.
„Die Huronen werden nicht eher ruhen, als bis sie den Tod ihrer Krieger an uns blutig gerächt haben“, antwortete Falkenauge. „Deshalb ist es gut, wenn wir uns aufs Schlimmste gefasst machen.“
Heyward schrak zusammen. „Wird uns denn dieses Versteck nicht vor den Feinden schützen?“, fragte er den erfahrenen Jäger. „Ich selbst fürchte mich nicht vor dem Tod, doch das Leben der Damen, die mir anvertraut sind, darf nicht der Blutgier der Rothäute zum Opfer fallen.“
Falkenauge warf einen mitleidigen Blick auf die beiden Mädchen, aber er vermochte dem Major keine Hoffnung auf eine Möglichkeit ihrer Errettung zu machen. „Es wird nur noch kurze Zeit anstehen, so schleichen die listigen Feinde gleich Schlangen heran“, sprach er. „Womit sollen wir ihnen dann Widerstand leisten? Wir haben weder Pulver noch Blei mehr und unsere Büchsen sind jetzt nicht mehr wert als ein Wollblumenstängel. Nein, täuschen wir uns nicht selbst, denn ich sage Euch, wir haben keine Hoffnung mehr – wir müssen sterben!“ Obschon er sich der Mädchen wegen bemüht hatte, die letzten Worte leise zu sprechen, hatte Cora sie doch vernommen.
„Sterben?“, rief sie entsetzt aus. „Wäre denn gar keine Möglichkeit – wenigstens für Euch –, in die Wälder zu gelangen und Hilfe von meinem Vater zu erbitten?“
„Da kennt Ihr die List dieser farbigen Teufel wenig, Lady, wenn Ihr glaubt, dass sie uns den Weg in die Wälder offen gelassen haben“, entgegnete Falkenauge. „Ja, wenn wir noch ein Kanu besäßen, dann wäre es vielleicht noch möglich, mit euch zu entrinnen, denn die Strömung des Flusses brächte uns rasch genug hinweg...“
„Nun denn“, rief Cora jetzt, „so versucht doch mit Euren beiden Freunden im Fluss schwimmend hinwegzukommen! Warum wolltet Ihr säumen und die Zahl unserer erbarmungslosen Feinde vermehren?“
„Warum?“, wiederholte Falkenauge stolz das Haupt erhebend. „Weil es besser ist, im Frieden mit sich selbst zu sterben, als vom bösen Gewissen gepeinigt zu leben. Was sollten wir Eurem Vater antworten, wenn er uns fragte, wo und wie wir seine Kinder verlassen hätten?“
„Dann sagt ihm, dass Ihr sie mit dem Auftrag verlassen hättet, ihnen eilig zu Hilfe zu kommen“, entgegnete Cora. „Sagt ihm ferner, dass wir vielleicht noch gerettet werden könnten. Wenn es aber der Himmel anders mit uns beschlossen hätte, dann“ – fuhr sie mit mehr und mehr brechender Stimme fort – „dann bringt unserem alten Vater die letzten Grüße seiner Töchter und sagt ihm, er solle nicht trauern über ihr frühes Ende, sondern mit frommem Vertrauen zu Gott emporblicken, wo er seine Kinder wiederfinden werde!“
Falkenauge wurde nachdenklich. Coras Vorschlag schien ihm mehr und mehr als vernünftig und deshalb durchaus annehmbar zu sein. Er wandte sich an Chingachgook und Uncas, um sich zu beraten. Der ältere Mohikaner hörte ihn schweigend an und erklärte sich endlich nach längerem Zögern bereit, das geforderte Wagnis zu unternehmen. Ohne viele Worte mit Abschiednehmen zu verlieren, glitt er durch die Felsspalte und wand sich gewandt wie eine Schlange, deren Namen er trug, an das im Schatten liegende Flussufer hinab. Hier hielt er einen Augenblick tief Atem schöpfend an, dann stieg er vorsichtig in die wild rauschenden Wellen und war im nächsten Augenblick, unter dem Wasser wegschwimmend, verschwunden.
Falkenauge schied erst, nachdem er die beiden Damen und den bei ihnen verbleibenden Major zu ruhigem Ausharren aufgefordert hatte. „Verhaltet Euch so still wie möglich“, ermahnte er sie, „dann werden die Rothäute aller Wahrscheinlichkeit nach Euer Versteck nicht entdecken. Sollte es aber dennoch geschehen und sollten Euch die Indianer durch die Wälder hinwegführen, so knickt bisweilen einen Zweig der Büsche oder Bäume um, die am Weg stehen. Vermag dann ein Menschenauge diese Merkzeichen zu entdecken, so verlasst Euch darauf, dass ihr einen Freund habt, der Euch bis ans Ende der Welt folgen und nicht eher ruhen wird, bis er Euch befreit hat!“
Nach diesen Worten folgte er Chingachgook und wurde gleich darauf von den Wellen hinweggetragen, die über ihm zusammenschlugen. Aller Augen richteten sich jetzt auf Uncas, der unbeweglich an den Fels gelehnt dastand.
Cora zögerte einen Augenblick dann sprach sie: „Deine Freunde sind wahrscheinlich bereits in Sicherheit, willst du noch zaudern, ihnen zu folgen?“
„Uncas bleibt!“, erwiderte der Jüngling ruhig.
„Wozu?“, entgegnete Cora sanft. „Um die Schrecken unserer Gefangennahme zu vermehren und unsere Rettung weniger möglich zu machen? Nein, edler junger Mann, geh auch du – und sage meinem Vater, er möge dir Geld geben, mit dem du die Freiheit seiner Töchter erkaufen könntest. Geh, Uncas, geh – ich bitte dich darum!“
Des jungen Häuptlings Blick wurde düster, aber er zögerte nicht länger. Die Hand aufs Herz legend, verbeugte er sich, glitt dann unhörbar durch den Spalt zum Flussufer und war einen Augenblick später im rauschenden Wasser verschwunden.
Tiefe Stille herrschte jetzt in der Höhle, keiner der Zurückgebliebenen wagte zu sprechen. Eine bange Stunde mochte vergangen sein, als die herrschende Ruhe durch wilde indianische Kriegsrufe unterbrochen wurde. Die Huronen hatten in aller Stille das Ufer des Flusses gewonnen und rückten nun gegen die Feinde vor. Doch wie eifrig sie auch den Wald durchschweiften, nirgends fand sich eine Spur der Gegner. Das Geschrei der Huronen entfernte sich immer mehr. Die in der Höhle Verborgenen durften hoffen, dass ihr Schlupfwinkel unentdeckt geblieben sei. Sie gaben sich schon der Freude über ihre wunderbare Rettung hin, als plötzlich Alice laut aufschrie und mit verstörtem Gesicht nach der Öffnung der Höhle deutete, die sie nach dem Weggang der Jäger vorsichtig mit einer Decke verhängt hatte. Schnell folgten Heywards Blicke der Richtung, und zu seinem Entsetzen sah er das tückische Gesicht seines indianischen Führers neben dem zurückgeschobenen Vorhang. Schnell riss der Major die Pistole aus dem Gürtel und feuerte, ohne lange zu zielen, auf das verzerrte Antlitz des verhassten Verräters.
Als der Pulverdampf sich verzog, war die Stelle leer. Auch als Heyward ins Freie lugte, vermochte er keine Spur von dem Feind zu entdecken. Da drang ein lauter, lang anhaltender Ruf an sein Ohr. Der Indianer benachrichtigte damit seine Genossen, die im Wald zerstreut waren, dass er glücklicher als sie gewesen sei und die Feinde entdeckt habe. Schnell kamen die Huronen von allen Seiten herbeigestürzt. Unter der Führung Maguas, der Heyward absichtlich in die Irre geführt hatte, um ihn mit den Damen um so sicherer verderben zu können, drangen sie in die Höhle ein. Jeder Widerstand war nutzlos und so ergaben sich die drei Gefangenen ruhig in ihr Schicksal.
In möglichster Eile brachen die Rothäute mit Heyward und den beiden Schwestern auf. Sie schienen zu ahnen, dass Boten ausgeschickt seien, um Hilfe herbeizuholen. Deshalb verhinderten sie jeden Versuch der Mädchen, dem Rat Falkenauges gemäß Zweige zu knicken, und suchten überhaupt jede Spur auf dem Boden zu verwischen. Damit im Gras kein verräterischer Abdruck eines Schuhs bleibe, wurden die Mädchen auf die Pferde gehoben. Dann ging es rasch vorwärts und erst nach Sonnenaufgang wurde auf einer Anhöhe Halt gemacht, um einige Zeit der Ruhe zu pflegen. Die Huronen legten sich auf den Boden nieder. In der Mitte saß Magua und nicht weit von ihm rasteten die Gefangenen. Die Schar der Indianer war nicht groß, sie bestand nur aus acht Kriegern. Heyward sah jedoch ein, dass jeder Fluchtversuch bei der Behändigkeit der Wilden vergeblich sein würde.
Magua, der die ganze Zeit über geschwiegen hatte, erhob sich jetzt von seinem Sitz und redete die Gefangenen an. „Hört“, begann er mit ernster Stimme, „Magua war unter den roten Huronen an den Seen geboren, wurde ein Krieger seines Stammes, der ihn zuletzt zum Häuptling erhoben hat. Da kamen die weißen Männer und lockten ihn in ihr Lager. Er folgte ihrem Ruf, weil sie gegen feindliche Stämme auszogen. Der alte Häuptling am Hurecon, euer Vater Munro, war der Anführer unserer Kriegspartei. Er fand Gehorsam in allem, was er verlangte. Da erhob er ein Gesetz, nach dem jeder Indianer, der Feuerwasser trank, hart bestraft werden sollte. Magua öffnete seinen Mund dem Getränk und Munro ließ ihn binden und vor allen Blassgesichtern peitschen.“
Die Stimme des Sprechers zitterte, als er der erlittenen Schmach gedachte, doch fasste er sich schnell und fuhr in gemessenem Ton fort: „Da gelobte sich Magua, an dem Graukopf Rache zu nehmen. Die Zeit dafür ist gekommen!“ Er winkte den Kriegern, und ehe Heyward es verhindern konnte, sah er sich mit den hilflosen Mädchen an junge Bäume gebunden. Mit einem frohlockenden, widerwärtigen Geheul trafen die Wilden die Vorbereitungen zur Marter. Einige suchten Äste, um einen Holzstoß zu errichten, andere schnitzten Splitter, um sie brennend den armen Opfern ins Fleisch zu stoßen, während ein besonders hässlicher Indianer die Wipfel zweier junger Bäume zusammenband, um bei Beginn der Marter Heywards Arme daran zu befestigen und dann die biegsamen Stämmchen zurückschnellen zu lassen. Die Vorbereitungen schienen den Rothäuten einen nicht geringen Genuss zu bereiten, denn ihre Gesichter glänzten in satanischer Erwartung. Als alles bereit war, schleuderte Magua seinen Tomahawk nach dem Stamm, an den Alice gebunden war, da sich diese als die Furchtsamste gezeigt hatte. Er wusste, dass er dadurch die beiden andern empfindlicher traf, als wenn er sie selbst zur Zielscheibe seines Wurfs gemacht hätte. Surrend flog der Tomahawk durch die Luft, durchschnitt eine der flatternden Locken Alice’ und fuhr direkt über ihrem Haupt in die Rinde des Baums. Ein lauter Aufschrei des geängstigten Mädchens ertönte. Heyward zerrte verzweiflungsvoll an seinen Banden. Mit übermenschlicher Anstrengung zerriss er die Fesseln. Er stürzte sich auf den nächsten Wilden, der, dem Beispiel seines Häuptlings folgend, eben zum Wurf ausholte, und brachte ihn zu Fall. Schnell fasste sich der Hurone und schwang seine fürchterliche Waffe. Schon blitzte der Tomahawk in der Luft, als plötzlich ein lauter Knall ertönte. Kraftlos sank der erhobene Arm des Wilden herab.
Regungslos standen die Huronen bei diesem plötzlichen Angriff da. Ein lauter Ruf aus dem Dickicht ließ Heyward die Stimme Falkenauges erkennen, der jetzt mit hochgeschwungener Büchse auf die Feinde eindrang. Ihm auf dem Fuß folgten Chingachgook und Uncas, die jeder einen Indianer aufs Korn nahmen, und fast gleichzeitig krachten ihre Flinten. Getroffen stürzten die beiden Huronen zu Boden, während die Übrigen wütend auf die Angreifer losstürmten, den Tod ihrer Gefährten zu rächen.
Mit kräftigem Arm schwang Falkenauge seine Büchse und ließ ihren Kolben auf den Schädel des Wilden niedersausen, der ihm zunächst stand. Die Rothaut stürzte zu Boden und nun befanden sich die Kämpfer in gleicher Anzahl. Es dauerte nicht lange, so hatten die Mohikaner und Falkenauge die Gegner besiegt. Nur noch Heyward rang mit seinem Feind Magua. Da er waffenlos war, musste er sich einzig auf die Kraft seiner Arme verlassen. Er befand sich in größter Gefahr, denn seinem Gegner war es gelungen, die rechte Hand frei zu bekommen. Rasch zog er das Messer, um es dem Major in die Brust zu stoßen. Im gleichen Augenblick aber sah er Falkenauge mit geschwungener Büchse auf sich zustürzen. Schnell ließ Magua daher sein Opfer los und sprang auf das Gebüsch zu, um dem grimmigen Feind zu entgehen. Eiligst setzte ihm der Jäger nach, doch Magua war bereits in dem Gestrüpp verschwunden. Die armen Mädchen wurden losgebunden und sanken im Übermaß ihrer Dankbarkeit zu den Füßen ihrer Retter nieder.
„Steht auf“, mahnte Falkenauge verlegen, „was wir taten, war nur unsere Pflicht. Ihr gerietet mit uns zusammen in Not, also oblag es uns, Euch daraus zu befreien.“
„Wie kommt es, dass wir Euch so bald wiedersehen, mein edelmütiger Freund“, fragte Heyward, „und ohne Hilfe der Garnison von William Henry?“
„Hätten wir unseren Plan ausgeführt, nach William Henry zu eilen“, antwortete Falkenauge, „so wären wir wohl nur noch recht gekommen, Eure Leichen zu begraben. Wir alle drei hatten uns, nach unserer glücklich verlaufenen Flucht aus der Höhle, etwa zweihundert Schritte unterhalb des Felsens, von dem wir weggeschwommen waren, wieder zusammengefunden. Schnell überlegten wir, wie wir Euch am besten dienen könnten, und kamen zu dem Entschluss, uns zunächst in den Rücken der Huronen zu schleichen, um zu sehen, was aus Euch würde. Vorsichtig führten wir dies aus und folgten Euch heimlich nach, als Ihr von den Irokesen weggeführt wurdet!“
„So wart Ihr Augenzeugen alles dessen, was mit uns vorging?“, fragte Heyward erstaunt.
„Ja“, entgegnete Falkenauge vergnügt lachend, „wir sahen alles, denn wir waren im Gebüsch verborgen. Als die Huronen aber Anstalten machten, Euch zu martern, schlichen wir noch näher und – denkt Euch unsere Freude! – gelangten an eine Stelle, wo die Feinde ihre Büchsen nebst Munition niedergelegt hatten. Das war – so schlau sie sonst auch sind – dumm von ihnen, umso mehr, als sie in ihrer Sorglosigkeit nicht einmal eine Wache dabei aufstellten. Schnell bewaffneten wir uns und – Gott sei Dank – so wurde es uns möglich, Euch vor dem sicheren Tod zu bewahren. Doch nun“ – fuhr er fort, indem er die erneuten Danksagungen der Geretteten zurückwies, – „lasst uns keine Zeit verlieren, sondern ungesäumt nach William Henry aufbrechen, denn noch schwebt Ihr in ernster Gefahr, weil ja der gefährlichste unserer Feinde, der schlaue Fuchs, leider entwischt ist. Sicher wird er uns sehr bald mit seinen Stammesgenossen wieder auf den Fersen sein, um blutige Rache für die erlittene Niederlage zu nehmen!“
Ohne noch länger zu zögern, brach die kleine Gesellschaft auf. Den ganzen Tag wurde die Wanderung fortgesetzt. Als sie am Abend endlich Rast machten, waren sie alle so ermüdet, dass es selbst den Mohikanern schwer fiel, die Augen offen zu halten. Doch einigten sie sich dahin, dass zuerst Chingachgook und dann Uncas die Wache übernehmen sollte. Chingachgook setzte sich an das Feuer, während die andern sich zum Schlaf niederlegten.
In der Höhle des Löwen
Einige Stunden vergingen in tiefster Ruhe, doch ließ sich Chingachgook dadurch nicht verleiten, in seiner Wachsamkeit nachzulassen. Nirgends ertönte ein Laut und nur das tiefe Atemholen der Schläfer unterbrach die Stille. Da war es dem Mohikaner, als hörte er leise Schritte. Sofort erhob er sich und spähte umher, ob sich etwas Verdächtiges zeige. Allein er vermochte nichts zu entdecken. Er weckte die Freunde und teilte ihnen seine Beobachtung mit. Leise erhoben sich die Männer, um nach Chingachgooks Weisung den Wald zu durchschweifen. Vorsichtig entfernten sie sich vom Feuer, an dem nur noch Heyward zurückblieb, um die schlafenden Mädchen zu beschützen.
Nach Verlauf einer halben Stunde kehrten sie zurück, doch welcher schreckliche Anblick bot sich ihnen dar! An Händen und Füßen gefesselt lag der Major so dicht an der Grenze des Feuers, dass seine Haare bereits zu sengen begannen. Er vermochte sich nicht zu rühren, denn ein dicker Strick war ihm um den Leib gebunden und mit beiden Enden an den zunächst stehenden Bäumen befestigt. Er hätte ohne das Hinzukommen der drei Freunde elend durch das Feuer umkommen müssen, da ein dicker Knebel im Mund ihm obendrein das Hilferufen unmöglich machte. Schnell befreiten die Gefährten den Unglücklichen aus seiner qualvollen Lage.
„Herr meines Lebens!“, rief Falkenauge, der sich nach allen Seiten umsah. „Die Mädchen sind verschwunden und die beiden Pferde dazu!“
Fragend blickten die Männer auf Heyward, der aber erst nach einer geraumen Weile die Sprache wiedergewann. Sein Bericht lautete ebenso kurz als schlimm. Ein Trupp Indianer, unter Anführung von Magua, hatte sich mit unhörbaren Tritten an das Feuer herangeschlichen. Sie kamen aus einer Richtung, die von den Mohikanern und Falkenauge nicht abgesucht worden war, weil sie nach einem steilen Abgrund führte. Ehe Heyward nach Hilfe zu rufen vermochte, war er bereits überwältigt. Die schlafenden Mädchen wurden von den Räubern auf die Pferde gehoben und nach der nämlichen Richtung entführt, aus der die Huronen gekommen waren. Zuvor aber hatten die Unholde das Feuer geschürt und den gefesselten Major möglichst nahe darangelegt, um ihm einen langsamen, qualvollen Tod zu bereiten.
„Die Schurken!“, rief Falkenauge erbittert. „Aber sie sollen an uns denken!“
Die Freunde stimmten bei und ohne Verzug wurde die Verfolgung der heimtückischen Rothäute angetreten. Die Spur führte die Gefährten bald an den Fluss zurück. Uncas lief stromabwärts und Chingachgook in entgegengesetzter Richtung, um ein Kanu zu entdecken, in dem sie die Fahrt den Fluss hinunter antreten konnten. Ein lauter Ruf Chingachgooks verständigte die Zurückgebliebenen, dass er ein Fahrzeug entdeckt habe, und Falkenauge rief nunmehr Uncas mit demselben Signal zurück. Fast gleichzeitig langten die beiden Mohikaner an und ohne weiteres Zögern wurde nun die Fahrt auf dem indianischen Kanu angetreten, das Chingachgook gefunden hatte.
Die Gefährten waren noch nicht weit gekommen, als Chingachgook das Ruder einzog.
„Was gibt’s?“, fragte Falkenauge gespannt. Statt einer Antwort zeigte der Mohikaner auf eine kleine Insel inmitten des Flusses, an der sie soeben vorbeigefahren waren. Sie sah so still und friedlich aus, als sei ihre Ruhe nie durch den Tritt eines Menschen gestört worden.
„Vor uns liegt nichts als das kleine Eiland und der unübersehbare Fluss“, rief Heyward ungeduldig. „Warum wollen wir uns vor einer Gefahr fürchten, die nicht vorhanden ist?“
„Mein Bruder hat schlechte Augen“, widersprach Chingachgook in ruhigem, aber gewichtigem Ton, während er das Ruder mit der Büchse vertauschte.
Der Indianer hatte kaum ausgesprochen, als der Knall einer Flinte ertönte. Von der Insel her drang das Geheul einer Rotte von Wilden, von denen mehrere in ein Boot sprangen und auf das Kanu zuruderten. Bedächtig zielten Falkenauge und die Mohikaner und auch Heyward spannte den Hahn einer Pistole. Fast gleichzeitig krachten die vier Schüsse. Drei der Indianer sanken tödlich verwundet zurück, während einem vierten die Kugel Heywards die Hand zerschmetterte, die das Ruder hielt. Nur ein einziger der Insassen des Bootes war verschont geblieben. Eilig ruderte er zurück, um Verstärkung zu holen.
„Schnell die Ruder zur Hand!“, kommandierte jetzt Falkenauge, und im nächsten Augenblick flog das Boot über den Wasserspiegel dahin. Inzwischen war das Kanu der Feinde wieder bei der Insel angelangt und mit lautem Rachegeschrei stürzten sich zehn der wilden Gesellen in das Fahrzeug, um den Flüchtigen nachzusetzen. Doch diese hatten einen zu großen Vorsprung und verschwanden alsbald aus den Augen der Indianer.
Nach mehrstündiger Fahrt legte das Kanu an. Schnellen Schritts eilten die beiden Mohikaner voran, während Falkenauge und Heyward langsam folgten. Uncas und Chingachgook blickten aufmerksam zu Boden. Sie suchten die Spur der weiterziehenden Huronen. So emsig Vater und Sohn aber auch forschten, so fanden sie doch keine Zeichen, die dafür sprachen, dass die Feinde diese Richtung eingeschlagen hätten. Die Mohikaner kehrten zu den Freunden zurück, die ihnen langsam nachfolgten.
Chingachgook und Falkenauge schienen unschlüssig, was sie tun sollten. Uncas, der wieder nach allen Seiten gespäht hatte, lief plötzlich eine kleine Anhöhe empor und blieb frohlockend vor einer Spur frisch aufgewühlter Erde stehen, die allem Anschein nach vom Tritt eines beschwerten Tiers herzurühren schien. Er winkte die Gefährten an sich heran und Falkenauge, der rasch bei ihm anlangte, rief in freudigem Ton: „Alle Wetter, das ist eine Spur, wie man sie nicht besser wünschen kann. Nun ist mir nicht mehr bange, die Huronen sollen bald unseren Besuch erhalten!“
Mit frischem Mut wurde der Marsch fortgesetzt. Nun ging es schneller als vorher, da die Spur den Gefährten deutlich den Weg offenbarte, den sie zu nehmen hatten. Endlich ließ Falkenauges Eile etwas nach.
„Ich wittere die Huronen“, äußerte er zu den Mohikanern. „Dort zwischen den Baumwipfeln wird es licht. Ich glaube, wir befinden uns in der Nähe des Lagers. Es wird daher das Beste sein, wenn wir jetzt getrennte Wege verfolgen.“ Er blickte noch einmal prüfend umher, dann wandte er sich an Chingachgook:
„Wende du dich dem Hügel zur Rechten zu. Uncas mag links entlang dem Bach gehen, während der Major und ich der Spur folgen. Stoßt ihr auf etwas Wichtiges und wünscht ihr uns ein Zeichen zu geben, so krächzt dreimal wie eine Krähe. Ich sah eben einen solchen Vogel emporfliegen, was am besten für meine Vermutung spricht, dass wir nicht allzu weit von bewohnten Gegenden entfernt sind.“
Die beiden Mohikaner entfernten sich nach der angegebenen Richtung, während Falkenauge und Heyward geradeaus schritten. Schon nach kurzer Wanderung lichtete sich der Wald und gewährte den beiden Männern einen freien Blick in das vor ihnen liegende Tal. Bald sahen sie zahlreiche Hütten, die im Kreis um das Beratungshaus lagen, das auf einer Anhöhe stand. Dies zeigte den beiden Fremden an, dass sie beim Dorf der Huronen angelangt waren.
Die Sonne sank hinter den Bergen nieder, an die das Lager der Indianer sich anlehnte, und die langgestreckten Schatten der Bäume und Hütten verkündeten das Herannahen der Dämmerung.
Zwischen den Hütten der Indianer bewegte sich eine seltsame Gestalt. Seinem Anzug nach hätte man den einsamen Wanderer für ein Bleichgesicht halten können, doch das Antlitz war nach der Sitte der Eingeborenen über und über bemalt. Seine Blicke ruhten eine Zeit lang auf den bunten Tinten der Wolken, die von der untergehenden Sonne beleuchtet wurden. Dann schritt er geraden Weges auf das Beratungshaus zu, um den Häuptling des Stammes zu sprechen. Der Medizinmann, denn seine Kleidung verriet ihn als solchen, war niemand anders als der Major Heyward. Er hatte, trotzdem ihm Falkenauge und die Mohikaner vergeblich abgeraten, den Entschluss gefasst, die Mädchen selbst, und wäre es auch mit Gefahr seines eigenen Lebens, zu retten. So mussten sich denn die Freunde, wenn auch schweren Herzens, seinem Wunsch fügen und Chingachgook bot seine ganze Kunst auf, das Gesicht des Majors so unkenntlich als möglich zu machen. Er behängte ihn noch außerdem mit verschiedenen Zierraten, die er von seiner eigenen Kleidung losriss. So gab er ihm das Aussehen eines der Gaukler, die sich bei den Rothäuten unter dem Vorgeben einschmuggeln, alle Krankheiten heilen zu können. Gern wären ihm die Gefährten auf seinem gefährlichen Weg gefolgt. Sie waren ihren Feinden jedoch zu bekannt, als dass sie hoffen konnten, auch nur eine Stunde unentdeckt zu bleiben. So ließen sie Heyward ziehen, nachdem sie noch für den Fall des glücklichen Gelingens verschiedene Signale verabredet hatten.
Die neugierigen Huronen, die sich die Anwesenheit des fremden Mannes nicht erklären konnten, folgten dem Major. So langte er endlich vor dem Beratungshause an. Festen Schrittes trat er in das Innere. Die Wilden kamen hinter ihm drein und bald war der ganze Raum von Kriegern angefüllt, die misstrauisch auf den Fremden schauten. Endlich erschien der älteste Häuptling, ein kräftiger, hochgewachsener Mann, der Heyward anredete. Da er sich aber der huronischen Sprache bediente, verstand dieser seine Worte nicht. „Spricht keiner meiner Brüder Französisch oder Englisch?“, fragte er in englischer Sprache und schaute sich im Kreis um.
„Hurone spricht die Sprache seiner Väter“, antwortete der Häuptling in der gebrochenen Weise, in der die Indianer das Englische sprechen. „Doch was will mein Bruder?“
„Ich komme von weit her, aus Kanada“, äußerte Heyward. „Die Kunst, Kranke zu heilen, ist mir eigen. Darf ich meine Geschicklichkeit bei euch ausüben?“
Aller Augen richteten sich hierauf so forschend auf den Sprecher, dass dieser alle Energie zusammennehmen musste, um sich nicht selbst zu verraten.
„Seit wann bemalen die kunstfertigen Männer in Kanada ihr Antlitz?“, fragte der Häuptling weiter. „Sie rühmten sich doch sonst ihres blassen Gesichts.“
„Wenn ein Indianer zu seinen weißen Vätern kommt“, antwortete Heyward mutig, „so legt er sein Büffelgewand ab und nimmt die Kleidung, die ihm angeboten wird. Meine roten Brüder haben mir diese Farben gegeben zum Dank, dass ich den bösen Geist aus ihnen getrieben. Ihnen zu Ehren trage ich die Farben.“
Ein Gemurmel des Beifalls erhob sich. Die Indianer freuten sich, dass der Fremde ihre Kameraden derart auszeichnete. Der Häuptling machte eine Gebärde der Zufriedenheit und die andern Krieger folgten seinem Beispiel. Einer der Wilden trat vor, um Heyward weiter über seine Herkunft zu befragen und ihn um seine Hilfe zu bitten. Doch ehe er zum Sprechen kam, erschollen so dumpfe und erschreckende Laute aus dem nahen Wald herüber, dass alle Krieger erschreckt aufsprangen und dem Ausgang zueilten.
In der Lichtung des Walds erschien eine Anzahl Krieger, die sich dem heimatlichen Dorf langsam näherten. Einer der Vordersten trug eine kurze Stange, an der mehrere menschliche Skalpe aufgehängt waren. Etwa hundert Schritte von den Hütten machten die Krieger halt. Einer rief den entgegenkommenden Stammesmitgliedern etwas in huronischer Sprache zu. In wilder Verzückung zogen die Indianer ihre Messer, schwangen sie hoch über ihren Köpfen und bildeten vor dem Platz, wo die neu angekommenen Krieger standen, eine lange Doppelreihe zu einer Gasse, die bis zu den Hütten führte.
Die Squaws ergriffen die Keulen und Äxte, um bei dem grausamen Spiel, das nun beginnen sollte, gleichfalls mitmachen zu können. Selbst die Kinder mochten nicht ausgeschlossen sein, sondern stellten sich, mit großen Stöcken bewaffnet, in die langen Reihen der Krieger. Ein Gestrüpp, das in der Nähe des Beratungshauses lag, wurde in Brand gesteckt, um das grässliche Schauspiel zu beleuchten, das jetzt beginnen sollte. Die neu angekommenen Krieger führten zwei Indianer mit sich, und diesen schien die Hauptrolle in dem unheimlichen Schauspiel zugedacht zu sein. Sie sollten nämlich durch die Gasse der wilden Huronen getrieben werden, und jeder einzelne der blutgierigen Krieger sollte sie dabei mit seiner Waffe treffen und verwunden. Dieses „Gassenlaufen“ war eine entsetzliche Marter, der der eine der Gefangenen ungebeugten Mutes, der andere dagegen zitternd und gesenkten Hauptes entgegensah.
Heyward betrachtete unverwandt die edle Gestalt des Ersteren. Obwohl das Feuer nicht hell genug brannte, um dessen Gesichtszüge zu erkennen, wusste er doch sofort, dass der Gefangene ein Häuptling sei. Kein anderer Krieger hätte sich sonst so stolz und mutig inmitten seiner Feinde benommen. Jetzt plötzlich ertönte ein lauter Schrei als Signal, dass der Lauf beginnen solle, und während das eine der beiden Schlachtopfer vor Angst bebend an seinem Platz blieb, rannte das andere mit der Flüchtigkeit eines Hirsches nach vorwärts, aber nicht in die todbringende Gasse, sondern mit einem mächtigen Satz über die Köpfe einer Reihe von Kindern hinweg. Der Flüchtling lief, noch ehe die Huronen einen einzigen Streich gegen ihn hatten führen können, dem nahen Wald zu.
Mit Geschrei und wildem Geheul stob die ganze Menge, die in der Gasse stand, auseinander und nahm unter heftigen Verwünschungen die Verfolgung des Entronnenen auf.
Leider konnte das Resultat derselben nicht lange zweifelhaft sein. Ein Teil der Huronenkrieger, der dem Wald viel näher war als der Flüchtling, schnitt ihm den Weg dahin ab und zwang ihn, eine andere Richtung einzuschlagen. Aber auch in dieser waren ihm seine Feinde zuvorgekommen. Es war ihm unmöglich, zu entrinnen. Kaum hatte er dies erkannt, als er sich in einem scharfen Bogen wieder rückwärts und dem Beratungshaus zuwandte, das er vor seinen Feinden erreichte. Hier mussten ihn die Verfolger in Ruhe lassen, denn nach der Sitte der Indianer durfte keinem Gefangenen ein Leid geschehen, der sich in den Schutz des Beratungshauses begeben hatte. Erst musste der ganze Stamm über sein Schicksal beschlossen haben. Mit lauten Verwünschungen, dass ihnen die günstige Gelegenheit genommen war, ihr Schlachtopfer niederzumetzeln, umringten die Huronen den Krieger. Doch dieser würdigte sie keines Blickes und blieb ruhig am Beratungshaus stehen. Das noch immer brennende Feuer beleuchtete seine Züge und Heyward erkannte zu seinem nicht geringen Schrecken in dem Gefangenen seinen jungen mohikanischen Freund Uncas.
Der älteste Häuptling des Stammes trat in Begleitung der übrigen Häuptlinge in das Beratungshaus. Die Krieger folgten ihnen und auch Heyward wusste sich einzudrängen, sodass er Zeuge der nun folgenden Szene wurde. Die Krieger setzten sich ihrem Rang nach im Kreis hin. In der Mitte stand Uncas ruhig und gefasst, wie es einem mohikanischen Häuptling zukam. Seine Würde verfehlte ihre Wirkung nicht, denn mehr als einer der Huronen starrte bewundernd auf die edle Gestalt des Jünglings. Nun wurde der andere Gefangene in die Hütte geführt. Voll banger Erwartung heftete Heyward die Blicke nach dem Eintretenden, denn er fürchtete auch in ihm einen Freund zu entdecken. Doch seine Besorgnis erwies sich als unbegründet, denn der Gefangene trug die Abzeichen der Huronen.
„Junger Krieger“, redete der Häuptling Uncas an, „du hast dich als Held gezeigt. Keine Furcht war in deinem Antlitz zu bemerken, als die Tomahawks dich suchten. Drei meiner Krieger verfolgen deine Begleiter. Du aber wirst ruhig dem Spruch entgegenharren, der dein Schicksal entscheiden und beim neuen Aufgang der Sonne erfolgen soll.“
In Uncas’ Augen blitzte es freudig auf. „Hat ein Hurone keine Ohren?“, rief er. „Zweimal hat euer Gefangener den Knall einer ihm wohlbekannten Büchse gehört, seit er in euerm Lager weilt. Eure Krieger kehren nicht wieder!“
Erstaunt hörte ihm der Häuptling zu. „Meine Krieger sind nicht tot“, äußerte er, „jede Kugel kann fehlen.“
„Ihr habt Recht“, bestätigte Uncas, „doch nie hat die Kugel der ‚Langen Büchse‘ ihr Ziel verfehlt!“
Die Nennung dieses Namens, der unter den Indianern Falkenauge beigelegt war, erregte Unruhe unter den Mitgliedern des Stammes. Der Jäger war sehr gefürchtet bei den feindlichen Indianern, denn man wusste, dass seine Büchse stets traf.
Der Häuptling allein unterdrückte seine Erregung. Mit ruhiger Stimme fragte er: „Wenn deine Brüder so geschickt sind, wie kommt es, dass ein so tapferer Krieger wie du in die Gewalt der Huronen fiel?“
„Er folgte der Spur eines fliehenden Feiglings“, antwortete Uncas stolz, „der Hurone flüchtete vor ihm. Auch der schlaue Biber kann gefangen werden. Ein tapferer Krieger flieht niemals!“ Uncas deutete dabei auf den gefangenen Huronen.
Aller Augen wandten sich finster nach dieser Richtung und ein dumpfes, drohendes Gemurmel lief durch die Versammlung.
Die Häuptlinge berieten sich kurz. Dann trat eine feierliche Stille ein, denn alle wussten, dass sie ein strenges Urteil über den feigen Huronen gefällt hatten. Der älteste Häuptling erhob sich und schritt in würdevoller Haltung auf den Huronen zu.
„Schwankendes Rohr“, begann er mit vorwurfsvoller Stimme, „deine Zunge ist laut im Dorf, aber stumm in der Schlacht. Die Feinde kennen die Gestalt deines Rückens, aber die Farbe deiner Augen ist ihnen fremd. Der Krieger verfolgte dich. Statt kühn ihn zu besiegen, eiltest du nach dem heimatlichen Dorf, um dich bei den Squaws zu verstecken. Dein Name wird nie wieder in deinem Stamm genannt werden – er ist vergessen!“
Bei den letzten Worten erhob der Häuptling sein blitzendes Messer, schwang es über dem Haupt des Schuldigen und stieß es ihm dann mitten ins Herz. Mit lautem Aufschrei sank der Gerichtete zusammen. Ohne ein Wort zu sprechen, entfernten sich die Krieger. Heyward stand im Begriff, ihnen zu folgen, da legte sich eine Hand auf seine Schulter und Uncas’ leise Stimme flüsterte ihm ins Ohr: „Chingachgook ist in Sicherheit und Falkenauges Büchse schläft nicht. Sei unbesorgt.“
Mit diesen Worten drängte er den Freund nach der Ausgangstür zu, und bald war Heyward in der Dunkelheit verschwunden. Er hatte sich gerade zur rechten Zeit entfernt, denn die Huronen eilten nach dem Beratungshaus zurück, um ihren Gefangenen zu holen. Beim Aufflackern des Lagerfeuers erkannte Heyward, wie vier der Indianer den Leichnam des hingerichteten Kriegers aufhoben und mit ihrer Last nach dem Wald zuschritten. Das Gepränge, das sonst die Bestattung eines Indianers begleitete, fehlte gänzlich. Der Leichnam wurde den wilden Tieren preisgegeben. So war der indianischen Gerechtigkeit Genüge geschehen.
Die Macht der Medizin
Heyward benutzte die Zeit, während der die Aufmerksamkeit der Huronen ihrem Gefangenen zugewandt war, um im Lager nach seiner Braut und deren Schwester zu forschen. Er durchstreifte das ganze Dorf. Doch er konnte nirgends etwas entdecken, was auf die Anwesenheit der geraubten Mädchen hätte schließen lassen.
Schweren Herzens kehrte er nach dem Lagerplatz vor dem Beratungshaus zurück und setzte sich zu den Kriegern, die um das Feuer lagerten. Einer von ihnen redete Heyward an: „Mein Bruder ist zur rechten Zeit angelangt. Ein böser Geist lebt in der Frau meines Sohnes. Vermag ihn der kundige Fremde zu bannen?“
Falkenauge hatte den Major genau unterrichtet, ehe er ihn nach dem Huronenlager ziehen ließ. So besaß dieser einige Kenntnisse von den Gaukeleien, die unter den Indianern gegen die vermeintlichen bösen Geister angewandt wurden. Er antwortete daher bejahend. Der Wilde setzte sich wieder auf seinen Platz, nahm seine Pfeife vor und rauchte. Geduldig wartete er auf die Stunde des Aufbruchs der andern Krieger, denn nach der indianischen Sitte durfte er das Lagerfeuer nicht früher verlassen und seine Hütte aufsuchen, als bis der Häuptling das Zeichen gegeben hatte.
Die mächtige Gestalt eines Kriegers trat jetzt ans Feuer. Die Huronen räumten ihm ehrerbietig einen Platz ein – ein Zeichen, dass er hoch in der Achtung seiner Gefährten stand. Heyward warf einen forschenden Blick auf den Ankömmling, und einen Augenblick drohte ihn seine Fassung zu verlassen, denn der Krieger war kein anderer als Magua. Ohne ein Wort zu sprechen, ließ sich dieser am Feuer nieder, zog seine Pfeife, das Calumet, hervor und füllte den Kopf mit Tabak. Nachdem er längere Zeit schweigend den Rauch des Krautes eingesogen, fragte er nach den Ereignissen des Tages, denn er war seit frühem Morgen nicht wieder im Lager gewesen.
„Die Feinde sind um die Hütten geschlichen“, berichtete einer der Indianer, „doch wer hätte je einen Huronen schlafend gefunden?“
Magua nickte schweigend.
„Einer von ihnen hat sich bis in die Mitte des Dorfes vorgewagt“, fuhr der Sprecher fort, „doch seine Neugierde ist ihm übel bekommen.“
„Haben meine Brüder seinen Skalp genommen?“, fragte Magua.
„Noch nicht, doch die Häuptlinge werden über ihn zu Rate sitzen.“
Ohne sich nach dem Gefangenen umzusehen, der unweit des Feuers an einem Pfahl festgebunden war, rauchte Magua ruhig weiter. Erst nach einer geraumen Weile schüttelte er die Asche aus der Pfeife und erhob sich, um den Gefangenen zu betrachten. Er traute seinen Augen kaum, als er den ‚schnellen Hirsch‘, wie Uncas von den Huronen genannt wurde, vor sich erblickte. Bald ging der erstaunte Ausdruck seines Gesichts in Freude über. Er atmete tief auf und frohlockend erklang es von seinen Lippen: „Der schnelle Hirsch!“
Wie von einer unsichtbaren Macht emporgeschnellt, sprangen die Krieger fast gleichzeitig in die Höhe, als sie den Namen des Todfeindes ihres Stammes nennen hörten. Aus aller Munde tönte der verhasste und doch geachtete Name, und selbst die Weiber und Kinder, die vor den Hütten kauerten, sprachen ihn mit Ehrfurcht aus. Doch schnell legte sich die Aufregung wieder. Die Krieger setzten sich abermals ans Feuer und alle schwiegen, als schämten sie sich der Teilnahme, die sie dem Feind gewidmet.
Uncas hatte sich währenddessen äußerst ruhig gezeigt. Nur ein Lächeln spielte um seinen Mund, ein Zeichen der Verachtung, die ihm die Huronen einflößten. Magua gewahrte diesen Ausdruck. Wütend über den unbeugsamen Charakter des Jünglings, der selbst in der Gefangenschaft den Huronenstamm verachtete, sprang er auf ihn zu, schüttelte drohend den Arm und rief in zornigem Ton: „Mohikaner, du stirbst!“
„Uncas stirbt, doch die Wasser aller Seen vermögen die toten Huronen nicht wieder zum Leben zu bringen, die von Uncas’ Hand gefallen sind“, antwortete der Jüngling mit keckem Trotz.
„Du sollst dafür büßen!“, entgegnete Magua. Racheschnaubend rief er alle Krieger herbei, um ihnen die Erlebnisse der letzten Tage genau zu schildern. Seine Grausamkeit und Hinterlist ließ er unerwähnt. Vielmehr kam er gleich auf den plötzlichen Angriff der ‚Langen Büchse‘ zu sprechen, den dieser mit seinen Genossen gegen ihn unternommen hatte. Dann sprach er vom Tod der Kameraden und wusste seine Worte so zu setzen, dass die Indianer, die von seiner Schilderung tief ergriffen waren, wütende Blicke auf Uncas warfen.
„Sind die Gebeine meiner Krieger auf dem Begräbnisplatz der Huronen?“, fuhr Magua in seiner Rede fort. „Ihr wisst es, nein! Ihre Geister sind nach der untergehenden Sonne gegangen und ziehen über die großen Wasser nach den glücklichen Jagdgründen. Allein sind sie hingegangen, ohne Nahrung, ohne Büchsen oder Messer, ohne Mokassins, nackt und arm, wie sie geboren wurden. Darf das sein? Brüder, wir dürfen die Toten nicht vergessen. Wir wollen den Rücken dieses Mohikaners beladen, bis er unter der Last zu Boden sinkt, und ihn dann unsern jungen Kriegern in die Jagdgefilde nachsenden. Sie rufen uns um Hilfe an, und unsere Ohren sind nicht verschlossen. Sie sprechen: Vergesst uns nicht! Und wir müssen nach ihrem Willen tun. Wenn sie den Geist dieses Mohikaners unter seiner Bürde ihnen nachkeuchen sehen, so werden sie erkennen, dass ihre Brüder sie nicht verlassen haben. Dann werden sie ruhig ihres Weges ziehen. Ein Flecken auf dem Namen der Huronen muss durch Blut getilgt werden: So sterbe denn der Mohikaner!“
Ein lautes Rachegeschrei ließ Magua erkennen, dass seine Rede die beabsichtigte Wirkung hervorgebracht habe. Einer der Krieger war so entflammt von dem Rachegedanken, dass er mit wildem Schrei seinen Tomahawk nach dem Gefangenen warf, um ihn gleich seiner Wut zu opfern. Blitzend fuhr die furchtbare Waffe durch die Luft, durchschnitt die Kriegsfeder auf dem Haupt des jungen Mohikaners und fuhr tief in den Pfahl, an dem Uncas stand. Ohne zu zucken, hatte der Indianer dem Beginnen des Huronen zugesehen; er hielt es nicht einmal der Mühe wert, den Kopf zu neigen, um dem Wurf auszuweichen. Das verächtliche Lächeln umspielte wieder seine Lippen, und einige wegwerfende Worte, die er über die Huronen fallen ließ, entfachten Maguas Wut von Neuem.
„Lasst ab“, mahnte Magua die Krieger, „die Sonne muss seine Schande beleuchten. Unsere Rache soll ihn treffen, dass er zittert und um Gnade fleht! Geht, bringt ihn fort; wir wollen sehen, ob der Mohikaner schlafen kann, wenn ihn am Morgen der Tod erwartet!“
Die jungen Krieger, denen die Bewachung des Mohikaners anvertraut war, banden Uncas mit Bastriemen und führten ihn nach einer Hütte. Auch Magua verließ mit einigen der vornehmsten Krieger das Feuer. Er war mit dem Erfolg zufrieden, den er mit seiner Rede erzielt hatte.





























