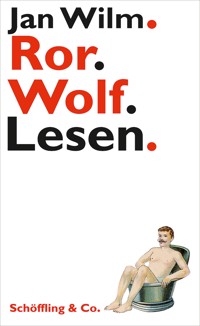14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Er ist ein fremder Gast unter Palmen, am Meer, in einer Stadt, in der immer die Sonne scheint, und das ist sein Unglück. Jan Wilm ist ein perspektivloser Philologe, der aus dem deutschen Wissenschaftsbetrieb ausgeschieden ist und - um die Arbeitslosigkeit hinauszuzögern - ein fremdfinanziertes Forschungsjahr in Los Angeles verbringt. Der Gegenstand seiner Untersuchung ist - ausgerechnet in Kalifornien - Schnee. Wilm soll durch die Jahreszeiten hinweg den Nachlass des verschollenen Schnee-Fotografen Gabriel Gordon Blackshaw (*1898 †1950) sichten. Doch wie ein Buch über Schnee schreiben an einem Ort, an dem es nie schneit? Wie eine verlorene Frau vergessen, die einen an die Heimat bindet, weil man sie noch lieben muss und nicht vergessen möchte?Verlust, Selbstverlust, Tod und Verortung in der Welt - wie lässt sich dafür eine Sprache finden, die gleichzeitig archiviert und auslöscht? Jan Wilms Roman unternimmt diesen Versuch. So meisterlich wie neu erweitert er die Möglichkeiten von Literatur, weist eindringlich in die Zukunft und zeigt dabei immer die Schultern der literarischen Riesen, auf denen wir stehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 589
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
[Cover]
Titel
Zitat
Widmung
WINTER
JANUARY HYMN ∙ THE DECEMBERISTS
SNOWY ATLAS MOUNTAINS ∙ FIONN REGAN
WINTER PRAYERS ∙ IRON & WINE
THE NOT KNOWING ∙ TINDERSTICKS
END & START AGAIN ∙ SYD MATTERS
DEMON DAYS ∙ ROBERT FORSTER
LOVE IS HARD ENOUGH WITHOUT THE WINTER ∙ LUKE SITAL-SINGH
OLD MAN ∙ NEIL YOUNG
WORDS YOU USED TO SAY ∙ DEAN & BRITTA
LAST YEAR’S MAN ∙ LEONARD COHEN
ALONE/WITH YOU ∙ DAUGHTER
ABOMINABLE SNOW ∙ ISLANDS
FROST ∙ COAST MODERN
WHOLE WIDE WORLD ∙ THE MOUNTAIN GOATS
I GOT NOBODY WAITING FOR ME ∙ M. CRAFT
STATIC ∙ BECK
IN THE LIBRARY OF FORCE ∙ JOHN CALE
LIVING IN LIMBO ∙ JANE BIRKIN
IMAGE FANTÔME – PAVANE POUR UNE INFANTE DÉFUNTE ∙ JANE BIRKIN
ESPECIALLY ME ∙ LOW
THE NIGHT BEFORE … ∙ JOEY DOSIK
MIRAH ∙ DON’T DIE IN ME
LATE MARCH, DEATH MARCH ∙ FRIGHTENED RABBIT
I HAVE BEEN TO THE MOUNTAIN ∙ KEVIN MORBY
BLACK COFFEE ∙ MARIANNE FAITHFULL
FRÜHLING
WHITE CEDAR ∙ THE MOUNTAIN GOATS
HATE IT HERE ∙ WILCO
IN THE SUN/THE GALAXY EXPLODES ∙ MEKONS
APRIL FOOL’S DAY MORN ∙ LOUDON WAINWRIGHT III
THERE IS NO THERE ∙ THE BOOKS
THAT LEAVING FEELING ∙ STUART A. STAPLES
SEASONS (WAITING ON YOU) ∙ FUTURE ISLANDS
SNOWFLAKE ∙ KATE BUSH
YOU CAN NEVER HOLD BACK SPRING ∙ TOM WAITS
SAME OLD MAN ∙ JOANNA NEWSOM
IN OTHER WORDS ∙ BEN KWELLER
AT THE FIRST FALL OF THE SNOW ∙ HANK WILLIAMS
ENJOY YOUR WORRIES, YOU MAY NEVER HAVE THEM AGAIN ∙ THE BOOKS
WHAT WE DO MATTERS ∙ THE MANTLES
DON’T INTERRUPT THE SORROW ∙ JONI MITCHELL
SOMMER
WINTER DIES ∙ MIDLAKE
HAPPINESS WILL RUIN THIS PLACE ∙ SAN FERMIN
CALIFORNIA ENGLISH ∙ VAMPIRE WEEKEND
L.A. ∙ ELLIOTT SMITH
SNOW SONG, PT. 1 ∙ NEUTRAL MILK HOTEL
JULY, JULY! ∙ THE DECEMBERISTS
COLD SUMMER ∙ SEABEAR
SUMMER BABE (WINTER VERSION) ∙ PAVEMENT
UNDERDOG (SAVE ME) ∙ TURIN BRAKES
SAVE ME FROM WHAT I WANT ∙ ST. VINCENT
SAVE ME ∙ AIMEE MANN
AFTER SANTA MONICA BOULEVARD ∙ DIRTY PROJECTORS
I WILL NOT SAY YOUR NAME ∙ THE DECEMBERISTS
TO THE GHOSTS WHO WRITE HISTORY BOOKS ∙ THE LOW ANTHEM
SKYWRITING ∙ EELS
HOUSE WHERE NOBODY LIVES ∙ TOM WAITS
GLACIER ∙ JAMES VINCENT MCMORROW
SLEEP ALL SUMMER ∙ CROOKED FINGERS
DEAD OF WINTER ∙ EELS
INVISIBLE INK ∙ AIMEE MANN
MORNING IN LA ∙ WHITE LIES
L.I.F.E.G.O.E.S.O.N. ∙ NOAH AND THE WHALE
ANOTHER MAN’S DONE GONE ∙ BILLY BRAGG & WILCO
SUMMERSONG ∙ THE DECEMBERISTS
WHITE ON WHITE ∙ CASIOTONE FOR THE PAINFULLY ALONE
BLINDSIDED ∙ BON IVER
THAT SUMMER, AT HOME I HAD BECOME THE INVISIBLE BOY ∙ THE TWILIGHT SAD
CHAIN OF MISSING LINKS ∙ THE BOOKS
GOOD MORNING, CAPTAIN ∙ SLINT
HERE COMES THE SUMMER KING ∙ DIRTY PROJECTORS
GET BACK ∙ MEMORYHOUSE
WHERE DID YOU SLEEP LAST NIGHT? ∙ LEADBELLY
ceiling gazing ∙ mark kozelek & jimmy lavalle
WHERE DO WE GO NOW BUT NOWHERE? ∙ NICK CAVE & THE BAD SEEDS
SNOWY IN F# MINOR ∙ TINDERSTICKS
DON’T LET THE SUN GO DOWN ON YOUR GRIEVANCES ∙ DANIEL JOHNSTON
HERBST
WHEN I WAS DONE DYING ∙ DAN DEACON
SNOW ANGEL ∙ RON SEXSMITH
HERE THERE IS NO WHY ∙ KATERWAUL
HE DOESN’T KNOW WHY ∙ FLEET FOXES
THE MEETINGS OF THE WATERS ∙ FIONN REGAN
COMING INTO LOS ANGELES ∙ ARLO GUTHRIE
OCTOBER ∙ BROKEN BELLS
SOON GOODBYE, NOW LOVE ∙ TOM ROSENTHAL
NOT A ROBOT, BUT A GHOST ∙ ANDREW BIRD
REACHING FOR THE BOOK AND TIME, WHILE STORMS FORM ON THE LEFT ∙ TOM ROSENTHAL
FADEAWAY TOMORROW ∙ JOHN CALE
WHY ∙ DAVID BYRNE
AUTUMN’S CHILD ∙ CAPTAIN BEEFHEART AND HIS MAGIC BAND
WINTER ∙ DAUGHTER
CHAMBER OF REFLECTION ∙ MAC DEMARCO
DIRTY SNOW ∙ THE OCCASIONAL FLICKERS
MAY IT ALWAYS BE ∙ BONNIE ›PRINCE‹ BILLY
SWEET LITTLE MYSTERY ∙ JOHN MARTYN
EASY ∙ LAURA MARLING
HAPPINESS ∙ JÓNSI & ALEX
ABOUT A BRUISE ∙ IRON & WINE
EMILY SNOW ∙ M. CRAFT
THE DESPERATE KINGDOM OF LOVE ∙ PJ HARVEY
SNOW CRUSH KILLING SONG ∙ THE MOUNTAIN GOATS
HERE TIL IT SAYS I’M NOT ∙ DIRTY PROJECTORS
VISIONS OF LA ∙ SLOWDIVE
50 WORDS FOR SNOW ∙ KATE BUSH
SOMEHOW THE WONDER OF LIFE PREVAILS ∙ MARK KOZELEK & JIMMY LAVALLE
AVALANCHE (SLOW) ∙ ZOLA JESUS
FROZEN NOTES ∙ WARREN ZEVON
SUNKEN TREASURE ∙ WILCO
WINTER
SANTA MONICA ∙ THE WEDDING PRESENT
FLIGHTLESS BIRD, AMERICAN MOUTH ∙ IRON & WINE
TYING UP LOOSE ENDS ∙ CASS MCCOMBS
I’LL BE AROUND ∙ YO LA TENGO
DISGRACED IN AMERICA ∙ OUGHT
THAT WAS THE WORST CHRISTMAS EVER! ∙ SUFJAN STEVENS
END OF THE YEAR ∙ OTHER LIVES
THE BOOK OF LOVE ∙ THE MAGNETIC FIELDS
ALWAYS SEE YOUR FACE ∙ LOVE
AFTER I MADE LOVE TO YOU ∙ BONNIE ›PRINCE‹ BILLY
UNDERNEATH THE SUN ∙ BILL FAY
OCEANS AWAY ∙ PHILLIP GOODHAND-TAIT
NIRGENDHEIM ∙ TEHO TEARDO & BLIXA BARGELD
THIS IS HELL ∙ ELVIS COSTELLO
IMPOSSIBLE GERMANY ∙ WILCO
DANKSAGUNG
Autorenporträt
Kurzbeschreibung
Impressum
Alle Figuren in diesem Buch, mit Ausnahme der namentlich genannten historischen Persönlichkeiten wie Gabriel Gordon Blackshaw und Leyton R. Waters, sind Erfindungen des Erzählers. Alle sonstigen Figuren, mit Ausnahme des Erzählers, sind unidentisch mit einer lebenden oder toten Person, und sämtliche Ähnlichkeiten mit Vorgängen der Realität sind rein zufällig.
Und dass ich neu auf der Welt bin mit einem Mal, ohne Augen, entlassen, ein Arbeitsloser, der keinen Halt mehr hat, und ein Wort muss ganz am Schluss stehen: Unglück.
PAZIFIK EXIL ∙ MICHAEL LENTZ
I am gonna make it through this year if it kills me.
THIS YEAR ∙ THE MOUNTAIN GOATS
FÜR A.
WINTER
JANUARY HYMN ∙ THE DECEMBERISTS
Die Träume sind tot, es gibt nur noch gestern. Und trotzdem liegt vor mir der Schnee, und hinter mir liegst du. In meiner verlassenen Stadt liegst du hinter mir. In einem flughafenhaften Archivgebäude auf einem Hügel in Los Angeles, auf Papier, liegt der Schnee. Ohne dort sein zu wollen, bin ich dort, und dort ist jetzt hier. Ohne hier sein zu wollen, bin ich hier, gestraft unter himmelhohen Palmen, mein Zuhause zu Hause in Ruinen, zerbrochen, in die Asche gedrängt. Ins Landschulheim fahren müssen, am Montagmorgen, wenn sich die Eltern am Sonntagabend angeschrien haben.
Im Flugzeug, über dem kalifornischen Bergfleck kurz vor der Stadt, wie üblich die starken Turbulenzen, wie gewöhnlich die alte Absturzangst, dann in einem Luftloch der neue Gedanke, dass es jetzt egal wäre. Ich lande am 2. Januar gegen Mittag in LAX und werde nach einer kurzen Befragung von einem mürrischen Immigration Officer mit blauen Plastikhandschuhen in einen deprimierenden, milchverglasten, klimatisierten Bürosarg gebracht, wo man mir den Pass abnimmt, ihn mit einem Dutzend anderer Pässe auf einem Rezeptionstisch aufreiht und mich mit dem dazu passenden Dutzend verlorener, Jetlag-lädierter Seelen in einer Stuhlreihe warten lässt. Ohne zu wissen, warum ich hier bin, bin ich also hier.
Hier ist Nachmittag, daheim ist Nachtmitte. Wie ein Seufzen sind die schwarzen Stunden in die Zimmer gesickert, in denen ICH noch WIR hieß. WIRist ein Wort aus Schnee, flüchtig, vergesslich, wie die vergängliche Blüte des Schnees selbst. Das Wort entflockt sich hier, es rieselt mir davon, doch es steckt in meinem Hals fest wie das kloßige, zugeschnürte Gefühl vor dem Weinen. Ob ich es jetzt aussprechen könnte, wenn ich hier sprechen dürfte, wenn ich hier meine Sprache sprechen dürfte, unsere Sprache? Selbst wenn jetzt zu Hause Tag wäre, ein kaltklarer Januartag, Jännertag, Jammertag, ein Tag mit zackengreller Sonne, ich hätte niemanden, um von dieser Erfahrung hier zu erzählen.
Ich erfahre, dass es ein Problem mit einem alten Visum gibt, aus der Zeit, als wir einmal zusammen hier waren. Die Symboliken des Schicksals. Zur Verteidigung sage ich, Ich bin Professor, und gebe mir das übersetzungsbedingte Upgrade, durch das ich mir Schutz erhoffe. Dass ich seit drei Monaten an keiner Universität mehr beschäftigt bin und mich allein das DAAD-Geld (God love it) vor dem postakademischen Limbus beschützt, in dem die verlorenen Seelen ihre geisteswissenschaftlichen Goldreserven schließlich in Kalauer für Die moderne Hausfrau verwandeln oder Bücher über Gartenbau Korrektur lesen, behalte ich für mich.
Das bin ich, hier, im Transitbereich von Los Angeles International, wie ich herzpaukend erkläre, dass ich für ein Buch über Schnee recherchiere und die Papiere nur vor Ort eingesehen werden können. Eine Augenbraue rundet sich nach oben: Snow? There ain’t no snow around here, you know? Ich lache verlegen, aber die Worte schienen weniger als Witz gemeint denn als Ausdruck eines Zweifels. Während der Beamte seinem Computer intensivere Aufmerksamkeit schenkt, schließt einer seiner Kollegen – es arbeitet nicht eine Frau hier – seinen Schalter und gießt sich an einer kleinen Refreshment Station auf einem Aktenschrank hinter den Arbeitsplätzen einen Instantkaffee auf, woraufhin ein Raunen durch den Raum geht. Mit der gedankenlosen Ruckartigkeit eines Rehs, das im Wald durch einen brechenden Ast beim Äsen unterbrochen wird und plötzlich aufschaut, sagt mein Grenzbeamter, allerdings ohne aufzuschauen: Mh. Could it be that I smell coffee? Daraufhin folgt aus der gesichtslosen Belegschaftsriege ein gedämpftes Gelächter.
Ohne eine Erklärung bekomme ich schließlich meinen Einreisestempel. Welcome to the United States, höre ich hinter einem Blick voller Zweifel, in dem ich fast Verzweiflung zu erkennen meine. Worauf freut sich Officer J. Morana im Laufe seines Arbeitstags? Auf den Instantkaffee mit der Pulvermilch, die aus einem rohrpostbüchsengroßen Streuer rieselt (hier gibt es doch Schnee!), oder darauf, erfolgreich die Menschen abweisen zu können, deren Zukunft, deren Vergangenheit eine Gefahr für Homeland Security darstellen? Vermutlich freut er sich nur auf eins: das Ende des Arbeitstags.
Als ich die lange Rolltreppe zur Gepäckausgabe runterfahre und mit meinem Abstieg auch mein Adrenalinspiegel sinkt und ich meinen Koffer wie ein letztes Treibgut auf dem Gepäckband fahren sehe, werde ich zum ersten Mal auf neuem Boden wirklich traurig. An dich zu denken wird möglicher, je weiter ich mich von dir entferne, und je weiter, desto schmerzlicher wird es, wirst du. Du bist bei mir, weildu fort bist, du bist hier, weil du dort bist. Wie ein mich heimsuchender Geist am fremden Ort.
SNOWY ATLAS MOUNTAINS ∙ FIONN REGAN
Seit Beginn des fotografischen Zeitalters lag in Los Angeles nur ein einziges Mal richtig viel Schnee, im Januar 1948. In allen Archiven der Engelsstadt sind nur zwei Fotografien dieses singulären Ereignisses erhalten. Gemacht wurden sie vom Robinson Crusoe des Schnees, Gabriel Gordon Blackshaw, einem gebürtig kalifornischen Fotografen, der sein Leben damit verbrachte, den Schnee Nordamerikas fotografisch und sprachlich zu sammeln. Seinen insularen Beinamen erhielt er wegen seines abgeschiedenen Daseins in einer Berghütte in den Selkirk Mountains an der kanadischen Grenze, wo er vermutlich an einem der ersten Tage des Jahres 1950 in einer Lawine ums Leben kam.
Im Getty Research Institute unter der heißen Januarsonne im warmen Wind des Golden-State-Winters über dem zehnspurigen, zähfließenden 405-Freeway liegt heute der Blackshaw-Nachlass für alle Forschung frei zugänglich, freilich unerforscht: Positive und Negative, Briefe und Bücher und ein seltsames Konvolut aus losen Papieren, ein Journal seines letzten Lebensjahres. Es trägt den Titel My Diary of the Plague Year. Hierfür bin ich hier, so steht es zumindest im Antrag. Doch als ich die Papiere vorige Woche, frierend in meinem airconditioned nightmare des Special Collections Reading Room, erstmals durchsehen durfte, jede Seite ist in eine lichtreflektierende Klarsichtfolie eingeschlagen, erschrak ich, da ich einen Moment lang glaubte, ich schaute in einen schrecklichen Spiegel. Und sofort überkam mich ein Gefühl von Beklemmung, als klammerte sich um mein Herz eine Hand aus schwarzem Staub.
Seitdem habe ich Angst vor diesem Schneetagebuch, Angst davor, herauszufinden, was es war, das Blackshaw in seinem Pestjahr verloren hatte, Angst davor, dich darin finden zu können, Angst vor dem Wegknicken der Welt, als ob etwas aus ihr herausgebissen worden wäre, Angst davor, vom Verlust lesend, dich erneut verlieren zu müssen, und, dich verlierend, erneut alle Menschen verlieren zu müssen, die ich in meinem Leben schon verloren habe. Angst davor, vor allem, dass der Tod wieder heimkommt, erneut nichts als Oleander und Zypressen. Ich hätte niemals hierherkommen sollen. Jetzt fühlt es sich an, als könnte ich niemals wieder weg von hier. Denn was, wenn du dann zu Hause doch noch einmal zu mir kämst und mich nicht mehr erkennen würdest, weil ich hier ein anderer geworden bin?
Alles Neue, was ich hier sehe, sehe ich ohne dich, und weil du es nicht mit mir siehst, sehe ich es gegen dich. Mit jeder Erfahrung bringe ich Entfernung zwischen uns, mit der Entfernung bringe ich dich mehr in mich heim. Die Augen binden sich heftiger an das, was sie verschwinden sehen. Der gehende Blick ist manchmal der längste. Orpheus guckte absichtlich zurück. Ich verliere dich jetzt mit jedem neuen Blick und jedem neuen Wort, so schmerzlich, dass ich manchmal meine, dieses Verlieren müsste irgendwie produktiv sein und mir irgendetwas bringen (dich). Es bringt mir nicht mal einen Text, weil ich keinen Text schreiben will, der kein Text über dich ist, und dabei habe ich eine ästhetische Theorie über Schnee schreiben wollen. Ich singe ein Echo über mich selbst in meinem Innern, wenn ich von dir sprechen will. Wirst du weniger, wenn ich von dir schreibe oder von dir spreche? Selbst meine geschriebenen Worte über dich haben eine Stimme, die ausschließlich klingt wie ich. Ich schreibe DU und du bist es nicht.
Ich werde dich zur Leerstelle machen müssen, zum Weiß zwischen den Worten, deine Stimme nicht in meine Stimme hinunterschreien, dich nicht in meine Sprache hineinzerstören. Du hast in einem wissenschaftlichen Text nichts verloren. Ich kann dich nicht auch noch in der Theorie verlieren. Vielleicht ist DU ein Wort, das keine Buchstaben haben sollte. Wenn ich von dir schreibe, verliere ich dich, wenn ich aber nicht von dir schreibe, verliert dich die ganze Welt.
Ich sitze im Big Blue Bus und holpere über die schlagdurchlöcherten Straßen, als führe ich durch ein Kriegsgebiet. Diese sonnengebleichte Stadt, die flachen Häuser, die leeren Himmel, die vielen Autos, die verlassenen Gehwege. Einem Exilanten gleich, scheint meine Vergangenheit über meine Gegenwart gefaltet. Ich habe das Gefühl, ich lebe rückwärts. Aber eigentlich ist es doch auch egal, an welchem Ort man seine Erinnerungen verliert. City of Quartz. Eine Stadt fürs Vergessen, heißt es doch, eine Stadt, die keine Erinnerungen hat.
Obwohl die Stadt laut ist durch Verkehr und Möwen, ist das Gefühl des Passanten ein lautloses, als ginge man durch eine Schneelandschaft, eine farblose, geglättete Welt. Ich gehe zurück zu meiner Casita hinter einem Wohnhaus in Santa Monica, ein umgebautes Poolhäuschen, das ich für umgerechnet zu viel Geld über Airbnb miete. Ein Wasserfiltersystem, ein Entsafter und ein Bügeleisen sind aber inklusive. Adrian, mein landlord, zertritt vor dem Recyclingcontainer in der Müll-Alley hinter der Casita gerade bauchige Plastikkanister. Er begrüßt mich mit den Worten: Sie haben Pech, dass Sie ausgerechnet während der Hitzewelle hier angekommen sind. Wenn es das Wetter nicht gäbe, denke ich, hätte man sich nichts zu erzählen. Aber ich sage Ihnen was, bald kühlt es ab. Meistens in der dritten Januarwoche, dann liegt auf den Bergen sogar manchmal Schnee. Ich bin überrascht, wie wenig mich das interessiert, in der Hand halte ich schon den Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Ich schließe sie auf, sie öffnet immer zu schwer, aber ich wage nicht, es anzusprechen. Ich muss mich anstrengen, dort hinzukommen, wo ich nicht hinwill. Als müsste er verschnaufen, legt Adrian seine Hände an die Hüften, sein Hemd spannt über einem kleinen Bauch. Schreiben Sie hier eigentlich ein Buch?, fragt er, worauf sich in mir etwas zusammenzieht, als hätte er mich bei etwas ertappt. Ich sage, ich versuche es, und schlüpfe schnell in meine Airbnbleibe. Die traurige Dunkelheit in Zimmern an sonnigen Tagen, als wäre man zur Strafe vom Spielen reingerufen worden. Draußen höre ich das trockene Krachen der zertretenen Plastikkanister.
Man sagt mir, es dauere ein Jahr, bis man einen Menschen vergessen hat. Einmal alle vier Jahreszeiten allein. Ich frage mich, sagen sie einem das als Hoffnung oder als Drohung?
Vielleicht ist das bisschen Schnee, das ich mit dir hatte, alles, was mir von dir bleibt. Ein Buch über Schnee schreiben wollen und die Schneetage mit dir deshalb satter erleben, als sie es eigentlich waren. Das Buch nicht schreiben können, weil du unter dem Schnee verschwinden würdest, unter der geglätteten Weißwelt des Buches, reduziert zu einer Spur, verkommen zu einem Zeichen.
Damals in der Wohnung beließ ich vieles unverändert in dem Kinderglauben, so könntest du jeden Moment zurückkommen und fändest alles, wie es war. Das Jahr des magischen Denkens. Ein Wasserglas stand noch nach einem Monat auf dem Küchentisch in der näherkommenden Sonne, ein Kalkrand wie ein staubiges Sediment, an dem ich glaubte, unsere Zeit ablesen zu können. Und wie dann plötzlich das Glas einfach weg war, als hätte ich mich selbst betrogen.
WINTER PRAYERS ∙ IRON & WINE
Seit drei Wochen war ich nicht im Archiv und frage mich, wie es, wenn es so weitergeht, weitergehen soll, wie ich in meinem Abschlussbericht eine Woche zu einem Jahr hochlügen soll, um das DAAD-Geld (God love it) nicht zurückzahlen zu müssen. Mit einem Stich aus Schuld sehe ich meinen Getty-Ausweis, wenn ich mein Portemonnaie öffne. Meine mitgebrachten Schnee-Bücher nutze ich, um meinen Laptop auf dem flachen Couchtisch zu erhöhen. Der Name Blackshaw fällt in mir zu wie eine Tür.
Dann plötzlich, am Ende meiner vierten Woche, ohne dass ich einen denkenswerten Gedanken über Schnee gehabt hätte, fällt über Nacht die Temperatur ab. Als ich mir am Morgen einen Kaffee hole, stehen die Palmen fast still, der warme Wind ist verflogen, das Licht winterlicher, als wäre es durch Kristallglas gefallen, bevor es in die Straße kam. Die wüstenleere Zementwelt des Wilshire wirkt wie ein kommunistischer Prachtboulevard, die einzige Passantin, die mir begegnet, trägt einen Mantel, der so schwer aussieht wie das juwelenbeladene Kleid einer Romanow-Tochter. Als ich sie sehe, wird mir kalt. Es scheint, als hätten sich die runtergekühlten Innenräume der Stadt nach außen gestülpt, überall Reading Room-Temperatur, die ganze Stadt ein Archiv. Der Himmel hat eine yveskleinblaue Klarheit. Die riesigen spinnendünnen Palmen, die sich schwindelerregend schräg und ungeheuer oben vom Sonnenlicht lackieren lassen, nicken mir leicht zu, als ich unter ihnen entlanggehe. Als wüssten sie etwas von mir.
Am Abend miete ich online einen günstigen Kleinwagen für den nächsten Tag, Chevrolet Spark or similar. Ich schlafe noch immer nicht gut, schiebe es auf den mittlerweile alten Jetlag, habe nachts Angst vor den Helikoptern in der Luft, Ghettobirds, wen suchen die denn über Santa Monica? Auf YouTube gucke ich Bob Ross beim Malen zu, An Arctic Winter Day, erst ein Glas Milch, dann ein Glas Maker’s Mark, dann mehr Maker’s Mark, dann mehr Bob Ross, Mountain Cabin. Hellwach. Das kleine BR-Logo wie ein winziges halb geöffnetes Sprossenfensterchen oben in der Ecke. Wer hätte gedacht, dass man einmal wehmütig an Bayern denkt.
Am Morgen stehe ich so müde im Mietwagenbüro, dass ich glaube, jeden Moment durch den Boden zu krachen. Weil noch nicht genügend Kleinwagen wieder zurückgekommen sind, bietet man mir einen Van an. Und einen Rabatt. Ich nehme beides. Eine Mitarbeiterin, die im Hintergrund des kleinen wasserhäuschengroßen Flachdachbüros mit müdem Handautomatismus Zettel in Plastikfolien steckt, hält inne und schaut auf, als die Worte Chevrolet Express fallen. Ich blubbere mir ein Glas Wasser aus dem bulboiden Spender, als die grelle, tiefstehende Morgensonne, die den leeren Parkplatz plättet, einen Moment lang verdunkelt wird, weil sich ein leichenwagenlanger schwarzer Bus vors Fenster schiebt.
Als ich mich gestaucht in dem glänzenden Lack des gigantischen Wagens gespiegelt sehe, sagt der Mietwagenhändler: That thing’s legit. Da passt eine ganze Band rein. Schlagzeug, sogar ein Kontrabass.
Danke, sage ich leichthin, ich bin heute auf Solo-Tour.
Der Wagen liegt behäbig auf der Straße und gleitet gleichzeitig mit einer seltsamen Schwerelosigkeit dahin, und in den Grace-Kelly-Serpentinen den Mount Hollywood rauf fühle ich mich kurz wie George Kaplan, auch wenn ich nicht mehr betrunken bin. Sperrig und schwerfällig, wie eine Tram, die in ihr Depot bugsiert wird, rangiere ich den Wagen auf dem Parkstreifen neben dem Abgrund und muss schließlich, selbst in der geräumigsten Autostadt, zwei Parkuhren quartern.
Mit Menschen in Touristenfunktionskleidung und Wahrzeichenmützen schleppe ich mich verhalten den nach Pinien duftenden Weg zum Griffith Observatorium hinauf. Unter den Gehenden herrscht eine merkwürdige, erwartungsvolle Stille, das mechanische Schlurfen der Schuhe wie die Schritte der verlorenen Seelen, die ins Totenreich einziehen. Mit plötzlicher Majestät steigen hinter dem von uns bewegten Horizont die Dreifaltigkeitskuppeln des Observatoriums auf, Taj Mahal Light. Rechterhand und ganz nah, auf den Berg gewellt, das HOLLYWOOD Sign. Ich gehe nicht aufs Observatorium zu, sondern sondere mich ab vom Mommy-Daddy-Geschrei und den Ausflüglern mit ihrem Stabgeschirr-für-Schwachsinnige. Ein Selfiestick ist auch nichts anderes als ein Dildo, der Fotos machen kann. Von der kleinen Mount Wilson-Terrasse aus liegt sie dann augenblicklich vor mir, diese neue, ausgesprudelte Stadt, der urban sprawl, hingestreckt zwischen weichen Bergen wie ein Flügel. Ein Engel. Ein Albatros. World on a wing. Dahinter, über dem Kessel von LA, schwebt der hohe Wall der San Gabriel Mountains, und wie mit der Bob Ross-Spachtel in die dunklen Bergspitzen geritzt, wie mit einem federzarten Kalkweiß sedimentiert, ein einziges, dünnes weißes Band, das auf den Gipfeln liegt wie der transparente Überrest einer gehäuteten Schlange. Etwas Wind und die brüchige Schneehülse müsste verfliegen. Das Alltäglichste, das Unsicherste. Die kühle Luft ist klar, ich rieche Gras und Blüten statt Smog und leise höre ich die ferne Brandung des Stadtverkehrs. Tief im Körper meine ich, die Wahrnehmung von Pulverschnee ausmachen zu können, so als hätte ich jetzt frischen, kalten Neuschnee an den Händen. Doch meine Hände sind warm, etwas feucht. Es scheint mir, als täuschten mir meine Augen durch ihren Eindruck dieses weit entfernten Schnees meine körperliche Wahrnehmung, meine Erinnerung nur vor. Und obwohl ich es nicht möchte, bist auch du jetzt da, als gehörte mir mein Körper nicht mehr allein. Weil es so ja auch ist, denke ich und mache Musik in meiner Ohrmuschel fest: While the city was busy we wanted to rest/She decided to drive up to Observatory crest (CAPTAIN BEEFHEART AND THE MAGIC BAND).
Ich bin ein Körper ohne sein Herz, das du warst, du schlugst mich durch die Tage. Allein, ein Körper ohne Herz ist nicht einfach ein Körper ohne Herz. Ein Körper ohne Herz ist eine Leiche. Und jetzt, als körperliches Gegenmittel: Schnee in den Fingern halten, das erste Mal ohne dich wieder Schnee berühren, wäre das das erste Mal? Das erste Mal Schnee in Southland. Die Berge sind nur anderthalb Stunden entfernt, man könnte hinfahren.
Als ich aber in der gedämpften Stille des Kleinbusses sitze, mit dem Wunderbaumgeruch, der waldig vom Rückspiegel pendelt, eines meiner Augen guckt mich auf Halbmast daraus an, bin ich plötzlich in eine Bewegungslosigkeit eingekrustet. Wir standen vor der James Dean-Büste auf der anderen Seite und eine Möwe hatte dir Kartoffelchips aus der Tüte geklaut, war ungelenk davongerannt und in die Luft fortgesunken. Trotzdem lächelst du auf dem Bild, deine Zunge leicht an die Zähne gelegt, und wenn man das Foto bis zum Ende hin vergrößert, meint man, auf deinen Zähnen das orchideenweiße Licht des Tages zu erkennen, und zu Pixeln zerlegt, sieht man in deiner Sonnenbrille zweimal auch mich, vor meinen Augen mein Telefon wie ein schwarzer Anonymisierungsbalken.
Ich fahre ein paar Straßen ab, die ich als Filmtitel kenne – Sunset Blvd., Mulholland Dr. –, und weil ich dann nicht weiter weiß, fahre ich die Küste runter, von den Bergen weg, nach Redondo Beach und meine, den Parkplatz am Pier zu finden, wo wir einmal an einem nebligen aschgrauen Morgen spazieren gegangen waren, halb regnerisch, aber nicht kühl, eine Stimmung, die mich damals an Berlin erinnerte, was du vor der Pazifik-Kulisse nicht verstehen konntest und lachtest (Berlin am Meer?), und du verglichst mich mit einem der Ex-Pacific-Palisades-Expatriaten, erwachsene Menschen, die Heimweh haben wie Kinder, die weinen, wenn sie ein deutsches Wort hören, weil das Zuhause ihrer Sprache zu Hause zerschnetzelt wird von den Barbaroi. Dein Lachen im nebelstäubenden Nieselregen, der Duft von Salz und Sand, dein zitterndes Haar im Wind wie eine Flamme, wie Wassergras, am Tag, bevor wir abflogen, nicht nach Berlin.
Mein Chevrolet Express ist der einzige Wagen auf dem Parkplatz vor dem metallgrauen Ozean, der wie ein altes Sediment unter dem kobaltblauen Himmel des Nachmittags liegt. Eine leere Getränkedose rollt im Wind ein Geräusch von Verlassenheit über den Beton. Ich bin nicht einmal ein Exilant hier. Weil ich die Sprache spreche, in zwei Sprachen zu Hause bin. Und in keiner der beiden ganz. Ich gehe nicht auf den Pier, bleibe hinterm Steuer sitzen, mache mir einen Soundtrack an, um momentweise leise zu ertragen: Well she left you the holes/The tracks in the back yard, December snow/But those sad souvenirs/They end at the fence line, disappear (IRON & WINE). Ich schaue auf den trockenen Kubus des Parkplatzes, ausgeblichener Beton, Palmen wie langbeinige Beobachter ringsum, ihre Wedel wie Pompoms, die in der Luft wiegen, als wollten sie mich anspornen, oder als zuckten sie mit den Schultern. Dahinter, die krause Folie des versilberten Meeres. Die Vergangenheit ist matt und die Folie der Gegenwart greller, doch die Mattigkeit schlägt von unten her durch. Ich denke an dich, bis die Scheiben angelaufen sind und die Welt im Nebel verschwindet, im Quecksilbernebel. And I seem to know/That everything outside us is/Mad as the mist and snow (W.B. YEATS).
Meine Vergangenheit hat kein Gesicht, schreibt Blackshaw im Januar seines letzten Jahres. Sie ist eine augenlose Mumie, eingemoort und unberührbar, geschützt in ihrem heiligenden Tod. An mein Bein ist ein Seil gebunden. Sein anderes Ende führt in ein Grab. Auf jedem Grab liegt Schnee.
Ich bleibe eine lange Zeit im Wagen sitzen. Dann aber muss die Musik verstummen, nach der Musik ist die Stille wie Schweigen, und man muss die silberne Scheibe weinen machen, mit der Hand ein kaltes Loch in den Nebel wischen und die kleinen Tränenamöben in die Silberfläche rinnen lassen, man würde gerne durch dieses Loch in den Himmel fallen, aber man öffnet bloß das Fenster und riecht die gesalzene Luft, hört die Möwen hämisch lachen, das Licht der Parkuhr springt von Grün auf Rot. Man richtet seinen sperrigen Tramwaggon vom Ozean weg und verlässt dieses Depot für die Rush Hour, in der erneut alles stillsteht.
In der Nacht wird es Februar werden. Dann kommt bald ein Tag, an dem sich der letzte Tag jährt. Da ich zu Hause nicht alle vier Jahreszeiten durchleben konnte, muss ich sie hier jetzt alle noch einmal wiederholen? Hier gibt es keine Jahreszeiten. Ich habe Angst vor diesem Tag mit der einzelnen 5, die Hälfte eines zerbrochenen Fahrrads, ein Seepferdchen treibend in der Widersee, auf Wiedersehen alter Tag, letzter Tag, der immer der kürzeste bleibt. Wie hilflos du damals warst, als du mir gesagt hattest, was los war, wie lose plötzlich unser WIRwurde.
Ich gebe den Wagen zurück, aber ich spreche noch nicht die Sprache der Boulevards und verlaufe mich, lande immer wieder vor dem grellspiegelnden Pazifik vor Santa Monica. Der modellgroße Vergnügungspier in weiter Ferne. Schließlich finde ich auf den Wilshire Richtung LA, überkreuze schnell die blendenden Zebrastreifen über die vierspurige Straße und es fällt mir ein, dass Christa Wolf hier mit dem Big Blue Bus abends in entgegengesetzter Richtung zurück in ihr Hotel gefahren ist und sich gefreut hat auf ein Glas Wein und Star Trek: The Next Generation. Die fiebrig bunten Blumen des Winters, stillgestellte Feuerwerke, die auch sie damals umgeben haben mussten, als sie, wie sie später schrieb, hier an ihrem aberwitzigen Projekt arbeitete. Nachdenken über Christa W. Als sie Scholar am Getty war, als das Getty noch in Santa Monica war, wurde sie besucht von ihrem Mann, der in ihrem daraus hervorgegangenen Engelsbuch nur kurz als ein einzelner Buchstabe auftaucht. Wenn ich schreiben könnte, denke ich, als ich in der nach Müll riechenden Alley die Tür zu meiner Casita aufdrücke – es ist seltsam, wie still es mitten in diesem brodelnden Stadtkessel sein kann, und ich habe einen Lidschlag lang Angst, in den halbdunklen, leeren Raum zu gehen, Angst vor der Abendsonne, die sich durch den Avocadobaum wie grünes Wasserlicht auf den Boden filtern wird – wenn ich Worte, wenn ich Buchstaben, für dich hätte, vielleicht könnte ich dich dann einfach zu mir mit mir hier hinschreiben, und wenn man uns dann als WIR lesen würde, würde die Leseerfahrung vielleicht irgendwie auf die Wirklichkeit zurückspiegeln und wir lebten zusammen in einer Fiktion, von der niemand wüsste, dass WIR nur ICH heißt. Freilich wären auch wir dann Fiktionen, aber vielleicht glückliche.
THE NOT KNOWING ∙ TINDERSTICKS
Ich weiß nicht viel vom Schnee. Vielleicht wüsste ich mehr von ihm, wenn ich den Schnee so liebte wie Blackshaw beteuerte, ihn geliebt zu haben, auf eine Weise, die aus seiner Schneeliebe einen Schneezwang machte, ein existenzielles Spiel. Als ob der Schnee ein früherer Aggregatzustand meines Blutes gewesen wäre, Teil meines Innersten, als ob geschmolzener Schnee durch mein Blut pulsierte. Ein paar Seiten später notiert er, beinahe wie eine Antwort auf diesen Eintrag: Was kann ich tun, außer mich, ohne Liebe, in eine Liebe für diesen Schnee zu retten? Eine Liebe für eine Sache, um die mangelnde Liebe eines Menschen zu ertragen? Eine Sachliebe, eine Mangelliebe, als Kompensation, um nicht darüber zu verzweifeln, dass es eine andere Liebe nicht gibt? Wo könnte ich diese Kompensationsliebe, diese Liebeskompensation finden?
Bin ich eigentlich unglücklich darüber, dass ich das Meiste erst über Menschen weiß, nachdem sie aus meinem Leben gestrichen sind, und ich aus ihrem? Für wie viele Menschen würde es keinerlei Unterschied machen, wenn man tot wäre? Wie viele Menschen würden sich in ihrer anwesenden Leere in meinem Leben nicht von Verstorbenen unterscheiden?
Vielleicht wüsste ich mehr vom Schnee, wenn ich Schnee so verloren hätte wie dich. Vielleicht verspüre ich deshalb das Bedürfnis (den Zwang?), wenn ich vom Schnee schreiben will, auch von dir zu schreiben.
Vielleicht lag Plato falsch, vielleicht ist es nicht der Eros, nicht die Liebe – nicht nur die Liebe –, die eine Sache zur Verinnerlichung bringt, vielleicht ist es erst der Verlust der Liebe, durch den man schließlich meint, eine Sache durchdringen zu können. Wenn ich MANsage, meine ich ICH.
Was würde es bedeuten, wenn die Nähe zu einer Sache aus ihrer Entfernung entstünde? Wenn ich nach Osten will, muss ich nach Westen gehen? Wenn ich Klavier spielen will, brauche ich ein Cello? Würde das nicht bedeuten, dass jede tiefe, jede liebevolle, jede freundschaftliche Beschäftigung mit einer Sache oder einem Menschen immer auch die Beschäftigung mit ihrem genauen Gegenteil voraussetzt, und können Menschen so miteinander leben? Über die Bewohner von Los Angeles, die Angelenos, sagt man, sie hassten ihre Stadt. Beim Verfluchen einer Sache in ihrer Metropole verfluchen sie für gewöhnlich das genaue Gegenteil dieser Sache gleich noch mit. Hieße das fürs Schreiben, wenn ich schreiben will, muss ich dann erst nicht schreiben? Schreibe ich dann nicht schon längst?
Und wenn ich von dir schreiben wollte, was wäre dein Gegenteil? Ich? Oder genügt es, den Schnee als dein Gegenteil zu entwerfen, weil du keinen Schnee mehr erfahren wirst, weil du ihn nicht mehr mit mir erfahren wirst?
Oder ist alles das, alles hier, mein bisschen Schnee, dieses aberwitzige Schneeprojekt – ist das alles eigentlich nur eine Ablenkung, die eigentliche Ablenkung, nämlich die von dir, während ich mich schreibend eigentlich zu dir hinlenken sollte? Um dich zu konservieren? Oder dich zu exorzieren?
F. Scott Fitzgerald meinte, es sei das Kennzeichen eines erstklassigen Verstandes, zwei gegensätzliche Ideen zur selben Zeit im Kopf zu behalten und dabei noch immer einwandfrei als Kopf und als Verstand funktionieren zu können. Philip Roth meinte, zwei gänzlich unzusammenhängende Stoffe bildeten das unverzichtbare Zündmaterial für ein gutes Buch. Julian Barnes meinte: Man bringt zwei Dinge zusammen, die vorher nicht zusammengebracht wurden, und die Welt hat sich verändert.
Vielleicht aber liegt auch Gefahr in dieser Richtung. Werde ich am Ende ein Buch über den Schnee geschrieben haben, von dessen Rand aus du mir zuschaust, oder werde ich am Ende ein Buch über dich geschrieben haben, aus dessen Rand ein paar Flocken fallen? Wie ich dich kenne, wie ich mich kenne, wirst du alles überscheinen, wirst du alles überdecken, wirst du alles überschneien, vom Rand her das Zentrum überschütten, überschatten, bis alles gedunkelt oder geweißt ist vor Liebe, die jetzt auf einmal Trauer heißen soll. Und eigentlich habe ich am Ende davor am meisten Angst: Dass ich dich ausgeleert haben werde in ein Buch, Angst vor dem Ende von dir, vor dem Ende vor dir durch das Schreiben. Könntest du nicht am Rande bleiben, als Ende, das ich nie erreicht habe, könntest du nicht am Rande bleiben, und aus meinem Zentrum der Einsamkeit würde ich manchmal zu dir herüberblicken und herüberwinken, und du wärst noch da, weil du eben nicht ganz bei mir wärst, weil du nicht ganz in mich hineingefallen wärst, in mein Innerstes, wo ich letztendlich nichts anderes mit dir tun kann, als dich zu vergessen, zu verarbeiten?
Aber du bist längst nicht mehr am Rand, du bist längst in meinem Innern als Ende, bist das Innerste selbst, und mit jedem Schreiben, ganz gleich wovon, flockst du von meinem Innern an den Rand meiner Sprache. In jedem Wort sprichst du, jedes Wort, das ich spreche, spricht gedoppelt wie mit einem Echo von dir. Nein, ich suche keine Heilung, ich suche ein Abkommen mit dem Schmerz, suche selbst einen Weg an den Rand, einen Weg an die Lichtung, an der ich stehen und sagen könnte: Was kann ich tun, als mich in eine Liebe für dich zu retten? Auch wenn sich diese Liebe äußert in einer Liebe, in einem Buch, zum Schnee.
END & START AGAIN ∙ SYD MATTERS
Ich lese nicht viel, aber ich hänge fest in einem Gedicht von Ror Wolf über Spaziergänge am Rande des Meeres und ich lese die Worte pausenlos, versuche sie auswendig zu lernen, ohne zu wissen, warum. Glaube ich doch noch an eine Zukunft, in der ich dieses Gedicht einmal aufsagen werde, aber wem, in einem Moment, in dem ich dieses Gedicht einmal brauche, ich brauche es jetzt, und ich lese, und ich spreche, und ich höre:
Es schneit auf mich, es schneit auf meinen Hut,
und auf den Mantel schneit es, kurz und gut:
Das Meer beißt große Stücke ab vom Strand,
es frißt und frißt ein Stück von meiner Hand,
es schlingt und schlingt in diesen kalten Tagen,
die Schiffe sinken rasch in seinen Magen,
das Meer, es frißt am Ende das Hotel
in dem ich wohne, insgesamt und schnell.
Die Wälder knicken um und es verschwand
der runde Mond, der Mond, das ganze Land.
Hier sitze ich beim vierten Bier und halte
mir alle Ohren zu, und als es knallte,
da stand ich auf und ging und sagte: Leider:
Wenn es so weitergeht, geht es nicht weiter.
Immer noch gefühlt gejetlagged erwache ich vor Sonnenaufgang, mit einer verkaterten Tarantel als Zunge und diesen Worten im Mund, und ich gehe, mir diese Worte vorkauend, runter zum Strand neben dem Santa Monica Pier, das stillstehende Riesenrad in der leeren Entfernung, die geschlossenen Läden, wie ein Ferienort in der Nebensaison. Im Sand schlafen Heimatlose unter improvisierten Zelten oder waschen sich im Pazifikwasser wie die Flussbevölkerung des Ganges. Heimatlos in Südkalifornien heißt, nicht erfrieren zu müssen. Ist das ein Grund zur Erleichterung, ein Grund zur Hoffnung auf eine Zukunft?
Vielleicht wird es auch in Zukunft noch schneien, und die Dichterinnen und Dichter werden weiter davon schreiben, weil sie nicht anders zu leben wissen. Vielleicht werden die Wolken aber auch austrocknen und aufhören, ihre weiße Stille auf die Welt zu streuen. Und dann bleibt nur die Dichtung, um den Schnee, wie alles andere, im Zeilenspeicher der Literatur aufzubewahren, im Zeichenspeicher der Dichtung. Und ich werde, Leser, mich bemühen,/etwas Wahrheit in die Welt zu sprühen, heißt es in einem anderen Gedicht von Ror Wolf, einem Schneedichter, obwohl ich mittlerweile meine, es gibt gar niemand Dichtenden, dem der Schnee ganz egal sein könnte. Schnee ist schön zum Schreiben (KARL KROLOW). Dass ich nicht weiß, was ich mit dem Schnee anzufangen weiß, sollte mich nachdenklich stimmen.
Der Gedichtband, aus dem ich nicht herauskomme, trägt den Titel Die plötzlich hereinkriechende Kälte im Dezember, und sein Schnee ist Programm und Pest, prächtig und lästig, Stimmung und Gefährdung. In diesem einen Gedicht ist die Anfangsaussage Es schneit auf mich, es schneit auf meinen Hut einerseits eine kühle Feststellung, andererseits macht das wiederholte es schneit, es schneit aus dem Aussageanfang beinahe einen Ausruf, der vielleicht Grund zur Freude verrät, Freude vielleicht darüber, dass endlich etwas geschieht. Denn im Leben des Ichs, das da so plötzlich anfängt zu sprechen, wie es da anfängt zu schneien, in diesem Spaziergängerleben scheint eine Leere zu liegen, und diese Leere wächst, wie Nietzsches Wüste, drängt von den Rändern in sein (in mein?) Zentrum. Gekleidet für die Reise, befindet sich das Ich hier nur auf Zwischenstation. Vielleicht hält sich das Ich schon länger auf in diesem Hotel/in dem er wohnt. Allein, wohnen heißt nicht leben und Haus nicht Zuhause.
Wolfs Gedichttitel erzählt immerhin von wiederholten Spaziergängen, im Plural. In dieser Welt, in der er lebt, reimt sich noch etwas. Auch wenn sich das Meer ausbreitet und das Land abnimmt. Auch wenn selbst das Ich in Gefahr ist, denn das aufschwellende Meerwasser frißt und frißt ein Stück von meiner Hand; das Meer, es frißt am Ende das Hotel, die Zwischenstation geht unter und zu Ende, und der Reisende, der Reimende, muss schlussendlich weiter, auch wenn es leider vielleicht so nicht weitergeht.
Ich gehe lange am Meer entlang und wiederhole des Wolfes Worte. Ich gehe spazieren, als suchte auch ich einen Reim. Aber in dieser grellen Februarsonne, in dieser hellen Februarstadt, im Santa-Monica-Sand, reimt sich nichts auf mich. ICH ist ein schrecklich leeres Wort, kalt und kurz und kümmerlich, wie es da in der Luft hängt, wie die Hälfte einer aufgebrochenen Schale, aber wie sich nichts mehr aus ihm entleeren kann, weil es ein längst entleertes Gefäß ist.
Im Gefäß des Gedichts befindet sich zu wachsenden Teilen Wasser. Das Wasser des Meeres, das frisst und schlingt und alles in seinen Magen schluckt, aber auch das Wasser des Schnees, der das Gedicht anfangs in Bewegung versetzte, der Flockenfall der Weiße. Und Schnee ist schließlich auch nur Meer in einer anderen Zustandsform. Der Schnee des Anfangs ist die Vergangenheit und die Zukunft des Wassers, aus dem er durch Kälte hervorging und in das er durch Wärme wieder zurückfließen wird. Und auch das Meer wird vielleicht einmal wieder seinen Aggregatzustand ändern wollen und als Wasser in die Wolken hinaufschweben, um von dort erneut verwandelt weiß und weich die Welt zu überschneien.
Ich spaziere zwar am Meer, doch ich befinde mich in einer Wüste, einer Wüste, die unter einer Betonwüste versteckt liegt, einer wachsenden Wüste, wie die ganze Welt, die sich langsam selbst überwüstet. Zivilisation als Verhüllung auf Zeit. Die Wüste wird zum Zentrum, die Trockenheit holt die Welt in den Sand. Das Wasser wird zur notwendigen Fiktion, der Schnee zum Inhalt der Dichtung, zum Papier, auf dem jedes Wort von Verlorenheit spricht.
Der Verlorene auf seinen Spaziergängen am Rande des Meeres hat aber selbst nach Ende seines Hotels noch ein Hier, in dem er sitzen und trinken kann. Und auch nach dem Verlust eines Stücks von seiner Hand hat er selbst noch genügend Hände, um sich alle Ohren zuzuhalten. In der Literatur sind wir so leicht nicht aus der Welt zu schütteln. Im Leben dagegen braucht’s bloß ein Wort, eine Tür, ein Grab, und es ist aus. Vielleicht aber kommen wir, wenn wir aufgestanden sind und gegangen sind, irgendwann ja wieder, wie die Wellen des Meeres oder wie der geschmolzene Schnee.
Allerdings: Wenn es so weitergeht, geht es nicht weiter. Oder doch? Denn wenn das Gedicht aus ist, ist es alles andere als ausgemacht, dass es eben nicht doch irgendwo und irgendwie weitergehen könnte. Denn das Ende ist durch das Wort wenn an eine Bedingung geknüpft. Und das Wort es? Wenn es so weitergeht. Was ist es, was da so weitergehen könnte? Was ist es, was dazu führt, dass der Mond und das ganze Land verschwunden sind? Augenscheinlich ist es das Fließen des Meeres, wie es schlingt und schlingt. Vielleicht ist es aber auch das Schneien des Schnees. Wie alle meteorologischen Verben ist auch das Wörtchen schneit niemals allein, sondern stets von einem es begleitet. Witterungsimpersonalie. Es schneit.
Und durch dieses es schneit und es frißt und es schlingt kommen Unpersönlichkeit und Leere ins Gedicht und ins Leben des Ichs. Es icht?Weil aber der Schnee und das Meer zwei Zustände desselben Materials sind, bleibt die Frage offen, ob auch die Abwesenheit, das Fortsein eines Menschen, der aufgestanden und gegangen ist, vielleicht doch auch nur ein anderer Zustand dieses Menschseins sein kann. Wenn es so weitergeht, vielleicht taucht dieser Mensch auch einmal wieder im Zustand seiner Anwesenheit auf. Denn hier am Meer, mit mir, warst auch du einmal. Ich gehe die Ränder unserer geliehenen Orte nach, uns suchend und nicht ahnend, dass ich dich mit jedem Schritt aus meiner Erinnerung zurück in diesen Ort trete, dass ich mit jedem neuen Schritt eine neue Erinnerung mache, mit jeder Spur, die ich durch unsere alten Orte trete, eine Linie ziehe, einen neuen Schnitt führe, der dich langsam von mir trennt. Es hat längst begonnen, das große Hierlassen. Könntest du mich bloß hören und sagen: Ach, lass, red keinen Unsinn. Das Meer leckt leise ans Ufer, eine Zunge über die Lippen des Mundes nach dem Fressen.
DEMON DAYS ∙ ROBERT FORSTER
An manchen meiner kalifornischen Tage der Gedanke: Ein Geschenk, hier sein zu dürfen, ein Geschenk, das ich glaube, mir verdienen zu müssen, womit? Etwas Arbeit am Schnee. Für jeden Tag habe ich einen festen Termin im Special Collections Reading Room auf dem Gettyberg reserviert, doch die letzten Wochen war ich kein einziges Mal dort.
Rechtfertigungswurmloch: Du kannst dir ruhig auch einmal ein, zwei Wochen Freizeit (Freiheit?) gönnen – nach allem, was du durchgemacht hast.Und weil der arme Kerl in seinem Leben eine ganze Menge durchgemacht hat (kein Grund für Schmerzensegoismus, jedem anderen geht das nicht anders), gab es in meinem Leben lange Zeiten, immer schon, in denen gar nichts passierte, Zeiten von Nichtstun und Drift. Dangling Man. Jetzt, hier, außerdem der Gedanke: Ich bin ja nur einmal hier, ich muss meine Zeit gut nutzen. Kein ganz aufrichtiger Gedanke. Denn ich werde noch lange hier sein, auch wenn ich schon lange wieder weg bin. Außerdem nutze ich meine Zeit nicht, ich verschwende sie. Ich habe noch nicht viel Kalifornisches hier erlebt, gehe, wie alle anderen auch, head down durch die Straße, ohne zu lächeln, ohne zu beobachten, sitze mit Kopfhörern im Bus, ohne den Gesprächen der anderen Augenlosen, der Angelenos, zu lauschen. Ich erfahre die Stadt gerade so, als wäre ich immer hier gewesen und würde es immer sein. Ich schaue nicht genug mit dem gehenden Blick, um die Stadt klar genug erkennen zu können. Vielleicht weil ich eigentlich nicht hier sein will. Wo ich stattdessen sein will? Immer zu Hause, was nichts anderes heißt als bei dir.
Zu Hause hörten die Leute Los Angeles, und die Augen lächelten. Niemand wusste, dass dieser Aufenthalt für mich weniger eine Reise sein würde und mehr eine Verbannung, ein Pazifik-Exil an meinem eigenen Schwarzen Meer.
Meine sechste Woche Kalifornien, außerdem: sexlos. Es ist immer noch erstaunlich heiß, die Luft trocken, als wäre Winter, der Santa Ana-Wind aber weht warm und gewaltig, bläst Sand und Blätter und klapperndes Totholz der Palmen durch die Boulevards, trägt unvermittelt einen schwachen Duft von Orangenblüten zu mir, einen Duft, der mir nichts über Februar sagt und mich an gar nichts erinnert. Irgendwann wird mich dieser Duft nach Südkalifornien zurückreißen, wenn ich längst aus dieser Zeit hier herausgefallen bin, falls ich es überhaupt zurück nach Hause schaffe, falls ich dieses Jahr hier überhaupt überlebe, falls ich mich selbst überlebe.
Ohne etwas zu arbeiten, arbeite ich hier täglich hart an den Erinnerungen an etwas zukünftig Verlorenes, und so scheint es, als erinnerte ich mich schon heute an einen erst noch kommenden Verlust.
Im letzten Monat zum letzten Mal im Archiv gewesen. Voller Hoffnung. Wie ein idealistisches Kind zum Schulanfang. Vor dem Bruch. Eine Woche lang habe ich es täglich ausgehalten. Zum Bus um halb neun. Richtung Osten, durch die ausufernden Häuserkluften von Hollywood, die weiten, flachen Studio-Gebäude, in denen die Fiktionen gemacht werden, vor denen morgens Obdachlose neben Müllsäcken, vor Dosen berstend, auf den Gehwegen schlafen, wo der HOLLYWOOD-Schriftzug wie ein Mondenschatten mitfährt. Im Bus neben Leuten, die für nur eine Haltestelle einsteigen, um kurz mit sich selbst zu reden, und immer wieder ausgestiegen sind, bevor man Bel Air erreicht, wo die vielen hispanischen Frauen – immer Frauen – als Haushaltshilfen und Kindermädchen stoisch in den pelzig begrünten Villen verschwinden, nachdem sie unbekümmert vor mir miteinander redeten, lachten oder Telenovelas auf ihren Smartphones schauten. Die Unsichtbaren, über die kaum Filme gedreht und Bücher geschrieben werden – die in Gegenden in LA County leben, deren Namen man in den Nachrichten und im Polizeifunk hört, East LA, Norwalk, Downey, South of Pico – Menschen, die autolos und ungesehen stundenlang in verstopften Straßen, in vollgestopften Bussen sitzen zur Arbeit als Busboy, Menschen, die resolut und unzerstörbar wirken und abtauchen, wenn man sie sehen will, die Restaurants in Beverly Hills und Dinnerpartys in Brentwood am Laufen halten, unbemerkt, die untertauchen, wenn es Probleme gibt mit Sozialversicherungspapieren, Arbeitserlaubnissen oder Aufenthaltsgenehmigungen. Menschen, die in dieser Stadt, ihrem Zuhause, Fremde sind, wie ich, Menschen, zu denen ich mich hingezogen fühle, selbst wenn sie mich niemals als jemanden betrachten würden, der versteht, wie sie durch diese gigantische Stadt hindurchleben.
Seit einiger Zeit versuche ich, mit ihnen Blickkontakt aufzunehmen. Ich bin ihnen näher als den Professorinnen mit den Seidenschals, die einen dicken Autoschlüssel an ihrem Bund auf dem Tisch neben den Archivpapieren liegen haben. Ich bin ihnen näher als den stocksteifen Akademikern mit den canvas shoes, die sich im eisgekühlten Reading Room den Rotz die Nase hochziehen, an der sie auf mich herabblicken, weil ich kein Getty-Fellow bin und nur external funding habe. I’m sorry. Aber auch die Blicke der Latinas im Bus durchgleiten mich, als wäre ich Glas. Oder Eis. Ich bin für sie so unsichtbar, wie sie es für die weißen Angelenos sind.
Obwohl ich mit dem Bus fahren muss und auch wenn meine Zunge, wie die ihre, nicht von dieser Sprache geformt wurde, bin ich keiner von ihnen. Meine Hautfarbe verrät mich – ein gringo. In einer Stadt, in der sich Busfahren auf Armut reimt, ist ein Weißer mit Ray Bans und Toms im Bus vielleicht einfach ein Verirrter, oder einfacher: ein Irrer, neben dem man einen Platz freilässt, für den Fall, dass er anfangen will, mit sich selbst zu reden.
Ich frage mich, wie ich meine kalifornische Zeit sinnvoll nutzen könnte, ohne sie zu verschwenden, ohne mich zu verschwenden und ohne Schnee und sinnvoll im Sinne von: ohne mich umzubringen.
Dabei bin ich längst weg, fort, auf einer erzwungenen Flucht, in einer notwendigen Ferne, und wenn es schmerzt, schmerzt es vielleicht irgendwann literarisch (Hoffnung, Klischee). Vielleicht finde ich zurück in die Spur, vielleicht aber auch nicht, und vielleicht ist das irgendwann auch egal. Ich bräuchte ohnehin neue Wege. Allerdings ginge ich sie nicht, denn sie wären Wege weg von dir.
LOVE IS HARD ENOUGH WITHOUT THE WINTER ∙ LUKE SITAL-SINGH
Auf Englisch ziehen sich die drei Buchstaben meines Ichs zu einem Strich zusammen. Die drei Buchstaben meines Namens lassen sich von vielen amerikanischen Zungen nur unter Behinderungen sprechen, als müsste man meinem Namen mehr Buchstaben geben, um ihn zu einem amerikanischen Namen aufzufüttern: Jahn. Dschenn. Yawn.
Ich spreche die andere Sprache fließend, aber flüssig fühle ich mich darin nicht, erstarre oft, wenn man mir schnell eine Frage stellt. Manchmal sage ich Dinge, die ich nicht sagen wollte, als kämen sie aus dem Mund eines andern. Früher schon habe ich festgestellt, dass ich in einer anderen Sprache über einen anderen spreche, wenn ich über mich sprechen will. Der Mund sagt nicht, wen das Ohr hört. Manchmal gefiel mir das, gefiel mir dieser andere besser und ich hatte den naiven Glauben, in einer anderen Sprache ein anderer sein zu können, obwohl ich schon in meiner eigenen Sprache nicht ich war, allerdings mit dem Unterschied, dass der andere, der ich im Deutschen war, nie etwas Reizvolles hatte, und selbst heute besitzt er nichts als stumpfe Fremde, Selbstdistanz, die bisweilen verzweifeln macht, während der andere, der man in einer anderen Sprache zu sein glaubt, bis heute betörend und aufregend wirkt.
Ein betörender und verstörender Teil meines Klammerns an dich ist auch nicht einfach bloße Liebe, sondern die Unmöglichkeit von ICHund DU. Allein, vielleicht ist selbst das auch bloß ein Teil von Liebe. Kein Wunder: Seit du weg bist, will ich dich noch mehr, als ich dich damals wollte, als ich dich hatte. Doch seit du weg bist, meine ich manchmal, ich müsse nun zwei von dir wollen, als wärest du durch dein Verschwinden nicht weniger geworden, sondern hättest dich stattdessen verdoppelt, so wie ich mich verdoppelt fühle in meinen Sprachen, mit dem Unterschied, dass ich mich dadurch seltsamerweise wie zerteilt fühle. Jedes Sprechen-von-dir ist auch schon ein Sprechen-von-ihr, ich habe gegen euch keine Chance, ihr seid mir schon zahlenmäßig überlegen.
Zwischen Frühstück und Lunch, zwischen Kaffee und Happy Hour, versuche ich jetzt manchmal, ein wenig über mich zu schreiben, doch auch in der anderen Sprache kommt es mir nun so vor, als verwendete ich bloß neue Worte in derselben Sprache für die alte Sache, als könnte ich immer nur auf Pauspapier über mich schreiben, niemals auf undurchsichtigem, jungfräulichem Weiß, niemals auf Neuschnee gehen, immer nur in alten, überholten Tritten. Über die Rückübersetzung spielt mein Leben von gestern, mein Leben mit dir, sich über Bande in mein heutiges Leben zurück und macht es verlorener, so als wäre auch alles hier und alles heute schon gestern und fort, und so kommt es mir nun vor, dass ich unvermittelt schon etwas weiter weg bin von dir, von dem, was mir zu verlieren befohlen wurde, und die Welt hat sich verändert, zumindest für einen Moment.
OLD MAN ∙ NEIL YOUNG
Ich lese einige Passagen, die ich aus Blackshaws Pestjahrbuch exzerpierte, vom Anfang seines Manuskripts, kurz nachdem er einen kurzlebigen Job bei der Los Angeles Times gekündigt hat, aus Kalifornien abgehauen ist – von der alten Greyhound Bus Station auf dem Broadway in Downtown aus, mit meiner Rolleiflex und einer Tasche voller Filme, meiner Reiseschreibmaschine, einem Seesack Winterbekleidung und einem 40 cent cream cheese and jelly sandwich – und sich drei Tage später in seiner federweißen Ödnis angesiedelt hat. Die Stille stört mich nicht, hat sie nie, schreibt er. In Wahrheit hört nur sie mich wirklich an in meiner stimmlosen Hütte. Was ich immer hasste, sind Geräusche, die mich von mir selbst distanzieren – jedes Geräusch, das nicht von mir gemacht wird oder von mir ausgeht, ist ein Störgeräusch, das von Fremde erzählt, von einem anderen spricht. Fotografien sind das härteste Gegenteil von Geräuschen – Stadtfotografie ist lächerlich, wenn sie tun muss, als könnte sie Töne abbilden. Zeig mir die weiten Boulevards von Southern California, und ich zeige dir ihren weißen Schnee in der Wüstenwelt ihres blendenden Asphalts. Zeig mir eine Stadt, und ich zeige dir Stille.
Weil ich das hermeneutische Tier bin, interpretiere ich mich beim Lesen wieder unvermittelt in diese Zeilen hinein, wenn Blackshaw auf der nächsten Seite weiter über seine Flucht aus LA schreibt: Der Fehlschlag, der mein Leben heißt, folgt einem kümmerlichen Muster, das ich heute verstanden habe, als ich ein Reh dabei beobachtete, wie es allein war: Heute bin ich unglücklich. Morgen wird ein Tag kommen, der mich noch unglücklicher macht, und ich werde lernen, dass ich eigentlich gestern glücklich war. So ist also jeder glückliche Tag meines Lebens mein Unglück. Nur die Ursache für seine Flucht, dieses Unglück von gestern, bleibt in seinen Papieren gänzlich im Ungewissen.
Vielleicht habe ich das Archiv – das Manuskript – in den letzten Wochen wirklich nur gemieden, weil meine Arbeit darin, wenn man es Arbeit nennen kann, wahrhaftig wie ein Lesen im Spiegel schien. Beckett legte Kafkas Schloß nach der Hälfte der Lektüre erschrocken beiseite. Kein Grund zur Scham: Kafka konnte das Buch selbst nicht zu Ende bringen. Beckett meinte, in dem Roman zu sehr zu Hause zu sein, zu sehr seine eigenen Spuren zu sehen, von einem anderen längst vorgetreten. Wozu also selbst noch schreiben? Es würde genügen, sich überall hineinzulesen. Doch diese Gedanken, diese Vergleiche gereichen mir zu nichts. Ich bin kein Autor, kein Blackshaw, kein Beckett und ganz bestimmt kein Kafka. Ich bin ein sprachloser Verlorener, wie jeder andere auch. Einsamkeit ist kein Alleinstellungsmerkmal, nicht mal für ein Reh.
Rechtfertigungswurmloch: Ich darf mich nicht mit meinem Forschungsobjekt beschäftigen, da ich mich zu sehr mit ihm identifiziere, deshalb ist es besser, sich den Bauch mit grilled cheese und Palo Alto Pale Ale aufzublähen. Die Wahrheit ist: Ich gehe nicht ins Archiv, weil ich Angst habe, Blackshaw könne meine Spuren vorgetreten haben, sondern weil ich ein Faulenzer bin. Eigentlich ist nicht mal das die Wahrheit. Nein, eigentlich ist die Wahrheit, dass ich nicht weiß, was du mit Schnee zu tun haben sollst und wie ich weitermachen soll – wie ich anfangen soll –, wie ich aus den zwei Dingen, die ich im Moment in meinem Leben habe – die ich im Moment nicht in meinem Leben habe –, etwas zusammenbringen soll, was mir die Welt verändern könnte. Vielleicht können nur Neurotiker Bücher schreiben, weil viel zu viel gleichzeitig in der Luft gehalten und vereint werden muss. Ich bin wahrscheinlich nicht mal ein Neurotiker. Oder: Ich habe einfach keinen erstklassigen Verstand.
WORDS YOU USED TO SAY ∙ DEAN & BRITTA
Je länger ich über dich und den Schnee nachdenke, desto mehr die Frage, was ich eigentlich mit Sprache will. Die Wahrheit hinter dieser Frage ist nüchterner: Ich habe eigentlich keine Lust mehr auf Sprache, schon gar nicht auf meine Sprache, mit der ich ohnehin nicht alleine bin. Schreibe ich deshalb hier kein Wort auf Deutsch?
Ein Beschreibungsversuch: Eine Sprache könnte nur meine Sprache sein, wenn ich in ihr alles genau so ausdrücken könnte, wie ich es wollte, wenn alles, was ich ausdrücken wollte, somit ganz allein mir gehörte. So bräuchte ich eine Sprache, die nur ich spräche, ich allein. Allein, dies wäre die vollendete Einsamkeit. Aber ist das nicht ohnehin schon der Fall, nicht weil die Sprache alles ist, was der Fall ist, sondern weil jede Sprache in eine Stille ohne Hall fällt, weil jede Sprache ohne einander gesprochen wird, weil jeder eine andere Sprache spricht? Meine Sprache gehört den anderen, und die anderen bist du.
Und dennoch: Wenn ich doch schreiben könnte, könnte ich nur von dir schreiben: Wenn ich/dennoch/etwas schrieb, /Worte/sprach,/die taugen,–/wars/einem Sternenpaar/zulieb,/wars/dank/zwei lieben Augen (WLADIMIR MAJAKOWSKI). Die einzige Wahrheit ist, dass ich, glaube ich, Angst habe, dich überhaupt in Sprache aufzuschaufeln, denn weil mir die Sprache nicht gehört, wie könnte ich da wiedergeben, was mir in ihr geliehen bleiben muss (du)? Wie könnte ich dich nicht verlieren, wenn ich nicht mehr in Sprache dabei sein könnte, wenn du in den Spiegel schautest, in deine beiden lieben Augen?
Ich versuche, nicht an dich zu denken, nicht weil mich der Gedanke so schmerzt, sondern weil ich fürchte, dich mit meinen Gedanken nicht greifen zu können und stattdessen zu glauben, ich hätte dich selbst in meinen Gedanken nicht für mich. Meine Sprache ist zu langsam für dich, wenn ich sage JETZT, dann ist jetzt schon vorbei. Ich versuche, nicht an dich zu denken, weil ich den Gedanken so schmerzlich fürchte, ich könne dich nicht nur in, sondern durch meine Gedanken verlieren. Von dir zu schreiben heißt, dich zu zerstören. Übersetzen, Sprechen, Schreiben. Techniken einer kulturell geforderten Form von Gewalt, Techniken einer vom Verlust überforderten Kultur.
Als wäre Sprechen und Denken eine Feile und eine Flamme und Denken an dich ein Abschleifen und Sprechen von dir ein Abschmelzen. Wenn das Kind den Schnee berührt, lernt es, den Schnee durch seinen Körper zu verlieren. Ist das, was das Kind berührt, dann überhaupt Schnee? Berührt aber das Kind niemals den Schnee, wie kann es Schnee für das Kind dann jemals geben? Vielleicht ist Verlieren die einzig echte Erfahrung unserer fabelhaft fehlerhaften Spezies, da sich die Welt als Verlust durch uns hindurch filtert, als Erfahrung, die in uns eingeht, durch uns hindurch geht und eine Restspur im Gewebe unseres Geistes zurücklässt.
Und trotz allem: Ich werde mich noch ein wenig weigern, noch nicht gleich klein beigeben und tun, was alle tun, und aus dir ein Produkt machen, ein Produkt eines verarbeitenden Geistes. Vorerst bleibst du geheim, verhüllt, am Rande meiner Sprache, wie die Toten.
Selbst die Fiktion scheint mir nun noch zu wirklich für dich, weil jedes Hinüberformen, jedes Übersetzen, von einem Wirklichkeitsufer ausläuft, und an diesem Ufer, an diesem Rand des Meeres, stehst du noch, und etwas aus dir formen wäre ein Von-dir-Entfernen. Weil ich meine Sprache so lange mit deiner teilte, spreche ich heute vielleicht nur noch deine Sprache aus der Zeit, als du durch mich hindurchgewaschen bist. So würde es eigentlich nicht einmal genügen, nicht von dir zu schreiben oder nicht von dir zu sprechen, nein ich dürfte eigentlich überhaupt nicht mehr sprechen, ich müsste schweigen, um dich bei mir zu behalten. Doch ich kann nicht von dir schweigen aus Angst, ich könnte dich vergessen, kann nicht aufhören, dich und deine Sprache in meine Gedanken und in meinen Mund zu nehmen aus Angst, wenn ich es nicht täte, nähme ich dich aus meinem Herzen, wie einen Reim, den man verliert, wenn man ihn endlos wiederholt, der jedoch banaler und banaler wird, je öfter man ihn sagt.
Bevor mein Geist sich entscheiden mag, genug von dir zu haben, entscheide ich: Ich werde dich nicht in deiner Sprache beschreiben und dich nicht in eine Gegenwelt hinüberformen. Und wenn ich es doch tue, werde ich es in einer anderen Sprache tun, in einer viel dunkleren Sprache, einer Sprache, die wie die schwerste Asche ist, dunkelstes Pech, das auf einem weißen Schnee liegt, und meine vorsichtigen Schritte wären wie Buchstaben, aber ich würde mit ihnen nichts in den Schnee einschreiben, sondern mit jedem Schritt nur das Pech abtragen, das auf dir abgelagert wäre. Ist es nicht tröstlich, dass manches unter der Einzäunung der Bedeutung hindurchzuschlüpfen weiß und so den Zeichen entkommt?
LAST YEAR’S MAN ∙ LEONARD COHEN
Schreiben über Schnee, über Schnee-und-dich als Versuch, den Geist auszutricksen, der nur in Sprache funktioniert und aus dir etwas machen will, als Versuch, den Geist mit einer Ablenkung auszutrinken, zu erschöpfen, damit er zu müde wird für Worte über dich? Warum aber schreiben, wenn man sich davor fürchtet, was die Sprache mit einem anstellt?
Ich traue der Sprache nicht, meint Herta Müller in ihrer Rede vom Schnee (eine Rede vom Schnee-und-vielem). Immer derselbe Schnee und immer derselbe Onkel. Über die Sprache sagt sie: Am besten weiß ich von mir selbst, dass sie sich, um genau zu werden, immer etwas nehmen muss, was ihr nicht gehört. In den Grimm-Gründen deiner Sprache ist schon einmal die rede vom schnee, und mit dieser Rede vom Schnee wird eine Redeweise der Sprachverwendung bezeichnet, die eine überflüssige, unnütze (MARTINLUTHER) Weise beschreiben soll, wenn die Rede ist vom alten Schnee des Vorjahrs: was kümmern uns die wolken, der schnee vom vorigen jahre? Mit diesen Worten wird Joseph Eiselein zitiert. Schreibt er vom Schnee, weil er das Eis im Namen trägt? Wie fühlte es sich für Robert Frost an, wie Nietzsche schreibend durch Frost und Eis zu gehen, wie war es für den Schnee-Baron C.P. Snow, das Wort Schnee auf der Zunge zu halten und es durch die Feder fließen zu lassen? Was wissen die Namen, was der Geist nicht weiß?
Mein Name ist bedeutungslos, fraglich. Google ich mich, sehe ich immer wieder, meine alte Universitäts-URL endet mit einem Fragezeichen (-universitaet.de/fb04/personen/profil_janwilm?). Dieser bedeutungsleere Name ist eine passende Schablone für das bedeutungsleere Leben, auf das er verweist. Verwaist. Unter diesem Namen könnte ich überflüssige, unnütze Reden schreiben, Reden vom Schnee. Allein, jede Rede ist eine Rede vom Schnee, der vorm jahr fiel (LUTHER), denn alle Formen von Sprache, geschrieben, gesagt, gesungen, sind veraltet, alle Sprache bezeichnet ausschließlich Vergangenes, und alle Sprache ist überflüssig, auch die Sprache von morgen, ein Fleck auf dem Schweigen (BECKETT).
Und ohnehin: Was interessiert mich ein angefetteter, antisemitischer Reformator, wenn ich dafür eine Sprachzauberin haben kann, die sich Nationalgrenzen genauso bewusst ist wie Sprachgrenzen und die gegenüber Nationalstaaten genauso skeptisch ist wie gegenüber der Sprache selbst und die doch weiterschreibt, wie Beckett, auch und gerade über den Schnee vom vorigen Jahr, den Schnee von gestern: