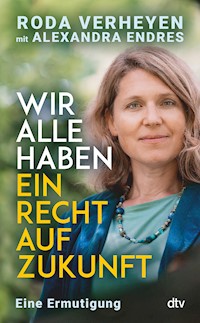
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Klimaschutz ist Menschenrecht Dürre, Eisschmelze, Überflutungen zerstören den Lebensraum und die Existenzgrundlage vieler Menschen. Doch Regierungen oder Konzerne zeigen sich oft träge bis ignorant, wenn sie Maßnahmen zum Klimaschutz ergreifen sollen. Was kann da der Einzelne, das Klimaopfer, tun? Die Rechtsanwältin Roda Verheyen sagt entschlossen: das bestehende Recht und die Gerichte nutzen. Wir alle sind bedroht und können mit Klimaklagen Verantwortliche zur Rechenschaft ziehen. Anhand eigener Erfahrungen und wichtiger internationaler Prozessfälle zeigt sie, dass die Judikative – in Sachen Klimaschutz eine oft unterschätzte Gewalt – Machtlosen Recht verschaffen kann. Schließlich geht es um das Recht des Menschen auf ein Leben in Würde, jetzt und in Zukunft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Roda Verheyen
Wir alle haben ein Recht auf Zukunft
Eine Ermutigung
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Wir widmen dieses Buch unseren Kindern, Patenkindern, Nichten und Neffen – und allen Kindern und Jugendlichen dieser Welt. Wir widmen es vor allem jenen Menschen, die in Weltregionen leben, in denen die Klimakrise jetzt schon Leben und Existenzen bedroht, und all denjenigen, die es wagen, vor Gericht für das Klima zu streiten. Ihnen allen gehört die Zukunft. Möge es eine fröhliche sein.
Roda Verheyen und Alexandra Endres, November 2022
AUFTAKT WARUM ICH FÜR DAS KLIMA VOR GERICHT ZIEHE
Ich wünschte, ich müsste dieses Buch nicht schreiben. Seit Jahrzehnten warnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Umweltverbände und die UNO vor der Klimakrise – aber tatsächlich geschehen ist einfach viel zu wenig. So wenig, dass wir jetzt in einer Krise stecken, die wir vielleicht nicht mehr bewältigen können. Dabei wurde der Treibhauseffekt schon vor nahezu zweihundert Jahren beschrieben,[1] und es wurde spätestens seit den 1960er-Jahren vor seinen Auswirkungen gewarnt. Viele Menschen haben seither aufgezeigt, was zu tun ist, um den Klimawandel zu stoppen. Die Lösung ist denkbar simpel: Öl, Kohle und Gas müssen in der Erde bleiben, und die natürlichen Treibhausgassenken, nämlich Wälder, Böden und Meere, müssen geschützt werden.
Ich wünschte, die Regierungen der Welt hätten genauer hingehört – und angemessen gehandelt, anstatt sich vom Primat des Bestandsschutzes und den sich auf ihn berufenden Partikularinteressen leiten zu lassen. Das Versprechen, das Regierungen vor dreißig Jahren auf dem Erdgipfel von Rio mit der Verabschiedung der Klimarahmenkonvention gemacht haben,[2] nämlich gefährlichen Klimawandel von der Menschheit fernzuhalten, haben sie gebrochen. Auf Kosten der Natur, des Planeten und der auf ihm lebenden Menschen. Inzwischen haben wir nur noch ein kleines Zeitfenster zum Handeln – und dabei kann und muss auch die dritte staatliche Gewalt, müssen die Gerichte, helfen. Davon handelt dieses Buch.
Die Menschheit überhitzt den Planeten und gefährdet dadurch ihr eigenes Überleben. Der UN-Klimarat IPCC stellt, aktuell im sechsten Sachstandsbericht, den Wissensstand in all seiner Dramatik dar[3] – nicht anders als in all seinen anderen Berichten seit 1990. Neu ist jetzt aber die Sprache. Schnörkellos bringt sie auf den Punkt, was Sache ist: Die Wissenschaft hat keinen Zweifel mehr, dass es unser eigenes Verhalten ist, das uns selbst bedroht: Tödliche Hitzewellen, Sturzfluten und Waldbrände führen uns vor Augen, dass die Klimakrise längst stattfindet, und das nicht nur im globalen Süden.[4] Durch die Folgen des Klimawandels sterben nachweislich inzwischen auch in Deutschland Menschen. Und immer noch reagiert die Politik viel zu langsam, steigen die klimaschädlichen Emissionen weltweit nur ein wenig abgebremst an. Durch den illegalen Angriff Russlands auf die Ukraine ist es zuletzt für politische Entscheidungsträger offenbar noch schwieriger geworden, das Klima zu schützen. Die Sorge um eine sichere Energieversorgung scheint vielen derzeit wichtiger zu sein. Angesichts der tiefen Energiekrise ist das kurzfristig vielleicht nachvollziehbar – auf lange Sicht aber ist es fatal.
Die größten Schäden erleiden dabei jene Menschen, die selbst kaum etwas zur Erderwärmung beigetragen haben. Nicht nur ich empfinde das als eine große Ungerechtigkeit. Ich bin der Ansicht, dass die Verursacher Verantwortung für die Folgen ihres Handelns tragen müssen. Dazu zähle ich Regierungen genauso wie große Unternehmen, die die Macht haben, wirtschaftliche Abläufe, Produktion und Konsum zu beeinflussen und damit die Emissionen bedeutend zu senken. Um sie dazu zu bringen, vertrete ich in Deutschland vor Gericht Menschen, die heute schon unter dem Klimawandel leiden. Und trage ein bisschen dazu bei, dass das auch in anderen Ländern der Welt geschieht.
Gerichte haben die Aufgabe, Recht durchzusetzen, es aufrechtzuerhalten und denjenigen zu ihrem Recht zu verhelfen, deren Rechtspositionen zwar existieren, aber augenscheinlich schwach sind. Mit anderen Worten: Sie haben Menschenrechte zu schützen – und damit letztlich den Planeten als Ganzes. Diese Aufgabe müssen Gerichte jetzt übernehmen, ganz einfach, weil es in zehn Jahren schon zu spät dazu sein wird. Und sie können das auch, davon bin ich überzeugt, schließlich bin ich Anwältin und seit Kurzem auch ehrenamtliche Richterin. Als solche glaube ich fest daran, dass sich die Welt mithilfe des Rechts ein Stück besser machen lässt. Klimafreundlicher. Gerechter. So wie die Dinge derzeit laufen, kann es nicht weitergehen. Die Welt gerät aus den Fugen – und es ist nicht zuletzt auch die Aufgabe der Gerichte, im Rahmen ihrer Möglichkeiten einzugreifen und uns vor unserem kurzsichtigen Tun zu schützen. Ich glaube an die positive, regulierende Kraft des Rechts, und ich will davon erzählen, wie ich – und andere – es im Kampf für mehr Klimaschutz einsetzen, wie mühsam das manchmal sein kann und wie es dennoch gelingt. Denn immerhin: Klimaschutz ist Menschenrecht, das steht inzwischen fest. Ich will zeigen, welche gesellschaftlichen Prozesse Klimaklagen auslösen können, welch zentrale Rolle die Wissenschaft spielt, welche rechtlichen Hürden zu überwinden sind – und warum ich unterm Strich trotz allem noch voller Hoffnung bin.
Ja, es ist ein persönliches Buch. Denn ich schreibe hier gemeinsam mit Alexandra Endres auf, woran ich seit über 20 Jahren glaube und arbeite. Doch im Grunde geht es gar nicht so sehr um mich. Als Rechtsanwältin bin ich Teil der Rechtspflege. Das heißt: Nicht ich stehe im Mittelpunkt, sondern meine Rolle und die damit verbundenen Aufgaben innerhalb des Rechtssystems. Ich lebe in einer privilegierten Situation, ich habe eine gute Ausbildung, einen guten Job, bin materiell abgesichert und selbst (noch) nicht akut durch die Folgen des Klimawandels gefährdet. Meine Mandantinnen und Mandanten und die meiner Kollegenschaft in der ganzen Welt haben dieses Glück oftmals nicht. Ihre Mittel sind begrenzt, und die Auswirkungen des Klimawandels bedrohen sie unmittelbar in ihrer Existenz.
Das Großartige am Rechtsweg ist doch: Gerichte müssen handeln, sobald sie angerufen werden. Untätig zu bleiben, ist ihnen nicht gestattet. Im Rahmen der geltenden – und hoffentlich funktionierenden – Rechtsordnung stehen sie jedem offen, sie arbeiten diskriminierungsfrei, also ohne Ansehen der Person, die vor ihnen steht, und sie müssen jeden Fall objektiv bewerten.[5] So verhelfen Klimaklagen gerade den Machtlosen zu ihrem Recht.
Was einmal höchstrichterlich erstritten ist, steht für lange Zeit fest. Die Politik, die gesetzgebende und vollziehende Gewalt müssen sich an die Entscheidungen der Gerichte halten. So zum Beispiel in Deutschland, wo die Regierung sich nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts im Frühjahr 2021 gezwungen sah, ihr Klimaschutzgesetz zu schärfen. Und das innerhalb von wenigen Tagen. Dieses bahnbrechende Urteil des Bundesverfassungsgerichts gehört niemandem, aber ist für alle da. Es ist ein Meilenstein, was Klimaprozesse in Deutschland angeht, und zugleich ein Wegbereiter hin zu einer lebenswerteren Welt. Daran oft und nachhaltig zu erinnern, forderte mich kürzlich ein hoher Bundesbeamter auf, denn »die Politik vergisst das gern« – darf sie aber nicht, denn sie ist an das Recht gebunden. Ähnliche Urteile gab es in den Niederlanden, in Frankreich, Irland, Belgien, Tschechien, Pakistan, Nigeria und vielen anderen Ländern. Die Zahl der Klimaklagen steigt weltweit – und das aus gutem Grund.
Menschen berufen sich in Klimaklagen auf ihre Grundrechte; sie fordern, dass geltende Klimaschutzgesetze in praktisches Handeln umgesetzt werden; sie verlangen Ausgleich für erlittene Schäden oder bestehen auf eine transparente Auskunft über Klimarisiken. Die meisten Klagen richteten sich gegen Staaten. Doch Klimaklagen können auch dazu dienen, Wirtschaftsunternehmen für die Folgen ihrer Geschäfte in die Verantwortung zu nehmen.
Manchmal verlieren wir solche Prozesse, doch immer öfter gewinnen wir. Und selbst wo das nicht gelingt, bringen die Verfahren Fortschritte. Sie erhöhen den Druck für mehr Klimaschutz, sie machen die Opfer der Klimakrise sichtbar und die Verantwortlichen öffentlich bekannt. Nicht selten kann man aus verlorenen Fällen auch Hinweise darauf gewinnen, wie man das Recht in Zukunft noch besser einsetzen kann. In gewisser Weise formt man das Recht, indem man Niederlagen annimmt und die gewonnenen Erkenntnisse als eine Art Trampolin für das Überspringen der nächsten Hürde nutzt.
So wirken Klimaklagen wie ein Hebel, der Veränderungen bewirkt: für Einzelne, zum Wohle des ganzen Planeten – und aller Menschen, die auf ihm leben oder künftig noch leben werden. Denn wir alle haben ein Recht auf eine menschenwürdige Zukunft. Ein Recht, das sich auch mithilfe der Gerichte durchsetzen lässt, ebenso wie durch die politische Auseinandersetzung, die Debatte auf der Straße, in den Medien und durch Wahlen. Schritt für Schritt, immer ein wenig mehr.
Für mich trägt noch ein weiterer Gedanke dieses Buch: Das Recht und Gerichte, die es anwenden, spielen eine wichtige Rolle für eine funktionierende Demokratie. Als dritte staatliche Gewalt können sie Menschen den Mut geben, für ihr Anliegen zu kämpfen. Für ihre Klagen investieren diese Menschen – Einzelpersonen oder Verbände – oftmals viel. Es erfordert Rückgrat, vor Gericht für seine Rechte einzustehen. Viele Gerichtsverfahren ziehen sich über Jahre, sie beanspruchen viel Zeit und einen hohen persönlichen Einsatz. Manchmal erfahren die klagenden Parteien auch persönliche Missbilligung aus ihrem Umfeld, oft aus dessen Unkenntnis über das, was die Klägerinnen und Kläger eigentlich erstreiten wollen.
Bei mir ist der Gang vor Gericht Teil meines Berufs, und meine Robe und Rolle schützen mich. All denen, die diesen Schutz nicht haben und sich dennoch trauen, Gerichte in die wichtige Arbeit zur Rettung unserer Lebensgrundlagen einzubinden, indem sie klagen oder Beschwerde führen, ist deshalb dieses Buch gewidmet. Ebenso wie allen, die mich und sie unterstützen. Es sind Menschen aus der Klimaforschung, aus den Umweltverbänden, aus der Rechtswissenschaft. Sie helfen mir, komplizierte naturwissenschaftlichen Zusammenhänge zu verstehen, meine juristischen Argumente wirkungsvoll zu schärfen und zielführende Strategien zu entwickeln. Nicht alle können in diesem Buch genannt werden, aber sie wissen, dass sie gemeint sind.
Dieses Buch erzählt von vielen Fällen rund um den Globus, in denen es um das Recht von Menschen geht und die stellvertretend für die echten Schäden und Probleme stehen, die der Klimawandel jetzt schon – bei über drei Milliarden Menschen – verursacht.[6] Das sind keine ausgedachten Geschichten. Sie sind Wirklichkeit.
In Kapitel 1 zeige ich anhand der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom März 2021, wie Klimaklagen dazu beitragen, dem Pariser Klimaabkommen von 2015 mit seiner 1,5-Grad-Grenze zur Geltung zu verhelfen und wie der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts die Freiheitsrechte zukünftiger Generationen in Deutschland schützt und weltweit Kreise zieht.
In Kapitel 2 mache ich anhand der Klage von Schweizer Seniorinnen und portugiesischen Kindern und Jugendlichen klar, warum Klimaschutz ein Menschenrecht ist und warum Klimaklagen die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit stärken.
Den Fall des peruanischen Bergführers Saúl Luciano Lluiya gegen die RWE AG greife ich in Kapitel 3 auf, um zu zeigen, welche zentrale Rolle die Klimawissenschaft vor Gericht spielt. Ihr ist zu verdanken, dass inzwischen der Anteil des Menschen an der Verursachung jedes einzelnen Sturms errechenbar ist, was weltweit Bedeutung für weitere Verfahren haben kann.[7]
Mittels der Klagen von Jugendlichen aus den USA möchte ich in Kapitel 4 verdeutlichen, welche Rolle selbst verlorene Klagen für die Fortentwicklung des Rechts und die öffentliche Meinung spielen und dass jede verlorene Klage immer auch eine neue Chance darstellt.
Kapitel 5 stellt zwei Fälle, die EU-Klimaklage People’s Climate Case und das Urgenda-Verfahren in den Niederlanden, einander gegenüber. Sie illustrieren, wie wichtig es ist, dass der Weg zu Gericht überhaupt offensteht und dass er nicht verschlossen wird. Hier versuche ich auch zu erklären, woran es liegt, dass nicht jede und jeder klagen kann.
Einen Fall von den Philippinen stelle ich in Kapitel 6 in den Mittelpunkt und zeige, wie das Recht den Menschen, die heute schon unter der Klimakrise leiden, Aussicht auf Gerechtigkeit geben kann und dass auch andere Gremien als staatliche Gerichte das Recht für den Klimaschutz nutzen können.
Um Klagen gegen Unternehmen, insbesondere gegen die Konzerne Shell und VW, geht es in Kapitel 7. Ich beschreibe, wie Klimaklagen die negativen Folgen der Globalisierung ein Stück weit rückgängig machen können und welche Rolle das Zivilrecht beim Ausgleich von Interessen spielt.
Kapitel 8 widmet sich anhand eines Falles aus Kolumbien dem in der Öffentlichkeit noch zu wenig beachteten Gegenstück zu Emissionen, nämlich der Bedeutung von Wäldern und Böden als Treibhausgassenken. Eine wichtige Aufgabe in der Zukunft ist ihr Schutz und Aufbau unter Berücksichtigung der weltweiten Biodiversitätskrise. Auch hier kann und muss die dritte Gewalt eine unterstützende Rolle spielen. In diesem Kontext gehe ich auch auf die Forderung nach Eigenrechten für die Natur ein.
Am Ende des Buchs wage ich einen Ausblick: Wo liegen die Herausforderungen angesichts des Kriegs um die Ukraine, wie kann Recht die notwendige Transformation unterstützen, und welche Art von Konflikten wird vor den Gerichten weltweit landen? Ein abschließendes Fazit lässt sich dabei nicht ziehen, da mit der fortschreitenden Klimakrise und ohne ausreichende politische Lösung weltweit immer neue Klimaklagen eingereicht und verhandelt werden. Die Urteile werden unseren heutigen Status quo überholen und neue Wege eröffnen. Im Zuge dessen wird Recht neu ausgelegt, vielleicht auch neu entstehen – und als Motor der Transformation und zur Umsetzung von Klimaschutz dienen. Hoffentlich.
EINS KLIMAKLAGEN MACHEN PARIS VERBINDLICH
Wenn man als Umweltanwältin eine Klage erhebt, schickt man ein bisschen Hoffnung in die Welt – darauf, dass man recht bekommt, egal wie aussichtslos und schwierig, neu und kompliziert die Sache sein mag. Ist die Klage eingereicht, gibt man die Kontrolle über diese Hoffnung ab. Entscheiden kann nur das Gericht. Zugleich ist man erleichtert, dass die oft Hunderte Seiten starke Klageschrift fertig und in der Welt ist.
Der Schriftsatz der Klimaverfassungsbeschwerde, die Anfang Februar 2020 aus unserer Kanzlei auf den Weg nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht geschickt wurde, umfasste mit all seinen Anhängen sogar Tausende von Seiten.[8] Schließlich ging es auch um sehr viel, nämlich um nicht weniger als die Frage, ob Klimaschutz Menschenrecht ist. Ob der deutsche Gesetzgeber nach eigenem Belieben entscheiden kann, etwas gegen die Klimakrise zu tun oder nicht, und wenn ja, was genau. Und ob das im Dezember 2019 gerade erst vom deutschen Bundestag beschlossene Bundesklimaschutzgesetz mit der deutschen Verfassung, dem Grundgesetz, vereinbar ist.[9]
Ich versuche in solchen Fällen, die Hoffnungen nicht zu groß werden zu lassen, damit ich nicht zu tief falle. Ich lenke mich mit Arbeit ab, mache einfach weiter, führe andere Verfahren, habe wie immer Hunderte von Bällen gleichzeitig in der Luft und jongliere mit Fällen, Anfragen und Urteilen. Bis das Gericht eine Entscheidung fällt.
Dann kam im April 2021 der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts: gewonnen.[10] Das Klimaschutzgesetz war teilweise verfassungswidrig. Unfassbar!
Ich muss jubelnd durch den Flur unserer Kanzlei in Hamburg gelaufen sein, so berichteten es mir später meine Kolleginnen und Kollegen. Ich weiß noch, dass mir bei den ersten Telefonaten die Hände zitterten. Kein Mensch hatte mit so einem Beschluss gerechnet. Das gesamte Gericht – also alle acht Richter und Richterinnen, denn die Entscheidung erging einstimmig – war von den Argumenten so überzeugt und fand den von uns geschilderten Sachverhalt so unstrittig, dass sie ganz auf eine mündliche Verhandlung verzichteten. Nicht einmal tiefer gehende Nachfragen hatten sie uns gestellt.
Gestützt auf das Grundgesetz, hatte das höchste deutsche Gericht die Notwendigkeit einer Klimaschutzpolitik bestätigt, die den Vorgaben des Pariser Abkommens entspricht.[11] Eine Ansage mit Folgen. Denn damit hat Deutschland nun eine verbindliche Richtschnur, die auch künftige Regierungen und Parlamente in der Klimaschutzgesetzgebung nicht mehr ignorieren dürfen. Tun sie es doch, müssen sie damit rechnen, vom Bundesverfassungsgericht erneut in ihre Schranken verwiesen zu werden.
Ich hatte – wie viele andere – erwartet, dass das Gericht unsere Verfassungsbeschwerde mit einer ausführlichen Begründung ablehnen würde. Wir hatten mit dem Bundestag und der Bundesregierung lediglich Schriftsätze ausgetauscht, eine mündliche Verhandlung hatte es nicht gegeben. Ich verstand das so, dass unsere Chancen eher begrenzt seien, zumal es nicht ungewöhnlich ist, dass Umweltklagen vor Gerichten scheitern. Und gerade Verfassungsbeschwerden – also Klagen von Einzelnen gegen Gesetze, weil diese gegen Grundrechte verstoßen – werden vom Bundesverfassungsgericht überwiegend nicht zur Entscheidung angenommen.
Verfassungsbeschwerden haben in Sachen Hoffnung grundsätzlich einen eher schlechten Ruf: Laut amtlicher Statistik aus dem Jahr 2020 sind in Karlsruhe nur 2,2 Prozent aller eingereichten Verfassungsbeschwerden erfolgreich.[12] Oft erfolgt ihre Ablehnung in einem einzigen, trockenen Satz: »Die Verfassungsbeschwerde wird nicht zur Entscheidung angenommen.« Dieser Satz hätte uns ebenfalls blühen können. Eine gut begründete Ablehnung hingegen hätte uns auch weitergebracht. Sie hätte uns Argumente für weitere Verfahren an die Hand geben können. Es obliegt allein dem Bundesverfassungsgericht, zu entscheiden, wie es im Fall von Ablehnungen verfährt. Es kann sich wortkarg geben oder sich ausführlich zur Sache äußern, selbst wenn es eine Beschwerde aus verfahrensrechtlichen Gründen gar nicht zur Entscheidung annimmt. Mir schien es realistisch, mit einer gut begründeten Ablehnung zu rechnen. Stattdessen bestätigten die Richter und Richterinnen einstimmig unsere Rechtsauffassung in den wichtigsten Punkten – eine historische Entscheidung.
Die Grundlagen dafür waren mehr als fünf Jahre vorher gelegt worden: 2015 in Paris.
DIE ERDERWÄRMUNG AUFHALTEN, ALLE GEMEINSAM
Am 12. Dezember 2015 brach großer Jubel aus in Le Bourget, einem Vorort von Paris. Nach Jahren der Hoffnungslosigkeit in der globalen Klimadiplomatie hatten sich die Staaten der Welt in langen Verhandlungen auf ein weiteres gemeinsames Klimaabkommen geeinigt. Es sollte das Kyoto-Protokoll von 1997 ersetzen und die Klimarahmenkonvention von 1992 mit neuem Leben füllen. Erstmals versprachen nicht nur die alten Industriestaaten, die sogenannten Annex-I-Staaten, sondern auch die Entwicklungs- und Schwellenländer, ihren Ausstoß an Treibhausgasen in Zukunft zu senken; Staaten wie beispielsweise China, Indien und Südafrika. Für den globalen Klimaschutz war allein das – dass wirklich alle sich beteiligen wollten – ein Riesendurchbruch.
Es gab aber noch einen weiteren Grund zu jubeln. Das Abkommen von Paris sieht in Artikel 2 als Langfristziel vor, die Erderwärmung bei »deutlich unter zwei Grad« zu stoppen und »Anstrengungen zu unternehmen, den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau« zu begrenzen. Teil dieses Ziels ist auch, Treibhausgasneutralität herzustellen, definiert in Artikel 4 als: »Gleichgewicht zwischen den anthropogenen Emissionen von Treibhausgasen aus Quellen und dem Abbau solcher Gase durch Senken.«
Dieser Festlegung eines klaren Ziels waren jahrzehntelange Streitigkeiten vorangegangen. Artikel 2 des UN-Klimarahmenabkommens von 1992 verpflichtet alle Vertragsstaaten schon seit 30 Jahren, »gefährlichen Klimawandel« zu verhindern. Aber was genau sollte das bedeuten? Solange der »gefährliche Klimawandel« nicht genauer definiert wurde, gab es auch keinen Maßstab dafür, wann ein Verstoß vorliegen könnte. Wohl auch deshalb hat kein Gericht jemals Artikel 2 direkt angewendet.
Heute ist die »deutlich unter 2 und besser 1,5-Grad-Grenze« zusammen mit den damit verbundenen Erkenntnissen zum verbleibenden CO2-Budget die zentrale Bezugsgröße der internationalen Klimapolitik, vor allem seitdem der Weltklimarat diese Schwelle in seinem Sonderbericht von 2018 plastisch beschrieben hat.[13] Aber dazu später. Ins Pariser Abkommen gelangte der Wert erst kurz vor dem Ende der damaligen Verhandlungen, auf Druck der Delegationen aus den besonders vulnerablen Ländern, darunter die Inselstaaten des Pazifiks. Kaum jemand hatte damit gerechnet, dass es ihnen gelingen würde, sich durchzusetzen, aber sie ließen als Treiber und Mahner bei allen Klimakonferenzen nicht locker. Und dann stand es wirklich im völkerrechtlich verbindlichen Text, in der Entscheidung 1/CP.21 der Vertragsstaatenkonferenz von Paris. Damit hatte niemand gerechnet.
Ich hielt die 1,5-Grad-Grenze zunächst für leere Worte. Die Regierungen hatten so lange gebraucht, um dieses Abkommen zu beschließen; seit 1992 und auch während der Geltung des Kyoto-Protokolls von 1997, mit dem die Industriestaaten zur Reduktion ihres Treibhausgasausstoßes verpflichtet worden waren, stiegen die Emissionen global nur immer weiter an. Und jetzt sollte man den Vertragsstaaten von Paris den Ehrgeiz glauben, der in diesen 1,5 Grad lag? Wie sollte es gelingen, dieses Ziel zu erreichen? Dazu muss man wissen, dass das Pariser Abkommen ausschließlich auf freiwillige Selbstverpflichtungen setzt, die im Jargon der Klimadiplomatie »Nationally Determined Contributions« oder NDCs (Artikel 4 Absatz 2 des Abkommens) genannt werden. Wie wollte man unter dieser Voraussetzung garantieren, dass die unterzeichnenden Staaten zusammengenommen tatsächlich die Erderhitzung an der vereinbarten Schwelle stoppen würden?
Erst später begriff ich: Wenn die 1,5 Grad im Pariser Klimaabkommen in dieser Klarheit benannt werden, dann kann man sie auch als juristischen Hebel nutzen. Zum Beispiel in Deutschland: Dadurch, dass das Pariser Abkommen ratifiziert und seine Ziele auch ins deutsche Recht aufgenommen wurden, konkret in Paragraf 1 des Klimaschutzgesetzes, werden die 1,5 Grad für die deutsche Politik zur verbindlichen Norm und zum Maßstab für Gerichtsurteile. Für das Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht waren die 1,5 Grad und das Ziel der Treibhausgasneutralität jedenfalls von zentraler Bedeutung.
Das Pariser Abkommen trat am 4. November 2016 in Kraft – dreißig Tage, nachdem die dafür nötige Anzahl von Staaten es unterzeichnet hatte. 193 Länder sind ihm seither beigetreten und somit fast alle Staaten der Welt, auch die USA sind wieder dabei.[14] Das internationale Engagement ist deshalb essenziell, weil der menschengemachte Treibhauseffekt genuin globalen Charakter hat. Ein effektiver Schutz von unteilbaren globalen Umweltgütern, etwa der Erdatmosphäre, der Ozonschicht oder von Ökosystemen, die sich außerhalb staatlicher Souveränitätsräume befinden, so wie in der Antarktis und auf Hoher See, lässt sich nur durch möglichst universale Kooperation aller Staaten erreichen. Klimadiplomatie rund um die Klimarahmenkonvention und das Abkommen von Paris ist deshalb unverzichtbar. Aber sie ist nicht mehr das einzige wirksame Mittel.
Denn: Es ist jetzt auch eine Frage der Menschenrechte und der globalen Gerechtigkeit, ob es uns gelingt, die 1,5 Grad einzuhalten – und damit ist es auch eine Frage der Gerichte. Das zeigt das Beispiel der pazifischen Inseln, die in Paris so für diese Temperaturschwelle gekämpft hatten. Für sie hätte der Unterschied zwischen einer globalen Erwärmung um 2 gegenüber 1,5 Grad besonders gravierende Folgen. Nachlesen lässt sich das im IPCC Sonderbericht von 2018. In Zahlen und Grafiken wird dort sehr deutlich gemacht, wie bei 2 Grad globaler Erwärmung das Überleben auf den pazifischen Inseln mit hoher Wahrscheinlichkeit unmöglich wird.
Weil der Meeresspiegel steigt, erodieren schon jetzt ihre Küsten. Stürme werden heftiger, kommen häufiger vor, und ihre Fluten richten auf dem Land Zerstörung bisher unbekannten Ausmaßes an. Im Landesinnern steigt schon seit Jahren salziges Meerwasser in den Böden empor. Die Folge: Die Süßwasservorräte werden untrinkbar, auf den Feldern und in Gärten verkümmern die Pflanzen. Das erlebt etwa auch mein Mandant Petero Qaloibau auf der zu Fidji gehörenden Insel Vanua Levu, den ich in der EU-Klimaklage People’s Climate Case vertreten habe. Und das ist auch die Realität der erfolgreichen Beschwerdeführer vor dem UN-Menschenrechtsgremium von den Torres-Strait-Inseln. Es wird immer schwieriger, auf den Inseln überhaupt zu überleben. Viele Menschen wollen sie verlassen, andere können sich nicht vorstellen, ihre untergehende Heimat aufzugeben. Und selbst wenn sie anderswo einen Platz zum Leben fänden, wäre ein Neuanfang schwer, da bislang kein Land der Welt die Umsiedlung von Klimaflüchtlingen aktiv unterstützt.
Bis heute ist die globale Durchschnittstemperatur der Erde bereits um rund 1,2 Grad Celsius gestiegen.[15] Nicht mehr lange, und wir erreichen die Schwelle von 1,5 Grad.
Dem IPCC-Bericht von 2018 zufolge könnten, wenn es uns gelingt, die 1,5 Grad nicht zu überschreiten, viele bedrohte Inseln weltweit erhalten und Millionen von Menschen vor Armut geschützt werden. Ernteeinbußen für die Landwirtschaft würden deutlich geringer ausfallen als bei einer stärkeren Temperaturerhöhung. Die Fischbestände und damit weltweite Fischereierträge wären womöglich zu retten. Manche Korallenriffe vielleicht ebenfalls. Das arktische Eis würde langsamer schmelzen, der Meeresspiegel weniger schnell steigen. Die Gefahr, dass das Grönlandeis unwiederbringlich abschmilzt, würde hoffentlich abgewendet, so wie auch das Anstoßen weiterer Kipppunkte im Klimasystem, nach deren Überschreiten eine Kaskade von negativen Entwicklungen in Gang gesetzt würde, die sich selbst durch die besten Gegenmaßnahmen nicht mehr aufhalten ließen.
Zahlreiche Studien und viele weitere Berichte des Weltklimarats haben diese Erkenntnisse seither präzisiert. Immer dringlicher werden die Warnungen der Wissenschaft – zuletzt hat es der IPCC-Teilbericht aus dem April 2022, der sich mit den Möglichkeiten beschäftigt, die uns noch bleiben, den Anstieg der klimaschädlichen Emissionen zu stoppen, erneut sehr deutlich aufgezeigt: Will die Menschheit noch eine Chance auf eine sichere Zukunft haben, bleibt ihr nicht mehr viel Zeit, um zu handeln. Schon heute kann nicht ausgeschlossen werden, dass allein aufgrund vergangener Emissionen abrupte, nicht aufzuhaltende und unkontrollierbare Wirkungen ausgelöst werden, die das Klima unwiederbringlich destabilisieren. Jede weitere Tonne Treibhausgase, die wir freisetzen, verstärkt das Risiko, dass wir solche Kipppunkte überschreiten.[16]
Sieben Jahre nach dem Jubel von Paris ist heute allerdings Ernüchterung eingekehrt. Trotz der hehren Ziele steigt der Ausstoß klimaschädlicher Gase weltweit weiter an. Anfang der 1990er-Jahre betrugen die jährlichen globalen Kohlendioxidemissionen knapp 23 Gigatonnen; bis 2015, dem Jahr des Pariser Abkommens, waren sie auf 35,5 Gigatonnen gestiegen. 2021 lagen sie trotz der Corona-Pandemie die im Vorjahr die weltweite Wirtschaft zum Erliegen gebracht hatte, bei 36,4 Gigatonnen.[17] Zwar haben viele der Vertragsstaaten von Paris auf dem Klimagipfel 2021 in Glasgow neue, ehrgeizigere Klimaziele bei den Vereinten Nationen hinterlegt und das teilweise bei der letzten Konferenz in Ägypten auch bekräftigt. Doch selbst wenn all diese Ziele in praktische Politik umgesetzt werden, befindet sich die Welt noch auf dem besten Weg in Richtung 2,4 Grad plus, wie Berechnungen des unabhängigen Thinktanks Climate Action Tracker (CAT)[18] ergeben haben, mit denen auch die Vereinten Nationen arbeiten.
Die CAT-Zahlen zeigen auch, dass die Regierungen wirkliche Anstrengungen im Klimaschutz immer noch viel zu weit in die Zukunft verschieben. Als ob es dann leichter würde. Im Gegenteil, uns bleiben nur noch wenige Jahre, um die globale Wirtschaft klimafreundlich umzubauen und uns aus der Abhängigkeit von Kohle, Öl und Erdgas zu befreien. Es ist eine gewaltige Aufgabe, und je länger die Menschheit jetzt noch zögert, desto schwieriger wird es, sie zu bewältigen. Desto wahrscheinlicher wird es, dass Kipppunkte überschritten werden und damit der point of no return erreicht ist.
Höchste Zeit also, dass jetzt Gerichte ins Spiel kommen. Klagen können dazu beitragen, den Wandel hin zu mehr Klimaschutz zu beschleunigen. Sie können Regierungen und Gesetzgeber zwingen, ihre Politik tatsächlich an der 1,5-Grad-Grenze auszurichten, statt es nur immer wieder neu zu versprechen. Und die Forschungsgruppe um die Soziologieprofessorin Anita Engels zeigt: Klimaklagen sind tatsächlich schon heute ein wichtiger Baustein des Wandels.[19]
Man könnte meinen, es sei logisch und selbstverständlich, dass nationale Gerichte ein völkerrechtliches Abkommen umsetzen. Ist es aber nicht. Das Pariser Abkommen ist zunächst einmal für die Vertragsparteien bindend, und das sind die Staaten. Das hat zur Folge, dass sich je nach dem rechtlichen Rahmen im jeweiligen Land ganz unterschiedliche juristische Konsequenzen aus ihm ergeben. Sobald beispielsweise die USA ein internationales Abkommen ratifizieren, wird es dort ganz automatisch und unverzüglich Bestandteil des gültigen nationalen Rechts. Damit ist es absolut verbindlich und muss zwingend umgesetzt werden. Deswegen sind – nebenbei bemerkt – die USA generell auch eher zurückhaltend beim Abschluss von völkerrechtlichen Verträgen.
Auf EU-Ebene verhält sich die Rechtslage ganz ähnlich. In Deutschland dagegen sind völkerrechtliche Verträge nicht automatisch nach ihrer Ratifizierung für alle verbindlich. Sie unterliegen einem besonderen Gesetzesvorbehalt, das heißt, sie gelten nur, wenn sie auch den Rang eines nationalen Gesetzes erhalten. Für das Pariser Abkommen ist das zwar schon mit dem Ratifikationsgesetz 2016 und dann mit dem Klimaschutzgesetz von 2019 geschehen, aber dennoch können einzelne Bürgerinnen und Bürger die Bundesregierung nicht einfach so vor einem deutschen Gericht verklagen, falls sie der Auffassung sind, dass deren Politik gegen das Abkommen verstößt. Der Grund: Im deutschen Recht entfaltet das Völkerrecht in der Regel keine Bindung zugunsten von einzelnen Personen. Es gilt – wie wir Juristinnen und Juristen sagen – nur objektiv, nicht aber subjektiv für jeden Einzelnen. So verhält es sich zunächst auch mit dem deutschen Klimaschutzgesetz, das dem ganzen Land einen Rahmen für die Transformation hin zu einer klimafreundlichen Gesellschaft vorgibt. Es gilt erst einmal objektiv-rechtlich.
Das Klimaschutzgesetz als »Rahmengesetz« legt Leitplanken für die deutsche Politik fest, innerhalb derer sich die Regierung bewegen muss. Sind die Leitplanken aber zu weit gesetzt, das heißt, ist das deutsche Klimaschutzgesetz zu unambitioniert formuliert, um die Vorgaben aus Paris zu erfüllen, kann man vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, um dort zu beantragen, dass der Gesetzgeber korrigiert wird. Dabei spielen als Maßstab die Grundrechte eine Rolle – und bei der Umsetzung auch das klassische, technische Umweltrecht.
Das Umweltrecht ist in Deutschland seit den 1970er-Jahren entwickelt worden – in den vergangenen 20 Jahren vor allem dadurch, dass EU-Regelungen (vor allem Richtlinien, also ausfüllungsbedürftige Rechtsakte der EU) auf nationaler Ebene umgesetzt werden mussten. Historisch beschäftigte sich das Umweltrecht vor allem mit technischen Fragen, beispielsweise des Lärmschutzes, der Rauchgasreinigung bei Kraftwerken und der Abwasserreinigung in Klärwerken und Industrie. Zentral war dabei der Begriff des »Stands der Technik«. Er ermöglichte es, die Ressourcen ungebremst zu nutzen, solange man dabei nur möglichst viel Umweltverschmutzung vermied. Daneben gab es immer auch konkrete Grenzwerte, die vor allem aus Gründen des Gesundheitsschutzes nicht überschritten werden durften. 1994 wurde der Umweltschutz als Staatsziel in Artikel 20a ins Grundgesetz aufgenommen. Danach ist der Staat verpflichtet, auch in Verantwortung für die kommenden Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen.
Die EU setzte dann verstärkt auf Grenzwerte, etwa für Wasser, Luft und Boden sowie auf Gebietsschutz für Vögel und verschiedene zentrale Arten und Habitate. Aber immer wieder wurden diese Vorgaben letztlich durch die Massivität der Mobilität und des Konsums überholt, mit dem Ergebnis, dass der Zustand unserer Umwelt insgesamt heute sogar dramatischer als in den 70ern bedroht ist. Um dem entgegenzuwirken, beschäftigt sich Umweltrecht jetzt auch mit der Frage, wie wir die globalen ökologischen »Grenzwerte« einhalten können. Wie wir also zum Beispiel das CO2-Budget nicht überschreiten, das uns unter der 1,5-Grad-Grenze und nach völkerrechtlichen Maßstäben noch zusteht. Und auch, wie wir die »planetaren Grenzen« insgesamt einhalten können. Das Konzept der planetaren Grenzen ist wissenschaftlich seit 2009 etabliert und quantifiziert die Schwellen, an denen der Mensch haltmachen muss, will er seine eigenen Lebensgrundlagen nicht zerstören.[20] Ein Parameter von neun ist das Klimasystem, ein anderer etwa Biodiversität. Wir stecken also mitten in einer Debatte darüber, wie man das Recht als Motor für die große ökologische Transformation nutzen kann, die wir bewältigen müssen. Das ist kein klassisches Umweltrecht mehr, das ist Transformationsrecht zugunsten aller zukünftigen Generationen, der natürlichen Umwelt und unserer Lebensgrundlagen an sich.
Der von uns und anderen erstrittene Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom Frühjahr 2021 hat einen Weg gezeigt, wie durch das Recht die Gesellschaft hin zur Klimaneutralität verändert werden kann. Möglich wurde er nicht nur durch das Abkommen von Paris, sondern auch durch den Mut und die Entschlossenheit der Beschwerdeführenden, unter ihnen vier junge Leute von der Nordseeinsel Pellworm.
DIE KLIMAKRISE GEFÄHRDET PELLWORM
Die Halligen, sagt Silke Backsen, werden es als Erste nicht schaffen. »Jedenfalls wenn der Meeresspiegel auch nur annähernd so weit steigt, wie es derzeit prognostiziert wird.« Silke ist Biologin, eine großherzige, zupackende, engagierte und politische Frau. Sie lebt auf der Nordseeinsel Pellworm im nordfriesischen Wattenmeer. Die Insel ist von zehn Halligen umgeben: flachen Inseln, die heute schon bei Sturmflut vom Meer überspült werden.
Auf Pellworm kann man spüren, wie sehr der Ausstoß an Treibhausgasen auch die Inseln des Wattenmeers in Gefahr bringt – nicht nur die des Pazifiks. Die Vorgänge, die dazu führen, sind bekannt: Weil die Erde sich erhitzt, schmilzt das Eis im Hochgebirge und an den Polen. Das Wasser der Ozeane erwärmt sich und dehnt sich deshalb aus. Aus beiden Gründen steigt der Meeresspiegel weltweit derzeit im globalen Durchschnitt um 3,6 Millimeter pro Jahr,[21] und allen Erkenntnissen der Klimawissenschaft zufolge wird er das in Zukunft immer schneller tun, insbesondere an der Nordseeküste Schleswig-Holsteins. Das hat geologische Gründe: Der Meeresboden und Teile der Küste sinken dort um etwa einen Millimeter pro Jahr – das ist eine Nachwirkung der letzten Eiszeit. Ein höherer Meeresspiegel aber verstärkt auch hier die Zerstörungskraft von Sturmfluten. Er lässt die Küsten erodieren und setzt Bauwerke und Anlagen unter Druck, die zu ihrem Schutz errichtet wurden. Und auch der normale Tidenhub fällt durch den Klimawandel höher aus als früher.
Noch wird Pellworm – sieben Kilometer lang, sechs Kilometer breit, knapp 1200 Menschen – von einem acht Meter hohen und mehr als 25 Kilometer langen Deich vor der Gewalt des Meeres geschützt. Immer höher haben die Bewohnerinnen und Bewohner der Insel den Schutzwall in den vergangenen Jahrhunderten gezogen. »Aber wie lange können wir den Deich noch höher bauen?«, fragt Silke. Sie lässt die Antwort offen, aber auch so ist klar, was sie sagen will: Irgendwann ist Schluss. Nach derzeitigem Stand wird der technische Hochwasserschutz bei einer globalen Erwärmung um 2 Grad Celsius an seine Grenzen stoßen.
Die Backsens leben seit Generationen auf der Insel. Ihr Bauernhaus wurde im Jahr 1703 erbaut. Es liegt auf einer Erhöhung, Edenswarf genannt, so wie all die alten Häuser hier auf Warften stehen. Es sind kleine Hügel, auf denen die Behausungen der Menschen – und der Tiere – noch ein wenig besser vor dem Wasser geschützt sind. Heute halten sie auf dem Biohof Schafe und Rinder, beherbergen Feriengäste und bewirtschaften rund zweihundert Hektar Wiesen und Ackerland. Im Flur des Hauses spürt man seine Geschichte, dort hängen Schwarz-Weiß-Fotografien aus vergangenen Tagen neben aktuellen Familienfotos.
Silkes Tochter Sophie, überlegt, leidenschaftlich und entschlossen, Studentin der Agrarwissenschaften in Kiel, will später einmal den Hof übernehmen, ebenso wie zwei ihrer Brüder – das ist in Deutschland etwas ganz Besonderes. Doch ganz gleich, wer den Hof später bewirtschaftet: Alle Backsens wollen ihre Familientradition auf Pellworm erhalten. Obwohl sie genau wissen, wie gefährdet die Insel ist.
Denn wenn nicht ein kleines Wunder passiert oder der Deich extrem erhöht wird, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Sturmflut kommt, gegen die die Deiche machtlos sind. Oder ein extrem starker Regen, der die Insel vom Landesinneren her überschwemmt und gegen den die Pumpwerke nichts mehr ausrichten können. Pellworm ist geformt wie eine Schüssel. Der Deich bildet den Rand, und das Land dazwischen liegt durchschnittlich einen Meter unter dem Meeresspiegel. Je höher der Meeresspiegel jenseits des Deichs steht, desto schwieriger wird es, starke Niederschläge von der Insel ins Meer abzuleiten. Die Folge: Im Extremfall könnte die ganze Insel einfach volllaufen. Beinahe ist das schon einmal passiert. Im Herbst 2017 regnete es so sehr, dass die Pumpen die Wassermengen nicht mehr bewältigen konnten. Feuerwehren und Technisches Hilfswerk vom Festland mussten zu Hilfe eilen, um das Schlimmste zu verhindern. Die Aussaat von Kleegras und Winterweizen auf Pellworm fiel damals buchstäblich ins Wasser, auch für Familie Backsen.
Sie spüren den Klimawandel auch aus anderen Gründen schon jetzt. Es sei ein schleichender Prozess, sagt Silke. Vögel kommen früher, gar nicht mehr oder in Massen. Vegetationsperioden verschieben sich. »Es gibt nicht diesen einen Moment, an dem es einem klar wird, das ist der Klimawandel. Man merkt es an vielen kleinen Dingen. Wetterextreme, die häufiger auftreten, so wie die trockenen Sommer der Jahre 2018 und 2019. Jahreszeiten, die sich verschieben. In der Landwirtschaft lebt man draußen, man spürt das, man sieht das.«
Als Greenpeace Silke fragte, ob sie gegen die unzureichende Klimapolitik der Bundesregierung klagen wolle, war sie schnell dazu bereit. Das war 2018. Es war das erste Jahr, in dem deutlich wurde, dass die Bundesregierung ihre eigenen, seit Jahren immer wieder bestätigten Klimaziele für das Jahr 2020 wohl nicht erreichen würde. Ihre eigenen Prognosen legten das für alle Welt offen. Damals lernten Silke und ich uns kennen, ich arbeitete für Greenpeace, sie wurde meine Mandantin.
Ihre Entscheidung fällte Silke nicht allein. Wir waren uns einig, dass sie nur mitmachen würde, wenn die ganze Familie, Mann und Kinder, ebenfalls hinter der Klage stünden. Mit gutem Grund: Umwelt- und Klimaklagen halten die Beteiligten über Jahre hinweg beschäftigt. Das steht man nur durch, wenn wirklich die ganze Familie das Vorhaben unterstützt. Und bei den Backsens waren alle dabei.
Am 25. Oktober 2018 reichte ich für sie, zwei weitere Landwirtsfamilien aus Brandenburg und dem Alten Land bei Stade und für Greenpeace als Umweltverband beim Verwaltungsgericht Berlin Klage gegen die unzureichende Klimapolitik der Bundesregierung ein.[22] Damals klagten wir noch nicht gegen das Klimaschutzgesetz, denn das gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Unsere Forderung war einfach. Wir verlangten, die Regierung möge Maßnahmen vorlegen, die es ermöglichen würden, das selbst gesetzte Klimaziel noch zu erreichen, also die deutschen CO2-Emissionen bis zum Jahre 2020 um 40 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 zu senken. Doch die rechtliche Argumentation dafür war schwierig, da das Klimaziel nur in vielen Beschlüssen und Kabinettsentscheidungen seit 2007 festgeschrieben war, aber in keinem Gesetz. Würde diese Grundlage vor Gericht ausreichen, um sich als Betroffene darauf zu berufen? Würde das Gericht das Erreichen von Klimaschutzzielen als eine Frage des Schutzes von Eigentum und Gesundheit bewerten, also der im Grundgesetz garantierten Menschenrechte?
Als wir am 31. Oktober 2019 zur mündlichen Verhandlung in Berlin erschienen, war der Gerichtssaal voller Journalistinnen und Journalisten. Seit sechs Uhr früh hatten die klagenden Parteien schon Interviews zu ihrem Fall gegeben. Von Pellworm war ein ganzer Bus voller Nachbarn und Nachbarinnen angereist, um den Backsens den Rücken zu stärken. Die Straße vor dem Justizgebäude war gesperrt, weil viele junge Leute zur Unterstützung der Klage lautstark demonstrierten.
Es half nichts. Am Ende des Tages wies das Gericht unsere Klage ab.[23] Aber sein Urteil stellte wichtige Weichen für später. Auf unsere erste Frage nach dem Anspruch auf Einhaltung des 2020-Klimaziels auf Grundlage von Eigentums- und Gesundheitsschutz antwortete es zwar mit Nein, doch auf die zweite – die Frage nach dem Schutzanspruch gegen die Folgen des Klimawandels aus Menschenrechten – gab es ein klares Ja. Damit hatten wir das Rüstzeug, mit dem wir später eine Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht wagen konnten.
Sophie und ihre Brüder waren enttäuscht von dem Berliner Urteil, auch wenn die Wirkung des Prozesses in der Öffentlichkeit immens gewesen war und das Gericht sie und ihre Familie als Betroffene sehr ernst genommen hatte. Aber sie wollten nicht aufgeben, schließlich ging es um ihre Heimat Pellworm.
Jetzt nahmen sie als Jugendliche und junge Erwachsene die Sache selbst in die Hand. Das sei schon ein wenig skurril gewesen, erinnert sich Silke. In der Klage vor dem Berliner Verwaltungsgericht war sie die treibende Kraft der Familie gewesen. »Jetzt war ich auf einmal die Sekretärin und stand komplett im Hintergrund. Ich habe die Tasche getragen, die Papiere angereicht, hatte den Mailverkehr und die Pressemitteilungen im Blick. Aber im Mittelpunkt stand Sophie.«[24]
Im Februar 2020 reichte ich also für Sophie, ihre Brüder und fünf weitere junge Menschen eine gemeinsame Verfassungsbeschwerde ein. Das kurz zuvor im Dezember 2019 von der Bundesregierung verabschiedete Klimaschutzgesetz war der Beschwerdegegenstand, auf dem wir unsere Argumentation solide aufbauen konnten. Mit dabei waren auch Luisa Neubauer von Fridays for Future sowie Johannes und Franziska Blohm, deren Vater Claus im Alten Land ganz in der Nähe von Hamburg einen Obsthof betreibt. Claus Blohm macht den Klimawandel beispielsweise daran fest, dass seine Äpfel im Sommer jetzt viel häufiger Sonnenbrand bekommen als je zuvor und von Schädlingen befallen werden, die es früher in der Region nicht gab.
Wir beantragten festzustellen, dass das Klimaschutzgesetz nicht genüge, um die Klimakrise wirksam zu bekämpfen. Denn das Gesetz erwähnte zwar das Pariser Abkommen, ignorierte aber ansonsten die 1,5-Grad-Grenze. Es beruhte auf alten Zielen und legte auch keinen Pfad hin zur Treibhausgasneutralität vor.
In den drei Monaten vor der Antragstellung hatten wir Tag und Nacht an der Klageschrift gearbeitet. Ich beriet mich mit Kollegen aus meiner Kanzlei und den Menschen aus den unterstützenden Umweltverbänden, Greenpeace, Germanwatch und Protect the Planet, tauschte mich mit Klimaforschenden aus, besprach offene Punkte mit den Backsens und den anderen jungen Menschen, die entschieden hatten, sich unserer Verfassungsbeschwerde anzuschließen. Es waren anstrengende Wochen, und ohne die Hilfe meines Kanzleikollegen Ulrich Wollenteit wäre der Schriftsatz wohl nicht fertig geworden. Wir schrieben, diskutierten, prüften Argumente und verwarfen sie wieder. Uli konzentrierte sich auf die Darstellung der verfassungsrechtlichen Grundsätze, ich bearbeitete den Sachverhalt und dessen Anwendung auf das Recht. Das heißt, ich musste den Stand der Klimaforschung, die Gefahren der Klimakrise für Sophie und die anderen Beschwerdeführenden und die ungenügenden Versprechen der Politik, etwas dagegen zu tun, so aufbereiten und in eine juristische Sprache übersetzen, dass das Gericht sie nachvollziehen konnte. Ich musste versuchen, die Klimaurteile anderer Gerichte möglichst verständlich aufzubereiten, unter anderem das Urteil aus dem wegweisenden Urgenda-Verfahren aus den Niederlanden (siehe Kapitel 5). Dazu haben wir Hunderte von Seiten juristischer Dokumente übersetzt.
Vor allem aber mussten wir möglichst überzeugend darlegen, warum das Bundesklimaschutzgesetz die Grundrechte der neun Klägerinnen und Kläger verletzte, die zu schützen der Staat doch verpflichtet ist. Wir sagten: Das Gesetz erreiche zu wenig Klimaschutz, denn seine Bestimmungen reichten nicht aus, um die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten und auch nicht die »deutlich unter zwei Grad« des Pariser Abkommens. Deshalb verletze es die Menschenwürde, das Recht auf Leben und Gesundheit, das Berufsfreiheits- und Eigentumsrecht.[25]
In seiner ursprünglichen Fassung legte das Klimaschutzgesetz fest, dass die deutschen Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 um 55 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 sinken sollten. Sophie sagt heute rückblickend, dass es so verabschiedet wurde, habe ein »totales Unverständnis« in ihr ausgelöst. »Und auch ein bisschen Wut. Denn am gleichen Tag, an dem die Bundesregierung ihre Gesetzesvorlage verabschiedet hat, sind ja bei dem Klimastreik von Fridays for Future Millionen Menschen auf die Straße gegangen. Sie alle haben für konkreten, wirksamen Klimaschutz demonstriert. Und dann kommt so ein Gesetz dabei heraus, das auf keinen Fall ausreicht?« Sie findet es »krass, wie man ein Thema wie den Klimawandel, das unsere Zukunft bestimmen wird, jahrzehntelang ignorieren kann. Und da hab ich gedacht, wenn selbst eine so große Demonstration nicht ausreicht, um Bewegung in die Sache zu bringen, dann muss man vielleicht einfach andere Möglichkeiten ergreifen.« Deshalb sei sie vor das Bundesverfassungsgericht gezogen.
Drei weitere Verfassungsbeschwerden waren zusammen mit unserer in Karlsruhe anhängig,[26] eingereicht von Menschen aus der Klimabewegung, den Umweltverbänden, der Politik und der Forschung. Alle Beschwerden funktionierten im Grundsatz nach dem gleichen Prinzip. Um die unveräußerlichen Grundrechte seiner Bürgerinnen und Bürger zu schützen, müsse der Gesetzgeber, also der Deutsche Bundestag, mehr für den Klimaschutz tun, argumentierten sie, und das Bundesverfassungsgericht sollte feststellen, dass das Klimaschutzgesetz aus diesen Gründen verfassungswidrig sei. Wir wandten uns gegen das im Gesetz ursprünglich festgelegte Klimaschutzziel für das Jahr 2030 und verlangten, dass die Emissionen schneller zu senken wären als vom Gesetz vorgesehen, konkret: so schnell wie möglich bis zur Treibhausgasneutralität. Grundlage unserer Verfassungsbeschwerde waren das aus dem Pariser Abkommen ableitbare CO2-Budget und die Forderung nach einem Reduktionspfad, der mit den Vorgaben des IPCC vereinbar ist.
Und was wir selbst kaum für möglich hielten, gelang: Das Gericht folgte unseren Argumenten, jedenfalls in den zentralen Punkten. Es erklärte das Klimaschutzgesetz für teilweise verfassungswidrig und verpflichtete die Bundesregierung dazu, es bis spätestens zum Ende des Jahres 2022 »nach Maßgabe der Gründe«, die das Gericht aufführte, zu schärfen. Das war ein Paukenschlag, den niemand überhören konnte.
Was auf dieses Urteil folgte, war in unseren Augen ein politisches Schauspiel, das an Absurdität kaum zu überbieten war. Genau die gleichen Politiker und Politikerinnen, die für das unzureichende Gesetz verantwortlich gewesen waren, schienen sich nun über den Beschluss aus Karlsruhe zu freuen. Ihre Kommentare klangen ganz so, als hätten sie immer schon eine strengere Klimapolitik gewollt, sie aber leider, leider nicht in die Tat umsetzen können. Der damalige CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmeier twitterte ein Dankeschön an das Gericht – dabei hatte die Bundesregierung im Verfahren selbst den vier Verfassungsbeschwerden noch klar und vehement widersprochen.[27]
Ob die Verschärfung des Klimaschutzgesetzes, die bald darauf im Mai 2021 durch die Bundesregierung vorgenommen wurde, ausreichen wird, um die Auflagen des Gerichts wirklich zu erfüllen? Ich meine nicht. Selbst unter dem geänderten Klimaschutzgesetz wird Deutschland bis 2030 mehr als 90 Prozent seines CO2-Budgets aufgebraucht haben.[28] Das Bundesverfassungsgericht aber hat nicht irgendeine Verschärfung gefordert. Seine Vorgabe lautet klipp und klar: Klimaschutz muss generationengerecht sein und die wissenschaftlichen Erkenntnisse ernst nehmen. Die Lasten, die sich aus ihm ergeben, müssen wir heute schon zu einem fairen Anteil schultern. Wir dürfen sie nicht unbegrenzt in die Zukunft verschieben. Auch die Deutsche Umwelthilfe ist übrigens der Auffassung, dass das verschärfte Klimaschutzgesetz die Vorgaben aus Karlsruhe noch nicht erfüllt. Im Januar 2022 reichte sie deshalb erneut eine Verfassungsbeschwerde gegen das neue Klimaschutzgesetz ein[29] – die allerdings vom Gericht ohne jede juristische Begründung nicht angenommen wurde. Dagegen läuft nun ein Verfahren in Straßburg vor dem Europäischen Menschengerichtshof.
Doch so viel ist sicher: Es gibt eine Zahl, die uns auch in Zukunft wieder und wieder helfen wird, nachzumessen, ob die Bundesregierung dem Auftrag des Gerichts nachkommt: das CO2-Budget, das Deutschland zur Verfügung steht, wenn wir einen angemessenen Beitrag zur Begrenzung des Klimawandels unter 1,5 Grad leisten wollen – eben so, wie wir es laut Pariser Abkommen tun müssen.





























