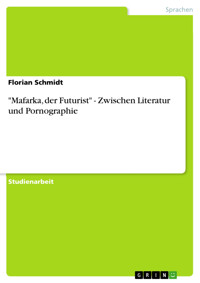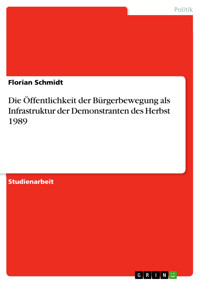15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mietenexplosion, Wohnungsnot, Gentrifizierung – Wohnen ist die soziale Frage unserer Zeit. Der Wohnungsmarkt ist aus den Fugen geraten. Wer die teuren Mieten in den Innenstädten nicht bezahlen kann, wird verdrängt. Die Politik scheint machtlos, der soziale Frieden ist in Gefahr. Florian Schmidt setzt sich schon seit Jahren für soziales Wohnen in den Städten ein, früher als Aktivist, heute als erfolgreicher Berliner Baustadtrat. Er will in der Wohnungspolitik einen Mentalitätswechsel herbeiführen und ruft uns alle auf zum selbstbewussten Kampf für mehr Gemeinwesen und Selbstverwaltung sowie für mehr geteilten Raum und gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Wir holen uns die Stadt zurück
Der Autor
FLORIAN SCHMIDT hat Soziologie, Kunstgeschichte und Volkswirtschaftslehre in Hamburg, Barcelona und Berlin studiert. Seit 2006 ist er Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen, seit 2016 Bezirksstadtrat für Friedrichshain-Kreuzberg, Berlin. Auch als Koordinator und Sprecher verschiedener Initiativen setzte er sich für eine progressive Stadtentwicklung ein.
Das Buch
Bodenspekulationen, Entmietungen und Gentrifizierungen bedrohen die Durchmischung und Vielfalt in deutschen Innenstädten. Angesichts explodierender Mieten haben immer mehr Menschen Angst, sich ihr Zuhause nicht mehr leisten zu können. Die Politik scheint mit der Immobilienwirtschaft unter einer Decke zu stecken und Wachstumsdenken über Mieter:innenrechte zu stellen.
Doch es tut sich was: »Kein Profit mit der Miete« ist der Slogan der neuen mietpolitischen Bewegung in Berlin und anderen Großstädten der Republik. Baustadtrat Florian Schmidt zeigt auf, wie Mieter:innen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen können und von Aktivist:innen unterstützt für eine lebenswerte Stadt der Zukunft kämpfen können – gemeinsam mit der Politik.
Florian Schmidt
Wir holen uns die Stadt zurück
Wie wir uns gegen Mietenwahnsinn und Bodenspekulation wehren können
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
© 2021 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinUmschlaggestaltung: BÜRO JORGE SCHMIDT, MünchenUmschlagmotiv: © Kitty Kleist-Heinrich / Der TagesspiegelE-Book Konvertierung powered by pepyrus.com
ISBN: 978-3-8437-2296-4
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
Vorwort
Bausteine des Neuen
Wenn Wohnungen zu Konsumprodukten werden
Wohnen als soziale Frage unserer Zeit
Gemeinsam sind wir stark
Der entfesselte Markt
Wie Gesetze die Mietrendite befördern
Der Mietendeckel oder das Herumdoktern an Symptomen
Die dramatischen Folgen der Umorganisation von Eigentumsverhältnissen
Eigentum neu denken
Immobilienwirtschaft – ein dekadentes System
Die vermeintliche Normalität der Verdrängung
Ein alternatives Wirtschaftsverständnis
Gentrifizierung
Bauentwickler:innen und die Politik
Spekulation mit Wohnimmobilien
Gesellschaftliches Elend durch knappen Wohnraum
Wie das Konzept »Immobilien als Altersvorsorge« zur Misere beiträgt
»Baut doch endlich, dann gibt es diese Probleme nicht!«
Gemeinwohlbewirtschaftung ist möglich
Gemeinwohl hat Tradition
Hausprojekte im Spiegel der Zeit
Wir machen unser Haus
Vom Hausprojekt zum Genossenschaftsquartier
Politik ist nicht machtlos
Berlin legt vor
Was es für den grundlegenden Wandel braucht
Die Zivilgesellschaft ist gefordert
Rebellion ist Pflicht
Entmietung – der gerechte Zorn der Zivilgesellschaft
Mittler:innen, Macher:innen, Protestierer:innen
Das Vorkaufsrecht als Aufreger und Pionierfeld
Die Rolle von Verkehr und öffentlichem Raum
Shared Spaces, Superblöcke und Begegnungszonen
»Automobilwahnsinn« in den Städten
Umweltgerechtigkeit
Feministische öffentliche Räume
Kleine Visionen zum guten Leben in der Stadt
Wohin wir kommen, wenn alles gut geht
Zwölf Beispiele für besseres Wohnen
Ein Gedankenexperiment
Anleitung für Stadtmacher:innen
Anhang
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Vorwort
Widmung
Für meine Lieblingsvermieterin
Vorwort
Die Städte in Deutschland stehen mit dem Rücken zur Wand. Weil die Mieten explodieren, haben immer mehr Menschen Angst, sich ihr Zuhause nicht mehr leisten zu können. Die Politik scheint machtlos. Spätestens ab 2010 begann die Wohnungskrise in deutschen Großstädten. Wurden etwa in Berlin im Jahr 2007 noch über 100 000 Wohnungen zu bezahlbaren Konditionen zur Neuvermietung angeboten, was 50 Prozent aller angebotenen Wohnungen entspricht, waren es 2013 nur noch 15 000 Wohnungen, also lediglich zwölf Prozent der Angebote.1 Seit zehn Jahren eskaliert die Lage in Berlin und in anderen deutschen Großstädten. Heute gilt: Wer einen alten Mietvertrag hat, kann sich in der Regel über eine günstige Miete freuen. Wer aber umziehen möchte, für den ist heute ein Wohnungswechsel oft keine Option mehr, eine Bunkermentalität ist die Konsequenz.
Seit 2016 bin ich Baustadtrat für Friedrichshain-Kreuzberg, den Bezirk in Berlin mit den höchsten Mietsteigerungen. Hier wohnt die Bevölkerung, die größtenteils jung, international und kreativ ist, dicht beisammen lebt und wenig Einkommen hat. Sie möchte den Mietenwahnsinn nicht länger hinnehmen und rebelliert. Auf diese Weise wurde der Bezirk zum Labor für den Widerstand gegen die Mächte des Wohnungsmarktes und deren Protagonist:innen: große börsennotierte Wohnungsunternehmen, Glücksritter auf der Suche nach dem schnellen Geld, Haus- und Wohnungseigentümer:innen aus aller Welt, die die Mieten nach oben schrauben, und Weltkonzerne, die das hippe Kreuzberg als Teil ihrer Marketingstrategie nutzen und dort sehr hohe Mieten bezahlen können, wo zuvor andere entmietet wurden. Obwohl einige Punktsiege erzielt werden konnten, ahnen viele, dass die Rebellion im Kiez allein keine Lösung bringt, sondern den Ausverkauf der Stadt, der Nachbarschaft und der eigenen vier Wände lediglich verlangsamt. Auch das steigert die Wut der antikapitalistischen Gemeinschaft im traditionell linken Friedrichshain-Kreuzberg.
Ganz konkret gingen politische Maßnahmen und Verordnungen, wie die Ausübung des Vorkaufsrechts und der Milieuschutz, Hand in Hand mit den öffentlichen Protesten gegen Unternehmen wie Deutsche Wohnen, Heimstaden, Google, Amazon, Akelius, die Accentro Real Estate oder die Ideal Versicherung. Durch den Druck der Straße wurden deren Vorhaben über den Haufen geworfen. Auch Proteste gegen Vermieter, die kleinere Ladenbetreiber mit Produkten für die Nachbarschaft durch Ladenbetreiber mit Produkten für Touristen austauschen wollten, waren erfolgreich. Es gab in Friedrichshain-Kreuzberg sogar eine rebellische Zusammenarbeit von Bürgerinitiativen und Politik: Als der Konzern Deutsche Wohnen im Winter 2018 vier Blöcke mit über 700 Wohnungen in der Karl-Marx-Allee erwerben wollte, wurden ihm durch ein spektakuläres Modell, genannt »gestreckter Erwerb«, rund 800 Wohnungen weggeschnappt. Die Mieter:innen übten ihr Vorkaufsrecht aus und verkauften die Wohnungen gleich an eine öffentliche Wohnungsbaugesellschaft weiter. Das Land Berlin investierte rund 50 Millionen Euro, damit in dieser Toplage auch langfristig bezahlbarer Wohnraum erhalten bleibt. Damit hatte die mietenpolitische Revolution in der Prachtallee der DDR ihr Exempel gefunden.
»Kein Profit mit der Miete« ist der Slogan der neuen mietenpolitischen Bewegung in Berlin und anderen deutschen Städten. Vor meinem Amtsantritt als Baustadtrat war ich einige Jahre in unterschiedlichen stadtpolitischen Initiativen aktiv und habe Mieter:inneninitiativen, innovative Baugenossenschaften, Künstler:innenkollektive sowie Gruppen, die Volksentscheide auf den Weg gebracht haben, kennengelernt und unterstützt. Viele dieser Initiativen haben die Politik maßgeblich beeinflusst. 2012 gründeten Aktivist:innen gemeinsam mit Parlamentarier:innen einen runden Tisch zum Stopp des Ausverkaufs von öffentlichen Grundstücken, 2014 entschied die Stadtgesellschaft durch einen Volksentscheid, dass der ehemalige Flughafen Tempelhof nicht bebaut werden soll – die regierende Politik fügte sich mürrisch. 2016 hat die rot-schwarze Regierung, um einen Volksentscheid zur Mietenpolitik zu verhindern, eilig einige Forderungen der Volksentscheidsinitiative in eine Gesetzesreform gegossen. Im Jahr 2019 wurde eine Initiative gegründet, die durch einen Volksentscheid die Verstaatlichung von großen Immobilienunternehmen ermöglichen möchte. Ein Vorstoß, der die öffentliche Debatte in Schwung gebracht hat, und ein Weckruf für alle. Sie nennt sich »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« und versuchte im September 2021, ihre Ziele mit einem Volksbegehren durchzusetzen, über das parallel zur Bundestagswahl abgestimmt wurde.
Die Herausforderungen sind riesig. Es geht um kein geringeres Ziel, als den sozialen Zusammenhalt in den Städten zu erhalten. Ansonsten ist die Gefahr groß, sich bald in segregierten, also nach arm und reich sortierten Städten wiederzufinden. London und Paris lassen grüßen. Niemand will das. Doch Banlieues, soziale Unruhen und abgehängte Bevölkerungsgruppen drohen auch in Deutschland zu entstehen – gerade in Zeiten eines erstarkenden Rechtspopulismus steigt das Risiko, dass sich die Gesellschaft noch weiter spaltet.
Eine urbane Revolution ist daher notwendig. Ich wähle diesen Begriff absichtlich, weil es sich um solch eine radikale gesellschaftliche Veränderung handelt, wohl wissend, dass man unter Revolution eigentlich einen Wandel versteht, der abrupt ist oder sich zumindest in einem relativ kurzen Zeitraum abspielt. Die urbane Revolution wird einen Zeitraum von mindestens zwanzig Jahren erfordern. Sie ist friedlich, und sie bricht Tabus. Sie stellt die Eigentumsfrage und die Frage, wie das Leben in den Städten in Zukunft organisiert sein kann. Und sie kann die Gesellschaft wieder zusammenführen.
Ihre Bausteine sind:
Rebellion und Selbstorganisation als Lebensstil,
mehr nachbarschaftlicher Austausch und Zusammenhalt,
kollektives Eigentum und Selbstverwaltung,
weniger privater Raum, mehr geteilter Raum,
die Vertreibung der Autos aus der Stadt.
Die Akteur:innen dieser Revolution sind:
rebellische stadtpolitische Bewegungen,
radikale, aber pragmatische Politiker:innen,
gemeinwohlorientierte immobilienwirtschaftliche Organisationen.
Aktuell herrschen Panik und euphorische Spannung zugleich. Initiativen kämpfen gegen den Markt, manchmal erfolgreich, oft chancenlos – aber mit ungebrochenem Kampfgeist. Die klassische Immobilienwirtschaft realisiert, dass sie der Buhmann ist, und sucht verzweifelt nach neuen Ideen, um ihr Image aufzubessern. Zugleich freut sie sich über die weiterhin verrückten Märkte, die satte Profite versprechen. Und die Parteien überschlagen sich mit radikalen Vorschlägen.
Das konservative Lager und die klassische Immobilienwirtschaft fordern Deregulierung und eine massive Bauoffensive, um gemäß der reinen Marktlehre die wachsende Nachfrage mit einem erhöhten Angebot zu beruhigen. Allerdings zeigen die Erfahrungen aus Städten wie Paris, London oder Hamburg, dass die Mieten trotzdem nicht sinken. Die linken Parteien hingegen fordern die Regulierung des Marktes und wollen auch neu bauen, aber vor allem Sozialwohnungen. Sie rennen damit dem Geschehen auf den Märkten hinterher. Denn da, wo eine Regulation greift, entsteht ein neues Schlupfloch an anderer Stelle.
Hintergrund der Krise ist – neben der mittlerweile sprichwörtlichen Kapitalflucht von den Finanzmärkten hinein in das sogenannte Betongold – der stetige Zuzug in die Ballungsräume. Wir sprechen auch von der Renaissance der Städte oder dem urbanen Zeitalter.2 Weltweit wollen immer mehr Menschen in die Städte. Der Wohnungsmarkt versagt zwangsläufig, da eine geografische Ballung der Nachfrage zu hohen Boden- und Immobilienpreisen führt. In den Städten gibt es Jobs, Kultur und Entfaltungsmöglichkeiten für alle. Doch wenn es so weiterläuft wie bisher, wird auch in deutschen Städten dieses schöne urbane Leben nur den Wohlhabenden vorbehalten sein. Die europäische Stadt, in der Stadtluft frei macht von sozialen, ethnischen und religiösen Ketten, steht auf dem Spiel.3
Die Politik ist seit Jahren in vielen Bereichen die Sachverwalterin des Elends. Um zu bekämpfen, was den Städten nun droht, reicht es aber nicht aus, an Symptomen herumzudoktern. Es muss vielmehr radikal neu gedacht und umgesteuert werden. Im digitalen Bereich kommen die rebellischen Antworten auf die Datenkraken Google, Amazon und Co aus den Hackerkollektiven. Vergleichbar zeigen diverse Initiativen aus der Stadtgesellschaft innovative Lösungen in der Stadtentwicklung auf. Doch es fehlen die Gesamtschau, der Weitblick und der Mut, systematisch neue Wege zu gehen und diese mit einer realistischen Vision vom zukünftigen Leben zu verknüpfen.
In diesem Buch entwickle ich ein Programm für die Stadt der Zukunft. Es ist aus keiner ideologischen Orientierung heraus entstanden, sondern basiert auf praktischen Erfahrungen in der Stadtentwicklung und wissenschaftlichen Erkenntnissen. Dabei gehe ich auch auf Experimente von der Gemeinwohl-Rebellion ein, die unter dem Label Munizipalismus erstaunliche Innovationen hervorgebracht hat. Gebraucht werden neue Systeme des Wirtschaftens, neue Vorstellungen vom Leben im Stadtraum und neue Ideen, wie man Engagement für die Gemeinschaft fördert. Gestützt werden soll das alles durch neue Formen von demokratischer Verhandlung. An die Stelle von klassischen Sender-Empfänger-Modellen oder aktuell Influenzer-Konsumenten-Modellen treten Feedback-Modelle oder aktuell Confluenzer-Schwarm-Modelle. Fundamental ist die Umstellung von kapitalgetriebenen individuellen Eigentumsmodellen zu gemeinwohlorientierten kollektiven Eigentumsmodellen. So unbekannt wie diese Elemente auf den ersten Blick sind, so überraschend ist ihre Kraft, einen nachhaltigen Wandel hervorzurufen.
Genossenschaften, Hausgemeinschaften, Mieter:innenräte, Nachbarschaftsforen, Stiftungen, gemeinnützige Vereine, kollektive Kunstprojekte, ethische Banken und Pensionskassen gibt es viele. Aber ihre Potenziale zur Umstrukturierung der Stadt und des Lebens in der Stadt bleiben bislang ungenutzt. Der Verdacht liegt nahe, dass Politik und Wirtschaft ihre Macht nicht abgeben wollen. Doch in Wirklichkeit ist es eine Frage des Wissens und des Vertrauens in eine neue Form des Stadtmachens.
Politik und Wirtschaft sitzen auf einem Ast, der immer dünner wird. Neue Wege zu gehen ist für Systeme, in denen viele Akteur:innen seit Langem nach existierenden Regeln zusammenwirken, kaum möglich. Doch die Menschen wollen sich zunehmend selbst helfen. Ohne die aktive Kooperation von Politik und Wirtschaft können sie es jedoch nicht. Das in Berlin erprobte Modell »Die Bewegung treibt die Politik an« trägt auf Dauer nicht. Daher braucht es ein Programm, das neue Prinzipien einführt und Demokratie, Gerechtigkeit und Innovation neu sortiert und als Paket auf eine revolutionäre Reise in eine bessere Zukunft der Städte schickt. Es braucht Städte, in denen Wohnen bedeutet, in einer Nachbarschaft gebraucht zu werden und Entscheidungen als Miteigentümer:innen des Gemeinwesens treffen zu können.
Das Besondere an dem hier vorgeschlagenen Programm ist, dass seine Bausteine schon heute praktisch umgesetzt werden und nur noch zusammengesetzt, skaliert und radikalisiert werden müssen. Alle, die dieses Buch lesen, werden die darin enthaltenen Vorschläge nachvollziehen und sich draußen in der Welt verschiedene Projekte anschauen oder selbst eines ins Leben rufen können. Was fehlt und dringend in Gang gesetzt werden muss, ist eine Politik, die das von mir skizzierte Programm fördert und damit auch die Menschen, die es umsetzen wollen. Denn das Ziel muss ein Programm sein, das zwar von Politik und Staat unterstützt, jedoch von den Menschen selbst umgesetzt und getragen wird.
Als Bezirksstadtrat habe ich in den letzten Jahren versucht, einige Punkte einer neuen gemeinwohlorientierten Stadtpolitik umzusetzen. Auch an vielen anderen Orten gibt es vergleichbare Aktivitäten, wie etwa im munizipalistischen Barcelona, in dem ich einige Jahre gelebt habe. Die Risiken aber, die der Einsatz für einen Systemwandel in der Immobilienwirtschaft mit sich bringt, möchte ich hier nicht verschweigen. Als ich Ende 2016 Bezirksstadtrat in Friedrichshain-Kreuzberg wurde, sagte mir ein Freund: »Das stehst du keine zwei Monate durch.« Damals lachte ich über ihn, doch heute weiß ich, was er meinte.
Die Anfeindungen gegen mich begannen, als klar war, dass ich ernst machen würde mit einer neuen Politik. Zunächst waren sie fast von Ehrfurcht geprägt. Man sah in mir den Investorenschreck und bildete mich als Teufel auf dem Cover einer Immobilienzeitung ab. Nur wenige Wochen später drohte mir ein Investor mit einer 400-Millionen-Euro-Klage. Bald fingen Großkanzleien an, mein Handeln genau unter die Lupe zu nehmen, und die Vermutung wurde gestreut, dass meine Politik in Sachen Vorkaufsrecht rechtswidrig sei.4 Die Rechnung ging nicht auf, da mir die Gerichte recht gaben. Die Chance, mich juristisch anzugreifen und sogar in eine große politische Bredouille zu bringen, brachte schließlich die mehrfache Ausübung des Vorkaufsrechts zugunsten einer Genossenschaft namens Diese e. G. im Jahr 2019. Während sich zuvor die Käufer:innen von Immobilien dem Vorkaufsrecht mit juristischen Mitteln widersetzt hatten, waren es nun politisch motivierte Akteur:innen, die mit geballter Kraft medial und juristisch gegen mich und meine Partner:innen in der Zivilgesellschaft vorgingen. Die Angriffe reichten bis in die Privatsphäre hinein. Die Geschichte erzähle ich genauer in einem eigenen Abschnitt (Das Vorkaufsrecht als Aufreger und Pionierfeld) in Kapitel 6.
Dass am Ende die Unterstützung für das Projekt größer war als der Widerstand und ein Scheitern verhindert werden konnte, hat sicher damit zu tun, dass dem Grundanliegen, Wohnraum vor Spekulation zu schützen, eine breite Mehrheit zustimmt. Und obwohl der Berliner Rechnungshof mein Handeln rügte und die Opposition einen Untersuchungsausschuss zur Diese e. G. im Berliner Abgeordnetenhaus einberufen ließ, sind viele Weggefährten im Rückblick stolz darauf, dass es gelungen ist, dass jetzt 160 Menschen in einer Genossenschaft leben, die sie selbst ins Leben gerufen haben.5
Eines ist auch klar: Wenn die Verwaltung neue Wege geht, indem sie sich z. B. einem bestimmten Vorgehen von Investoren widersetzt, dann läuft sie Gefahr, juristisch zurückgepfiffen zu werden. Dies geschah im Fall der Diese e. G. jedoch nicht. Die von einer FDP-nahen Anwältin initiierten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wurden allesamt eingestellt. Was bleibt, und genau das ist Teil des Kalküls, sind Überschriften in Zeitungen und im Internet, die von Rechtswidrigkeit und Ermittlungen sprechen. Ziel ist es, den politischen Gegner kleinzumachen und seinen Ruf zu ruinieren. Hätte ich mir die Warnung meines Freundes besser zu Herzen nehmen müssen? Ich denke: Nein. Aber ich habe meine Lektion gelernt. Zukünftig werde ich versuchen, präziser zu arbeiten und insbesondere juristisch weniger Angriffsfläche zu bieten.
Bausteine des Neuen
Wenn Wohnungen zu Konsumprodukten werden
In der modernen funktionalen Stadtplanung, die in den 1960er- und 1970er-Jahren in der ganzen Welt um sich griff, wurde das Wohnen mit dem Begriff der Reproduktion in Verbindung gebracht. Das Private war ein Rückzugsort, der sicherstellte, dass die physische und mentale Funktionsfähigkeit des Arbeiters »reproduziert«, also wiederhergestellt wurde. Er erholte sich dort mit Unterstützung »seiner« Hausfrau, die sich um den Nachwuchs kümmerte. Weitere Reproduktionsorte waren Kinderspielplätze oder Bildungseinrichtungen. Öffentliche Verwaltungen oder privatisierte Unternehmen hatten die Aufgabe, urbane Strukturen (Wohnhäuser, Parks, Infrastruktur) aufrechtzuerhalten. Sie wiederum waren kaum Gegenstand von politischen Auseinandersetzungen. Meist war es unproblematisch, dass die Verwaltung Immobilien und den Boden als am Markt handelbare Waren gesetzlich definierte.
Der Wandel hin zu einer individualisierten Gesellschaft setzte schleichend ab den 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts ein. Doch erst mit der Renaissance der Städte spätestens ab den Nullerjahren und einem verstärkten Zuzug in die Städte wurden Wohnungen zum umkämpften Konsumprodukt. Dieser Trend lässt die alte Ordnung der Wohnverhältnisse aus den Fugen geraten. War die moderne Stadtplanung davon ausgegangen, dass jeder an seinem Platzt wohnt, beginnt nun in den Stadtregionen die Sache ungemütlich zu werden. Wer Geld hat, sucht sich seine Traumwohnung im Lieblingsviertel, wer weniger hat, muss schauen, wo er bleibt. Da es beim Thema Wohnen immer auch um die »gute Lage« geht, können nicht alle gleichermaßen etwas vom Kuchen abbekommen. Treibende Kraft ist die konzentrierte Nachfrage nach Wohnraum in der Stadt durch die neue Gewinnerklasse (Manager:innen, Kreative, Erb:innen), die auf die Krise der liberalisierten Finanzmärkte trifft. Es entsteht eine explosive Situation, in der private Unternehmen die Lebenswelten räumlich neu sortieren, um maximalen Profit zu machen. Die alten Strukturen der Stadt, die das Leben ausmachten, werden in einen paradoxen Strudel gezogen. Einerseits sind die urbanen Qualitäten wie die Eckkneipe, der Gemüseladen, die multiethnische Bewohnerschaft und die Künstler:innen das Vermarktungsargument für neue teure Wohnwelten, die von Aktiengesellschaften wie der Accentro Real Estate aufwendig produziert und vermarktet werden. Andererseits werden genau diese Qualitäten mit der schleichenden Aufwertung durch die Immobilienbranche weggespült. Das Wohnen wird zum Kampfplatz ökonomischer Prozesse. Wer in der Nachbarschaft willkommen ist, entscheidet der Markt. Die Aussortierung findet schleichend statt, aber mittlerweile so aggressiv, dass sie nicht mehr stillschweigend hingenommen wird.
Doch die Formen des guten urbanen Lebens stehen nicht im Fokus der Gegenbewegung. Nach der alten Logik der modernen Stadtplanung sind die urbanen Lebensformen nichts weiter als austauschbare Dienstleistungen. Ihr Potenzial als widerständige Lebensformen, die Nachbarschaften zusammenhalten und politische Kraft entfalten können, wird noch nicht erkannt. Geredet wird allein über Möglichkeiten, den Markt durch Verbote und Regulierungen zu bändigen. Oder den Markt durch Neubau zu beruhigen, um Angebot und Nachfrage ins Gleichgewicht zu bringen. Beide Ansätze sind richtig, haben allerdings im Ergebnis wenig Einfluss auf die Höhe der Mieten in der Stadt.
Regulierungen sind notwendig, sie kommen jedoch aus zwei Gründen immer zu spät und entfalten wenig Wirkung. Erstens setzt jede Bremse oder Deckelung der Mietpreise nur auf eine Einschränkung von einfachen Mitnahmeeffekten, die Versorgung mit Wohnraum wird dadurch nicht erhöht. Die Akteur:innen des Marktes sind nämlich schneller und suchen den Profit an einer anderen Stelle. Statt Wohnungen werden Gewerbeimmobilien errichtet, und der Schwarzmarkt für Untervermietung blüht. Zweitens ist Deutschland ein Flächenstaat, was bedeutet, dass viele bau- und mietrechtliche Regeln auf Bundesebene entschieden werden und einheitlich geregelt sind. Da die Interessen der Menschen außerhalb der Städte aber ganz andere sind als die der Stadtbewohner, wird die Politik im Bund und auf Länderebene kaum oder nur verspätet die nötige Konsequenz an den Tag legen, um der Krise der Städte angemessen zu begegnen. Stadtstaaten wie Berlin, Hamburg oder Bremen haben allerdings Vorteile, weil sie als Länder einiges tun können.
Die Idee, dass die steigende Nachfrage nach Wohnraum allein durch Neubau gestillt werden könnte, ist ein Mythos der Marktgläubigen. Denn Städte sind Agglomerationen, also Konzentrierungen von Wirtschaft, Menschen und Aufmerksamkeit. Da Grund und Boden und Gebäude überwiegend in Privatbesitz sind, tendieren die Marktakteur:innen dazu, Städte ständig so zu transformieren, dass sich die Erträge maximieren. Weil diese Akteur:innen sehr unterschiedlich sind, ist es schwierig, die Marktdynamik zu durchschauen. Wohnkomplexe in schlechtem baulichem Zustand können trotz billiger Mieten hohe Erträge abwerfen, gleichzeitig gibt es aber die Strategie, durch weitreichende Umbauten und lukrative Neuvermietungen, denen der Austausch der Mieter:innen vorausgeht, Profit zu machen. Im Unterschied zu Konsumprodukten kann eine Immobilie Gegenstand von Umbau und Neuprogrammierung sein, und dies stets in Verbindung mit hohem Kapitaleinsatz und entsprechenden Gewinnerwartungen.
Wenn die geltenden Gesetze es ermöglichen, können die Mieten trotz geringer Nachfrage gesteigert werden. Wenn die Nachfrage hoch ist, entsteht auf dem Markt oft nur teurer Wohnraum. Das wiederum treibt die Mieten insgesamt weiter nach oben. Wenn Neubauquartiere einzig von privaten Investor:innen erdacht werden, entstehen meist monotone Anlagen für besser situierte Gruppen. Daher haben viele Städte verfügt, dass ein Drittel der Neubauwohnungen zu günstigen Mieten angeboten werden muss. Doch keine Stadt in Deutschland hat es bisher geschafft, den Trend zu steigenden Mieten aufzuhalten. Selbst das für viele jahrelang als vorbildlich geltende Hamburg machte zuletzt negative Schlagzeilen. »Hamburg sieht Rot«, schrieb der Tagesspiegel im Februar 2021. Die Rede ist nicht von der Dominanz der Sozialdemokratie in der Hansestadt, gemeint ist, dass trotz anhaltendem Wohnungsbau die Miet- und Kaufpreise weiterhin steigen. Die Konsequenz: Viele Menschen zieht es ins Umland, was wiederum lange Anfahrten zum Arbeitsplatz, Transportkosten und klimaschädlichen Energieverbrauch zur Folge hat. Ein Teufelskreis.6
Das gute urbane Leben wird von den Menschen vor Ort ermöglicht. »Wir haben den Kiez gemacht, und ihr verkauft ihn«, sagen daher Mieter:innen in Berlin-Kreuzberg. Doch was haben die Menschen gemacht, und warum kann das verkauft werden? Das Besondere am Wohnen ist, dass es – auch in einer von Kommunikationsmedien dominierten Gesellschaft – im realen Raum stattfindet. In der eigenen Wohnung, aber auch in der Nachbarschaft und an anderen besonderen Orten in der Stadt. Das Wohnen des Einzelnen steht im Zusammenhang mit vielen anderen Menschen und Orten im Umfeld. Die Qualität des Wohnens definiert sich daher zu einem großen Teil auch durch die Lebensqualität des Stadtteils und der Stadt. Aber wer und was macht einen Stadtteil aus? Natürlich die Menschen, die verschiedene Angebote gewährleisten. Kleine Läden und Restaurants, Schulen, Bibliotheken, Plätze, Spielplätze, kulturelle Veranstaltungen, soziale und politische Initiativen – alles wird von Menschen gepflegt. Je mehr Engagement in all diese Angebote gesteckt wird, desto höher ist die Lebensqualität, weil die Angebote dann nicht bloße Dienstleistungen sind. Die Lebensqualität sinkt hingegen, wenn viele Angebote von Ketten und Franchisern übernommen werden. McPaper ersetzt den traditionellen Papierwarenladen. Die Metzgerei wird vom Discounter verdrängt. Eine Privatschule nimmt die wohlhabenden Kinder auf, die anderen bleiben auf der öffentlichen Schule. Was bei der Vermarktung der Stadtteile zählt, ist allein die Höhe der Miete, die Immobilien als verkäufliche Ware und nichts sonst.
Wenn die Rendite im Vordergrund steht, werden Läden eben an Discounter vermietet und Bildungsangebote von privaten Unternehmen bereitgestellt. Bei den Wohnungen läuft es schleichender, dafür weit existenzbedrohlicher. Mieten werden erhöht, Kündigungen ausgesprochen. Aus Mietwohnungen werden international handelbare Eigentumswohnungen, also Anlageobjekte. Stück für Stück wandelt sich die Bevölkerungsstruktur: Wohlhabende können sich bedienen, die weniger gut Betuchten haben zu weichen. Die Wohlhabenden wiederum ermöglichen die kommerzielle Umstrukturierung der Angebote im Stadtteil. Auf sie wird alles abgestellt. Natürlich sammeln sich die weniger zahlungskräftigen Haushalte auch irgendwo. Meistens am Stadtrand. Die Folgen sind bekannt.
Doch viele Stadtteile und Städte haben in den letzten Jahrzehnten, teilweise schon vor hundert Jahren, Strukturen aufgebaut, die den beschriebenen negativen Entwicklungen (Aufwertung und Vermarktung) standhalten können: Eigentums- und Organisationsformen etwa, die nicht so ohne Weiteres verkäuflich sind. Hier ein paar konkrete Beispiele.
Die Miete der urigsten Kneipe in meinem Wohnbezirk, in der nachmittags kaum jemand sitzt und in der sogar lärmende Kinder willkommen sind, ist seit Jahren kaum gestiegen. Warum? Das Haus, in dem sie sich befindet, ist ein Altbau-Mehrfamilienhaus und gehört einer Genossenschaft.
Von einer Künstler:innengruppe konnte vor rund zehn Jahren gemeinsam mit einer Bodenstiftung ein Gewerbehof erworben werden. Damit ist er dem Immobilienmarkt entzogen. Seither können hier Handwerker:innen und Künstler:innen zu erschwinglichen Mieten und ohne Angst vor Mieterhöhungen arbeiten sowie soziale Projekte verwirklicht werden. Es gibt eine Kantine, die preiswertes Essen für die Nachbarschaft anbietet, und auch einen Veranstaltungsraum für stadtpolitische Initiativen.
Auf 30 Hektar wurde zwischen 2016 und 2020 in München auf einer ehemaligen Militärfläche ein Quartier mit 1800 Wohnungen errichtet. 600 davon wurden als ökologische Mustersiedlung gebaut, womit die größte Holzbausiedlung Europas errichtet wurde. 50 Prozent der Wohnungen sind gefördert und stehen Haushalten mit geringerer Zahlungsfähigkeit zur Verfügung. Es gibt Genossenschaften, normale Mietshäuser, Eigentumswohnungen und einen großen Quartiersplatz an dem das gemischte Leben stattfindet.
Der Görlitzer Park, ein großer Park in Kreuzberg, wird von bezirklichen Parkmanager:innen und einem Parkrat, der von der Nachbarschaft gewählt wird, betreut und weiterentwickelt. Immobilien auf dem Areal stehen sozialen und kulturellen Projekten zu bezahlbaren Mieten zur Verfügung. Wenn eine Immobilie neu vermietet wird, entscheiden die Nachbar:innen mit, was dort passieren soll.
Das Gängeviertel ist ein Komplex mit alten Häusern in der Innenstadt Hamburgs. Eine Künstler:inneninitiative verhinderte durch eine Besetzung den Verkauf des Areals an private Investoren und initiierte schließlich eine genossenschaftliche Entwicklung. Weit über Hamburg hinaus wurde dieses Beispiel für eine rebellische Zivilgesellschaft bekannt und dafür, welche Rolle Künstler:innen in der Stadtentwicklung spielen können, die besonders von Verdrängung betroffen sind.
Das »Haus der Statistik«, ein großer Komplex mit ehemaligen Bürogebäuden der DDR direkt am Alexanderplatz, wird in einer Kooperation von Bezirksamt, Land Berlin, einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft und einer Initiative, die als Genossenschaft organisiert ist, zu einem neuen Quartier umgewandelt, inklusive eines neuen Rathauses für den Bezirk Berlin-Mitte. Viele Wohnende und Gewerbetreibende sowie soziale und kulturelle Projekte finden hier Raum zu bezahlbaren Konditionen. Es entsteht ein lebendiger Ort, an dem vieles gemeinsam entschieden werden kann.
All die hier aufgeführten Beispiele sind genauso effektiv organisiert wie gewinnorientierte Unternehmen. Aber sie haben darüber hinaus – im Unterschied zu privaten Immobilienunternehmen und auch zu rein staatlichen und bürokratischen Angeboten – einen »Engagement-Faktor«: Sie tragen das Gen der urbanen Lebensqualität in sich, menschliches Engagement in Kombination mit sozialer Vielfalt. Denn soziale Vielfalt, Herzlichkeit und Vertrautheit der Menschen untereinander prägen einen Stadtteil über soziale Grenzen hinweg. Ein Stadtteil, in dem nur Studierende oder nur alte Menschen wohnen, mag Kontaktchancen unter Gleichgesinnten erhöhen, aber er ist als urbane Struktur langweilig. Denn er befördert die kulturelle Abkapselung, ähnlich wie das in den sozialen Medien geschieht.
Vor vierzig Jahren wurden selbst organisierte Projekte noch von Menschen ins Leben gerufen, die auf der Suche nach alternativen Lebensstilen waren – heute sind solche Projekte im Mainstream angekommen. Menschen aus allen Milieus gründen Hausvereine, Genossenschaften und Stiftungen, die sich mit der Bewirtschaftung von Immobilien befassen, und versuchen so, Stadt selbst zu gestalten. Sie schaffen Orte des sozialen Zusammenhalts und Engagements. Begriffe wie Co-Living und Co-Housing bezeichnen in Fachkreisen eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie Menschen selbst etwas betreiben, bauen oder nutzen können. Nachbarschaften oder auch nur ein einzelnes Ladenprojekt können Gegenstand solcher Projekte sein. Allen zugrunde liegt der Wunsch nach Mitmenschlichkeit und Absicherung gegen die Irrungen und Wirrungen des verrückt gewordenen Immobilienmarktes.
Wohnen als soziale Frage unserer Zeit
Im Begrüßungsseminar der Universität Hamburg antwortete ich 1997 auf die Frage, warum ich Soziologie studieren würde: »Um die Welt etwas besser zu machen.« Während des Studiums beschäftigte ich mich zunächst mit den Klassikern der Soziologie von Karl Marx über Max Weber bis hin zu Niklas Luhmann. Von Revolution bis Systemkonformismus war alles dabei. Später, als ich zum Hauptstudium nach Berlin wechselte, widmete ich mich hauptsächlich der Stadtforschung, angeregt durch den Soziologen und Stadtforscher Professor Hartmut Häußermann, dessen Seminare ich damals besuchte. Ausgestattet mit diesem soziologischen Wissen versuche ich seither, die Stadt immer als einen Ort mit gesamtgesellschaftlicher Bedeutung zu verstehen.
Damit bin ich nicht allein. Der Kultursoziologe Andreas Reckwitz, bei dem ich in Hamburg meine Einführungsvorlesungen hatte, beschreibt in seinem Buch Die Gesellschaft der Singularitäten (2017) die gegenwärtige Gesellschaft als eine, die in drei Klassen gegliedert ist. Da gibt es die beruflich Erfolgreichen der aktuellen wissensbasierten Ökonomien; sie leben gern in den urbanen, hippen Stadtteilen der Großstädte und genießen die multikulturellen Gegenden. Laut Reckwitz ist für sie das Wohnen, also wo und wie man wohnt, ein »Baustein des singularistischen Lebensstils«. Orte sind damit »zum Gegenstand einer gesellschaftlichen Valorisierungsdynamik geworden«.7
Seit circa zehn Jahren ist diese neue Mittelklasse die treibende Kraft der Reurbanisierung. Ihre Mitglieder sind hoch mobil und konsumieren freudig Städte, Quartiere und Lifestyle-Angebote, wenn sie wegen neuer beruflicher Herausforderungen den Wohnort wechseln, aber auch wenn sie als Tourist:innen unbekannte Orte aufsuchen. Allerdings sind diese Erfolgreichen nicht alle wohlhabend. Viele leben bewusst prekär, da ihnen Selbstverwirklichung mehr bedeutet als ein dickes Gehalt. Andere haben beides, dickes Gehalt und den urbanen Lebensstil. Diese Klasse ist es, die – egal ob als Studierende in WGs oder als High Professionals – neue Immobilienprodukte nachfragt. Für die einen gibt es Mikrowohnen auf engstem Raum, oft mit All-inclusive-Serviceangeboten, für die anderen die frisch hergerichtete großbürgerliche Altbauwohnung. Doch für viele dieser Gewinnerklasse, die zwar im Job angekommen sind, wird das Wohnen zum Problem. Während man vor zwanzig Jahren zu Beginn des Studiums noch billige Wohnungen fand und manchmal auch danach dort wohnen blieb, sind die Preise mittlerweile so gestiegen, dass die Mietkosten (oder der Erwerb einer Eigentumswohnung) oft deutlich mehr als 30 Prozent des Einkommens verschlingen. Wenn es also mit dem Job schlecht läuft, können die Wohnkosten existenzbedrohlich werden. Oder wenn man sich in einer Wohnung mit altem Mietvertrag und daher niedriger Miete eingerichtet hat, kann der Verlust einer solchen Wohnung das Lebensmodell gefährden. Denn die neue Wohnung ist entweder doppelt so teuer oder halb so groß und liegt statt im Szeneviertel am Stadtrand. Die Angst wohnt also mit, auch bei der Gewinnerklasse.
Ganz anders ergeht es der Klasse, die Reckwitz als die »neue Unterklasse« bezeichnet.8 Sie setzt sich zusammen aus Gruppen, die real ausgegrenzt sind, sowohl materiell als auch kulturell. Ihre Wohnorte sind noch auf den ganzen Stadtraum verteilt. Selbst in dem einen oder anderen Villenviertel gibt es sozialen Wohnungsbau, der dort in den 1970ern bewusst von meist sozialdemokratischen Kommunalverwaltungen platziert wurde. Oft sind die Mieten solcher Wohnungen moderat, der Wohnstandard ist allerdings niedrig. Genau diese Wohnungen stehen nun im Fokus der Immobilienentwickler. Denn niedrige Mieten und niedriger Wohnstandard ergeben ein hohes Wertsteigerungspotenzial. Paradoxerweise ist es aber zugleich die soziale Mischung, die sich in Berlin, Hamburg, München und anderswo auch im multikulturellen Straßenbild spiegelt, die ein Teil der Vermarktungsstrategie ist. Das heißt: Die Menschen mit geringen Einkommen, geringen Mieten und niedrigem Wohnstandard werden gern als Kulisse für ein urbanes Stadtleben bei der Vermarktung herangezogen. Gleichzeitig entsteht bei den Menschen, die finanziell schlechter gestellt sind und sich auch kulturell nicht in die neuen Szenequartiere einfügen, das Gefühl, unerwünscht zu sein. Denn die Angebote des alltäglichen Bedarfs für sie werden zunehmend durch Angebote für die Gewinnerklasse ersetzt. Die Angst vor Verdrängung wird also überlagert von dem Gefühl, benutzt zu werden und unerwünscht zu sein.
Die alte Mittelklasse ist für Reckwitz die dritte Klasse.9 Ihre Situation ist in Bezug auf die Wohnungsfrage sehr speziell. Denn sie ist auf den ersten Blick nicht von den aktuellen Transformationen betroffen. Typische Vertreter:innen sind über fünfzig Jahre alt, wohnen in einem behüteten Wohngebiet, im Ein- oder Mehrfamilienhaus und sind oft Eigentümer:innen der Immobilie. Sie sind sparsam, aber gut ausgestattet mit allen Utensilien, vom Wohnmobil bis zur hochwertigen Kücheneinrichtung. Urlaube sind kostspielig, aber nicht ausschweifend, gern werden Pauschalreisen in alle Welt angetreten. All das beruht auf den guten alten Verhältnissen der wohlstandsgesättigten vergangenen sechzig Jahre. In den Städten mit Wohnungsnot kann diese Mittelklasse genauso von Wohnungsverlust bedroht sein wie andere, aber sie hat den Vorteil, dass das Sparkonto in der Regel gut gefüllt ist. Notfalls kauft man sich eben eine Wohnung. Doch wenn die Preise für Eigentumswohnungen ins Unermessliche steigen, dann wird es selbst für die alte Mittelklasse knapp. Dies ist in Ballungsräumen zunehmend schon der Fall.
Allerdings gibt es auch eine Verknüpfung zwischen der »alten« Mittelklasse und der »neuen« Klasse der Erfolgreichen: das Erben. Nicht wenige Mitglieder der Klasse der Erfolgreichen bekommen von ihren Eltern, die Mitglieder der alten Mittelklasse sind, ein Erbe mit auf den Weg. Auch eine weitere sehr praktische und lebenserleichternde Variante greift immer mehr um sich. Junge Leute, die zum Studium, Arbeiten oder Familiegründen in die Großstädte ziehen, bekommen ihr Erbe früher ausgezahlt, um eine Eigentumswohnung zu erwerben. Diese kann zunächst auch als WG genutzt werden, später auch mal vermietet und dann bei Gelegenheit bezogen oder weiterverkauft werden. Eine gute Sache und ein Anker der Stabilität, gerade wenn man nie so recht weiß, wohin einen das Leben treibt.
Natürlich hat diese Tendenz eine Kehrseite: Das Immobilienprodukt Eigentumswohnung muss in urbanen Kiezen auch produziert werden. Dies bedeutet in sehr vielen Fällen, dass Mietshäuser umgewandelt werden in Häuser mit Eigentumswohnungen, so wie es im sogenannten Wohnungseigentumsgesetz, kurz WEG, geregelt wird. Die Folgen für die Mieter:innen sind drastisch. Wer in einer Eigentumswohnung zur Miete wohnt, muss gehen, wenn der:die Vermieter:in die Wohnung selbst bewohnen will. Das deutsche Mietrecht, das Menschen ein dauerhaftes Wohnrecht gibt und um das man Deutschland international beneidet, wird bei Eigentumswohnungen quasi außer Kraft gesetzt. Ein Riss, der immer größer wird, zieht sich durch die Gesellschaft. Die einen kommen, die anderen müssen gehen. In Zeiten von Wohnungsnot spaltet sich die Gesellschaft entlang der Immobilienverhältnisse. Die Frage ist, ob diese Spaltung als Einzelschicksal im privaten Raum verbucht wird oder ob darin ein gesellschaftliches Problem erkannt wird. Ich werde darauf in den folgenden Kapiteln zurückkommen.
Offensichtlich ist, dass fast alle Menschen von steigenden Mieten und der Umstrukturierung der Eigentumsverhältnisse betroffen sind. Die Produktion der neuen Immobilienverhältnisse ist Teil einer neuen Klassenkonstellation. Jeder kann Opfer werden, manche aber profitieren und noch dazu direkt auf Kosten anderer. Die Mechanismen, die den Immobilienmarkt aktuell kennzeichnen, werde ich an anderer Stelle genauer darstellen. Jedoch bleibt es wichtig, zu erkennen, wie die Menschen aus der Perspektive ihrer Lebensumstände betroffen sind. Denn wenn wir die aktuelle Situation überwinden wollen, dann braucht es einen politischen Willen, der aus der Gesellschaft, also von den Menschen selbst, kommen muss. Aktuell herrscht das Motto »Rette sich, wer kann«. Wenn Menschen hart getroffen werden, so ist dies als privater Schicksalsschlag, ähnlich wie eine Krankheit, irgendwie von jedem:r Einzelnen zu überwinden. Doch wie wäre es, wenn sich Menschen aus allen drei Klassen solidarisieren und die Sache gemeinsam – von Haus zu Haus, von Quartier zu Quartier, von Stadt zu Stadt – in die Hand nehmen würden? Was wäre, wenn das nicht geschieht? Dann würde die Wohnungskrise Stress, soziale Spaltung und im politischen Raum populistische Tendenzen weiter verstärken.
Reckwitz selbst ist zurückhaltend, was Rezepte zur Überwindung der von ihm diagnostizierten Klassenlogik und somit dem Zerfall der modernen Gesellschaft betrifft. Eine Empfehlung, an die man im Feld der Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik anknüpfen kann, gibt er aber. Reckwitz schlägt vor, Projekte umzusetzen, die Mitglieder aller drei Klassen betreffen und einbeziehen, und sieht einen, wie er es nennt, »eingebetteten Liberalismus« als neues Paradigma heraufziehen, der eine neue »Kultur der Reziprozität« befördern könnte.10 Was könnte man also anders machen? Die Menschen zusammenbringen in Projekten, die sich aus ihrem Alltag heraus als sinnvoll darstellen. Projekte, bei denen alle auf Augenhöhe zusammenarbeiten und alle aus ihrer Lage heraus einen Nutzen ziehen können. Aber können Gruppen mit verschiedenen sozialen und kulturellen Ausgangspositionen überhaupt ein gemeinsames Ziel haben? Meine Erfahrungen als Aktivist und Baustadtrat legen nahe, dass es möglich ist. Als Soziologe sage ich: Wir müssen bei den Grundbedürfnissen ansetzen, also zum Beispiel dem Wohnen als solchem und dem Bedürfnis nach existenzieller Sicherheit, oder »Einbettung«, um Reckwitz’ Vokabular zu verwenden. Das Grundbedürfnis nach der Sicherheit, dass die eigenen vier Wände wirklich die eigenen sind, stellt einen guten Ausgangspunkt für eine klassenübergreifende Politik dar.
Gemeinsam sind wir stark
Fragt man Menschen, ob es ein Recht auf Wohnen gibt, würden die meisten wohl Ja sagen. Tatsächlich gibt es in der Deutschen Verfassung dieses Recht nicht. Aber es gibt die Grundrechte auf ein würdiges Dasein, »Die Würde des Menschen ist unantastbar« (Artikel 1), und auf die »Unverletzlichkeit der Wohnung« (Artikel 13). Das Grundrecht auf Wohnen ist in Arbeit, könnte man sagen (siehe Infokasten »Gibt es ein Grundrecht auf Wohnen?«).
Gibt es ein Grundrecht auf Wohnen? Nicht in Deutschland!
Im Jahr 1973 hat die Bundesregierung den UN-Sozialpakt ratifiziert, in dem der Anspruch auf eine angemessene Unterkunft als Menschenrecht verankert ist. Damit hat sich Deutschland verpflichtet, das Recht auf Wohnen umzusetzen. Dass es bei uns Wohnungslosigkeit gibt und viele Menschen zu viel von ihrem Einkommen fürs Wohnen ausgeben müssen, steht außer Zweifel. Es gibt viele Ideen und Maßnahmen, mit denen dagegen vorgegangen werden kann. Bisher mit wenig Erfolg. Juristisch betrachtet können die betroffenen Menschen die Bundesregierung jedoch nicht in die Pflicht nehmen. Denn das Recht auf Wohnen ist zwar völkerrechtlich verankert und auch Bestandteil mehrerer Landesverfassungen, aber eine Möglichkeit zu klagen gibt es nicht. Doch die Bemühungen von Jahrzehnten könnten sich demnächst auszahlen. Im Januar 2021 hat das Europäische Parlament die Forderung nach einem Grundrecht auf Wohnen beschlossen.11 Wie immer ist unklar, was die Europäische Kommission daraus macht. Würde sie den Beschluss des Parlaments umsetzen, würde der Druck auf die Mitgliedsstaaten erheblich steigen, die Wohnungsmisere deutlich konsequenter anzugehen.
Wie könnte ein klassenübergreifendes Projekt aussehen, das beim Grundbedürfnis Wohnen ansetzt? Das Mehrfamilienhaus ist in deutschen Großstädten und auch in anderen Ländern Europas noch immer ein Ort sozialer und klassenübergreifender Koexistenz und Begegnung. Gleiches gilt für viele Stadtteile und Nachbarschaften. Natürlich gibt es reiche und arme Stadtteile, aber überwiegend ist die soziale Mischung größer, als man denkt.
Die europäische Stadt war seit dem Mittelalter ein Ort kultureller und sozialer Vielfalt und Durchmischung. Zuzug von außen war stets Teil ihres Wesens und ihrer Entwicklung, ob nun die Landbevölkerung in die Städte floh (Landflucht) oder Menschen aus fernen Regionen aus politischen oder ökonomischen Gründen in die Städte kamen (Migration). Zugleich leben viele Stadtbewohner:innen nur temporär in einer Stadt, der neue Arbeitsplatz oder familiäre Gründe führen dazu, dass viele Menschen mehrfach im Leben den Ort wechseln. Trotz des ständigen Zu- und Wegzugs bilden Städte, Stadtteile und sogar Häuser Charakteristika heraus, die den Menschen ein Gefühl von Heimat geben.