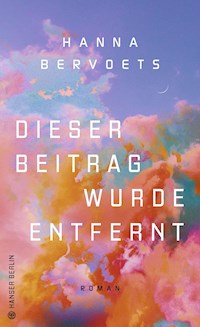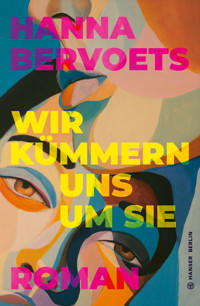
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Einfühlsam und meisterhaft schreibt Hanna Bervoets über die Geschichte einer Liebe, über Freundschaft und über das Thema Frauengesundheit. »Großartig und unverzichtbar!« Lize Spit Die umtriebige Danielle - "Daniel" - de Koster begleitet eine Bekannte zum Arzt und erreicht damit, dass sie nach Jahren unerklärlicher Schmerzen endlich die passende Therapie erhält. Dieser Erfolg spricht sich schnell herum, und schon bald kann sie sich vor Hilfegesuchen von erschöpften, entmutigten Frauen mit falsch diagnostizierten Beschwerden nicht mehr retten. Mit ihrer neuen Liebe Jodie gründet sie eine Stiftung und macht den Kampf für medizinische Gerechtigkeit zu ihrer Lebensaufgabe. Von den einen wird sie dafür als Heldin und Heilige gefeiert, andere betrachten ihre Taten mit Skepsis. Als Daniel unerwartet stirbt, sucht Jodie nach Antworten in der Lebensgeschichte und den Freundschaften ihrer großen Liebe. Wir kümmern uns um Sie ist ein klug komponierter, tief berührender Roman über Liebe, Trauma, Trauer und Schmerz – und den unermesslichen Wert selbstgewählter Gemeinschaft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 855
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Einfühlsam und meisterhaft schreibt Hanna Bervoets über die Geschichte einer Liebe, über Freundschaft und über das Thema Frauengesundheit. »Großartig und unverzichtbar!« Lize SpitDie umtriebige Danielle — »Daniel« — de Koster begleitet eine Bekannte zum Arzt und erreicht damit, dass sie nach Jahren unerklärlicher Schmerzen endlich die passende Therapie erhält. Dieser Erfolg spricht sich schnell herum, und schon bald kann sie sich vor Hilfegesuchen von erschöpften, entmutigten Frauen mit falsch diagnostizierten Beschwerden nicht mehr retten. Mit ihrer neuen Liebe Jodie gründet sie eine Stiftung und macht den Kampf für medizinische Gerechtigkeit zu ihrer Lebensaufgabe. Von den einen wird sie dafür als Heldin und Heilige gefeiert, andere betrachten ihre Taten mit Skepsis. Als Daniel unerwartet stirbt, sucht Jodie nach Antworten in der Lebensgeschichte und den Freundschaften ihrer großen Liebe. Wir kümmern uns um Sie ist ein klug komponierter, tief berührender Roman über Liebe, Trauma, Trauer und Schmerz — und den unermesslichen Wert selbstgewählter Gemeinschaft.
Hanna Bervoets
Wir kümmern uns um Sie
Roman
Aus dem Niederländischen von Lisa Mensing
Hanser Berlin
So sah der Unterleib meiner Mutter von innen aus, als ich die Liebe meines Lebens kennenlernte: Die Gebärmutter war geschwollen und mit der Blase verklebt. Der linke Eierstock war mit dem Eileiter verwachsen, im rechten Eierstock befand sich eine Zyste mit zähem, rotem Inhalt. Ein rosaroter Gewebestrang, der aus der Rückseite der Vagina ragte, klemmte den Mastdarm ab, und auf dem Bauchfell befanden sich stellenweise schleimige, dunkle Blasen, kleine Knollen, die aussahen, als könnten sie jederzeit platzen — meine Mutter wusste von alledem nichts. Sie wusste nur, dass sie ständig Schmerzen hatte, jeden Tag spürte sie starke Stiche, die in ihre Leistengegend ausstrahlten. Manchmal wirkte es fast so, als wären die Oberschenkel die Quelle allen Übels, als kämen die Stiche von dort, aber meine Mutter wusste, dass das nicht stimmen konnte, denn als sie in meinem Alter gewesen war, hatte sie die Schmerzen bereits gehabt, wenn auch nur einmal pro Monat zur Menstruation.
Das gehöre dazu, hatten die anderen Frauen immer behauptet. Doch nachdem mein Bruder zur Welt gekommen war, wurden die Unterleibsschmerzen sogar stärker. Manchmal hielten sie tagelang an, auch wenn meine Mutter längst nicht mehr blutete. Im Laufe der Jahre wurden aus den anfänglichen drei Tagen vier Tage, sieben Tage, zwei Wochen, bis es keinen einzigen Tag im Monat mehr gab, an dem sie schmerzfrei war, an dem es sich nicht so anfühlte, als hätte jemand zwei große Angelhaken von innen in ihre Bauchdecke geschlagen, an deren Nylondrähten, die aus ihrer Vulva ragten, er nun mit sadistischem Vergnügen zog. So beschrieb meine Mutter das, nachdem sie auf Tante Ines’ Hochzeit ein paar Piña coladas getrunken hatte.
Daniel gegenüber erwähnte meine Mutter die Angelhaken nicht.
Ich hatte morgens Apfelkuchen bei einem Bäcker gekauft, zu dem wir nur gingen, wenn es etwas zu feiern gab, war jedoch die Einzige, die sich ein Stück davon nahm. Daniel saß in unserem Sessel, leicht vorgebeugt, die Unterarme auf die Knie gestützt, wie eine Fußballerin auf der Ersatzbank, die kurz vor Spielende immer noch nicht eingewechselt worden war.
Ich konnte meinen Blick nicht von diesen Armen lösen.
Unser Sessel war für Daniel zu klein, zu niedrig; sie saß ziemlich sicher unbequem, doch beschwerte sich nicht, stattdessen bedankte sie sich ausgiebig für den Kaffee, den ich extra für sie gekocht hatte (meine Mutter und ich tranken keinen Kaffee), sie habe hoffentlich keine Umstände gemacht?
Ihre Telefonnummer hatte ich aus einem Forum. Übrigens, schrieb die Person, die mir den Tipp gegeben hatte, in einer Privatnachricht: Sie ist ein bisschen speziell, aber das musst du einfach ignorieren. Daniel hatte nach vier, fünf Fragen, die sie meiner Mutter gestellt hatte, genug Informationen. »Ich gebe Ihnen den Namen einer Gynäkologin«, sagte sie bestimmt. »Sie sollten einen Termin bei ihr vereinbaren.«
»Wir waren schon bei einem Gynäkologen«, schaltete ich mich vorsichtig ein.
»Sogar bei zweien!«, sagte meine Mutter, und Daniel nickte. »Das hier ist eine andere Gynäkologin«, erklärte sie. »Die weiß mehr, macht andere Untersuchungen. Haben Sie vielleicht einen Stift? Dann schreibe ich auf, wo Sie sich melden müssen.«
Einen Stift, dachte ich. Natürlich, warum hatte ich daran nicht vorher gedacht? Ich stand schnell auf, um einen aus dem Fernsehschrank zu holen, den wir gerade erst abbezahlt hatten, ein imposantes weißes Ding, das im Showroom etwas kleiner gewirkt hatte und nach der Lieferung unsere ganze Wand in Beschlag nahm; der Flachbildfernseher stand verloren obendrauf, unsere Porzellankätzchen wurden von der Leere verschluckt: »Schicker Schrank«, sagte Daniel nichtsdestotrotz, und inzwischen glaube ich, dass sie das sogar ernst meinte.
»Da hast du es«, sagte meine Mutter triumphierend und lächelte Daniel zu, die gerade mehr oder weniger zufällig ihr Vertrauen gewonnen hatte.
Ich selbst traute mich kaum, Daniel anzusehen, als ich ihr den Kugelschreiber reichte. Nicht nur weil sie Daniel de Koster war, eine Frau, über die ich schon so viel Positives gelesen hatte. Sondern auch wegen ihrer Art zu sitzen und ihrer Kleidung. Sie trug eine unauffällige Jeans — eine weite, obwohl eng aktuell in Mode war — und ein weißes T-Shirt mit hochgekrempelten Ärmeln. Schon beim Öffnen der Haustür hatte mich das gleiche süße Unbehagen übermannt, das ich damals bei meiner Sportlehrerin verspürt hatte. Auch Frau Janssen schaute ich damals nie in die Augen, weil ich vermutete, dass sie etwas bemerken könnte: Würde ich sie zu direkt ansehen, würde sie mich ertappen, auch wenn ich damals noch nicht genau wusste, bei was.
»Sorgst du dafür, dass ihr Hausarzt sie überweist?«, fragte Daniel, als ich wieder neben meiner Mutter auf dem Sofa saß. Sie blickte mich an, ich spürte, wie ich rot wurde, aber starrte unentwegt weiter auf ihre Oberarme, die auf eine fast lässige Art muskulös waren. Jedes Mal wenn Daniel sich anders hinsetzte und ihre Ellbogen erneut auf den Knien platzierte, rieb der hochgekrempelte Stoff des T-Shirts leicht über ihren Bizeps. Ich stellte mir vor, wie ich mit meinem Handrücken über die blassen, hochstehenden Härchen strich. »Das ist wichtig«, sagte Daniel, sie klang auf einmal streng. »Deine Mutter muss wirklich genau zu dieser Spezialistin, okay, Jodie?«
»Wird erledigt!«, antwortete ich, aber ich sagte es etwas zu zackig (wird erledigt, Sergeant!). Ich frage mich immer noch, ob Daniel mir an jenem Nachmittag glaubte. Glaubte sie wirklich, dass wir es ohne sie schaffen würden? Und wenn meine Mutter nichts gesagt hätte, wäre sie dann einfach aufgestanden? Nochmals vielen Dank für den Kaffee, sagt mir Bescheid, wie es gelaufen ist.
Manchmal denke ich, dass es genau so gekommen wäre. Ja, manchmal denke ich, dass Daniel sich wirklich verabschiedet hätte, gerade weil sie gern geblieben wäre.
Aber meine Mutter sagte: »Ich habe gehört, dass Sie die Leute manchmal auch zum Hausarzt begleiten.« Ich nickte, denn das wusste sie von mir. »Stimmt das?«
In meiner Erinnerung passierte in diesem Moment etwas in Daniels Gesicht. Ich schließe nicht aus, dass spätere Erlebnisse das Bild verzerrt haben — es ist gute zwanzig Jahre her, dass Daniel zum ersten Mal bei uns zu Hause war —, doch wenn ich daran zurückdenke, wie sie da in unserem besten Sessel saß, dann meine ich zu erkennen, wie ihre Professionalität ganz kurz weicht, als meine Mutter sie darum bittet, auch sie zu begleiten, und wie sie ein kleines, stolzes Lächeln zu unterdrücken versucht, dabei aber grandios scheitert.
Als Daniel starb, hatte meine Mutter schon seit Jahren keine Gebärmutter mehr. Auch keine Eierstöcke. Und sie musste ein Stück ihres Darms entfernen lassen und hatte Gicht bekommen. Dafür tat ihr der Unterleib nicht mehr weh. Wenn ich hörte, wie sie über steife Finger klagte, darüber, dass sie die Seiten des Stadtanzeigers kaum noch umblättern konnte — das Blatt war seit der Neuausrichtung sowieso vollkommen nutzlos —, dann fragte ich mich, ob sie noch wusste, wie viel größer ihr Leid einmal gewesen war und dass sie damals Sachen gesagt hatte wie: »Wenn ich mich nächstes Jahr an meinem Geburtstag nicht besser fühle, dann marschiere ich einfach ins Meer.«
In gewisser Weise hatte Daniel diese Leiden gelindert. Aber als ich meine Mutter anrief, um ihr zu erzählen, dass Daniel nicht mehr lebte, reagierte sie anfangs recht gefasst. »Sie war ein sehr besonderer Mensch«, war alles, was sie sagte. Ich dachte, dabei würde sie es belassen, bei dieser Lakonie, die sie mit zweiundsechzig immer noch an den Tag legte — vor allem, wenn es um Daniel ging. Ich hatte es schon lange aufgegeben, ihr ausführlich von unserem gemeinsamen Leben zu erzählen, ich hob mir meine Energie lieber auf, um einigermaßen geduldig auf ihre Geschichten über den schlecht erzogenen Zwergspitz ihres Nachbarn reagieren zu können. Doch kurz bevor ich auflegte, an jenem Morgen nach Daniels Tod, hörte ich, wie meine Mutter noch ein Geräusch machte. Etwas zwischen einem tiefen Seufzen und einem Klagelaut, das vermutlich nicht für mich bestimmt gewesen war. Dennoch blieb das traurige Ächzen für den Rest des Tages hier im Haus hängen, bekam Beifall vom brummenden Kühlschrank, von den rauschenden Wasserleitungen und dem heulenden Durchlauferhitzer.
Ich konnte es mir nicht erlauben mitzuweinen, dachte ich an diesem Tag, der jede Vorstellungskraft überstieg. Ich musste Dinge erledigen, Sachen regeln, denn, ja, meine Partnerin war gestorben. In einem anderen, traditionelleren Leben wäre ich jetzt Witwe gewesen, ich hingegen wusste nicht, ob Daniel ein Testament hatte, geschweige denn, wo es liegen könnte, wie sie begraben werden wollte und wen ich alles einladen sollte: Damals verstand ich noch nicht mal, wie es überhaupt passiert war.
»Ich weiß es nicht genau«, hatte ich morgens der Nachbarin gestanden.
Genau das hatte ich auch meiner Mutter gesagt, kurz bevor ihr dieser Laut entfloh.
Das alles ist jetzt zwei Jahre her. Das heißt, gestern vor genau zwei Jahren haben wir Abschied von meiner großen Liebe genommen, in einem Saal voller Freunde und Fremder. Es gibt immer noch einiges, was ich nicht verstehe, aber ich weiß inzwischen mehr als damals, und heute Morgen dachte ich zum ersten Mal: Vielleicht weiß ich jetzt genug.
Molenstraat (I)
1
Als Daniel noch lebte, gingen wir nur selten in das kleine Zimmer unten im Erdgeschoss, das wir das »Archivkabuff« getauft hatten. Es war staubig und stickig, und das einzige Fenster konnte man nicht mehr erreichen, dafür war der Raum zu voll. An die rechte Wand hatten wir ein Regal gestellt, ein billiges Teil, das ihr in der heruntergekommenen Wohnung, in der Daniel bis zu unserem Umzug gewohnt hatte, gleichzeitig als Bücherregal und als Wäscheständer gedient hatte. Schon bald wurde es von uns mit »Archivmaterial« befüllt — mit Daniels, mit unserem gemeinsamen und mit dem unseres einzigen Kindes: Stiftung Lucille. Danach wurde neuer Krempel zuerst sorgfältig vor dem Regal gestapelt, als wären es Opfergaben für ein bunt bestücktes Totem, doch im Laufe der Jahre wurden wir immer nachlässiger und stapelten Kisten aufs Geratewohl aufeinander; leere Kisten, volle Kisten, Sachen, die wir behalten wollten und Sachen, die wir einfach nicht wegwerfen konnten (zwei völlig unterschiedliche Kategorien). Deshalb konnte man eigentlich keinen Fuß mehr ins Archiv setzen.
Als ich letztes Jahr den Entschluss fasste, ein paar Kisten zu öffnen, hätte ich also am besten erst mal gründlich aufräumen und putzen sollen, damit ich nicht bei jeder Bewegung eine Staubwolke einatmete, aber das tat ich nicht. Zu faul vielleicht. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, wie oft ich unser Archivkabuff in den folgenden Monaten betreten würde. Um mich nicht zu lange dort aufhalten zu müssen, nahm ich immer nur einen Umzugskarton mit, eine Obstkiste, zwei oder auch mal drei Fotoalben, um sie in Ruhe am Küchentisch anzuschauen. Mittlerweile habe ich die meisten Kisten, Kartons und Ordner sogar zweimal durchstöbert.
Beim ersten Mal bin ich nicht besonders systematisch vorgegangen. Ich räume auf, redete ich mir selbst ein. Aber die Wahrheit war: Schon allein Daniels Hefte, diese klecksige Handschrift, die sie oft selbst nicht entziffern konnte (»Hey Jodie, was meinst du, was steht hier auf dem Einkaufszettel?«), erzeugte ein Gefühl der Nähe, das mir ihre Kleidung, ihre Zeitschriften und Kurzhanteln nach einem Jahr nicht mehr verschaffen konnten. Von Staub bedeckte Gegenstände verraten, dass sie ihren Besitzer verloren haben. Daniels alte Aufzeichnungen hingegen, ihre Notizen über Informationssuchende, haben jahrzehntelang kein Sonnenlicht gesehen und machen trotzdem den Anschein, als wären sie erst gestern geschrieben worden. Dadurch bekommen sie etwas Reizvolles, Vogelfüße im Schnee, die zum Spurensuchen ermutigen, aber angekommen am Waldrand, bricht die Spur plötzlich ab, scheint der Vogel über den Abhang geflogen zu sein.
Als ich unser Archiv das zweite Mal durchforstete — ein paar Monate nach dem Öffnen des ersten Schuhkartons —, ging ich systematischer vor. Ich suchte nach bestimmten Fotos, Abschriften, Notizen; Beweisstücke für meine Vermutungen, Hinweise zur Bestätigung der Geschichten, die andere mir inzwischen erzählt hatten, und diesmal war ich neugierig, ja sogar gierig gespannt, bis ich letzte Woche dann doch beschlossen habe, unser Archivkabuff aufzuräumen und zu putzen.
Ich habe gesaugt, mit Mundschutz das Regal gewischt, leere Kisten entsorgt. Ich habe Ordner aufgereiht, Obstkisten aufeinandergestapelt und ihren Inhalt noch mal entstaubt; danach habe ich das Zimmer abgeschlossen und nur ein paar Fotos vor dem Winterschlaf gerettet, zu dem die Gegenstände in der Dunkelheit wieder verurteilt wurden.
Die Fotos, die jetzt vor mir liegen. Abgesehen von ein paar Polaroids stammen sie alle aus der Ära vor dem Smartphone. Daniel als Studentin, zwischen zwei geschmückten Bäumen im Park (ist es nicht ein Wunder der Natur, dass das Lächeln einer Person auch nach Jahrzehnten gleich bleibt? Ich möchte meinen Kopf an ihren Hals schmiegen, damit sie ihre Arme um mich legen kann — oder nein, die breit lächelnde Daniel im Park ist erst Anfang zwanzig, würde sie jetzt vor mir stehen, dann würde wahrscheinlich ich sie festhalten und nicht sie mich). Ich, in der baufälligen Wohnung, als ich noch lange Haare hatte (oh, wie ich damals herumlief).
Barbara und Nettie an einem Silvesterabend (nein, das hebe ich mir für später auf). Daniel am Herd, Daniel auf dem Sofa, eine Nahaufnahme von Daniel, Daniel, die einen Fuß auf einem kleinen Generator platziert hat, triumphierend lächelnd, als posierte sie mit einem erlegten Wildschwein, auch dieses schräge Foto weiß ich zu schätzen, aber das hier, das ist mein unangefochtener Favorit: ein Gruppenfoto, von Daniel, Sjoerd, meinem Bruder und mir, aufgenommen am Tag unseres Umzugs.
Wie wär es, wenn ich damit anfange?
Ja, wie wär es, wenn ich einfach in der Mitte anfange, mit einer Zeit, die in meiner Erinnerung absolut sorglos war: unsere ersten drei Jahre hier, in der Molenstraat 15.
Achtzehn Jahre zuvor, August 2006, vielleicht der wärmste Tag des Jahres. Auf unserem Umzugsfoto trage ich Bermudashorts, die ich schon lange nicht mehr besitze. Daniel hat eine Jeans an, deren Beine sie selbst abgeschnitten hat, weiße Fransen kitzeln ihre kräftigen Knie. Das verleiht ihr etwas Jugendliches, sie sieht ungefähr fünf Jahre jünger aus, als sie in Wirklichkeit war. Ich selbst habe die Augen zugekniffen, weil wir direkt in die Sonne schauen, hinter mir steht mein jüngerer Bruder Rohan, seine Hände liegen auf meinen Schultern; eine väterliche Geste, die mich mittlerweile rührt, und neben meinem Bruder steht Sjoerd, einer von Daniels wenigen Freunden, der uns regelmäßig zu Hause besucht hat. Wir posieren im Garten vor den Glasschiebetüren zum Wohnzimmer und heben strahlend unsere Plastikbecher. Wenn man genau hinsieht, kann man erkennen, dass Daniels Becher schon fast leer ist. Wir wollten nicht, dass sie mithalf, und sie wollte auch nicht mithelfen, glaube ich, aber andere mussten es für sie aussprechen: Daniel, du hebst nichts, okay, du kümmerst dich um die Getränke. Ihre Cocktails schmeckten wirklich scheußlich. Das Gebräu sollte einen »Tequila Sunrise« darstellen, aber wir hatten keinen Orangensaft und keine Grenadine, und die Zitrone hatte Daniel der Einfachheit halber durch einen Schuss Apfelsaft ersetzt — und so standen wir um fünfzehn Uhr da und stießen quasi mit Tequila pur an.
Barbara hat das Foto gemacht. Sie kam mittags irgendwann angeradelt, daran erinnere ich mich noch, und dann veränderte sich etwas, wie es öfter geschah, wenn Barbara auftauchte. Daniel verhielt sich anders. Als würde sich die Person, die sie bei Barbara war oder mal gewesen war, von der Person unterscheiden, die sie bei mir war, weshalb sie jetzt versuchen musste, einen Kompromiss für ihr Handeln und ihre Intonation zu finden. Es lief immer darauf hinaus, dass sie sich zu sehr ins Zeug legte. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass es an jenem Tag auch an den besonders starken Cocktails lag, aber Daniel fing plötzlich an, Barbara dabei zu helfen, die Kisten, die noch draußen standen, ins Haus zu tragen. Barbara ließ das unkommentiert. Ich fand das merkwürdig, sie kannte Daniel von uns allen am längsten und war zudem Ärztin, gerade sie musste wissen, dass das nicht gut war, dass die starken, braungebrannten Oberarme, die Daniel mit täglichem Krafttraining stählte, nichts über den Zustand ihres untersten Rückenwirbels und das verwachsene Steißbein aussagten, die eine Folge ihres Jahre zurückliegenden Unfalls waren. Aber die beiden zogen es bestens gelaunt durch: Abwechselnd hoben Daniel und Barbara Kisten in der Einfahrt hoch und schwatzten dabei wie Bäuerinnen auf dem Weg zum Markt.
»Bisschen übermutig, oder?«, sagte Sjoerd, als er bemerkte, dass ich die beiden besorgt beobachtete.
»Schon irgendwie«, sagte ich. »Warum sagt Barbara denn nichts dazu?«
Sjoerd zuckte mit den Schultern. »Würde Daniel denn auf sie hören?«
Abends bestellten wir thailändisches Essen, damals war das noch etwas Besonderes, aber wir hatten ja auch was zu feiern. Rohan hatte die Tischbeine an die Platte geschraubt, alle Stühle standen an ihrem Platz, Sjoerd hatte Pappteller mitgebracht, ein Partyset mit silbernen Punkten (er tat geheimnisvoll, aber es war offensichtlich, dass er die Teller extra für diesen Anlass gekauft hatte). Unsere Gesellschaft überlegte, wie man unser neues Haus am besten einrichten könne. Es war groß, wenn auch etwas kleiner als die heruntergekommene Wohnung, aus der wir kamen, dafür hatten wir eine Zentralheizung, einen Garten und sogar einen Wintergarten — ich konnte es kaum fassen, wie luxuriös wir in den nächsten Jahren leben würden. Unten sollte natürlich das Wohnzimmer eingerichtet werden, der Esstisch müsste noch etwas verschoben werden: »Vielleicht in die Ecke in der Küche«, sagte ich, aber Barbara schüttelte den Kopf.
»Zu eng«, sagte sie energisch. »Wäre schade um den Raum.«
Abgesehen vom Wohnzimmer hatten wir noch vier weitere Zimmer. Oben und unten jeweils ein Büro, wurde am Tisch vorgeschlagen: Oder wollten wir etwa auch beim Arbeiten nebeneinandersitzen?
Daniel und ich lachten schelmisch. Unter dem Tisch griff ich nach ihrer Hand.
Das Schlafzimmer nach hinten raus, meinten Sjoerd und mein Bruder, die morgens in der Berichterstattung über die Tour de France ein gemeinsames Thema gefunden hatten (ganz schön nachgelassen, seitdem der und der nicht mehr dabei ist) und seitdem rührend einträchtig auftraten.
»Aber nach hinten raus kann es schon ziemlich laut sein«, sagte Barbara. »Die Leute grillen, schmeißen Partys.«
»Ich hoffe doch, dass wir dann selbst auf diesen Partys sind«, sagte Daniel, bevor sie einen Schluck Bier trank.
Das war ziemlicher Quatsch. Cooles Getue oder Übermut, alle am Tisch, abgesehen von meinem Bruder vielleicht, wussten, dass Daniel nicht zu Nachbarschaftsfesten gehen würde.
»Das ist die richtige Einstellung«, sagte Sjoerd trotzdem, und als Rohan danach zum x-ten Mal von Holzfensterbänken anfing, die die »abscheulichen« Kunststoffdinger unter unseren Fenstern ersetzen sollten, hoben wir schnell unsere Gläser, um ihm das Wort abzuschneiden: »Ja-haaa!«
In der Zwischenzeit hielt Daniel sich an der Tischkante fest, um nach hinten kippeln zu können. So saß sie damals gerne; irgendwie muss das eine bequeme Position für sie gewesen sein. Ich wusste, dass sie das nur machte, wenn sie entspannt war, und sie war bestimmt schon müde, aber ich konnte sehen, dass ihr das Gespräch, an dem sie selbst kaum noch teilnahm, gefiel. Kurz sah sie mich an. Und sie lächelte verschwörerisch, denn wir hatten natürlich längst entschieden, wie wir dieses Haus einrichten würden. Das Schlafzimmer zur Straße raus, wir würden ein neues Bett kaufen, ein Boxspringbett, die teuerste gemeinsame Anschaffung bisher, dann hätte jeder eine eigene Matratze, sie eine weiche, ich eine extraharte — so würde sie sich nachts, ohne sich schlecht zu fühlen, herumwälzen können. Die beiden anderen Räume oben sollten zusammen unser Büro werden und das übrige Zimmer im Erdgeschoss als Lagerraum für Daniels Kisten aus dem begehbaren Schrank in der alten Wohnung dienen — und für das noch junge Archiv der Stiftung Lucille. Wir nahmen an, dass das Archiv in den kommenden Jahren schnell wachsen würde (kein Wunschdenken, damals lief es einfach gut), und den Schuppen konnten wir dafür nicht verwenden, denn wir hatten uns vorgenommen, dort zwei Kanus unterzubringen. Zwei Kanus, vielleicht noch ein Schlauchboot und eventuell einen Generator, denn Daniel hatte große Pläne für unseren Garten: Sie wollte eine kleine Felsformation anlegen lassen, mit exotischen Moosen und einem Springbrunnen. »Ich wollte immer schon einen Springbrunnen haben«, hatte sie nach unserer ersten Besichtigung gesagt, und ich hatte sie ausgelacht: »Was, so ein hässliches Teil?«
Unsere Runde reagierte genauso, als sie von der Idee hörte. Ich hatte gewusst, dass das Thema zur guten Stimmung beitragen würde; Daniel, die schon immer von einem Springbrunnen im Garten geträumt hatte, das passte nicht zu dem Bild, das sie von ihr hatten. »Erzähl mal von deinen Gartenplänen«, sagte ich deshalb, während ich uns zum letzten Mal nachschenkte. Und Daniel biss an. Sie wusste, was sie zu tun hatte, mit fein dosiertem Selbstspott erzählte sie, wie sie sich den Springbrunnen vorstellte — »Geplätscher beruhigt mich« —, und trug noch etwas dicker auf: »Ich denke über bunte Lämpchen im Wasser nach, grün, orange, blau.« Ich lachte, die anderen lachten, und Daniel lachte am lautesten, denn sie schaute sich um und sah, dass sie geliebt wurde.
»Bist du glücklich?«, fragte sie an jenem Abend, als wir zusammen auf unserer alten Matratze im Wohnzimmer lagen. Wir betrachteten unsere neue Zimmerdecke, mein Kopf lag auf Daniels Oberarm, es war immer noch extrem warm, deshalb schliefen wir nur unter einem Laken.
»Ja«, sagte ich etwas albern. »Endlich eine Zentralheizung.«
»Aber ansonsten?«, fragte sie, und sie klang heiser, was häufiger passierte, wenn sie getrunken hatte.
»Was meinst du?«
»Mit mir, mit deinem Leben, bist du glücklich mit allem, so wie es ist?«
Sie stellte mir eine große Frage, und ich verstand sie nicht. Das soll heißen, dass mich das Timing irritierte. Wir hatten uns nach einem schönen Abend gerade fröhlich von unseren Freunden verabschiedet, und wir hatten einen erfolgreichen, aber auch absolut anstrengenden Tag hinter uns, und ich dachte, dass sie, genau wie ich, schon fast eingeschlafen war. Eine große Frage verdient eine große Antwort. Aber dafür hatte ich keine Energie mehr, ich war schlaftrunken oder auch einfach nur betrunken, vielleicht sogar etwas verärgert, weil Daniel, die sonst nie scharf auf solche Konversationen war, etwas an mir zu hinterfragen schien, auch wenn ich nicht genau wusste, was.
»Ja«, sagte ich leise. »Ich bin superglücklich, echt« — und das war auf keinen Fall gelogen. Aber ich fragte nicht zurück, und bevor ich wirklich einschlief, spürte ich den Hauch eines Schuldgefühls, es war das gleiche Schuldgefühl, das mich in jener Zeit hin und wieder überfiel, wenn Daniel mir einen Orgasmus beschert hatte, ich jedoch nach allzu langem Fingern die Lust verlor, auch sie zum Höhepunkt zu bringen, und meinen Arm zurückzog, um ihn subtil, aber liebevoll um sie zu legen.
Mittlerweile tut mir meine Antwort leid. Nicht weil ich Daniel danach nie wieder gesagt hätte, wie glücklich ich mit ihr war — ich liebe dich!, manchmal mit großer Geste, genauso oft zwischen Tür und Angel, von einer plötzlichen Rührung erfasst; ihr Arm um meine Schultern, ihr bedauernder Blick, wenn ihr das Croissant mit der mit Butter bestrichenen Seite auf den Boden gefallen war —, aber in dem Moment, dort auf der Matratze, war ich zu faul, zu kurz angebunden gewesen. Und das, obwohl ich damals ziemlich glücklich war: mit Daniel, mit unserem Leben; damit, wie alles war — vielleicht war ich sogar glücklicher gewesen als je zuvor. Wenn ich jetzt an diese Nacht zurückdenke, stelle ich mir vor, wie Daniel wach liegt, nachdem ich eingeschlafen bin, die Lüsterklemmen anstarrt, die aus unserer neuen Decke hängen, obwohl sie eigentlich von Kanus und Springbrunnen träumen sollte. Dieser Gedanke trifft mich, weckt die naive Neigung in mir (»so bin ich überhaupt nicht!«), mich ans Übernatürliche zu wenden: Darf ich sie vielleicht noch einmal ganz kurz sehen? Nur für eine Stunde, bitte, für ein paar Minuten, ich muss ihr nämlich noch etwas sagen, danach gebe ich sie dir zurück!
Und ich fühle mich wie ein Kind, das nicht ins Bett will, sich ständig eine neue Ausrede ausdenkt, um das Zähneputzen hiauszuzögern und dadurch das Aufleuchten des Nachtlichts.
2
Schon ein paar Tage nach unserem Umzug — unsere Backutensilien und Fotoalben würden noch Monate ihr Dasein in Kisten fristen — nahmen wir die Routine wieder auf, die wir uns in der alten Wohnung angewöhnt hatten. Ich weiß es noch ganz genau: Montags arbeiteten wir beide von zu Hause aus für die Stiftung. Ich saß im »kleinen Büro«, Daniel in dem etwas größeren, angrenzenden Zimmer. Dort stand ein Computer, dessen Monitor auf einem aus Obstkisten gebauten Podest thronte, damit Daniel den Kopf nicht neigen musste, wenn sie am PC arbeitete. Sie saß in einem großen, ergonomisch eingestellten Bürostuhl, den niemand anfassen durfte — eigentlich war es ihr schon ein Graus, wenn jemand ihr Zimmer betrat, weil sie Angst hatte, der Stuhl könnte verschoben werden oder jemand könnte sich setzen und an einem der vielen Hebel herumspielen, wodurch sie dann nicht mehr bequem sitzen würde: Lucille O’Connor höchstpersönlich hatte den Stuhl irgendwann einmal an ihren komplizierten Körper angepasst. Sie hatten vor Jahren einen ganzen Nachmittag damit zugebracht, und jetzt, wo Lucille nicht mehr da war, würde Daniel sie nie wieder fragen können, welche magischen Einstellungen sie damals vorgenommen hatte.
Mir selbst tat die Struktur gut, aber Daniel war kein Fan unserer Büro-Montage. Das hatte vermutlich mit ihren körperlichen Problemen zu tun: Alle fünfundvierzig Minuten stand sie auf, um kurz in den Garten zu gehen oder Kaffee zu kochen, dann hörte ich sie unten herumtigern, bis der Wasserkocher sich ausklickte. Und auch die Arbeit selbst fiel ihr manchmal schwer. Regelmäßig hörte ich sie hinter ihrem Bildschirm stöhnen, Flüche murmeln. Wegen der E-Mails, die an die Stiftung gingen. Wegen des Leids, das ihr daraus entgegenschlug, der Geschichten, die teilweise erschütternd waren, nicht zuletzt weil wir sie schon so oft gehört hatten. Jahrein, jahraus las Daniel ähnliche Berichte, Schilderungen, die sich immerzu wiederholten, alte Mythen, in neue Körper gekerbt, nein, in all den Jahren, in denen sie dieser Arbeit nachging, hatte sich rein gar nichts verändert, und das ließ sie laut seufzen, grummeln und hin und wieder »Verdammte Scheiße« zischen. Jedenfalls vermutete ich das damals. Und auch wenn ich jetzt Sachen über meine Partnerin weiß, die ich seinerzeit nicht wusste, glaube ich nach wie vor, dass Daniels Abneigung gegenüber Montagen zum Großteil daher rührte, dass sie das Unrecht aus den E-Mails aufwühlte. Ich erkenne das an den Nachrichten, die sie zurückschrieb, die entschlossen und leidenschaftlich und vor allem empathisch waren; die Autorin dieser E-Mails, das war die Daniel, in die ich mich verliebt hatte. Eine Daniel, die etwas weniger komplex war als die Frau, die ich danach kennenlernte, und dadurch vielleicht auch etwas uninteressanter. Doch wenn ich an diese Frau zurückdenke, dann spüre ich immer noch eine Anziehung, die stark genug ist, um eine körperliche Reaktion hervorzurufen, für ein warmes Glühen zwischen meinen Beinen zu sorgen.
Jennifer, du hast Rechte. Nicht nur als Patientin, sondern auch als Bürgerin. Deine Rechte wurden verletzt, dagegen werden wir jetzt etwas unternehmen.
Lisa, wie schrecklich, dass du so lange warten musstest. Aber das Warten hat jetzt ein Ende, denn wir werden dir helfen.
Hayat, ich denke, du hast recht und es stimmt tatsächlich nicht, was sie dir erzählt haben. Es tut mir leid, dass unser erster Versuch nicht erfolgreich war, aber wir werden es einfach noch mal probieren. Was hältst du davon?
Während Daniel diese Mails schrieb, kümmerte ich mich im kleineren Büro um die Finanzen. Ich stellte Förderanträge, machte die Steuererklärung und pflegte unsere Website, was ganz schön viel Arbeit war, wenn man zu zweit eine Stiftung betreibt. Transparenz und Verantwortung, das waren die Zauberwörter; für unsere Förderer, aber auch für das Finanzamt. Also erstellte ich jeden Januar einen Jahresbericht, den ich pflichtbewusst auf unserer Website veröffentlichte. Außerdem dachten wir regelmäßig zusammen über unsere Ziele nach, unsere Aufgaben und unsere langfristige Vision. Wozu gab es die Stiftung Lucille? Das war eine wichtige Frage, darüber waren Daniel und ich uns einig. Doch in den ersten Jahren konnten wir stundenlang über die richtigen Formulierungen unserer Kernaufgaben diskutieren, denn sie sollten einerseits zeigen, was wir machten, und andererseits eine breitere Auslegung zulassen, wenn ein Fall genau das erforderte.
Mir fällt der Abend in der alten Wohnung ein, an dem wir den Text für unsere erste Website schrieben. Wir arbeiteten erst seit ein paar Monaten zusammen (kannten uns auch noch nicht viel länger) und saßen nebeneinander am Tisch. Beide starrten wir auf den Bildschirm von Daniels Computer, den sie gebraucht gekauft hatte. Stiftung Lucille ist eine nicht gewinnorientierte Stiftung, tippte ich. Wir sind für Frauen da, denen —
»Nicht nur Frauen, oder?«, sagte Daniel. »Ich würde Menschen sagen.«
»Aber du hilfst doch vor allem Frauen?«, fragte ich.
»Ich helfe auch Männern, wenn die sich bei mir melden.«
»Mit Menschen kommen wir vielleicht für bestimmte Fördermittel nicht infrage.«
»Dann ist das eben so. Meine Stiftung soll für alle da sein, finde ich.«
Ich fing wieder an zu tippen: Wir sind für Menschen da, denen das Gesundheitssystem nicht weiterhilft.
»Hmm«, schaltete Daniel sich wieder ein. »Wirken wir dann nicht wie ein paar Quacksalber? Als ob wir Alternativmedizin anbieten oder so? Das geht nicht.«
»Stimmt«, sagte ich, »das geht nicht«, und ich formulierte den Satz um: Wir sind für Menschen da, die ihren Platz im Gesundheitssystem nicht finden können.
»Ich weiß nicht«, sagte Daniel. »Jetzt wirkt es so, als würde es an den Menschen liegen und nicht am System — streich doch einfach das mit dem System, oder?«
Wir sind für Menschen da, die noch nicht die Behandlung bekommen, die sie benötigen —
»Die Behandlung, die ihnen zusteht!«
Wir sind für Menschen da, die noch nicht die Behandlung bekommen, die ihnen zusteht. Gemeinsam gehen wir ihre Optionen und ihre medizinischen und juristischen Möglichkeiten bei ihrer Suche nach einer passenden Behandlung und der richtigen Diagnose durch.
Diesmal schüttelte ich den Kopf. »Ich weiß nicht«, sagte ich. »Das ist so ein Bandwurmsatz, das funktioniert sprachlich irgendwie nicht.«
»Nein?«, fragte Daniel, und sie stand auf, die Augen immer noch auf den Bildschirm gerichtet — als wäre der Text ein modernistisches Gemälde, das sie kurz mit etwas Abstand betrachten müsste, um beurteilen zu können, was es darstellen sollte. Obwohl sie in ihrem früheren Leben als Pressesprecherin gearbeitet hatte, war Daniel etwas weniger wortgewandt als ich. In Momenten wie diesem war das hilfreich, denn ihr Urteil war ein guter Gradmesser für den durchschnittlichen Leser: Wenn Daniel nicht über einen Satz stolperte, würden unsere Förderer das vermutlich auch nicht tun.
»Da steht auf jeden Fall das Wichtigste, oder?«, murmelte Daniel schließlich, und ich nickte und widmete mich noch mal dem Text, während Daniel eine Flasche Rotwein und zwei Kaffeebecher holte. Wir kümmern uns um Sie, fügte ich noch schnell hinzu. Ohne Ausnahme!
In jener Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich wohnte damals noch zu Hause, der Computer, den ich mir mit meiner Mutter teilte, stand im Flur, und ich weiß noch, dass ich aufstand, um mir noch mal unsere Website anzusehen. Hinter dem kleinen Schreibtisch neben der Garderobe verwandelte sich die Aufregung, die ich tagsüber gespürt hatte, in eine andere Art der Anspannung. Das fröhliche Brausen unter meinem Zwerchfell veränderte sich fast unmerklich und unangekündigt: Transparenz und Verantwortung, dachte ich, und eine schwere Welle schlug mir gegen den Brustkorb. Ab jetzt trug ich Verantwortung. Für den Erfolg der Stiftung, für die Menschen, die sich bei uns meldeten, und — vielleicht flößte mir das am meisten Angst ein — für Daniel. Denn das ganze Unterfangen war meine Idee gewesen. Ich hatte sie dazu überredet, und sie hatte sich von mir überzeugen lassen, einem Mädchen, das sie gerade erst kennengelernt hatte. Täuschte ich sie nicht, indem ich ihr etwas versprach, von dem ich überhaupt nicht wusste, ob wir es umsetzen konnten? Panisch versuchte ich, durch die Nase ein- und durch den Mund auszuatmen: Ich hatte mich Daniel aufgedrängt, mich ihr mehr oder weniger zu Füßen geworfen, sie beschworen, mich einzustellen. Aber das hier war Daniel de Koster, und auch wenn ich deutlich spürte, dass sie mich mochte (ich wagte es nicht, die hoffnungsvolle Vermutung zuzulassen, sie könnte darüber hinaus noch etwas anderes für mich empfinden — am Ende wäre ich enttäuscht, schämte ich mich nur noch mehr), befürchtete ich, unsere Zusammenarbeit könnte bald enden. Ich hatte ein paar wunderbare Monate hinter Daniel auf dem Pferd gesessen, zusammen hatten wir unerforschtes Terrain beritten, manchmal hatte ich sogar selbst die Zügel in die Hand nehmen dürfen. Aber was, wenn das Ganze nicht so lief, wie wir es uns erhofften? Wer garantierte mir, dass Daniel mich nicht doch am nächsten Wasserloch zurücklassen würde?
Meine Zweifel sollten sich in den darauffolgenden Jahren als unbegründet erweisen. In Bezug auf Daniels Loyalität, aber auch in Bezug auf die Lebensfähigkeit unseres Projekts. Stiftung Lucille funktionierte, sie lief sogar wie am Schnürchen, schon von Anfang an erreichten uns die Anfragen in der alten Wohnung in anhaltend hohem Tempo, und das blieb auch in den ersten Jahren in der Molenstraat so — rückblickend war das unser goldenes Zeitalter. Denn außerhalb der Büro-Montage blühte Daniel auf. Sie hat in der ganzen Periode bestimmt zweihundert Interventionen durchgeführt, wir machten ungefähr dreimal so viele Hausbesuche, und auch wenn ich die Gesichter von den meisten Informationssuchenden vergessen habe, erinnere ich mich bis heute an fast jede Geschichte.
3
Jennifer war seit ihrem achtzehnten Lebensjahr regelmäßig schwindelig. Der Schwindel kam plötzlich und wurde manchmal — doch nicht immer — von Beklommenheit begleitet. Sie wurde zittrig, und ein paar Mal verlor sie sogar das Bewusstsein. Mehrmals suchte Jennifer ihren Hausarzt auf, und auch wenn sie wegen anderer Beschwerden dort war, sagte sie: Der Schwindel, der bereitet mir nach wie vor Probleme. Ihr Blut wurde untersucht, die Werte waren gut, Entschuldigung, sagte der Hausarzt, da kann ich nichts machen — aber als Jennifer eines Tages auf dem Platz vor dem Kindergarten, zu dem sie gerade ihren Sohn gebracht hatte, ohnmächtig wurde, brachte eine besorgte Mutter sie ins Krankenhaus. Dort stellte man fest, dass ihr Puls viel zu hoch war. »Sie haben eine Panikattacke«, sagte der zuständige Arzt. »Sie müssen es langsamer angehen lassen, Sie sagen, Sie arbeiteten Vollzeit und hätten Kleinkinder, dann sollten Sie vielleicht mal Urlaub machen« — ob eine halbe Stelle denn keine Option sei?
War das Panik?, fragte Jennifer sich, als sie auf die Tram wartete. Na klar, die Schwindelanfälle waren stressig, aber sie traten nur selten in beängstigenden Situationen auf — so viele beängstigende Situationen gab es in ihrem Leben gar nicht. Ihr war bei einem Umtrunk zur Feier ihrer Promotion schwindelig geworden. Fast wäre sie auf dem Junggesellinnenabschied ihrer besten Freundin in Ohnmacht gefallen. Einmal in der Schlange vor der Supermarktkasse, einmal im Stau nach Hause — es passierte immer öfter, und beim letzten Mal war es sehr warm gewesen, doch erst als der Schwindel einsetzte, war sie ein kleines bisschen panisch geworden: Reflexartig hatte sie ihren Arm aus dem Fenster gehalten und dem Autofahrer hinter sich ein Handzeichen gegeben. Der hatte abgebremst, damit sie langsam auf den Standstreifen rollen konnte, wo sie gewartet hatte, bis der Schwindel wieder abnahm. Minuten zuvor hatte sie noch den Radiosong »Drops of Jupiter« mitgesungen — Jennifer war voll und ganz in den na na, na na, na nas nach dem dritten Refrain aufgegangen.
»Hier steht, dass Sie eine weitere Panikattacke hatten«, sagte der Hausarzt, als sie wieder vor ihm saß.
Jennifer schüttelte den Kopf. »Ich bin mir da nicht so sicher«, antwortete sie. »Ich hatte keine Angst, ich habe einfach nur meinen Sohn zur Kita gebracht, ich glaube, das hat eher was mit dem Herzen zu tun.«
»Genau so erleben Menschen Panikattacken«, sagte ihr Arzt jetzt. »Aber ich glaube, Sie haben eine ganze Menge um die Ohren, das ist bestimmt nach einem stressigen Tag passiert, oder?«
Vielleicht wäre ein Atemtechnikkurs ja etwas für sie: Der Hausarzt schrieb ihr eine Internetadresse auf, aber Jennifer sah sich die Seite nicht an, denn das hier hatte nichts mit ihrer Atmung zu tun. Es lag an etwas anderem, irgendwas stimmte nicht, davon war Jennifer felsenfest überzeugt. Und wer überzeugt davon war, dass etwas nicht stimmte, kam zu Daniel.
Allerdings wusste Daniel diesmal nicht sofort, in welche Richtung es gehen könnte, also machte sie einen Termin bei Barbara, die Jennifer, ohne besonders lange darüber nachdenken zu müssen, an eine Spezialistin für Herz- und Gefäßerkrankungen überwies, eine frühere Kommilitonin. Die Ärztin stellte eine Herzrhythmusstörung fest; keine angenehme Erkrankung, aber mit den richtigen Medikamenten konnte man damit gut leben.
Jennifer war erleichtert, auch wenn sie schockiert war, als sie hörte, dass daran jährlich Menschen starben. »Drops of Jupiter« hätte mich fast ins Grab gebracht, scherzte sie seitdem, wenn sie jemandem von dem »Zirkus« mit ihrem Herzen erzählte. Darüber musste die andere Person immer lachen, froh darüber, dass die Kranke noch Humor hatte — und dann grinste Jennifer ebenfalls, damit ihr Gesprächspartner sehen konnte, dass es für sie keinen Grund zur Panik gab.
Hayat war ständig müde, aber vor einem Jahr war das noch nicht so gewesen. Es fing nach der Geburt ihres zweiten Kindes an: Hormone, sagte der Hausarzt. So eine Geburt war keine Kleinigkeit, sie würde bestimmt häufiger kein Auge zubekommen, oder? Aber nach der Geburt ihres ersten Kindes hatte sie sich nicht so gefühlt. Ihre Nächte waren jetzt nicht kürzer als damals, und sie war auch nicht viel älter, zwei Jahre und drei Monate, um genau zu sein, hatte sie dadurch etwa so viel Energie eingebüßt?
Ihre Blutwerte waren ihrem Hausarzt zufolge nicht auffällig. »Zeig mal«, sagte Daniel, und sie betrachtete die Zahlen, Pfeile und Abkürzungen. »Vitamin D dürfte ruhig etwas höher sein«, sagte Daniel. »Leidest du auch unter Muskelkrämpfen oder Zahnfleischbluten?«
»Nein«, sagte Hayat. »Das nicht.« Es fühle sich eher so an, als würde ihr Körper immer langsamer, sagte sie. Alles war so viel mühsamer: das Bewegen, das Sehen, das Hören; sogar ihr Puls war schwächer. Daniel nickte: »Das hier sind nicht die Werte, die wir uns anschauen müssen.«
Hayat ging wieder zu ihrem Hausarzt. Sie dachte: Den Rest bekomme ich schon allein hin. Aber auch nach dem zweiten Bluttest behauptete der Mann, ihr fehle nichts, und er schlug vor, sie solle Milch abpumpen, damit ihr Mann dem Baby nachts die Flasche geben könnte — dann könne sie endlich mal durchschlafen.
»Aber ich gebe meiner Tochter gerne die Brust«, sagte Hayat. »Das ist gut für die Bindung.«
»Das können Sie ja auch gerne machen«, entgegnete der Hausarzt. »Aber dann müssen Sie akzeptieren, dass Sie am nächsten Tag etwas müder sind.«
Wenige Tage später schüttelte Daniel Hayats Hausarzt die Hand. »Ich bin Daniel«, sagte sie. »Ich unterstütze Hayat und weiß einiges über Schilddrüsenprobleme.«
T4 und TSH messen und dann nicht nur die Antikörper von TPO anfragen, sondern auch die von TG. Und tatsächlich, die Werte wichen stark ab. Hayat hatte Hashimoto, eine Schilddrüsenerkrankung, deren Symptome nach einer Schwangerschaft in manchen Fällen schlimmer wurden. Letzteres wusste Daniel noch nicht, aber sie hätte es wissen können; die Geburt eines Kindes machte alles schlimmer — so lautete die Faustregel, und sie machte sich in einem ihrer Hefte eine Notiz, damit sie es nicht wieder vergaß.
Lisa hatte mit einer Vielfalt an Beschwerden zu kämpfen. Sie hatte in fast allen Gelenken Schmerzen, vor allem im Becken. Sie war oft müde, es war eine Müdigkeit, die sich wie eine Decke über sie legte, die dafür sorgte, dass sie sich hinlegen wollte, oft mitten am Tag, oder kurz nach dem Aufstehen. Wenn ihre Freundinnen sich erkundigten, ob sie in die Stadt mitkommen wolle, sagte sie immer öfter ab, sie log, dass sie Fieber oder Magen-Darm habe, denn Müdigkeit war kein guter Grund, dachte Lisa. Ihre Augen waren oft trocken.
Sie war auf Allergien getestet worden, aber das Ergebnis war negativ, und seitdem sagte die Ärztin, sie müsse abnehmen, weil sie gute zehn Kilo zu schwer sei. Wenn sie abnehme, würde sie weniger Schmerzen haben, nicht so müde sein — doch sie hatte schon mal elf Kilo weniger gewogen, erzählte sie uns, als wir sie trafen. Im letzten Sommer hätte sie stark abgenommen, als sie kein Brot mehr gegessen hätte, auch keine Cracker oder Toast, nicht mal eine Salzstange auf einer Party — es hätte kaum geholfen. Die Schmerzen wären vielleicht etwas besser geworden, aber das könnte auch an den höheren Temperaturen im August liegen. Und ihre Müdigkeit sei genauso schlimm gewesen. Lisas Hausärztin meinte, sie hätte es länger durchziehen müssen: »Du hast die Zügel selbst in der Hand«, sagte sie. »Das ist harte Arbeit, und ich kann sie dir nicht abnehmen.«
Aber Lisa hätte es durchgezogen, erzählte sie uns. Sie äße so gesund wie noch nie, leide aber wie gehabt unter trockenen Augen, Schmerzen im Becken, und jetzt war auch noch ein sehr trockener Mund hinzugekommen.
»Hi, ich bin Daniel«, sagte Daniel, als sie das Sprechzimmer von Lisas Hausärztin betrat. »Ich kenne Lisa sehr gut und ich weiß einiges über Autoimmunerkrankungen.«
Sie hatte eine Art Visitenkarte mitgebracht, die sie selbst gedruckt hatte, eine komische Karte, zu groß für eine typische Visitenkarte und zu klein für eine Postkarte: Das sorgte immer wieder für Verwirrung. Daniel überreichte der Frau die Karte, auf der der Name und die Telefonnummer eines Rheumatologen im Osten des Landes standen.
»Würden Sie meine Freundin bitte überweisen?«, fragte Daniel.
Der Rheumatologe im Osten stellte bei Lisa das Sjögren-Syndrom fest. Eine schlimme Erkrankung, aber Lisa bekam Medikamente und ein Fläschchen mit künstlicher Tränenflüssigkeit, und jetzt konnte sie ihren Freundinnen wenigstens erklären, warum sie nicht oft mitkommen konnte, ohne dass sie dachten, sie wäre faul oder hätte keine Lust auf sie.
Und dann war da noch Ronny, ach Ronny — eine Ausnahme, in gewisser Weise, trotzdem werde ich ihn nicht so schnell vergessen. Ronny hatte immer Probleme mit seinen Beinen. Schmerzen unter den Füßen, Missempfindungen in den Waden. »Manchmal fühlt es sich an, als würden sie mit Messern bearbeitet, dann wieder, als würde eine Ameisenarmee mit Nadeln zustechen.«
Haben Sie immer noch Schulden, fragte sein Hausarzt, und die gleiche Frage stellte ihm der Sozialarbeiter, zu dem ihn sein Hausarzt geschickt hatte. Ob Ronny ein soziales Netz habe, wie oft er seine Familie sehe, ob er manchmal einsam sei, wie viele Biere er pro Tag trinke?
»Vier kleine Bier«, sagte Ronny. Und ja, manchmal sei er einsam, aber dazu trügen die Schmerzen in den Beinen ja auch bei, vielleicht könne sich das mal jemand ansehen, jemand, der sich damit auskenne? »Ich kann deswegen nämlich nicht schlafen.«
Oh, sagte der Sozialarbeiter, daher könne es natürlich auch kommen: Schlafmangel verursache die komischsten und verrücktesten Beschwerden, vielleicht könne Ronny seinen Hausarzt demnächst um Lorazepam bitten.
»Aber ich liege vor Schmerzen wach«, sagte Ronny. »Ich habe die Schmerzen nicht, weil ich wach liege.«
»In einem solchen Fall«, sagte der Sozialarbeiter damals, »spricht man von einem Teufelskreis.«
Ronny hatte keinen festen Hausarzt, er ging in eine Praxis, wo immer ein anderer Arzt vor ihm saß — Daniel machte sofort einen Termin bei Barbara, Ronny wohnte sogar in der Nähe ihrer Praxis. Als Barbara ihn zum Neurologen überwies, war die Sache schnell geklärt: Ronny litt unter Small-Fiber-Neuropathie, stellte Doktor van Dam fest. Eine chronische Erkrankung, die Schmerzen würden vielleicht nie ganz verschwinden. Aber Ronny hatte Anspruch auf eine Invalidenrente, und innerhalb von einem Jahr und zwei Monaten hatte er seine überschaubaren Schulden abbezahlt.
4
Daniel hat Ronnys Postkarte in eine Obstkiste gepackt (oder habe ich das selbst irgendwann gemacht?). Vielen Dank, meine Liebe, stand darauf. Im gleichen Stapel fand ich letztes Jahr die Karten von Jennifer, Hayat und Lisa und einen langen Brief von Daya, die keinen Bandscheibenvorfall, sondern Krebs hatte, und einen von Selma, die neun Monate lang mit einem gebrochenen Mittelfußknochen herumgelaufen war, und Postkarten von Sonja, Marieke, Martine und Anuradha, alle Endometriose — immer wieder Endometriose —, und einen großen Stoß kleiner gelochter Karten, die mit einer Geschenkschleife an Sträußen gehangen hatten: Danke, Daniel, Dankeschön, es geht mir schon etwas besser, ein Smiley, ein Kuss, eine gezeichnete Blume; die merkwürdig geformten Blütenblätter rühren mich, drücken Dankbarkeit aus und verraten zugleich eine zittrige Hand — auf den Karten aus den späteren Jahren wird auch mir immer öfter gedankt.
In unserem dritten Sommer in der Molenstraat (wir wussten nicht, dass sich bald alles ändern würde) begleitete ich Daniel zum ersten Mal zu einem Hausarztbesuch. Ich spielte mit dem Gedanken, eines Tages vielleicht ein paar von Daniels Aufgaben übernehmen zu können. Wenn ich selbstständig Interventionen durchführen würde, könnten wir mehr Menschen helfen. Außerdem sehnte ich mich nach etwas Neuem. Langeweile trifft es nicht wirklich, aber der Gedanke, dass alles so bleiben würde, wie es war — Daniel ging raus, und ich blieb zu Hause, fuhr höchstens Hilfesuchende mal zu Barbara —, ging mir langsam etwas gegen den Strich.
»Lass mich doch wenigstens einmal mitkommen«, sagte ich deshalb eines Nachmittags. Es war Wochenende, vielleicht ein Sonntag. Wir hatten einen Spaziergang oder eine Radtour gemacht und ruhten uns zusammen auf dem teuren Boxspringbett aus, Daniel auf dem Rücken, ich auf der Seite, zu ihr hingedreht, ein Bein über ihren leicht verschwitzten Körper gelegt.
»Du bist schon mal dabei gewesen«, murmelte Daniel.
»Stimmt nicht.«
»Stimmt wohl.«
Ich dachte nach.
»Meinst du etwa damals bei meiner Mutter?«
»Ja klar!«
»Das zählt doch nicht! Damals war ich mit ihr beschäftigt. Und jetzt will ich sehen, was du machst.«
»Ich erzähle dir doch immer, was ich mache.«
»Das ist nicht das Gleiche wie dabei sein.«
Daniel antwortete nicht sofort. Ich wusste, dass sie es schwierig fand, mir Dinge abzuschlagen, und ich spürte, wie sich die Muskeln ihres Körpers leicht anspannten.
»Es funktioniert nicht so gut, wenn zu viele Menschen dabei sind«, sagte sie dann, und ich wusste, dass sie recht hatte. Zwei Fremde im Sprechzimmer konnten einschüchternd wirken — auf den Spezialisten oder den Hausarzt, die oft nichts Böses im Sinn hatten, aber auch auf unsere Informationssuchenden. Doch so schnell würde ich mich nicht abwimmeln lassen — wie sollte ich sonst von ihr lernen? — und ich beschloss, meinen Wunsch anders zu verpacken.
»Eigentlich müsste unser Vorstand auch mal mit«, sagte ich. »Sie sind dazu da, uns zu kontrollieren, also sollte Sjoerd mal mit, und Barbara auch.«
»Auf keinen Fall«, sagte Daniel sofort. »Die kommen nicht mit.«
»Dann lass wenigstens mich mitgehen. Es ist doch merkwürdig, dass wir schon seit fünf Jahren zusammenarbeiten und ich keine Ahnung habe, was du überhaupt machst?«
»Wieso keine Ahnung?«
»Ich will es sehen«, sagte ich und streichelte ihr mit einer Hand über den Oberschenkel. »Ich will dabei sein«, flüsterte ich und fuhr mit der Hand über die Innenseite ihres Schenkels.
Wir mussten beide lachen, das war ein komisches Manöver. Und Daniel murmelte noch so was wie »benimm dich«, aber anscheinend war es doch die richtige Strategie: Bald darauf besuchten wir zusammen den Hausarzt von Caro. Sie war dreiundzwanzig Jahre alt und hatte seit zwei Jahren Magenschmerzen. Beim Hausbesuch, Daniels erstem Kennenlernen mit Caro, war ich nicht dabei gewesen. »Wenn du überall danebensitzt, ich meine: wenn wir jetzt alles zusammen machen, dann wird das echt zu viel«, hatte Daniel vorher gesagt, und ich verstand, was sie meinte, Caro sollte sich nicht bevormundet fühlen. Als wir jetzt zu dritt im Wartezimmer von Caros Hausarzt saßen, fühlte ich mich schließlich doch fehl am Platz. Aber was, wenn Daniel irgendwann einmal ausfallen sollte, versuchte ich mir Mut zu machen, während ich die Kinderecke anstarrte: eine Spirale mit Holzperlen, ein Tisch voller stumpfer Buntstifte.
Caro hatte gerade ihr Studium an der Kunstakademie abgeschlossen, wusste ich von Daniel. Bald würde sie aus dem Studierendenwohnheim ausziehen müssen, also musste sie dringend Geld verdienen, doch ihr schlechter Gesundheitszustand ließ das nicht zu, es waren merkwürdige Magenkrämpfe, die den Studienabschluss fast gefährdet hätten. Wochenlang hatte sie im Bett gelegen, auf der Seite, nur so war der Schmerz noch erträglich; sie konnte ihre Abschlussarbeiten erst lange nach der Frist abgeben und hatte es einem verständnisvollen Dozenten zu verdanken, dass sie ihr Diplom überhaupt bekommen hatte: »Und dann auch noch eine 1,3!«, hatte Daniel voller Bewunderung gesagt.
»Wann hat es angefangen?«, hatte ich gefragt.
»Vor drei Jahren, unabhängig von ihrem Zyklus.«
»Also keine Endometriose?«
Daniel hatte den Kopf geschüttelt: »Ich glaube nicht, auch wegen der Art der Schmerzen.«
Eines Nachts hatte Caro plötzlich starke Stiche rechts unter ihrem Bauchnabel verspürt. Sie hatte versucht, weiterzuschlafen, aber ihre Mitbewohnerin wurde von ihrem Stöhnen wach. Caro war in der Notaufnahme gelandet, dort dachten sie, es handle sich um eine Blinddarmentzündung: Sie hatten einen Ultraschall gemacht, Blut abgenommen und um eine Urinprobe gebeten. Sie konnten nichts finden, und um fünf Uhr morgens stand Caro wieder auf dem Krankenhausparkplatz, wo sie wie benommen dabei zusah, wie Rettungswagen ankamen und abfuhren. Die Schmerzen hielten an, tage-, wochen-, monatelang. Manchmal nahmen sie etwas ab, aber die Stiche — mal dumpfe Schläge, dann wieder ein scharfes Reißen — kamen immer zurück. Vor allem bei körperlicher Anstrengung loderten die Schmerzen auf; wenn sie Bauchmuskelübungen machte, sich nach einer Nudelpackung auf dem obersten Küchenregalbrett streckte oder Salsa tanzte. Einmal berührte ihre Mitbewohnerin sie aus Versehen mit dem Ellbogen in der Magengegend: Caro schrie laut auf, sackte zusammen — Spasmen des Darms, sagte ein Gastroenterologe in dem Krankenhaus, in dem sie schon mal gewesen war. Der Arzt reichte Caro eine Mappe mit Diätvorschriften, woraufhin sie wochenlang auf Alkohol, Weizen und Milchprodukte verzichtete und täglich drei Kiwis aß. Es half nicht, die Stiche blieben, und als Caro eines Abends eine Serie über das alte Rom schaute, brach sie in Tränen aus, als der Held einen Speer in seinen Magen bekam. Sie wusste, wie Spurius sich fühlen musste, die verrostete Spitze bohrte sich durch die Haut, direkt in die Bauchmuskeln, sie schrie laut auf, als die Waffe von einem Kameraden aus dem feuchten, plumpen Fleisch gezogen wurde.
»Haben sie eine Darmspiegelung gemacht?«, fragte ich.
»Ja, sie haben nichts gefunden.«
»Und ein CT?«
»Nur vom Darm. Aber Caro glaubt, dass die Schmerzen woandersher kommen.«
»Sie hat eine Darmdiagnose.«
»Aber die Schmerzen sind sehr lokal, sie konnte die Stelle genau bestimmen.«
»Irgendwas mit den Nerven?«
Daniel nickte. »Ich bin mir fast sicher, sie muss auf jeden Fall zu van Dam. Und wenn er nichts findet, weiß er bestimmt, wohin sie danach muss.«
»Läuft es diesmal nicht über Barbara?«
Daniel schüttelte den Kopf. »Ich glaube, das wird auch über ihren Hausarzt möglich sein, Caro ist repräsentativ.«
Damit meinte sie: Caro ist hübsch, klug und wurde hier geboren.
Den Namen von Caros Hausarzt habe ich vergessen, aber es hätte sehr gut Bert sein können.
»Ich bin Daniel, ich kenne Caro schon lange«, sagte Daniel, als wir ins Sprechzimmer kamen. Bert war ein großer Mann mit freundlichen Augen und einem festen Händedruck; ich wusste, dass Daniel bei groben Händedrückern gerne zurückdrückte, und sah, dass sie das auch jetzt tat.
»Ich bin Jodie, eine Bekannte« — mein eigener Händedruck war eher versöhnlich als aggressiv: Ach, wieg meine Hand ruhig kurz in deiner, dachte ich, als Bert meinen kleinen Finger und den Ringfinger zusammenquetschte, man sollte einen Hund auch erst an seinen Fingern schnuppern lassen, bevor man ihn streichelt.
Im Halbkreis standen wir um Bert herum. »So, Caro«, sagte er. »Da hast du ja eine richtige Delegation mitgebracht.« Er sagte es lächelnd, aber wirkte überrumpelt, Caro hatte uns nicht angekündigt.
»Soll ich noch einen Stuhl holen?«, Bert nickte in meine Richtung. Überrumpelt oder nicht, er spürte ganz genau, wer hier die blinde Passagierin war. »Nein, nein«, sagte ich. »Ich kann gerne stehen«, und ich machte einen Schritt zurück, lehnte mich mit dem Hintern gegen Berts Liege und dachte daran, dass er das Stück Papier, das dort zu Hygienezwecken lag, später austauschen müsste.
»In Ordnung«, sagte er und setzte sich an seinen Schreibtisch. »Herzlich willkommen, die Damen.« Bert lehnte sich zurück und verschränkte die Arme. »Was verschafft mir die Ehre?«
»Ich möchte, dass mein Bauch weiter untersucht wird«, sagte Caro. »Die Diät hilft nicht, ich bin mir sicher, dass es etwas anderes ist.«
»Das glaube ich auch«, schaltete sich Daniel ein. »Es sind lokale Schmerzen, das sollte sich mal ein Neurologe ansehen.«
»Ich kann Sie nicht einfach überweisen«, protestierte Bert. Es hörte sich so an, als würde er das öfter sagen. »Dafür muss es erst konkrete Symptome —«
»Es gibt da einen Arzt«, unterbrach Daniel ihn und holte eine ihrer Karten heraus. »Doktor van Dam, ein Neurologe im Zuiderkrankenhaus. Die Warteliste ist nicht besonders lang, Caro könnte innerhalb von vier Wochen einen Termin bekommen.«
Bert nahm die Karte entgegen und betrachtete sie mit hochgezogenen Augenbrauen, als handle es sich um ein Herbstblatt, das in seinem Garten gelandet war und bei dem er sich fragte, von welchem Baum es stammte. Er legte die Karte vor sich auf den Tisch, sah uns an. Kurz glaubte ich, die Sache sei schon erledigt. Ich dachte, er würde jetzt zustimmen — na gut, dann stelle ich die Überweisung aus —, so lief es oft in den Geschichten, die Daniel erzählte, wenn sie nach einer Intervention nach Hause kam. Aber heute lief es nicht so.
»Wer sind Sie überhaupt?«, fragte der Hausarzt und verschränkte wieder seine Arme. »Woher haben Sie Ihre Expertise, wenn ich fragen darf?«
Ich konnte Daniels Gesicht nicht sehen, von meiner Position aus blickte ich auf ihren Hinterkopf. Ihre langen Haare, damals noch nicht von Grau durchzogen, fielen gerade so über die Rückenlehne des limettengrünen Schalenstuhls (die Farbe war damals in Sprechzimmern, Krankenhausfluren und Mensen weit verbreitet, die Stühle müssen neu gewesen sein und übertrafen Bert in Sachen Modernität). Auch Caro sah Daniel jetzt an. Wir schauten alle zu ihr und warteten; Bert mit einem kaum merklichen Lächeln, das etwas spöttisch wirkte, aber genauso gut von Nervosität hätte zeugen können.
Kurz fragte ich mich, ob das überhaupt möglich war: zu sehen, wie Daniel vorging. Schließlich war ich Zeugin einer Aufführung vor Publikum. Und dann sagte Daniel etwas, das ich nicht erwartet hatte.
»Ich bin Daniel de Koster von der Stiftung Lucille«, sagte sie bestimmt. Sie sprach etwas langsamer als zuvor, die Stimme tiefer: »Wir sind für Menschen da, die noch nicht die Behandlung bekommen, die ihnen zusteht. Gemeinsam gehen wir ihre Optionen und ihre medizinischen und juristischen Möglichkeiten bei ihrer Suche nach einer passenden Behandlung und der richtigen Diagnose durch. Wir kümmern uns um Sie, ohne Ausnahme.«
Ich kniff in den Rand des Behandlungstischs. Daniel trug meinen Text vor, unseren Text, den Text unserer Website. Ich hatte noch nie gehört, wie sie das tat, und nach all den Jahren machte das etwas mit mir, ja, es rührte mich dermaßen unverhofft, dass ich mich wirklich bemühen musste, nicht wie ein Honigkuchenpferd zu strahlen.
»Caro hat das Recht auf eine zweite Meinung«, sprach Daniel weiter, und ich erkannte etwas an ihrer Intonation. »Das wissen Sie genauso gut wie ich« — ja, ich hatte richtig gehört: Daniel klang triumphierend. Und das auf eine neckische Art und Weise, wie auf gemeinsamen Wanderungen, wenn ich fest davon überzeugt war, dass wir einen Wegweiser verpasst hatten, aber sie sich sicher war, dass das Schild noch käme: Siehst du!, sagte sie, wenn es an der nächsten Kreuzung auftauchte — ein amüsiertes Grinsen, das ein gutmütiges Überlegenheitsgefühl verriet. War es das, was Bert jetzt sah?
»Und was genau wollen Sie jetzt von mir?«, fragte der Hausarzt. Er hatte die Arme immer noch fest verschränkt, und wenn er nicht hinter seinem Schreibtisch gesessen hätte, dann hätte er wahrscheinlich breitbeinig dagestanden: An ihm kam niemand vorbei.
»Ich möchte, dass Sie Caro überweisen«, sagte Daniel ruhig. »Denn wenn Sie das nicht machen, und man stellt in drei Jahren eine ernsthafte Krankheit bei ihr fest, dann kann ich bezeugen, dass Sie weitere Untersuchungen aktiv behindert haben.«
»Von Ihnen lasse ich mich nicht einschüchtern«, sagte Bert jetzt, und das I von Ihnen zog er in die Länge, als erteilte er Daniel eine Sprachlektion.
»Dafür bin ich auch nicht zu Ihnen gekommen«, sagte Daniel und imitierte seine Intonation.
Kurz herrschte eisiges Schweigen. Caro blickte auf, ihren Hausarzt an. Aber der blickte über sie hinweg zu mir. Vielleicht wollte er herausfinden, was ich von der ganzen Sache hielt, oder er hatte vergessen, dass ich auch noch da war, und fühlte sich plötzlich ertappt — ich weiß es nicht, aber bevor sich unsere Blicke treffen konnten, wandte ich mein Gesicht dem Fenster zu.
Berts Überweisung an Doktor van Dam war sehr knapp gehalten. Caro glaubte, etwas stimme nicht, das könne man zwischen den Zeilen lesen, er selbst glaubte das aber nicht. Eine dumme Formulierung, vielleicht die Folge von Daniels rücksichtslosem Auftreten während der Intervention, auch wenn die Überweisung erst dadurch ermöglicht worden war.
Caros Suche endete jedoch nicht mit dem Besuch bei van Dam. Der Neurologe konnte nichts finden und überwies sie an die Abteilung für Magenchirurgie, wo Caro endlich Glück hatte. Sie landete bei einem Arzt, der gerade eine Fortbildung gemacht hatte und nach ein paar recht simplen Fragen die Diagnose ACNES stellen konnte: Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome, ein eingeklemmter Nerv sei schuld an den unerträglichen Schmerzen in ihrer Bauchwand gewesen, eine OP und die Sache sei erledigt gewesen, teilte sie uns ein halbes Jahr später auf der Karte mit, die an den Feldblumen hing. Sie hatte uns einen schicken Strauß geschickt. So einen, der nur aus langstieligen Blumen bestand und in dem jede Sorte nur einmal vertreten war, und ich weiß noch, dass ich ihn auf unsere Kommode im Schlafzimmer gestellt hatte, wo er ein paar Tage lang das Erste war, was wir sahen, wenn wir zusammen wach wurden.
5
Dezember 2009 also, jetzt bin ich doch dort gelandet. Lichterketten im Fenster, an einem roten Band baumelnde Karten in der Küche, und meine Geliebte am Herd, trägt sie etwa eine Schürze?
Wir wohnen schon gute drei Jahre in der Molenstraat, es ist Heiligabend und wir kochen zusammen. Ich bereite den Rollbraten zu, den wir als Kinder an Weihnachten oft gegessen haben, wenn meine Mutter mal wieder dachte, sie müsse ihre körperlichen Beschwerden überwinden und für uns kochen. Daniel kümmert sich um die weniger aufwendigen Beilagen, Salat mit einer ordentlichen Portion Fertigdressing und Kartoffelschnitze, die, obwohl der Ofen Daniel zufolge genau richtig eingestellt war, trocken und angebrannt auf unsere Teller purzeln. Wir lachen darüber, schaben die schwarzen Krusten mit Schälmessern ab, und nach dem Essen ziehe ich Daniel aus ihrem Stuhl, dirigiere sie nicht ohne Hintergedanken zum Sofa, doch der Rollbraten liegt uns zu schwer im Magen, weshalb wir stattdessen einfach nur reden: Ich lege meinen Kopf auf ihren Schoß, sie streichelt meine Wange, und wir malen uns unsere gemeinsame Zukunft aus, wie wir das schon so oft gemacht haben; ich bin gerade erst sechsundzwanzig geworden, Daniel ist vierzig, und wir glauben, alle Zeit der Welt zu haben. »Warte!«, rufe ich plötzlich, stehe auf und mache schnell ein Foto von Daniels Gesicht, denn über ihr Kinn zieht sich die Rußspur einer Kartoffelkruste.
Am ersten Weihnachtstag besuchten wir meine Mutter, Daniels Familie besuchten wir nie. Ihr Vater lebte nicht mehr und ihre Mutter Maureen war vor Jahren zurück in die Heimat gezogen, nach Norwich. Wenn wir sie einladen würden, käme sie nicht, behauptete Daniel jedes Jahr felsenfest. »Ich suche mir meine Familie lieber selbst aus«, sagte sie dann oft. Letzteres war damals ein beliebter Gedanke unter unseresgleichen, aber manchmal hatte ich das Gefühl, Daniel beschreibe eher einen Wunsch statt eine gelebte Praxis. Ihre Freunde sahen wir schließlich auch nicht besonders häufig, nur Sjoerd kam hin und wieder zum Essen vorbei. Eigentlich konnte nur Barbara als Familie bezeichnet werden, was daran lag, dass die beiden sich schon aus der Zeit vor Daniels Unfall kannten. Es wirkte so, als wären sie durch etwas Unausweichliches miteinander verbunden, etwas, das zwingender als Freundschaft war, als hätten sie nicht die Möglichkeit gehabt, sich wirklich füreinander zu entscheiden. Aber Barbara war Familie — selbst gewählt oder nicht — und somit ein Teil unseres Lebens, unserer Feste und Rituale. Und wie jedes Jahr feierten wir Silvester auch diesmal mit Barbara und ihrer Freundin Nettie.