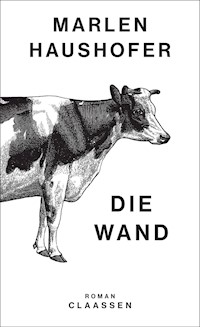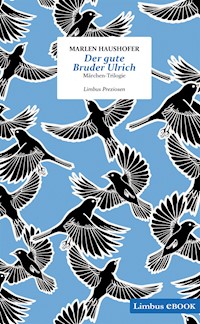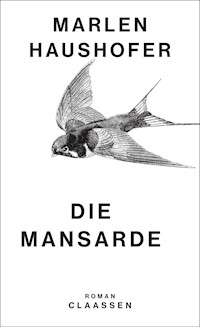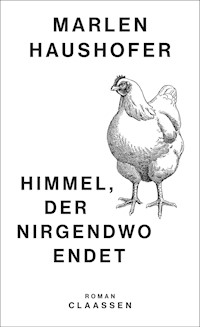8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die beiden Meisternovellen der berühmten österreichischen Schriftstellerin Was Marlen Haushofer auszeichnet, ist ihre Fähigkeit, in scheinbar schlichter Sprache messerscharfe Beobachtungen anzustellen, die unter die Haut gehen. So auch in der meisterhaften Novelle Wir töten Stella, einer furiosen und nüchternen Darstellung der Machtstrukturen und -kämpfe in einer Familie, einer eiskalten Bestandsaufnahme einer gescheiterten Beziehung: Aus ängstlicher Bequemlichkeit und dem vergeblichen Wunsch, dem Sohn eine perfekte Familie vorzugaukeln, nimmt eine Ehefrau die Affären ihres Mannes leidend hin. Sie schreitet auch nicht ein, als Richard die neunzehnjährige Stella verführt. Diese nimmt sich schließlich aus Verzweiflung das Leben, und nun fühlt Anna sich mitschuldig, klagt sich an als Komplizin ihres Mannes ... Das fünfte Jahr schildert Ereignisse eines Jahres aus der Sicht einer Vierjährigen, die auf dem Hof ihrer Grosseltern in den Bergen aufwächst. Die Kinder der Grosseltern sind alle gestorben (vermutlich im Krieg), und Marili, die wohlbehütete Enkelin, entdeckt mit kindlicher Neugier die Sonnen- und Schattenseiten des Lebens. Die Grossmutter ist eine stille, melancholische Frau, gezeichnet vom Leben, während der Grossvater mit seinem ruhigen, fröhlichen Gemüt sehr viel Wärme ausstrahlt. Marili könnte mit ihrem Leben zufrieden sein, wären da nicht ein paar furchteinflössende Dinge, mit denen sie konfrontiert wird. Beispielsweise jenes Bild des Gekreuzigten in ihrem Zimmer. Marili ängstigt sich davor, weil der Sohn Gottes, der für die Sünden der Menschen gestorben ist, in der Nacht aus dem Bild steigt und mit seiner bedrohlichen, vorwurfsvollen Gegenwart den Raum ausfüllt. Marili kann sowieso nicht verstehen, zu was dieser Sohn Gottes gut sein soll – sie jedenfalls braucht ihn nicht. Viel lieber betet sie zum lieben Gott, ein alter und freundlicher, mächtiger Verwandter ihres Grossvaters. Dann ist da noch jene Kröte, die ihr oftmals im Traum erscheint und qualvolle Tode stirbt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Sammlungen
Ähnliche
Das Buch
Was Marlen Haushofer auszeichnet, ist ihre Fähigkeit, in scheinbar schlichter Sprache messerscharfe Beobachtungen anzustellen, die unter die Haut gehen. So auch in der meisterhaften Novelle Wir töten Stella, einer furiosen und nüchternen Darstellung der Machtstrukturen und -kämpfe in einer Familie, einer eiskalten Bestandsaufnahme einer gescheiterten Beziehung: Aus ängstlicher Bequemlichkeit und dem vergeblichen Wunsch, dem Sohn eine perfekte Familie vorzugaukeln, nimmt eine Ehefrau die Affären ihres Mannes leidend hin. Sie schreitet auch nicht ein, als Richard die neunzehnjährige Stella verführt. Diese nimmt sich schließlich aus Verzweiflung das Leben, und nun fühlt Anna sich mitschuldig, klagt sich an als Komplizin ihres Mannes … »Ich wüßte kein von einer Frau geschriebenes Stück Literatur, das mich in meinem Dasein und Verhalten als Mann fundamentaler in Frage stellte als diese Prosa. Ich zähle sie [Marlen Haushofer] ohne Zögern zu den Künstlerinnen vom Rang Ingeborg Bachmanns, Christa Wolfs.« (Otto F. Walter)
In ihrer nicht minder gelungenen Novelle Das fünfte Jahr schildert Marlen Haushofer Ereignisse eines Jahres aus der Sicht einer Vierjährigen, die auf dem Hof ihrer Großeltern in den Bergen aufwächst. Auch hier kommt hinter der Zeit- und Sorglosigkeit des kleinen Mädchens die kalte, harte Realität zum Vorschein, muß sie erste staunende Erfahrungen mit dem Negativen im Leben machen …
Das fünfte Jahr wurde 1953 mit dem Förderungspreis des Österreichischen Staatspreises ausgezeichnet; für Wir töten Stella erhielt Marlen Haushofer 1963 den Arthur-Schnitzler-Preis.
Die Autorin
Marlen Haushofer wurde am 11.April 1920 in Frauenstein/Oberösterreich geboren. Sie studierte Germanistik in Wien und Graz und lebte später mit ihrem Mann und zwei Söhnen in Steyr. Marlen Haushofer starb am 21.März 1970 in Wien. Sie wird zu den bedeutendsten Schriftstellerinnen Österreichs gezählt. Obwohl sie unter anderem 1968 mit dem Österreichischen Staatspreis für Literatur ausgezeichnet wurde, hatten ihre Bücher erst nach ihrem Tod großen Erfolg, als die Frauenbewegung sie für sich entdeckte.
In unserem Hause sind von Marlen Haushofer bereits erschienen:
Bartls Abenteuer
Begegnung mit dem Fremden
Himmel, der nirgendwo endet
Die Mansarde
Schreckliche Treue. Gesammelte Erzählungen
Die Wand
Wir töten Stella / Das fünfte Jahr. Novellen
Marlen Haushofer
Wir töten Stella Das fünfte Jahr
Novellen
List Taschenbuch
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-taschenbuch.de
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-0800-5
Ungekürzte Ausgabe im List Taschenbuch
1. Auflage Mai 2003
6. Auflage 2012
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2005
© 2003 by Ullstein Heyne List GmbH & Co. KG
© 1992 by Claassen Verlag, Hildesheim
© 1986 by claassen Verlag, Düsseldorf
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Titelabbildung: plainpicture
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
E-Book: CPI books GmbH, Leck
WIR TÖTEN STELLA
Ich bin allein, Richard ist mit den Kindern zu seiner Mutter gefahren, um das Wochenende dort zu verbringen, und die Bedienerin habe ich abbestellt. Natürlich hat mich Richard aufgefordert, mitzukommen, aber nur weil er wußte, ich würde nein sagen. Meine Anwesenheit hätte ihn und Annette nur gestört. Und ich wollte ja endlich allein sein.
Zwei Tage liegen nun vor mir, zwei Tage Zeit, um niederzuschreiben, was ich zu schreiben habe. Aber ich kann mich schlecht sammeln, seit dieser Vogel in der Linde schreit. Es wäre mir lieber, ich hätte ihn heute früh nicht entdeckt. Das verdanke ich meiner schlechten Gewohnheit, stundenlang am Fenster zu stehen und in den Garten zu starren. Hätte ich nur einen flüchtigen Blick hinausgeworfen, wäre er mir nie aufgefallen. Sein Gefieder ist so grüngrau wie die Rinde des Baumes. Erst nach einer halben Stunde bemerkte ich ihn, weil er zu schreien und zu flattern anfing. Er ist noch so jung, daß er nicht fliegen und noch viel weniger Mücken fangen kann.
Zunächst dachte ich, seine Mutter werde sogleich kommen und ihn ins Nest zurückbringen, aber sie kommt nicht. Ich habe das Fenster geschlossen und höre ihn noch immer schreien. Aber sie wird bestimmt kommen und ihn holen. Wahrscheinlich hat sie noch andere Junge zu versorgen. Er schreit übrigens so laut, daß sie ihn, wenn sie am Leben ist, unbedingt hören muß. Es ist lächerlich, daß dieser winzige Vogel mich so irritiert – ein Zeichen für den schlechten Zustand meiner Nerven. Schon seit einigen Wochen sind meine Nerven in diesem elenden Zustand. Ich kann keinen Lärm hören, und manchmal, wenn ich einkaufen gehe, fangen plötzlich meine Knie zu zittern an und der Schweiß bricht mir aus. Ich spüre, wie er in Tropfen über Brust und Schenkel rinnt, kalt und klebrig, und ich fürchte mich.
Jetzt fürchte ich mich nicht, denn in meinem Zimmer kann mir nichts geschehen. Außerdem sind sie ja alle fortgegangen. Nur das Fensterglas sollte viel stärker sein, daß ich dieses Geschrei nicht mehr hören müßte. Wäre Wolfgang hier, würde er versuchen, den Vogel zu retten, aber natürlich wüßte er ebensowenig wie ich, was man tun könnte. Man muß eben abwarten, die Vogelmutter wird noch kommen. Sie muß kommen. Ich wünsche es mit meiner ganzen Kraft.
Übrigens kann mir ja auch auf der Straße nichts geschehen. Wer, in Gottes Namen, sollte mir denn etwas antun? Und selbst wenn ich in ein Auto liefe, wäre es nicht schlimm, ich meine, nicht wirklich schlimm.
Aber ich bin ja so vorsichtig. Ich schaue jedesmal nach links und rechts, ehe ich über die Straße gehe, aus Gewohnheit; wie man es mir beigebracht hat, als ich noch ein kleines Mädchen war. Nur der freie Raum um mich herum macht mir Angst. Man merkt es mir aber nicht an, niemand hat es noch bemerkt.
Sie kann doch höchstens im nächsten Garten sein, oder im übernächsten. Jedes Haus hier hat einen Garten, unserer ist einer der größten und ungepflegtesten. Er ist nur dazu da, damit ich ihn vom Fenster aus sehen kann. Jetzt sind endlich die Lindenblätter herausgekommen, seit es so warm geworden ist. Alles ist ja heuer um Wochen verspätet. Ja, es scheint mir seit einigen Jahren, daß unser Klima sich allmählich verschiebt. Wo sind die glühenden Sommer meiner Kindheit, die schneereichen Winter und der zögernde, sich ganz langsam entfaltende Frühling?
Wenn es plötzlich wieder kalt würde, wäre das sehr böse für den kleinen Vogel. Aber ich mache mir unnötige Sorgen, es ist ja sogar ein wenig föhnig. Es kommt ja auch gar nicht an auf diesen winzigen Vogel, es gibt ja so viele von ihnen. Wenn ich ihn nicht gesehen und gehört hätte, wäre er mir ganz gleichgültig.
Ich wollte ja auch gar nicht über diesen unglückseligen Vogel schreiben, sondern über Stella. Ich muß über sie schreiben, ehe ich anfangen werde, sie zu vergessen. Denn ich werde sie vergessen müssen, wenn ich mein altes ruhiges Leben wieder aufnehmen will.
Denn das ist es, was ich wirklich möchte, in Ruhe leben können, ohne Furcht und ohne Erinnerung. Es genügt mir, wie bisher, meinen Haushalt zu führen, die Kinder zu versorgen und aus dem Fenster in den Garten zu schauen. Wenn man sich ruhig verhält, so dachte ich, kann man nicht in die Angelegenheiten anderer verstrickt werden. Und ich dachte an Wolfgang. Es war so angenehm, ihn täglich um mich zu haben. Vom Tag seiner Geburt an hat er immer zu mir gehört. Hätte ich Stellas wegen unser friedliches Beisammensein gefährden sollen?
Nun, es hätte nicht schlimmer für mich enden können, wenn ich es getan hätte. Stella rächt sich an mir und nimmt mir das einzige, an dem mein Herz noch hängt. Aber das ist Unsinn. Stella kann sich ja gar nicht rächen, sie war schon als Lebende so hilflos, wie hilflos muß sie erst jetzt sein. Ich selber räche Stella an mir, das ist die Wahrheit, und es ist auch ganz in Ordnung so, so sehr ich mich dagegen sträube.
Freilich habe ich immer schon gewußt, es würde einmal der Tag kommen, es hätte dazu nicht Stellas bedurft. Früher oder später wäre Wolfgang für mich verloren gewesen. Er gehört zu den Leuten, die sich keine Illusionen machen und die Konsequenzen ziehen. Auch ich mache mir keine Illusionen, aber ich lebe so, als machte ich mir welche. Früher dachte ich, ich könnte noch einmal von vorne anfangen, aber dazu ist es jetzt viel zu spät, dazu war es eigentlich immer zu spät, nur wollte ich das nicht zur Kenntnis nehmen.
Nichts könnte sich mehr lohnen, denn Wolfgang ginge doch von mir weg. Und das ist gut für ihn.
Irgendwo las ich, daß man sich an alles gewöhnen könne und Gewohnheit die stärkste Kraft in unserem Leben sei. Ich glaube es nicht. Es ist nur die Ausrede, die wir gebrauchen, um nicht über die Leiden unserer Mitmenschen nachdenken zu müssen, ja, um nicht einmal über unsere eigenen Leiden denken zu müssen. Es ist wahr, der Mensch kann vieles ertragen, aber nicht aus Gewohnheit, sondern weil ein schwacher Funke in ihm glimmt, mit dessen Hilfe er in aller Stille hofft, eines Tages die Gewohnheit zerbrechen zu können. Daß er es meist nicht kann, aus Schwäche und Feigheit, spricht nicht dagegen. Oder sollte es zwei Sorten Menschen geben, die einen, die sich gewöhnen, und die anderen, die es nicht können? Das kann ich nicht glauben; wahrscheinlich ist es nur eine Frage der Konstitution. Wenn wir in ein gewisses Alter kommen, befällt uns Angst und wir versuchen etwas dagegen zu tun. Wir ahnen, daß wir auf verlorenem Posten stehen, und unternehmen verzweifelte kleine Ausbruchsversuche.
Wenn der erste dieser Versuche mißlingt, und er tut es in der Regel, ergeben wir uns bis zum nächsten, der schon schwächer ist und uns noch elender und geschlagener zurückwirft.
So trinkt Richard regelmäßig seinen Rotwein, ist hinter Frauen und Geld her, meine Freundin Luise verfolgt junge Männer, deren Mutter sie sein könnte, und ich stehe vor dem Fenster und starre in den Garten hinaus. Stella, dieser dummen jungen Person, ist gleich der erste Ausbruchsversuch geglückt.
Es wäre mir viel lieber, ich könnte mit ihr tauschen und müßte nicht hier sitzen und ihre jämmerliche Geschichte schreiben, die auch meine jämmerliche Geschichte ist. Viel lieber wäre ich tot wie sie und müßte den kleinen Vogel nicht mehr schreien hören. Warum schützt mich niemand vor seinem Geschrei, vor der toten Stella und dem quälenden Rot der Tulpen auf der Kommode? Ich mag rote Blumen nicht.
Meine Farbe ist Blau. Es gibt mir Mut und rückt alle Menschen und Dinge von mir ab. Richard glaubt, ich trage meine blauen Kleider nur, weil sie mir zu Gesicht stehen; er weiß nicht, daß ich sie zum Schutz trage. Niemand kann mich in ihnen verletzen. Das Blau hält alles von mir fern. Stella liebte Rot und Gelb, und sie lief in dem roten Kleid, das ich ihr geschenkt hatte, in einen gelblackierten Lastwagen.
Dieser strahlend gelbe Tod, der wie eine Sonne auf sie zustürzte, ich glaube, er war schön und schrecklich, wie wir ihn aus den Sagen der Alten kennen.
Ich mußte sie identifizieren. Ihr Gesicht war unverletzt, aber grünlich weiß und viel kleiner, als es mir im Leben erschienen war. Der verstörte und halb wahnsinnige Ausdruck der letzten Tage war daraus gewichen und hatte einer eisigen Stille Platz gemacht.
Stella war immer ein wenig schwerfällig und scheu gewesen, auch wenn sie froh war, blieb ihr regelmäßiges, großflächiges Gesicht unbewegt. Es blühte dann von innen her auf bis in die Lippen. Stella war eine kurze Zeit hindurch sehr glücklich gewesen, aber sie war unfähig, die Spielregeln zu erlernen, sie konnte sich nicht anpassen und mußte untergehen.
Von einer leichtfertigen und habgierigen Mutter war sie schon als Kind in ein Internat gesteckt worden. Ich erinnere mich, sie damals, vor etwa fünf Jahren, in der Kirche beobachtet zu haben. Sie kniete neben mir, das Gesicht der Monstranz zugewandt, die Augen weit geöffnet, die Lippen ein wenig vorgewölbt, hingegeben und offen. Und mit demselben Ausdruck starrte sie später auf die Abendzeitung, hinter der sich Richards Gesicht verbarg. Auch Wolfgang sah es. Er errötete und erblaßte, und schließlich verschluckte er sich, um meine Aufmerksamkeit von Stella abzulenken. Mit seinen fünfzehn Jahren wußte er ebensogut wie ich, was vor unseren Augen geschah, und er versuchte verzweifelt, mich vor diesem Wissen zu schützen, während ich einzig und allein bestrebt war, ihn aus dem Spiel zu halten, und so genau das tat, was ich nicht hätte tun dürfen, nämlich nichts.
Während Stella, unfähig, ihr einziges großes Gefühl zu verbergen, unaufhaltsam in ihr Unglück glitt und Richard uns mit seiner glatten Bonhomie zu täuschen versuchte, bemühte ich mich, nichts zu sehen und zu hören. Wolfgangs wegen und auch mir selbst zuliebe, denn ich hasse nichts mehr als Auftritte, Auseinandersetzungen, und schon eine gespannte Stimmung genügt, um mich auf Wochen verstört und unruhig zu machen.
Die Einsamkeit und Ruhe meines Zimmers, die Aussicht auf den Garten, die Zärtlichkeit, die mich bei Wolfgangs Anblick erfüllt, hätte ich das alles — und es ist alles für mich — aufs Spiel setzen sollen, um eines Mädchens willen, das dumpf und unaufhaltsam in sein Schicksal rannte, von Anbeginn verurteilt, mit seinem einfachen, törichten Gefühl an unserer zerfallenden, gespaltenen Welt zu scheitern?
Nun, es war mir nicht der Mühe wert, aber es hätte mir der Mühe wert sein müssen, denn Stella war das junge Leben und ich ließ es in eine dieser mordenden Blechmaschinen laufen.
Man kann auf ganz verschiedene Weise zugrunde gehn, aus Dummheit ebensogut wie aus übertriebener Vorsicht; die erste Art erscheint mir würdiger, aber sie ist nicht die meine.
Luise, Stellas Mutter, kam erst nach dem Begräbnis. Sie war verreist gewesen, und kein Mensch in der kleinen Provinzstadt, in der sie lebt, wußte, wohin. Als wir sie endlich erreichen konnten, war schon alles vorüber. Richard hatte diese Sache erledigt, gut und passend, wie er alles zu erledigen pflegt. Luise, sie war übrigens mit ihrem Freund, einem jungen Magister, in Italien gewesen, saß uns nun in unserem Wohnzimmer gegenüber und schluchzte.
Richard sagte ihr Gemeinplätze, die aus seinem Mund viel überzeugender klingen als aus dem meinen, Worte der wahren Anteilnahme. Seine Augen wurden tiefblau und feucht, sie werden es auch, wenn er erregt oder betrunken ist, und ich mußte an die Kränze auf dem kahlen Hügel denken. Es waren übrigens nicht viele Kränze, denn Stella hatte in dieser Stadt nur uns und ein paar Schulfreundinnen. Ich dachte an den Hügel und an Stellas ausgebluteten, zerquetschten Körper in seinem hölzernen Gefängnis. Zum erstenmal überfiel mich das Mitleid. Es war töricht und absurd, denn Stella war tot, und doch schwoll das Mitleid in mir an wie ein körperlicher Schmerz, der wie ein Klumpen in meiner Brust saß und bis in die Finger ausstrahlte. Aber dieser Schmerz galt nicht mehr Stella, sondern ihrem toten Körper, der nun zum Zerfall verurteilt war.
Ich hörte Richard reden, verstand aber nicht, was er sagte. Von Entsetzen gepackt, sah ich nur seine Augen, die so feucht und lebendig waren. Jedes Haar an ihm lebte, seine Haut, sein Atem, seine Hände, und ich konnte nicht mehr atmen bei diesem Anblick.
Von außen gesehen waren wir ein Ehepaar in mittleren Jahren, das versuchte, eine schmerzgebeugte Mutter zu trösten. Nur ist Luise keine schmerzgebeugte Mutter. Stellas Tod kam ihr sehr gelegen. Das wußten wir, und sie wußte, daß wir es wußten, aber sie seufzte und weinte, wie es ihre Rolle verlangte.
Nun, da Stellas Erbteil, die Apotheke, an sie fällt, kann sie ihren Magister heiraten, der sie ohne diese Morgengabe nie genommen hätte. Sie kann sich diesen jungen, kräftigen Mann kaufen und sich eine Zeitlang einreden, daß sie Glück gehabt hat.
Stella war für uns alle eine Last gewesen, ein Hindernis, das nun endlich aus dem Weg geräumt war. Noch besser wäre es natürlich gewesen, sie hätte sich glücklich verheiratet, wäre ausgewandert oder sonst auf irgendeine Weise aus unserem Gesichtskreis verschwunden. Aber verschwunden war sie auf jeden Fall, und man konnte sie endgültig vergessen.
Ich bemerkte an Richard, wie sehr er sie schon vergessen hatte, da bei ihm Vergessen eine Sache des Körpers ist. Sein Körper hat Stella vergessen; groß, breit und hungrig nach neuen Frauen und Sensationen saß er neben mir und tätschelte Luises magere Vogelfinger mit seiner breiten gepflegten Hand, die sich immer trocken, warm und angenehm anfaßt.
Und Luises Gewimmer verstummte unter dieser Wärme und unter dem Klang seiner beruhigenden Stimme.
»Immer«, stöhnte sie, »hab’ ich ihr gesagt, gib acht, wenn du über die Straße gehst. Ich möchte nur wissen, wo sie ihre Gedanken gehabt hat.«
»Ja«, sagte Richard bekümmert, »das möchten wir auch wissen, nicht wahr, Anna?«
Er sah mich an, und ich nickte. Keine Spur von Ironie schwang in seiner Stimme mit. Ich entschuldigte mich und sagte, daß ich in die Küche sehen müsse. Ich ging aber nicht in die Küche, sondern ins Badezimmer, und fing an, ein wenig Rouge aufzulegen. Die Blässe kleidet mich nicht.
Auch Stella war in den letzten Wochen blaß, aber sie war neunzehn und das Leiden verfeinerte ihr Gesicht und machte es erwachsen und reizvoll. Eine Frau über Dreißig müßte aufhören können zu leiden, es tut ihrem Aussehen dann nicht mehr gut.
Als Stella zu uns kam, war ihre Haut leicht gebräunt. Sie war schön, aber ganz ohne Scharm und Grazie. Für den modernen Geschmack war sie ein wenig zu gesund und kräftig. Es hat ja später auch eines schweren Lastwagens bedurft, um das Leben aus ihrem Körper zu quetschen. Es war so rücksichtsvoll von Stella, wie zufällig vom Gehsteig zu treten, so daß man ein Unglück annehmen konnte. Und es zeigt, wie wenig Luise ihre Tochter gekannt hatte, daß sie an dieses Unglück glaubte. Denn Stellas Verträumtheit war die eines schläfrigen, starken jungen Tieres, das wie im Traum seinen Weg durch das Gewühl der Stadt findet. Nicht einmal der Fahrer des Lastwagens, ein junger primitiver Mensch, hat an das Unglück geglaubt. Stella wollte tot sein, und mit der gleichen besinnungslosen Selbstaufgabe, mit der sie sich ins Leben hatte fallen lassen, fiel sie aus dem Leben, das vergessen hatte, sie festzuhalten mit ein wenig Liebe, Güte und Geduld. Wir haben Ursache zur Dankbarkeit. Wie peinlich wäre es gewesen, hätte sie Schlafpulver genommen oder sich aus einem Fenster gestürzt. Ihre Vornehmheit, die eine Vornehmheit des Herzens war, zeigte sich in der Art, in der sie starb, uns allen die Möglichkeit schenkend, an ein sinnloses Unglück zu glauben.
Aber was nützt mir das, wenn der einzige, der es wirklich hätte glauben müssen, es nicht glaubt und niemals glauben wird. Immer wird Stella zwischen mir und Wolfgang stehen. Die Zeit der kindlichen Zärtlichkeit und des Vertrauens ist vorüber. Wolfgang verabscheut seinen Vater und verachtet mich wegen meiner Feigheit. Erst viel später wird er mich verstehen, dann nämlich, wenn er wie ich von einem Zimmer ins andere gehen wird, allein mit der Unruhe und dem Wissen um die völlige Ausweglosigkeit des Kerkers. Aber dann werde ich nicht mehr sein, so wie mein Vater nicht mehr ist, dessen ironisches Gewährenlassen mich als Kind mit Unsicherheit erfüllte. Der Blick, der mich traf, wenn ich mit meinen Puppen spielte, ist der Blick, mit dem ich Wolfgang folge, wenn er mit seinem Freund zum Tennis geht und mit dem er schon jetzt die Spiele seiner kleinen Schwester beobachtet.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.