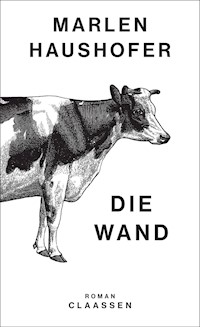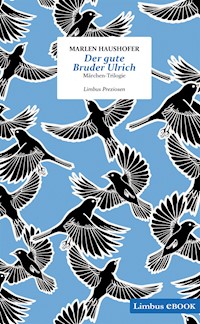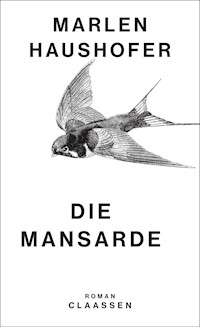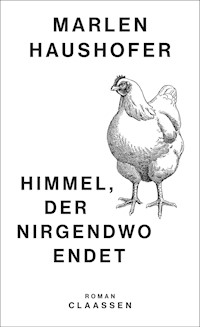
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Einfühlsam und sehr genau beobachtend, beschreibt Marlen Haushofer die Welt aus der Sicht der kleinen Meta, die in einem Forsthaus aufwächst. Mit allen Sinnen nimmt diese ihre idyllische Umgebung in sich auf und versucht, Ordnung in das Durcheinander der Eindrücke und Ereignisse zu bringen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Frau in blauem Kleid vor blauem Himmel. Text: ‚Marlen Haushofer‘ und ‚Himmel, der nirgendwo endet‘. Buchumschlag.
Die Autorin
Marlen Haushofer wurde am 11. April 1920 in Frauenstein / Oberösterreich geboren. Sie studierte Germanistik in Wien und Graz und lebte später mit ihrem Mann und zwei Kindern in Steyr. Marlen Haushofer starb am 21. März 1970 in Wien. Obwohl sie unter anderem 1968 mit dem Österreichischen Staatspreis für Literatur ausgezeichnet wurde, hatten ihre Bücher erst nach ihrem Tod großen Erfolg, als die Frauenbewegung sie für sich entdeckte.In unserem Hause sind von Marlen Haushofer bereits erschienen: Bartls Abenteuer · Begegnung mit dem Fremden · Himmel, der nirgendwo endet · Die Mansarde · Schreckliche Treue. Gesammelte Erzählungen · Die Wand · Wir töten Stella / Das fünfte Jahr. Novellen
Das Buch
»Das kleine Mädchen, von den Großen Meta genannt, sitzt auf dem Grund des alten Regenfasses und schaut in den Himmel. Der Himmel ist blau und sehr tief. Manchmal treibt etwas Weißes über dieses Stückchen Blau, und das ist eine Wolke. Meta liebt das Wort Wolke. Wolke ist etwas Rundes, Fröhliches und Leichtes.«Metas Welt ist das Forsthaus mit all seinen Menschen, Tieren und Pflanzen, die es zu entdecken und erforschen gilt. Eine Welt voller neuer großer Eindrücke und Erfahrungen, die Meta nach und nach zu einem Ganzen zusammensetzen muß … Einfühlsam und phantasievoll erzählt Marlen Haushofer aus jenem Reich, dessen Himmel nirgendwo endet – aus dem Reich der Kindheit.
Marlen Haushofer
Himmel, der nirgendwo endet
Roman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Ungekürzte Ausgabe im List Taschenbuch1. Auflage Mai 2005© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2005© 1992 by Claassen Verlag GmbH, Hildesheim© 1969 by Claassen Verlag GmbH, Hamburg und DüsseldorfUmschlaggestaltung: Sabine Wimmer, BerlinTitelabbildung: Image Source / jupiterimagesE-Book-Konvertierung powered by pepyrus.comAlle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-8437-0798-5
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Himmel, der nirgendwo endet
Empfehlungen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Himmel, der nirgendwo endet
Widmung
Für meinen Bruder
Himmel, der nirgendwo endet
Das kleine Mädchen, von den Großen Meta genannt, sitzt auf dem Grund des alten Regenfasses und schaut in den Himmel. Der Himmel ist blau und sehr tief. Manchmal treibt etwas Weißes über dieses Stückchen Blau, und das ist eine Wolke. Meta liebt das Wort Wolke. Wolke ist etwas Rundes, Fröhliches und Leichtes.
Meta sitzt strafweise im Regenfaß. Sie hat die Großen bei der Heuernte gestört und geärgert. Sie ist zweieinhalb Jahre und kann nicht über den Faßrand blicken; eingefangen, festgehalten und eingesperrt zu werden ist das Schlimmste, was es gibt. Sie würgt an einem Brocken aus Schmerz und Wut, der immer wieder vom Magen in die Kehle steigt und sich nicht schlucken läßt. Ein schreckliches Unrecht ist ihr geschehen. Sie hat eine Weile gebrüllt, jetzt weint sie still vor sich hin. Die Großen sind böse. Sie wird sie einfach fortschicken. So, jetzt sind sie weit weg, und Meta will sie nie wieder sehen. Sie ist ganz allein. Ermattet vom Weinen rutscht sie zu Boden und sitzt auf Moospolstern und kleinen Steinen. Seit Wochen hat es nicht mehr geregnet. Es ist heiß und trocken im Faß. Das Holz ist alt und glänzt silbergrau. Es zieht die kleinen Hände an und läßt sich betasten und streicheln, bis es leise zu summen beginnt. »Mach dir nichts draus; sie werden dich schon wieder holen, die Großen. Ich bin gut und warm, du mußt dich nicht fürchten.« Meta lauscht dem Gesumm und lehnt die Wange gegen die gewölbten Bretter. Zartes rauhes Streicheln und Wärme, die unter die Haut dringt. Sie fängt an das Holz abzuschlecken; es schmeckt vertraut und ein wenig bitter. Der Brocken in ihrer Kehle löst sich, fließt zurück in den Leib und versickert. Das alte Faß ist brav und zum Liebhaben. Aus seinen Rissen, in der Glut vergangener Sommer entstanden, wachsen kleine Moospflanzen und bilden Polster für eine feuchte gekränkte Wange. Immer tiefer hinab gleitet das Kind. Jetzt liegt es auf dem Rücken. Es gibt so viel zu sehen; die eigenen bräunlichen Knie, darüber das silbrige Holz und das Fleckchen Himmel, eine tiefblaue Gasse, die nirgendwo endet. Meta reißt die Augen ganz weit auf, und die Bläue sickert in sie hinein. Das tut sie so lange, bis sie ganz dick und angeschwollen ist und der Himmel verblaßt. Dieses Spiel ist nicht ganz geheuer. Vielleicht mag der Himmel nicht, daß man ihm seine Farbe wegnimmt. Meta schließt die Augen und schickt die Bläue wieder hinauf. Das ist sehr anstrengend, und sie wird müde und leer davon. Als sie endlich die Augen aufschlägt, leuchtet der Himmel wieder tiefblau.
Meta ist ganz und gar getröstet, und immerfort wispert das alte Faß seine unverständlichen Geschichten.
Alle hundert Jahre beugt sich ein Großer, ein Riese, über den Rand, und seine Stimme klingt brummend oder kreischend in die warme Dämmerung. Je nachdem, ob es ein Mann-Riese oder eine Frau-Riese ist. Meta tun die hellen Stimmen in den Ohren weh, deshalb hat sie die Mann-Riesen lieber. Rollende Augen, vorspringende Nasen, Schnurr- und Kinnbärte, nackte schweißglänzende Wangen. Und die Riesen riechen bis auf den Grund des Fasses und verdecken den Himmel mit ihren großen Gesichtern. Meta mag heute die Riesen nicht sehen und schließt die Augen. Wenn sie dann wieder die Lider öffnet, ist da nichts als die tiefe blaue Gasse, das schimmernde Holz und die leise alte Faßstimme. Ein rotbrauner Falter läßt sich auf dem Rand nieder, und wo seine Flügel an die Bläue des Himmels stoßen, zittern goldene Bänder. Später kommt eine Hummel, umkreist brummend das Faß und läßt sich auf Metas Knie nieder. Dort sitzt sie lange und betastet mit ihrem Rüssel die feuchte Haut. Es kitzelt ein wenig, aber Meta regt sich nicht.
Die Hummel erweckt ihr Verlangen. Sie möchte sie fangen und anfassen, aber sie weiß, die Hummel mag nicht festgehalten werden. Endlich, das Gekrabbel ist schon fast nicht mehr auszuhalten, muß Meta leise auflachen, und die Hummel schießt mit einem zornigen kleinen Schrei in die endlose Himmelsgasse hinein, wird ein goldener Punkt und ist verschwunden.
Dann geschieht lange, lange Zeit gar nichts. Gewisper, Sirren von Gräsern, ferne Rufe von der Wiese her und der süße Geruch nach frischem Heu. Etwas drückt Metas Augen zu. Und da kommt ein Riese, ein Riese, den sie noch nie gesehen hat, und beugt sich über das Faß. Sein Bart ist rot und gelockt; er hat große blaue Augen und Haare, die in wilden Büscheln um seinen Kopf stehen. Seine Wangen sind dick und braunrot, und er zeigt breite weiße Zähne. Schön und schrecklich sieht er aus. Meta starrt hinauf in das feuchte Gesicht und atmet schweren Heugeruch. Die blauen Augen sind voll wilder Freude und voll Spott. Das ist kein braver Riese, aber auch kein böser. Sicher ist es der Riesenkönig. Jetzt wirft er den Kopf zurück und stößt ein tiefes, brüllendes Lachen aus.
Meta fährt hoch und sitzt ganz gerade. Der Riese ist fort, und der Himmel ist grau geworden. Aber das Gebrüll kann sie noch immer hören. Langsam wird es zu einem fernen Grollen. Meta fürchtet sich. Im Faß ist es fast ganz dunkel. Es stellt sich tot und hat aufgehört zu wispern. Das alte Faß hat auch Angst. Das ermuntert Meta ein bißchen. Sie streichelt die rauhe Wand und flüstert Trostworte. Aber das Faß bleibt stumm. Es hat sich ganz und gar in sein altes Holz verkrochen. Und da ist wieder das Gebrüll des Riesen. Es kommt vom Wald her. Dort stapft er jetzt über Bäume und Büsche und schüttelt zornig seinen roten Bart. Meta legt sich auf den Bauch und preßt das Gesicht ins Moos. Ein fremder Geruch steigt daraus auf, nach Finsternis und Verlassenheit.
Die Großen vergessen das Kind im Regenfaß nicht. Nachdem das letzte Fuder Heu eingebracht ist und als die ersten Regentropfen niederklatschen, befreien sie es aus seinem Gefängnis. Aber Meta hat die Großen ganz vergessen. Erstaunt starrt sie in die lachenden, aufgeregten Gesichter. »Aha«, sagen die Großen, »es hat also doch genützt, jetzt ist sie endlich brav. Man darf ihr einfach nicht alles hingehen lassen.« Meta weiß nicht, wovon sie reden. Sie ist sehr müde, und irgend etwas Wichtiges, dem sie auf der Spur gewesen ist, hat sich vor den lärmenden Großen verkrochen. Und sie fassen sie viel zu fest an. Sie zerren an ihren Haaren und bohren ihre dicken Finger in das sanfte junge Fleisch. Meta fängt an zu weinen und verbirgt ihr Gesicht an einer vertraut riechenden Brust. Dann verebben alle Geräusche, und es wird leer und still. Meta hat sich in den Schlaf geflüchtet.
Die ganze Welt stürmt auf Meta ein. Tausend Gerüche bedrängen ihre Nase, tausend Geräusche ihr Ohr, und die kleinen Hände tasten Glattes, Rauhes, Feuchtes, Trockenes, Heißes und Kaltes; ein Fetzchen Samt, ein schiefriges Holzscheit, Riesenhaut und Hundefell; die scharfe Glätte der Gräser und die ganz andere Glätte von Kieselsteinen. Und da ist auch noch der eigene Leib, der sich schmerzlich krümmt. Oder die kleinen Finger und Zehen wollen vor Freude schreien. Die Haut auf den Armen kräuselt sich, und Meta weiß nicht, soll sie lachen oder weinen. Alles ist ganz unsicher. Meta lernt und lernt, und wenn es zuviel wird, schnappt etwas in ihrem Kopf ein und läßt sie in Schlaf versinken. Schlägt sie die Augen auf, ist alles wieder da; das Brausen, die Gerüche und die Dinge, die sich in ihre Hände schmiegen. Sie ist sehr beschäftigt. Die Welt ist ein großes Durcheinander, das sie, Meta, in Ordnung bringen muß. Steinchen für Steinchen setzt sie aneinander, aber selten wird etwas Rundes daraus. Wenn sie die Welt einfach auffressen könnte, wäre sie aller Bedrängnis enthoben. Aber sie kann die Welt nicht auffressen, und so weiß sie nie, was im nächsten Augenblick geschehen wird. Was wird ihr hinter der Tür entgegentreten, wird süßer Duft aufsteigen oder beißender Gestank, wird das Blatt, das sie anfaßt, ihre Hand kühlen oder verbrennen? Es gibt gar keine Sicherheit.
Da ist Mama: sie besteht aus vielen Teilen; aus einem dunklen Zopf, der bei Tag aufgesteckt ist und nachts hin und her baumelt auf dem weißen Nachthemd. Der Zopf riecht sehr angenehm. Mamas Hände sind warm und rund. Manchmal tun sie wohl und manchmal weh. Mama hat eine Brust, an die Meta den Kopf lehnen, und einen Schoß, auf dem sie sitzen kann. Ob die blaue Schürze ganz zu Mama gehört, ist ungewiß, denn sie ist nicht immer da. Mamas Stimme ist liebevoll und geduldig oder böse und grell. Nie weiß Meta, wie sie klingen wird. Aber das alles zusammen ist Mama und riecht sehr gut. Sie zeigt Meta Bilderbücher und liest ihr Märchen vor.
Es gibt Hunde, die im Haus herumlaufen, und Hunde, die in Bilderbüchern wohnen. Auch Menschen gibt es in den Büchern, Katzen, Kühe und Hähne. Und ein Haus mit rotem Dach. Aus einem Fenster streckt ein Kind ein Körbchen mit Erdbeeren. Meta möchte wissen, was mit diesen Figuren geschieht, wenn Mama das Buch zuschlägt. Ganz heimlich schleicht sie sich an und klappt das Buch wieder auf. Da stehen sie noch immer starr und unbewegt. Meta ist sicher, daß sie sich nur über sie lustig machen. Nachts, wenn alles schläft, springen sie aus dem Buch heraus und spielen in der Stube. Einmal ist das Kind mit den Erdbeeren an Metas Bett getreten, und der kleine schwarz-weiß gefleckte Hund ist auch dabeigewesen. Das Kind ist nicht lieb; Meta fürchtet sich ein bißchen vor ihm, aber den Hund möchte sie gern wiedersehen. Und er kommt auch wieder. Er legt seine Pfoten auf den Rand des Gitterbettes, und Meta spürt seinen heißen Atem auf der Wange. Und gerade wie sie sich freudig aufsetzt, macht es einen lauten Donnerschlag, und der Hund ist weg. Meta schreit vor Schreck. Mama sagt: »Du hast geträumt. Der Hund war nur in deinem Kopf, nicht wirklich.« Meta glaubt ihr nicht; wie käme ein ganzer Hund in ihren Kopf. Entschlossen klettert sie aus dem Bett. Sie muß unbedingt den Hund finden, er kann noch nicht weit gelaufen sein. Sicher wartet er in der Küche auf sie. Aber sie kommt nicht weit, sie verhaspelt sich in ihr langes Nachthemd, und Mama fängt sie ein und trägt sie ins Bett zurück. Meta brüllt vor Wut. Sie bekommt ein paar Klapse und weint sich in den Schlaf.
Die Großen sind leider sehr lästig. Alle stellen sich Meta in den Weg und hindern sie an ihren Forschungen. Nur weil sie so groß sind, muß man ihnen gehorchen. Aber einmal wird sie ihnen entwischen und einfach weglaufen. Oh, wie lästig die Großen sind! Meta muß Wolljacken anziehen, wenn es heiß ist, und ihre Zehen, die so gern in feuchter Erde wühlen, werden in harte Schuhe gezwängt. Und sie darf nie tun, was so wichtig für sie wäre, den Dingen auf den Grund gehen. Und wenn sie das nicht tun darf, wird sie auf der Stelle in winzige Stücke zerspringen; ganz bestimmt, gleich wird es soweit sein.
Vater ist nicht so lästig wie Mama oder Berti, das Mädchen. Die beiden sind den ganzen Tag hinter ihr her. Vater kommt immer gegen Abend nach Hause, und wenn er gegessen hat, nimmt er Meta auf die Knie und erzählt ihr Geschichten. In diesen Geschichten geht es zu wie im Traum. Man weiß nie, was geschehen wird; kleine Mädchen verwandeln sich in Bäume, und wenn sie auf eine Frage keine Antwort wissen, verwandeln sie sich in Nußhäher und fliegen fort über den Wald, und kein Mensch sieht sie jemals wieder. Und alle Hunde können sprechen in Vaters Geschichten, und sie sagen die unglaublichsten Dinge. Mama behauptet, kleine Mädchen können sich nicht in Nußhäher verwandeln und Hunde können niemals reden, aber Meta will das nicht glauben. Freilich, Schlankl, der Jagdhund, redet nicht, aber nur, weil er nicht will. Er versteht jedes Wort, aber aus Eigensinn sagt er nur wuff darauf. Das ist sehr gescheit von ihm, denn wollte er antworten, müßte er gehorchen wie Meta und immerzu dies und das herbeitragen. So wälzt er sich frei und glückselig im Ofenloch. Meta beschließt auch zu schweigen, aber es gelingt ihr nicht. Die Worte springen nur so aus ihrem Mund, und schon heißt es wieder: »Zieh die Jacke an, mach die Tür zu, sei ein braves Kind.«
Meta mag kein braves Kind sein; eine stille tiefe Abneigung gegen alles, was brav ist, wächst in ihr und wird von Tag zu Tag hartnäckiger. Nur wenn Vater »brav« sagt, ist es etwas anderes. Es klingt dann wie: Spielen wir einmal braves Kind; nur so zum Spaß. Er zwinkert dazu mit einem Auge, und alles wird lustig, sogar das Wort »brav«. Leider ärgert Mama sich darüber, und ein Schatten fällt über das Spiel. Meta ahnt, der Vater soll nicht spielen, er soll ernsthaft sein; er soll nicht mit einem Aug’ zwinkern und Geschichten erzählen, in denen es zugeht wie im Traum. Sie müssen beide sehr vorsichtig sein. Meta mag nicht, daß Vater und Mama ihretwegen aufeinander böse sind. Dann wird es finster in ihrem Kopf, und sie möchte gar nicht auf der Welt sein. Deshalb bemüht sie sich, brav zu sein, wenn Vater nach Hause kommt. Sie lacht nur gedämpft zu seinen Geschichten und gibt Mama keine frechen Antworten.
Freche Antworten nennt Mama es, wenn Meta sagt, was sie denkt. Es ist so schwierig, nicht zu sagen, was man denkt. Manchmal gelingt es Meta, aber das ist gar nicht lustig; alles miteinander stimmt dann plötzlich nicht mehr. Freche Antworten geben dagegen ist wundervoll, aber nur ganz kurze Zeit. Gleich darauf, wenn Mama böse wird, ist es nicht mehr wundervoll. Auch wenn Meta Sieger bleibt und trotzt; ein dicker schwarzer Kummer bleibt zurück. Das alles ist unverständlich. Woher kommt der Kummer; wo ist er, wenn er nicht in Metas Bauch sitzt? Und wie könnte man ihm entgehen. Gar nicht, plötzlich ist er da und läßt sich nicht vertreiben. Mama ist böse, und Meta ist böse, aber sie ist die Schwächere. Unter ihrem Bösesein weint das Verlangen nach Mamas kühler Wange, nach ihrem dunklen Zopf und dem Duft, den er ausströmt.
Ganz langsam wächst eine Wand zwischen Mutter und Tochter auf. Eine Wand, die Meta nur in wildem Anlauf überspringen kann; kopfüber in die blaue Schürze, in eine Umarmung, die Mama fast den Hals verrenkt und ihr das Haar aus dem Knoten reißt. »Mußt du denn so wild sein? Entweder du bist verstockt, oder du bringst mich fast um vor lauter Wildheit. Kannst du kein braves, sanftes Kind sein?« Meta kann kein braves, sanftes Kind sein. Verzagtheit überfällt sie und läßt ihre kleinen Arme lahm niedersinken. Der wunderbare Duft entfernt sich. Die Wand ist wieder ein winziges Stück gewachsen.
Der Hund, für den Meta ein Haus aus Holzscheitern baut, hat sich in einen Fichtenzapfen verwandelt, damit er in das kleine Haus paßt. In Wahrheit ist er aber ein Hund und heißt Bergerl. Er hat schwarze Flecken auf weißem Grund und ist nicht nur ein Hund, sondern auch Metas Kind. Bergerl ist sehr schön und duftet nach Harz. Eben teilt er Meta mit, daß er müde ist und schlafen will, und sie nimmt ihr kleines Taschentuch und deckt ihn damit zu. Der Fichtenzapfenhund schließt die Augen und beginnt leise und melodisch zu schnarchen.
Meta besitzt keine Puppe. Man kann ihr keine Puppe schenken, denn sie zerlegt jede in ihre Bestandteile. Sie macht sich gar nichts aus Puppen. Puppen sind kalt und dumm und riechen nach gar nichts. Außerdem sehen sie jeden Tag gleich aus.
Mama sitzt an der Nähmaschine, dem schnurrenden Ungeheuer, das man nicht anfassen darf, und näht weiße Vorhänge fürs Schlafzimmer. Sie ist fröhlich und singt halblaut vor sich hin:
»Es hat keine Dornen die Wasserros’,sie trägt den Frieden in ihrem Schoß.«
Meta weiß nicht, was eine Wasserros’ ist, und auch das Wort »Frieden« kennt sie nicht, aber das Lied gefällt ihr. Es klingt so schön traurig und feierlich. Langsam sträuben sich die feinen Härchen auf ihren Armen und Beinen, und sie beginnt zu zittern. Beklommen streichelt sie den schlafenden Bergerl in seinem Holzbett. Die Luft im Zimmer schlägt Wellen und schwillt an und ab mit dem Gesang.
Überhaupt ist heute ein besonderer Tag. Mama ist so froh, das Nähen tut ihr gut. Meta rührt sich nicht. Es ist besser, sie bleibt ganz still und macht sich klein, damit Mama sie vergißt, nur an ihre Vorhänge denkt und fröhlich bleibt. Die Fliegen summen am Fenster, und Mamas Stimme zittert beim Singen immer auf und nieder. Über Metas Rücken läuft ein Schauer hin. Sie möchte weinen oder lachen, aber sie will ja ganz still sitzen, damit Mama nicht aufhört. Jetzt tut der Gesang schon ein wenig weh, und Meta merkt gar nicht, daß sie zu winseln anfängt wie ein kleiner Hund. Mama verstummt und wendet erstaunt den Kopf, und da springt Meta auf und stürzt sich in die blaue Schürze. Plötzlich versteht sie alles. Die Wasserros’, das ist Mama, und in ihrer blauen Schürze ist Frieden. Frieden ist das Wunderbarste, was es auf der Welt gibt. Mama streichelt Metas Kopf und lacht ein bißchen, ehe sie das Kind wegschiebt und aufsteht. »So«, sagt sie befriedigt, »und jetzt hängen wir die Vorhänge auf.« Meta ist froh, daß etwas geschieht. Noch mehr Gesang könnte sie wirklich nicht aushalten. Sie kann befreit lachen, und die Luft hat aufgehört Wellen zu schlagen. Mama breitet die Vorhänge aus, die sie selber bestickt hat: hellblaue Schlüsselblumen mit gelben Staubgefäßen. Gemeinsam tragen sie die Vorhänge ins Schlafzimmer. Mama steigt auf einen Sessel und befestigt sie. Ihre Freude färbt auf Meta ab. So ist es: wenn man ganz allein etwas Schönes gemacht hat, ist man zufrieden und stolz. Die Schlüsselblumen leuchten blauer als der Himmel, und die Staubgefäße lassen Meta an die gelben Butterwecken in der Speisekammer denken. Einen schöneren Vorhang hat es nie gegeben. Meta äußert begeistert diese Meinung, und Mama lacht geschmeichelt dazu. Die Vorhänge bauschen sich leicht im Frühlingswind, weiß, blau und gelb, und Meta bekommt Herzklopfen vor Freude.
Immer soll Mama so stehen bleiben, nichts darf sich ändern. Meta ist noch sehr klein, aber schon jetzt weiß sie, nichts bleibt, wie es ist. Mama wird in die Küche gehen und keine Zeit für sie haben, und die Seligkeit wird aufhören. Schon jetzt ist diese Seligkeit getrübt von Angst und Wissen. Beinahe ist Meta froh, als Mama den letzten Vorhang befestigt hat und vom Sessel steigt. Wenigstens muß sie nicht länger warten auf das Ende der Seligkeit.
Auf der Schwelle dreht sie sich noch einmal um. Die Vorhänge fallen gerade, der Wind ist erstorben, und das Licht fällt gedämpft auf den honiggelben Fußboden. Eine große Stille und Freude erfüllt den Raum. Gefaßt zieht Meta die Tür hinter sich zu und klettert an Mamas Hand die Stiege hinunter. Die große Stille und Freude ist im Schlafzimmer eingeschlossen. Ein Strahl davon sickert noch durch das Schlüsselloch und macht die Stiege ein bißchen freundlicher.
Meta sitzt wieder vor ihrem Scheiterhaus und unterhält sich lautlos mit Bergerl, der von seinem Lager gekrochen ist und dringend einen Garten und Vorhänge für sein Schlafzimmer verlangt. Meta baut ihm einen großen Garten mit Bäumen und Kieswegen und hängt kleine Vorhänge aus Stoffresten vor die Fenster. Im Holzhaus ist es still und dämmrig, und Bergerl beschließt, noch nicht in den Garten zu gehen. Er legt sich wieder auf sein Bett und bewundert die prächtigen Vorhänge.
In der Küche klappert Mama mit dem Geschirr. Jetzt fängt sie gar zu pfeifen an. Meta hat das gar nicht gern. Es tut ihr in den Ohren weh. Leise schleicht sie zur Tür und drückt sie zu. Aber Mama entgeht nichts. Sie möchte wissen, was das bedeuten soll. Was hat Meta hinter geschlossenen Türen vor? Sicher etwas Böses. Meta ist bestürzt. Sie kann nicht sagen, mir tun die Ohren weh von deinem Pfeifen. Das würde Mama bestimmt kränken. So steht sie starr und schaut auf ihre Füße nieder. Mama ist enttäuscht. Was soll diese Verstocktheit? »Mach den Mund auf«, sagt sie, »du kannst doch reden. Warum hast du die Tür zugemacht?« Meta schweigt. Ihr Kopf ist ganz leer. »Na, ist schon gut«, sagt Mama heftig, »dann bleibt die Tür eben zu. Ich mag kein so trotziges Kind sehen.« Bums, schlägt die Tür zu, und Meta hockt trostlos neben ihrem Holzhaus. Bergerl wird aus dem Bett gerissen und wegen seiner Verstocktheit aus dem Haus verbannt. Er verkriecht sich traurig unter die Eckbank.
In düsterem Schweigen verrinnt die Zeit. Dort oben, über Metas Kopf, liegt das Schlafzimmer, und in ihm wartet die große Stille und Freude. Aber das ist alles sehr weit weg. Meta hat etwas falsch gemacht und Mama gekränkt. Nie wieder wird es sein wie heute nachmittag. Schwarz und undurchdringlich wächst der Kummer rund um sie herum. Jetzt reicht er ihr bis zum Hals, jetzt bis zur Stirn, und jetzt schlägt er mit einem bösen Schmatzen über ihr zusammen.
Im Roßstall ist es immer dämmrig. Auch wenn die Sonne scheint, wirft sie nur ein gelbes Band durch das kleine Fenster. Hier ist immer frische Streu aufgeschüttet, und in der Krippe hängt ein bißchen Heu. Der Stall steht ganz leer; nur selten kommt der Forstmeister und stellt seine Pferde ein. Die ganze Zeit über kann Meta hier ungestört spielen. Sie sitzt in der Streu und verwandelt Steine, Fichtenzapfen und Schneckenhäuser in Kühe, Hunde und Katzen, gibt ihnen Namen und baut Häuser für sie. Und alle sind sie ihre Kinder und müssen ihr gehorchen. Der Roßstall ist ein guter friedlicher Ort, der Meta immer ein bißchen schläfrig werden läßt. Ja, manchmal sinkt sie wirklich in die Streu zurück, und die Augen fallen ihr zu. Wenn Meta hier sitzt und spielt, gibt es sonst gar nichts auf der Welt. Wenn sie plötzlich an das Haus denken muß, springt sie auf und rennt hinaus, um nachzusehen, ob wirklich noch alles da ist und auf seinem Platz steht. Nachher kann sie beruhigt weiterspielen.