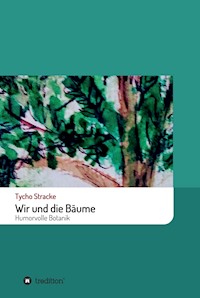
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Tycho Strackes "Wir und die Bäume" ist ein botanisches Werk, ein Blick in die Kulturgeschichte der Beziehung zwischen Mensch und Baum und Lesevergnügen in einem Buch. Wir erfahren Wissenswertes und Humorvolles zu mehr als dreißig Bäumen und verlieren dabei auch die Angst vor lateinischen Begrifflichkeiten. Dieses Buch ermöglicht es auch Laien, Bäume mit anderen Augen zu sehen und ihre tiefe Bedeutung für unsere Kultur nachzuvollziehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 130
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Tycho Stracke
Wir und die Bäume
hrsg. von Carolin Rother
© 2020 Tycho Stracke, Carolin Rother
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
Coverdesign: Carolin Rother
ISBN
Paperback:
978-3-7497-6496-9
Hardcover:
978-3-7497-6497-6
e-Book:
978-3-7497-6498-3
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
„Bei einem Spaziergang durch einen ‚ehrwürdigen‘ Mischwald, in dem Baumruinen und am Boden liegendes Totholz geduldet wurde, also fast schon ein mitteleuropäischer Urwald, genoss ich die Vielfalt des Lebendigen. Am Boden Moose, Kräuter, Kleinsträucher, Farne, verschiedene Sämlinge der Baumarten und Pilze. Durch diesen Pflanzenteppich krabbelten Käfer, Ameisen, krochen Schnecken, Tausendfüßler und vieles mehr. Mäuse, Wiesel, Iltis, Marder und Luchs hatten dort ihre Heimat. Auch Wolf und Bär waren nicht weit. Auf Zweigen von Sträuchern und Bäumen - bis in den Kronenbereich - tummelten sich Blaukehlchen, Tannenmeisen, Kleiber, Specht und viele mehr. Auch Waldkauz, Eulen, Schwarzstorch und Greifvögel fanden Plätze zum Nisten. Natürlich sind hier nur Beispiele aus der Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt genannt, die man auf Schritt und Tritt bei einiger Aufmerksamkeit bewundern durfte. In der Luft ein Schwirren von zahllosen Insekten wie Bienen, Käfer, Schmetterlinge und Libellen. Dazu das Gezwitscher der Vögel und oft geheimnisvolle Waldgeräusche.
- Doch plötzlich eine unheimliche Stille. Nichts bewegte sich, nicht einmal die Blätter an den Bäumen. Es war wie im Märchen von Dornröschen. Das dauerte nur wenige Momente, dann war wieder alles voll Leben. Was hatte das wohl zu bedeuten? Gab es das wirklich oder war das nur eine Lücke in meiner Wahrnehmung?“
Tycho Stracke November 2016
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Die Namen der Pflanzen
Die Eichen
Die Buchen
Die Linden
Die Ahornbäume
Die Eschen
Die Birken
Pappeln
Die Weiden
Die Erlen
Die Ulmen
Die Rosskastanie
Edelkastanien (Maronen)
Akazien – Robinien – Mimosen
Die Magnolien und einige ihrer Verwandten
Die Walnüsse
Die Kirschen
Unsere Äpfel
Die Birnen
Pflaumen, Zwetschgen und so weiter
Der Holunder
Weißdorn und Rotdorn
Die Kornelkirsche
Beerenfrüchte I
Beerenfrüchte II
Nadelgehölze und ihre Position im Pflanzenreich
O Tannenbaum – O Tannenbaum…
Pinus
Lärchen
Die Zypressen
Die Lebensbäume: Thuja
Wacholder
Rekordhalter unter den Bäumen und Exoten
Der Urwelt-Mammutbaum
Quellennachweise
Nachwort der Herausgeberin
Vorwort
Bäume spielten und spielen von Anbeginn der Menschwerdung bis heute immer eine beachtliche Rolle. Betrachten wir das alttestamentarisch, biblisch, dann war das im Garten Eden der „Baum der Erkenntnis“. Von den verlockenden Früchten dieses Baumes sollten laut Gottes Gebot Adam und Eva keinesfalls essen, doch die Schlange hat Eva, und letztlich auch Adam, listig dazu verführt, dieses Gebot zu brechen. Als Folge wurden sie und damit die nachfolgende Menschheit aus dem Paradies verwiesen und ihnen all die Plagen und Mühen des uns geläufigen Lebens auferlegt.
Betrachten wir die Menschwerdung im Sinn Darwins als einen evolutionären Prozess, haben wohl die Vorgänger des Homo erectus mehr oder weniger in und auf Bäumen gelebt. Auch nach dem bodenständig werden, dem generell sich aufrecht fortbewegen, waren für die Hominiden bis zum modernen Menschen Bäume immer von großer Bedeutung. Bäume lieferten Nahrung – Früchte verschiedenster Art – sie boten Schutz mit ihrem Blätterdach vor Regen und Sonne, Äste und Zweige (Knüppel) dienten als einfache Werkzeuge und Waffen. Seit der Nutzung und Beherrschung des Feuers war und ist (bis zur Grillkohle) Holz der wichtigste, anfangs wohl auch der einzige Brennstoff. Nicht nur mit der Sesshaftwerdung des größten Teils der Menschheit wurde das Holz unserer Bäume unverzichtbarer Baustoff, auch für die Nomadenzelte, Jurten und Tipis brauchte man Stangen aus Holz (Bambus wollen wir mal großzügig zum Holz hinzurechnen). Selbst bei den steinernen Monumenten der Frühgeschichte wie den Pyramiden, Tempeln oder Profanbauten ging so gut wie nichts ohne Holz als Hilfsmittel in verschiedener Form. Im Bauwesen, ob für Blockhäuser, tragendes Element für Geschossdecken oder tragende Struktur der Dachstühle wurde und wird immer wieder Holz in großen Mengen verwendet.
Im Altertum und Mittelalter wurden riesige Waldflächen, besonders wo die Eiche dominierte, abgeholzt, um das Material zum Schiffbau für ganze Flotten zu gewinnen. Mit Beginn des Industriezeitalters verbrauchte man ganze Wälder, weil der Bedarf an Holzkohle riesig war, bis die Steinkohle, meist in Form von Koks, die günstigere Variante für die Stahlindustrie wurde. Im Grunde genommen entstanden Steinkohle und die jüngere Braunkohle neben anderem organischen Material größtenteils aus Holz von sehr alten Baumarten, auch von Baumfarnen oder Riesenschachtelhalmen.
Näher liegt uns das Holz in unserem direkten Umfeld. Seit alters her baute man Tisch, Stuhl, Bank, Bett und Schrank aus Holz. Wenn auch avantgardistische Designer andere Materialien, Metalle, Kunststoffe bis zu Kohlefaserverbundstoffen usw. benutzten, bleibt doch das Holz, massiv, als Faserplatte und Furnier auch in der Gegenwart die erste Wahl. Selbst der fortschrittsgläubigste Homo urbanus(Stadtmensch) in einem modernistischen Bau aus Stahl, Glas und Beton und holzlosem Mobiliar kommt nicht ohne Produkte aus dem Rohstoff Holz aus. Man denke an Papier, nicht nur für Zeitungen oder Bücher, sondern auch in schön weichen Rollen von 10 cm Breite.
Mit diesen Zeilen soll an die vielfältigen Beziehungen des Menschen zu Bäumen und ihren Produkten erinnert werden, soll Interesse geweckt werden, sich mal etwas näher mit dem Thema „Bäume“ zu beschäftigen.
Die Namen der Pflanzen
Jedes Ding muss seinen Namen haben, nicht nur der Mensch, auch Pflanzen und Tiere. Die Mediziner haben auch für jedes Organ, jeden Knochen, Muskel oder Nerv, wie auch für jede Krankheit einen Namen. Manchmal nervt uns das, wenn „die Götter im weißen Kittel“ ihr „Fachchinesisch“ gebrauchen. Das „Fachchinesisch“ ist natürlich nicht chinesisch, im Wesentlichen kommen die Bezeichnung oder Begriffe aus der lateinischen Sprache.
Warum gerade Latein? Da müssen wir wohl auf die Bibel zurückgreifen. Ursprünglich waren große Teile, insbesondere das Alte Testament, in hebräischer Sprache verfasst. Es gab auch Teile in Griechisch, ob im Original, oder schon übersetzt. Im Neuen Testament dürften die Urtexte schon zum großen Teil in lateinischer Sprache verfasst worden sein. Das Zentrum des post Christum natum entstandenen Christentums befand sich vom Anbeginn bis heute in Rom. Also ist es logisch, dass alle Schriften, soweit sie fremdsprachig verfasst waren, in die damals gesprochene lateinische Sprache übersetzt wurden.
Zentren des europäischen Christentums wurden, neben dem Vatikan, die Klöster und zum Teil auch die Fürstenhöfe. Alle brauchten die Bibel als Grundlage ihres Glaubens und Wirkens. Bis zur Erfindung der Buchdruckerkunst um 1450 durch Gutenberg musste dieses Buch der Bücher Zeile für Zeile handschriftlich abgeschrieben werden. Durch Übersetzungen in andere Sprachen und allein schon durch Abschrift der Abschrift der Abschrift usw. konnten sich ungewollt, manchmal auch gewollt, Fehler, Irrtümer und Sinnverschiebungen einschleichen. Aus diesem Grunde gehört(e) zum Theologiestudium die Kenntnis der Sprachen Latein, Hebräisch und Altgriechisch. So sollte man Texte verstehen und auslegen können, die möglichst wenig oft übersetzt und abgeschrieben worden waren und am besten im Urtext vorlagen. Die Klöster und natürlich der Vatikan sammelten und übersetzen, wenn nötig, auch das, was an schriftlichen Zeugnissen aus Geschichte, Medizin, Wissenschaft, Philosophie und Mythologie erreichbar war. So wurde die christliche Kirche zum Bewahrer der europäischen und auch außereuropäischen Kultur und Wissenschaft – und all das in lateinischer Sprache. Logischerweise bedienten sich schon die ältesten Universitäten in Vorlesungen, Studien, Dissertationen und Veröffentlichungen der lateinischen Sprache. Diese Praxis endete noch vor gar nicht so langer Zeit. Ein Vorteil war, dass ein Professor, genau wie ein Student, ohne Sprachprobleme von einem Land und einer Universität in jedes andere europäische Land wechseln konnte. Denn mit dem Lateinischen hatten die Wissenschaftler eine international verständliche Sprache, was auch für den Austausch von neuen Forschungsergebnissen sehr wichtig war. Inzwischen hat hauptsächlich die englische Sprache das Lateinische verdrängt. In der Medizin, Botanik und Zoologie sind die Benennungen aber weitgehend in der lateinischen Form verblieben.
Der Naturwissenschaftler Linné (1707 bis 1778) schuf eine Ordnung und begründe die Systematik der Pflanzennamen und ihre Zuordnung in Familien, Gattungen, Arten und Species. Dieses weitgehend auf den lateinischen Namen aufbauende System ist vom Prinzip her auch heute noch gültig. Und das ist auch gut so. Die weltweit einheitlichen Namen der Pflanzen erlauben eine unmissverständliche Verständigung, allerdings nur für Fachleute und die interessierten Laien, die sich etwas mehr mit Botanik beschäftigen. Bedauerlicherweise werden immer wieder neue eingedeutschte Namen von Pflanzen erfunden, die oftmals in eine völlig falsche Richtung laufen. Ich denke hier zum Beispiel an den Enzianstrauch mit seinen blauen Blüten, der zu den Nachtschattengewächsen - Solanum - gehört und eher mit der Kartoffel, als mit dem Enzian in Verbindung zu bringen wäre. Aber auch traditionellere deutsche Namen können irre führen, zumal sie - je nach Sprachgebiet - oft für ein und dieselbe Sache ganz unterschiedlich sind.
Dazu einige Beispiele: Die Bezeichnungen Löwenzahn, Butterblume, sowie Kuhblume für die gleiche Pflanze, nämlich Taraxacum officinale. Oder auch die unterschiedlichen Namen Geranien, Storchschnabel und Pelargonien für die Pflanze Pelargonium zonale und peltatum, die wiederum auch als Efeupelargonie bezeichnet wird. Auch die sogenannten Eisbegonien (die allerdings überhaupt keinen Frost vertragen) werden unter anderem als Gottesauge bezeichnet und heißen im Lateinischen Begonia semperflorens. Weitere Beispiele sind „Schmuckkörbchen“ für die Pflanze Cosmea oder „Fleißiges Lieschen“ für Impatiens holstii.
Der jeweilige Zweitname bezeichnet die Art der Pflanze und ist vergleichbar mit unserem „Vornamen“. Er ist nötig, weil der erste Name die Gattung benennt. Bei Begonien sind beispielsweise 125 Artnamen („Vornamen“) gebräuchlich, da die Gattung sehr viele unterschiedliche Arten hat.
Es geht aber auch anders. Erfreulicherweise gibt es auch im deutschen Sprachgebrauch etliche Pflanzennamen, wie Gerbera (Gerbera) oder Fuchsien (Fuchsia), die mit dem „richtigen“ botanischen Namen völlig oder fast identisch sind. Bitte keine Furcht vor den „lateinischen“ Namen der Pflanzen, es ist die einzig mögliche Methode sich unmissverständlich auszudrücken. Außerdem geben speziell die Zweitnamen oft nützliche Hinweise auf Aussehen, Farbe, Eigenschaft, Verwendung oder Herkunft der jeweiligen Pflanze, um das herauszulesen muss man allerdings Latein beherrschen…
Die Eichen
Die Eichen, Gattung Quercus mit mehr als 300 Arten gehören zur Familie der Buchengewächse (Fagaceae).
In Österreich und Deutschland waren vor langer Zeit Eichen und Buchen bestandsbildende Gehölzarten. Wegen der außergewöhnlichen Eigenschaften des Holzes und dessen vielseitiger Verwendbarkeit entstanden Begehrlichkeiten von allen Seiten, die vom natürlichen Nachwuchs auf Dauer nicht vollständig befriedigt werden konnten.
Zwei Arten, die Stieleiche (auch Sommereiche genannt) und die Traubeneiche (auch als Winter- oder Steineiche bezeichnet) kommen in Mitteleuropa am häufigsten vor. Wegen ihrer Beständigkeit, Größe und oftmals imposanten Erscheinung wurden Eichen schon von den alten Griechen, Römern, Kelten, Slawen und Germanen verehrt und Göttern zugeordnet. Erst in den letzten beiden Jahrhunderten wurden sie zum Symbol der Stärke und des Heldentums, das Eichenlaub Grundlage der Siegerkränze statt dem Lorbeer. Schon im deutschen Kaiserreich über die Weimarer Republik hin bis ins dritte Reich zierte die Prägung von Eichenlaub Münzen, Medaillen und Orden. Auch auf den Münzen der BRD und der DDR konnten wir Eichenlaub finden und wer genau schaut, kann es heute noch auf den 1-, 2-, und 5-Eurocentmünzen deutscher Prägung (nicht aber auf denen anderer EU-Länder) erkennen.
Zurück zu unseren Eichen: Die Bäume erreichen Höhen bis 40 Meter, haben eine standfeste Pfahlwurzel und stehen gerne frei. Aus diesen Gründen und auf Grund ihrer Langlebigkeit, die mehr als 1000 Jahre betragen kann, ist es nur natürlich, dass viele Baumveteranen Spuren von Blitzeinschlägen aufweisen. Aber auch freistehende Buchen, Linden und Pappeln werden mindestens genauso häufig vom Blitz getroffen.
Das Holz ist mit einer Brinellhärte von 34-41 N/mm² sehr stabil. Durch den Gehalt von Gerbstoffen ist es recht widerstandsfähig gegen Verrottung und hat nur wenig Wurmbefall. Wegen dieser Eigenschaften wurde Eichenholz vorzugsweise für den Schiffsbau, Hafenbauten, Eisenbahnschwellen und als Bauholz verwendet. Auch für Pfahlgründungen selbst großer Gebäude (Venedig), oder für Brückenpfeiler hat sich Eichenholz über Jahrhunderte bewährt. In unserer Zeit findet es auch Verwendung im Möbelbau, oft als Furnier auf Holzfaserplatten.
Eine lange Tradition hat die Herstellung von Eichenholzfässern für die Lagerung und Reifung von Weinen, hauptsächlich Rotweinen, sogenannte „Barrique ausgebaute“ höherwertige Weine. Auch Cognac, Rum und Whiskey haben Charakter und Farbe (wenn nicht mit Zuckercouleur gemogelt wurde…) erst durch die Lagerung in Eichenfässern entwickelt.
Die im westlichen Mittelmeerraum beheimatete Korkeiche liefert uns den Kork, der außer für Flaschenstöpsel (werden durch Kunststoffstöpsel und Schraubverschlüsse zunehmend verdrängt) auch für Schuhsohlen, Korkböden, Untersetzer, aber auch für die Schall- und Wärmedämmung eingesetzt wird. Die Gewinnung erfolgt, indem alle 6 bis 10 Jahre die Korkeichenstämme, sowie dickere Äste, geschält werden, was den Bäumen offenbar nicht schadet.
Die zerkleinerte Rinde unserer heimischen Stieleichen wurde als „Gerberlohe“ zum Gerben besonders von Rindsleder verwendet (heute kaum noch).
Auf medizinischem Gebiet verwendet man Extrakte aus Eichenrinde in Bäder gegeben bei Hauterkrankungen wie Ekzemen, wegen ihrer entzündungshemmenden, antibakteriellen und antiviralen Wirkung. Auch in der aktuellen Krebstherapie – gerade in der anthroposophischen Medizin – verwendet man u.a. Misteln (Iscador), die auf Eichen gewachsen sind.
Die Früchte der Eichenbäume, die Eicheln, waren seit dem Altertum eine wichtige Nahrungsquelle für Eichhörnchen, Eichelhäher, Schalenwild, Wildschweine und andere Tiere. Gerade in Spanien sind sie als Mastfutter für domestizierte Schweine zur Herstellung der teuren Schinkenspezialität „Jamón Ibérico“, den man bis zu 30 Monate an der Luft reifen lässt, unverzichtbar. In Notzeiten wurde aus gemahlenen Eicheln, die durch Wässern entbittert werden mussten, ein stärkehaltiges Mehl gewonnen, das durch Rösten auch als Kaffeeersatz herhalten musste.
Ein weiteres Produkt, das uns diese Bäume schenken, war und ist der Gallapfel. Hauptsächlich aus der levantinischen Galleiche wachsen Galläpfel als „Kinderstube“ einer Gallwespenart heran. Gibt man einem Sud aus diesen Pseudofrüchten Eisen(II)-sulfat hinzu, entsteht die tiefschwarze Eisengallustinte, die auch heute noch zum Unterzeichnen (beispielsweise von Staatsverträgen) Verwendung findet. Diese Baumart, einschließlich ihrer Abkömmlinge in Amerika, wird uns immer interessieren. Es würde mich freuen, wenn Sie bei einem Ihrer nächsten Spaziergänge durch diverse Parkanlagen, aber auch durch den Wald, die Eichen mit einem neuen Blick betrachteten!





























