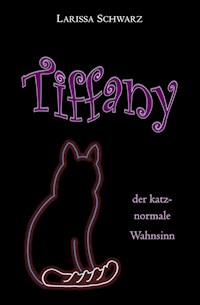Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Wer sind wir? Wann werden wir zu dem, was wir sind? Und wodurch? In den Neunzigern beginnt für fünf Freunde die Suche nach der eigenen Identität. Umwege, Abwege und Unwägbarkeiten führen sie in ein selbstbestimmtes Leben. Finden sie alle ihre Bestimmung? Alles wird sich ändern, wenn wir groß sind ... hoffen wir. Als Kind, als Heranwachsender. Sogar als Erwachsener manchmal noch. Und alles ändert sich tatsächlich. Auch wenn die Fäden der Freundschaft zerfasern, laufen sie irgendwann wieder zusammen. Dann werden sie unser Rettungsseil. Oder strangulieren uns.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 84
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Larissa Schwarz
Wir und Es
Erzählung
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.d-nb.de abrufbar.
Texte: © Larissa SchwarzUmschlaggestaltung: © Larissa Schwarz
Verlag:Edition Eschberg – Larissa Schwarz Heisterbusch 1
46539 [email protected]
Druck: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Ketchupkopf – Ketchup fürs Volk
Schon als ich klein war wusste ich, dass ich hässlich bin. Die anderen Mädchen im Kindergarten hatten längere Haare, ein hübscheres Lächeln, waren sportlicher und beliebter. Das änderte sich auch in der Grundschule nicht.
Ich war immer das Kind, das als Erstes ins Haus musste und selten bis nie länger aufbleiben durfte. Nicht einmal im Sommer, wenn die Sonne bis spätabends die Straßen und Gassen des Dorfes erhellte. Während alle anderen noch draußen Verstecken spielten, musste ich ins Bett und konnte nur aus der Ferne ihr Kichern und Reden hören. Was sie erzählten, konnte ich mir nur ausmalen.
Statt den Tag erst mit dem Sonnenuntergang zu beenden, lag ich in meinem abgedunkelten Zimmer und durfte noch ein paar Seiten lesen. Die Bücher entschädigten mich für das, was ich draußen verpasste. Von den anderen abgetrennt, öffneten sich mir Welten. Ferne und fremde, spannende und traurige, besondere und alltägliche. Es war mehr als ein Film in meinem Kopf. Ich tauchte in die Geschichten ein, suchte, rannte, erschrak und verliebte mich. Erlebte Wunder und Trauer, Freude und Vielfalt. Es war, als sei ich Teil dieser Welten, und je mehr ich las, desto klarer wurde für mich, dass ich ebenso Welten erschaffen wollte. Eine, in der ich mit den anderen auch so lange am Lagerfeuer sitzen durfte, bis ich vor Müdigkeit umkippte. Eine, in der ich einen zahmen Tiger als Haustier hatte. Eine, in der ich ich sein durfte und trotzdem von anderen gemocht wurde.
Den Kindern, die noch um die Häuser zogen und die wildesten Abenteuer erlebten, war nämlich egal, dass ich nicht mehr da war. Sie hatten ja sich. Es war ihnen gleichgültig, ob einer weniger beim Versteckspiel zu suchen war. Einer weniger, mit dem man die selbstgepflückten Kirschen teilen musste? Umso besser. Einer weniger, der das Abenteuer durch seine Zögerlichkeit in Gefahr brachte? Perfekt.
Tag für Tag rückte meine Kindheit ein wenig von der der anderen ab.
Ich war ein sonderbares Mädchen. Eigen. Stur. Eingebildet. Arrogant. Affektiert. Schlau. Nervig. Ängstlich. Langweilig. Und natürlich hässlich. So ein Mädchen konnte ja gar nichts anderes sein.
Ich war das Kind, dessen Brotdose man aus dem Tornister stahl und in den Müll warf. Meine Mitschüler standen herum und lachten, als ich in den Container kletterte, um sie wieder nach Hause zu bringen. Nicht ohne sie vorher gesäubert zu haben, damit die Mutter nichts merkte. Warum ich so fürchterlich aussah und so schmutzig war? Nur so. Nichts passiert. Schulweg eben. Da kommt jeder mal dran.
Der eine wurde häufiger geärgert, der andere weniger oft und wohl immer nur dann, wenn ich nicht dabei war.
Wenigstens hatte ich eine sprachliche Neigung, neben meiner Abneigung für Mathematik. Abends verschlang ich Band um Band der Fünf Freunde von Enid Blyton. Ich fühlte mich als Teil ihrer Gemeinschaft, rätselte mit ihnen und war überzeugt, dass wir gemeinsam diese Abenteuer bestehen würden. Stundenlang starrte ich mit meinen großen Froschaugen in das Buch, spielte mit meiner etwas zu großen Unterlippe, während das zu kurze Haar mir ab und an zu Berge stand. Aber das spielte keine Rolle, es sah ja niemand. Auch nicht Tim, Karl, Klößchen und Gabi, die kurz darauf in meine Bibliothek und in meinen Kopf einzogen.
Nach draußen in den Garten zu den anderen wollte ich gar nicht mehr, es war mir zu anstrengend, in den Ränkespielen und Machtkämpfen mitzuhalten. Mich prügeln und Mutproben bestehen wollte ich auch nicht. Zumindest nicht, wenn Letztere aus kleineren Diebstählen oder größerem Ungehorsam bestanden. Ich wusste, dass mein ständiges Zögern zu Erklärungsnöten führen würde, also ging ich der Konfrontation aus dem Weg. Was mich wiederum zur Zielscheibe machte.
Zwar war die Opferrolle auch nicht das große Los, da man als schlaues und hässliches Kind ja über den Dingen zu stehen und sich nicht so anzustellen hatte, aber für eine Weile ließ es sich damit leben. Ungefähr bis zum ersten Pickel.
Als mich zu dieser Zeit das erste Mal ein Junge als „Schönheit“ bezeichnete, war ich überrascht. Und elf. Oder zwölf.
Er war mit seinen Eltern aus dem Kosovo zugezogen und sprach erst wenig Deutsch. Jeden Tag, wenn ich auf dem Heimweg mit dem Rad an ihm vorbeifuhr, rief er: „Hallo, Schönheit!“ Ich winkte. Er winkte. Einige Wochen lang.
Als ich meiner einzigen Freundin davon erzählte, lachte sie mich aus und erklärte mir, dass die anderen Kinder ihm das beigebracht hätten und er das nur sagen würde, weil sie ihn sonst nicht in ihrer Bande mitmachen ließen. Meine Freundin kam aus gutem Hause, der Vater Anwalt, die Mutter Lehrerin; sie eiferte ihnen nach und gab lauter so kluge Sachen von sich. Ich glaubte ihr, als sie sagte, dass er mich eigentlich hässlich fand. Und vor allem dumm. Und dass da ja vielleicht was dran wäre.
Ich fand mich fortan nicht mehr nur hässlich, sondern auch dumm.
Gegen Ersteres ließ sich nicht viel unternehmen; meine Kleidung war von C&A und aus dem Discounter. Im Wachstum lohnte es sich nicht, teure Sachen zu kaufen. Schon gar keine Marken-Jeans oder Turnschuhe.
Meine Eltern hatten recht. Es fühlte sich trotzdem scheiße an.
Mein Bibliotheksausweis glühte in dieser Zeit. Wenn ich schon hässlich war, wollte ich wenigstens nicht dumm bleiben. Alles, was irgendwie interessant war, wurde ausgeliehen und binnen kürzester Frist verschlungen. Fontanes Effi Briest verstand ich zwar noch nicht zur Gänze, aber es schadete nicht. Sofies Welt wurde zu meiner. Und sie zerbrach beim nächsten Elternsprechtag.
Das hässliche und dumme Mädchen hatte zu wenig Freunde im Klassenverband und integrierte sich schlecht. Ein unhaltbarer Zustand. Der Vater müsse dringend dafür sorgen, dass sich etwas ändere. Notfalls mit professioneller Hilfe. Der Kinderarzt könne sicherlich vermitteln. Die wenigen Freunde in den Parallelklassen und die Kinder aus dem Dorf wären schließlich kein Maßstab und nicht der richtige Umgang. (Auch wenn sie mich verstanden, ebenso seltsam waren wie ich und doch so normal.) Der Junge, der so gern Geige spielte und für klassische Musik schwärmte, sei schließlich auch ein Sonderling. Immerhin mit einer Inselbegabung, aber kein gutes Beispiel. Robin, das burschikose Mädchen aus der letzten Reihe, erst recht nicht.
Das musste aufhören. Ich sollte mich gefälligst anbiedern!
Was für ein grandioser Auftritt der Oberstudienrätin.
Mein Vater war beeindruckt, ich heulte. Als hätte es nicht schon gereicht, gegen Pubertät und Stolpersteine der Gymnasiallaufbahn anzukämpfen, musste es nun auch noch Schauspiel sein. Gaarder, Austen und Hohlbein halfen mir da nicht; erst musste die Außenseiterin an sich arbeiten und dann an den Noten. Mit einem Zweierschnitt konnte es schließlich nicht weitergehen.
Stimmt. Es ging sogar viel lustiger weiter. Ich machte mich nämlich zum Gespött der Schule, als mir im Unterricht verweigert wurde, die Toilette aufzusuchen, und ich dann zur nächsten Pause mit blutdurchtränkter, tropfender Hose weinend den Hof verließ.
Eine Rückkehr schien undenkbar, ich würde nie wieder einen Fuß in dieses Gebäude setzen.
Der Wecker klingelte am nächsten Morgen um zehn nach sechs, um sieben Uhr fünfundfünfzig saß ich in Raum einhundertacht und sezierte lustlos eine Hummel.
Noten waren mir wichtig, aber nicht auf dem Zeugnis. Musik war es, die mir Halt gab. Die mich mit anderen verband. Über die konnte man reden, ohne dass man über sich selbst reden musste. Meine Haare wurden raspelkurz und ketchuprot. Secondhand war in, und wer brauchte Markenschuhe, wo es doch Doc Martens gab. Der einzige Doc, der gerade helfen konnte. Punk is not dead – und mein Leben begann auch erst jetzt. Die Oberstudienrätin gab auf, mein Vater nach und ich mir selbst einen Tritt in den Hintern.
Aus dem hässlichen Entlein wurde ein schräger Vogel – ich haderte zwar immer noch mit mir, aber mein Ego stand da drüber. Wer mich scheiße fand, den wollte ich auch nicht enttäuschen. Diese Weisheit hatte ich nicht selbst ersonnen, sondern von meiner neuen besten Freundin Robin übernommen. Meiner Freundin, die keine sein wollte. Eher ein Freund. Oder etwas, für das es keinen Namen gab.
Mister Softie – Es geht ein Flug nach irgendwo
Als mein Vater starb, war ich zwölf. Und nicht da. Weder zu Hause am Küchentisch, wo er leblos zusammensackte, noch im Lande. Man hatte mich in die Ferien geschickt, für zwei Wochen nach England. Ich verabschiedete mich mit der Ahnung, dass es voraussichtlich für immer sein würde.
Von seinem Ableben erfuhr ich erst bei meiner Rückkehr. Die Trauermienen verrieten seinen Tod und die Gewissensbisse, weil sie mich im Unklaren gelassen hatten. Geändert hätte es wahrlich nichts. Zumindest nicht an den Fakten.
Der Herr im Hause war nun ich, noch lange nicht adoleszent, wenn überhaupt präpubertär. Glückwünsche dazu blieben seltsamerweise aus, stattdessen hagelte es Beileidsbekundungen. Geheucheltes Verständnis und leere Versprechungen. Aufrichtige Anteilnahme und hilfreiche Hände fehlten. Man hielt sich zurück, in der Dezenz des Anstands, und wich unangenehmen Situationen aus. Das arme Kind hatte schließlich keinen Vater mehr, die Mutter keinen Mann. Was für ein Leid, was für ein Elend. Da mischt man sich nicht ungefragt ein, man fragt am besten gar nicht, bevor man noch jemanden belästigt oder in der Trauer stört. Das wäre ja pietätlos.
Drauf geschissen. Weder meine Mutter noch ich hatten Ahnung von Hauselektrik. Wir waren beide keine sonderlich begabten Gärtner und im Handwerklichen auch nicht gerade geschickt. Völlig abgesehen davon waren plötzlich zwei schon einer zu viel, wo vorher drei sich gerade genügt hatten.
Für meine Mutter ging das Leben einfach weiter, nahtlos. Nach den Osterferien wurden ihre Schüler von einer Witwe gelehrt. Das machte weder für sie noch für irgendjemanden sonst einen Unterschied. Für mich auch nur geringfügig, da ich nach dem Unterricht, wenn meine Mutter noch Konferenzen oder eigene Stunden hatte, zum Hausmeister ging und mit dessen Sohn meine Zeit verbrachte. Der Sommer kam, dann der Herbst, Weihnachten, der Jahreswechsel, der erste Jahrestag, Ostern ohne Auferstehung und so ging es jahrein, jahraus.