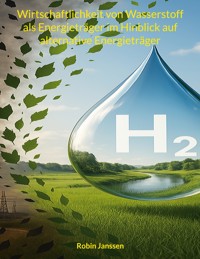
Wirtschaftlichkeit von Wasserstoff als Energieträger im Hinblick auf alternative Energieträger E-Book
Robin Janssen
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Warum veröffentliche ich meine Untersuchungen aus meiner Bachelorarbeit zum Wirtschaftsingenieur erst jetzt? Und was hat der Ukraine-Krieg damit zu tun? Wasserstoff wird bereits heute in einzelnen Nischen erfolgreich eingesetzt; z.B. in der chemischen Industrie. Die dargestellten Berechnungen zeigen jedoch, dass der Wasserstoffeinsatz in voller Breite der Energieerzeugung und Energiespeicherung, der Industrie und in der Mobilität erst in 10 bis 20 Jahren wirtschaftlich sein wird. Erdgas ist eben billiger. Prognosen beruhen in der Regel immer auf normalen/linearen zukünftigen Entwicklungen; so auch in meiner Ausarbeitung. Der Ukrainekrieg wirbelt diese Gedankenwelt durcheinander. So perfide es auch klingen mag, der Ukrainekrieg sorgt bei diesem Thema für enormen Vorschub. Insbesondere die überproportional gestiegenen Gaspreise und der wieder erstarkte Drang nach Unabhängigkeit werden den Zeitraum bis zur Wirtschaftlichkeit von Wasserstoff deutlich verkürzen. Auch wenn die aktuellen schweren Brandherde in der Welt den Ruf nach Umweltschutz etwas in den Hintergrund drängen. Wasserstoff bringt die angestrebte CO² Neutralität zwangsläufig mit; quasi geschenkt. Ich bin ein regelrechter Fan von Wasserstoff geworden. Sie werden es auch. Versprochen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 71
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Untersuchungen in dieser Ausarbeitung zeigen, dass Wasserstoff in den nächsten zwei Jahrzehnten wirtschaftlich einsetzbar sein wird.
Hierbei wurden, „normale“ zukünftige Entwicklungen zugrunde gelegt.
Der Ukrainekrieg fand hierbei noch keine Berücksichtigung.
Die dramatischen Veränderungen ließen unter anderem die Strom- und Gaspreise unvorhersehbar stark steigen.
Dadurch ist zu erwarten, dass die hier ermittelten Wirtschaftlichkeitsprognosen deutlich früher eintreten werden.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Ziel
1.3 Vorgehensweise
1.4 Aufbau
2 Begriffsdefinition
2.1 Wirtschaftlichkeit
2.2 Kostendegression
2.3 Energieträger
2.3.1 Primäre Energieträger
2.3.2 Sekundäre Energieträger
2.3.3 Fossile Energieträger
2.3.4 Erneuerbare Energieträger
2.3.5 Alternative Energieträger
2.3.6 Wasserstoff
3 Energieträger Wasserstoff
3.1 Herstellungsverfahren
3.1.1 Elektrolytische Wasserspaltung
3.1.2 Reformierungsverfahren
3.1.3 Wasserstofferzeugung aus Biomasse
3.2 Unterscheidungen und Besonderheiten
3.2.1 Farbkennzeichnung von Wasserstoff und ihre Bedeutung
3.2.2 Besonderheiten von Wasserstoff
3.3 Kostenentwicklung von Wasserstoff
3.4 Stromerzeugung aus Wasserstoff
3.4.1 Brennstoffzelle
3.4.2 Blockheizkraftwerk
3.5 Anwendungsgebiete von Wasserstoff
3.5.1 Chemische Industrie
3.5.2 Stahlindustrie
3.5.3 Mobilitätssektor
3.5.4 Wasserstoff als Speichermedium
4 Weitere Energieträger
4.1 Funktion und Besonderheiten der Energieträger zur Stromerzeugung
4.1.1 Fossile Energieträger
4.1.2 Kernenergie
4.1.3 Windenergie
4.1.4 Solarenergie
4.1.5 Energie aus Biomasse
4.1.6 Wasserenergie
4.1.7 Geothermie
4.2 Kostenbetrachtung
4.2.1 Stromgestehungskosten
4.2.2 Kostenvergleich von fossilem Erdgas und grünem Elektrolysegas
4.2.3 Interne und externe Kosten
5 Auswirkungen von wirtschaftlichem Wasserstoff auf alternative Energieträger
5.1 Erhöhter Anteil volatiler Energieträger und wachsender Bedarf von Wasserstoff
5.2 Windgasanlagen senken Kosten bei der volatilen Stromerzeugung
5.3 Zusammenwirken und Rückkopplung von Wasserstoff mit anderen Energieträgern
6 Fazit
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Erzeugungsverfahren von Wasserstoff (Shell 2017: S. 13).
Abbildung 2: Funktionsprinzip von Wasserelektrolyse und Brennstoffzelle (Schnurnberger, Janßen & Wittstadt 2004: S.53).
Abbildung 3: Reformeranlage bestehend aus dem eigentlichen Reformer, dem Shift-Reaktor und der H2 Abtrennung / CO2-Entfernung (Aicher, Blum & Specht 2004: S.61).
Abbildung 4: Funktionsweise der Dunklen Fermentation. (EMCEL GmbH 2020)
Abbildung 5: Bedeutung der Farbgebung bei Wasserstoff (EMCEL GmbH 2020).
Abbildung 6: Wasserstoffproduktion: Kosten und Kostenentwicklung von 2019 bis 2050 (Bukold 2020: S.8).
Abbildung 7: Kostenvergleich: Import von Wasserstoff 2030 (Energiewirtschaftliches Institut an der Universität zu Köln 2020: S.3).
Abbildung 8: Wege der Energieumwandlung von chemischer – zu elektrischer Energie (EnergieAgentur.NRW 2021)
Abbildung 9: Brennstoffzellentypen und deren Temperaturzugehörigkeit (EnergieAgentur.NRW 2021)
Abbildung 10: Prinzipielle Funktionsweise eines BHKWS (Fluessiggas.de 2021).
Abbildung 11: Der Weg des Wasserstoffs von der Herstellung bis zum Verbrauch (BDEW.de 2021).
Abbildung 12: Power-to-X Prozesse (EnergieAgentur.NRW 2021).
Abbildung 13: Vereinfachte Schematische Darstellung der Verfahren zur Ammoniaksynthese (Geres et al. 2019: S.33).
Abbildung 14: Vergleich der Produktionskosten und CO2 -Emissionen bei konventioneller Ammoniakherstellung und Herstellung mit grünem Wasserstoff (Geres et al. 2019: S.34).
Abbildung 15: Vereinfachte schematische Darstellung der Verfahren zur Methanolsynthese (Geres et al. 2019: S.37).
Abbildung 16: Vergleich der Produktionskosten und CO2 -Emissionen bei konventioneller Methanolherstellung und Herstellung mit grünem Wasserstoff (Geres et al. 2019: S.39).
Abbildung 17: Gesamtbetriebskosten von grünem Stahl im Vergleich zu alternativen kohlenstoffarmen Produkten und konventionellen Wegen (McKinsey & Company 2021: S. 42).
Abbildung 18: Energiekostenvergleich für Personenkraftwagen in €/100km (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2021).
Abbildung 19: Autokostenvergleich für ein im Jahr 2030 angeschafftes KFZ mit Brennstoffzellenantrieb (FCEV) und einem Benzinmotor (Shell 2017: S.49).
Abbildung 20: TCO-Rechnung für die ersten 4 Jahre nach Neukauf eines Mittelklasse-Neuwagen mit 18.000 km Laufleistung pro Jahr (Verbraucherzentrale Bundesverband e.V 2017: S.9).
Abbildung 21: TCO Schwerer LKW, Vergleich zwischen Diesel und Brennstoffzellenantrieb (FCEV) von 2015 bis 2030 (Altenburg et al. 2017: S.38).
Abbildung 22: Gesamtbetriebskosten eines Kurzstreckenflugs im Zeitverlauf (McKinsey & Company 2021: S. 40).
Abbildung 23: Gegenüberstellung verschiedener Energie- bzw. Stromspeichersysteme anhand ihrer Kapazität und Entladedauer (Sterner et al. 2015: S.74)
Abbildung 24: Mittelwerte wichtiger Parameter verschiedener Speichertechnologien technologischer Stand 2015 (Sterner et al. 2015: S.93).
Abbildung 25: Windenergieanlagen mit horizontaler Achse. (BWE Bundesverband Windenergie 2020).
Abbildung 26: Prinzip eines Auftriebsläufers. (BWE Bundesverband Windenergie 2020).
Abbildung 27: Energieumwandlung bei Windkraftanlagen (BWE Bundesverband Windenergie 2020).
Abbildung 28: Die drei Prinzipien der Solarkonzentration (Welt der Physik 2016).
Abbildung 29: Funktionsweise einer Laufwasserkraftanlage (VDE Energietechnische Gesellschaft 2008).
Abbildung 30: Funktionsweise eines Speicherkraftwerks (VDE Energietechnische Gesellschaft 2008).
Abbildung 31: Funktionsweise eines Pumpspeicherkraftwerks (VDE Energietechnische Gesellschaft 2008).
Abbildung 32: Funktionsweise eines Osmosekraftwerks (Lübbert, D. 2005).
Abbildung 33: Stromgestehungskosten bei regenerativen- und fossilen Kraftwerken 2021 in Deutschland (Kost et al. 2021: S.2).
Abbildung 34: Gegenüberstellung der Stromgestehungskosten von regenerativen Kraftwerken mit Betriebskosten von bestehenden Kraftwerken mit fossilen Brennstoffen in den Jahren 2021,2030 und 2040 (Kost et al. 2021: S.5)
Abbildung 35: Erwartete Produktionskostenentwicklung von Elektrolysegas mit drei unterschiedlichen Szenarien bezüglich des Umgangs mit Überschussstrom und Kostenvergleich hinsichtlich des Einsatzes von fossilem Erdgas inklusive CO2-Zertifikate ("Graugas“) (Huneke 2018: S.8).
Abbildung 36: Externe Kosten von unterschiedlichen Stromerzeugungssystemen in ausgewählten Studien (Deutscher Bundestag 2006: S.17).
Abbildung 37: Kohlenstoffpreis in Euro pro Tonne im europäischen Emissionshandelssystem (DWS Investment GmbH 2021).
Abbildung 38: Technologiereifegrade Mobiler H2-Anwendungen (Shell 2017: S.47).
Abbildung 39: Neu zu installierende Leistung aus erneuerbaren Energien zwecks Stromerzeugung in GW pro Jahr (McKinsey & Company 2021, S. 38).
Abbildung 40: Mittleres Erzeugungs- / Lastprofil im Jahre 2021 vom 01.01. - 31.10.2021 gegliedert nach Energieträgern. (Windbranche.de IWR 2021).
Abbildung 41: Aktuelle Einspeiseleistung von Windenergie und Solarenergie in Deutschland (Wind Journal 2021).
Abbildung 42: Höchste Einspeiseleistung von Windenergie und Solarenergie in Deutschland (Wind Journal 2021).
Abbildung 43: Zahl der Stunden mit negativen Strompreisen je Jahr (Institut der deutschen Wirtschaft 2020).
Abbildung 44: Entwicklung des Saldos aus Stromexporten und - importen sowie Strompreis im Februar 2020 (Institut der deutschen Wirtschaft 2020).
Abbildung 45: Stromsystem mit Windgas (E.ON Hanse AG 2014: S 16).
Abbildung 46: Bedarf an Windgas-Anlagen im Maximalfall (Sterner et al. 2015: S.7).
Abbildung 47: Die langfristigen Kostenvorteile des Stromsystems mit Windgas (Sterner et al. 2015: S.15).
Abbildung 48: Wasserstoff kann verschiedene Sektoren verbinden (PwC.de 2021).
1 Einleitung
Gerade unter dem Eindruck aktueller Ereignisse in diesem Jahr, insbesondere der Hochwasserkatastrophen in Deutschland, ist der Klimawandel und die daraus abgeleitete Forderung nach CO2 Neutralität sehr präsent. Immer häufiger wird in diesem Zusammenhang Wasserstoff genannt und auch als Schlüsselelement bezeichnet, um den Energiewandel erfolgreich zu gestalten.
1.1 Problemstellung
Zur Erreichung der Klimaziele ist die Verwendung von fossilen Energieträgern zur Stromerzeugung zu reduzieren und durch erneuerbare Energieträger zu ersetzen. Darüber hinaus muss aufgrund des Ausstiegsbeschlusses auch die Kernkraftwerkskapazität durch erneuerbare Energieträger kompensiert werden. Vor allem in der Industrie, der Chemie und im mobilen Bereich stellt der Einsatz von Wasserstoff umwelttechnisch gesehen grundsätzlich eine geeignete Möglichkeit dar, um fossile Energieträger zu verdrängen. Wasserstoffanwendungen stehen jedoch überwiegend am Anfang ihrer Entwicklung bzw. noch im Forschungsbereich und benötigen zur Herstellung wiederum viel Strom, um ihn CO2 neutral herzustellen.
1.2 Ziel
Es ist zu untersuchen, ob die Erzeugung und Anwendung von Wasserstoff wirtschaftlich ist bzw. in Zukunft wirtschaftlich sein kann und welchen Einfluss Wasserstoff auf die alternativen Energieträger hat. Um ein Verständnis für die Gesamtproblematik zu bekommen, sind die unterschiedlichen Möglichkeiten der Wasserstofferzeugung und -anwendung wie auch der alternativen Energieträger sowohl technisch als auch kostenmäßig übersichtlich zu erläutern.
1.3 Vorgehensweise
Die folgende Ausarbeitung beruht auf der Methode einer wissenschaftlichen Literaturarbeit. Im Laufe dieser Arbeit wird daher zur Erörterung der Thematik auf Literatur aus themenbezogenen Studien und dem Internet zurückgegriffen.
Das zu erarbeitende Thema wird literarisch untersucht. Dafür erfolgt eine ausführliche Recherche, um passende Quellen zu finden.
1.4 Aufbau
Mit der Einleitung wird auf das Thema hingeführt und gerade unter dem Eindruck aktueller Ereignisse die Priorität von Wasserstoff und der Zusammenhang mit den angestrebten Klimazielen dargestellt.
In Kapitel 2 wird bei der Begriffsdefinition besonderes Augenmerk daraufgelegt, wissenschaftlich belegte Begriffe und umgangssprachliche Bedeutungen herauszustellen und abzugrenzen, da sie oft unscharf bzw. nicht einheitlich benutzt werden.
Kapitel 3 stellt die unterschiedlichen Erzeugungsverfahren und Anwendungsschwerpunkte von Wasserstoff, einschließlich der Auswirkungen auf den CO2 Ausstoß und die Kostenentwicklung, übersichtlich dar.
Da das Thema "andere Energieträger" sehr komplex ist und hiermit häufig neue bzw. noch selten eingesetzte Anlagentechniken verbunden sind, werden in Kapitel 4 die wichtigsten Verfahren übersichtlich dargestellt. Eine vergleichbare Darstellung der Kosten stellt die Basis dar, um die verschiedenen Energieträger von der Kostenseite her einzuordnen und auch Kosten aufzuzeigen, die heutzutage nicht bzw. nur unzureichend in der Preisbildung ihren Niederschlag finden.
Der notwendige starke Anstieg der Wasserstoffkapazität, um diesen kostengünstig herzustellen und anzuwenden, hat große Auswirkung auf die alternativen Energieträger. Diese Auswirkungen hinsichtlich des Ausbaus erneuerbarer Energien, die daraus folgenden Problematiken und die Kostenentwicklungen werden in Kapitel 5 unter Verwendung der Erkenntnisse aus Kapitel 3 und 4 gezeigt. Außerdem wird die Rückkopplung dieser Entwicklung auf die Kostensituation des Wasserstoffs herausgearbeitet.
Abschließend werden in dem Fazit die durchgeführten Untersuchungen und Erkenntnisse zusammengefasst, mögliche Schlussfolgerungen und die Priorität des politischen Einflusses, insbesondere in der Zeit des Veränderungsprozesses unserer Energieversorgung, aufgezeigt.





























