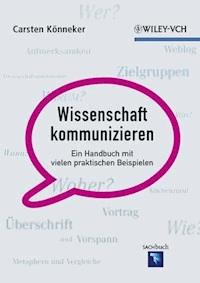
25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Das Buch ist eine systematische Einführung in die Praxis guter Wissenschaftskommunikation. Anhand zahlreicher Beispiele erklärt es, wie Wissenschaftler, Öffentlichkeitsarbeiter und Journalisten unterschiedliche Zielgruppen über Forschung informieren können und dabei die wichtigsten medialen Formate nutzen: Meldungen, Artikel, Kommentare, Vorträge, Interviews, soziale Netzwerke, Weblogs usw. Aus dem Inhalt: - Allgemeine Regeln für gutes Formulieren - Praxis guter Wissenschaftskommunikation: Überschrift, Vorspann, Bildunterschrift, Metaphern usw. - Spezielle mediale Formen: Meldungen, Kommentare, Rezensionen, Vorträge, Interviews usw. - Wissenschaftskommunikation per Internet: Blogs, soziale Netzwerke, die persönliche Webseite - Ausblick: 10 Thesen zur Zukunft der Wissenschaftskommunikation
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Series
Autor
Copyright page
Einleitung
Anmerkung zu den Quellenangaben
Teil I Grundlagen
Kapitel 1 Mediale Formen
Kapitel 2 Die Zielgruppe
Kapitel 3 Intendierte Wirkung und kommunikative Haltung
Kapitel 4 Der Küchenzuruf
Kapitel 5 Aufmerksamkeit – die wichtigste Währung in der Wissenschaftskommunikation
Teil II Praxis guter Wissenschaftskommunikation
Kapitel 6 Allgemeine Regeln für gutes Formulieren
Kapitel 7 Die Überschrift
7.1 Nachrichtliche Überschriften
7.2 Kreative Überschriften
7.3 Thetische und dialogische Überschriften
7.4 Überschriften im Internet
Kapitel 8 Der Vorspann
8.1 Der nachrichtliche Vorspann
8.2 Der kreative Vorspann
8.3 Nutzwertversprechen
8.4 Der thetische Vorspann
8.5 Der dialogische Vorspann
Kapitel 9 Die Bildunterschrift
Kapitel 10 Einstieg und Aufbau eines populärwissenschaftlichen Artikels
Kapitel 11 Die Spitzmarke
Kapitel 12 Die Zwischenüberschrift
Kapitel 13 Das Pullquote
Kapitel 14 Metaphern und Vergleiche
14.1 Quantitative Sachverhalte veranschaulichen
14.2 Qualitative Sachverhalte veranschaulichen
Teil III Spezielle mediale Formen
Kapitel 15 Die Meldung
15.1 Die klassische Meldung
15.2 Die unterhaltsame Meldung
15.3 Die Pressemeldung
15.4 Die Agenturmeldung
Kapitel 16 Der Kommentar
16.1 Der Kurzkommentar
16.2 Der Pro-und-Kontra-Kommentar
Kapitel 17 Die Rezension
Kapitel 18 Der Vortrag
18.1 Die Präsentation
18.2 Die Rede
Kapitel 19 Das Interview
Kapitel 20 Exkurs: Für Experten kommunizieren
20.1 Der Drittmittelantrag
20.2 Der Fachartikel
Teil IV Wissenschaftskommunikation per Internet
Kapitel 21 Blogs und soziale Netzwerke
Kapitel 22 Die persönliche Website
Teil V Ausblick: 10 Thesen zur Zukunft der Wissenschaftskommunikation
Anhang Informationsquellen: Wo Wissenschaftsjournalisten recherchieren
Quellenverzeichnis
Abbybindex
Beachten Sie bitte auch weitere interessante Titel zu diesem Thema
Ebel, H. F., Bliefert, C.
Bachelor-, Master- und
Doktorarbeit
Anleitungen für den
naturwissenschaftlich-technischen
Nachwuchs
978-3-527-32477-4
Ebel, H. F., Bliefert, C., Greulich, W.
Schreiben und Publizieren in den Naturwissenschaften
978-3-527-30802-6
Ebel, H. F., Bliefert, C.
Vortragen
in Naturwissenschaft, Technik und Medizin
978-3-527-31225-2
Für Kerstin, Louis und Ferdinand
Autor
Dr. Carsten Könneker
Verlag Spektrum der Wissenschaft
69126 Heidelberg
1. Auflage 2012
Alle Bücher von Wiley-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
© 2012 Wiley-VCH Verlag & Co. KGaA, Boschstr. 12, 69469 Weinheim, Germany
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Umschlaggestaltung Adam-Design, Weinheim
Satz Reemers Publishing Services GmbH, Krefeld
Druck und Bindung Strauss GmbH, Mörlenbach
Print ISBN: 978-3-527-32895-6
ePDF ISBN: 978-3-527-65222-8
ePuB ISBN: 978-3-527-65221-1
mobi ISBN: 978-3-527-65220-4
Jeder ist Laie – fast überall.
Einleitung
Wissenschaft ist wichtig. Sie weitet den Blick für die Welt, in der wir leben, schafft Wohlstand, bereitet intellektuelles Vergnügen. Sie löst Probleme – und schafft bisweilen zugleich neue, die teils alle Menschen betreffen. Egal, ob es um die Faszination von Natur, Leben und Kosmos geht oder um handfeste Herausforderungen wie Infektionskrankheiten, Energiesicherheit und Klimawandel: In die Ziele, Methoden und Schlussfolgerungen von Forschern1) und Ingenieuren sollten möglichst viele Menschen Einsicht erhalten. Das gilt insbesondere für Demokratien, in denen letztlich die Bürger darüber zu befinden haben, wohin Gelder gelenkt werden und welche Risiken, die etwa mit bestimmten Technologien verknüpft sind, eingegangen werden sollen – und welche nicht.
Den Transfer des Wissens und den Dialog mit verschiedenen Teilen der Öffentlichkeit leistet die Wissenschaftskommunikation. Ihre Akteure sind Wissenschaftsjournalisten und Öffentlichkeitsarbeiter an Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Stiftungen usw. sowie zunehmend auch die Forscher selbst. Alle drei Berufsgruppen haben ihre jeweils spezifische Rolle in der Wissenschaftskommunikation, und es ist wichtig, sich dieser Aufgabenteilung stets bewusst zu sein (siehe Teil V). Gemein ist ihnen, dass sie komplexe Sachverhalte durch geschicktes Formulieren und Veranschaulichen unterschiedlichen Zielgruppen von Nicht-Fachleuten verständlich machen müssen. „Die Allgemeinheit“, „die Gesellschaft“ oder „die breite Öffentlichkeit“ gibt es dabei nicht, ebenso wenig wie „allgemein verständliche“ Populärwissenschaft. Denn Wissenschaftskommunikation richtet sich in der Praxis stets an einzelne mehr oder minder scharf umrissene Personengruppen: Kindergartenkinder, Patienten, die Zuschauer einer bestimmten Fernsehsendung usw.; besonders wichtige Adressaten für die Wissenschaftler sind Gutachter von Förderanträgen sowie Kollegen aus anderen Fachgebieten. In diesem Sinne ist auch der interdisziplinäre Dialog eine Form von Wissenschaftskommunikation.
Jede Kommunikation verfolgt Ziele. Wie man sich ihrer versichert und sie erreicht, davon handelt das vorliegende Buch. Es richtet sich an Wissenschaftler, die ihre mediale Kompetenz verbessern wollen, Öffentlichkeitsarbeiter in der Forschungskommunikation sowie Nachwuchsjournalisten, die ihr stilistisches Repertoire für Überschriften, Einstiege, Kommentare usw. systematisch erweitern wollen.
Ein Lehrbuch über Wissenschaftskommunikation zu schreiben, ist ein hoch aktuelles Unterfangen, denn sein Gegenstand ist in einem tief greifenden Umbruch begriffen: Auf der einen Seite nimmt die Erwartung gegenüber den Wissenschaftlern zu, sich zu äußern, Stellung zu beziehen, zu erklären. Interviews, Pressemitteilungen, Exzellenzanträge – auf allen möglichen Kanälen sollen sie Auskunft geben über ihre Forschung: Was sie da treiben, warum sie es geschickter anpacken als andere, wo Nutzen und Risiken liegen. Auch werden Wissenschaftler immer häufiger in die Politikberatung einbezogen, müssen Stellungnahmen abgeben und Gutachten schreiben. Auf der anderen Seite schießen ständig neue Formate aus dem Boden – Kinderunis, Weblogs und Science Slams sind nur drei Beispiele von vielen. Sie treten als weitere Möglichkeiten neben die altbekannten Formen der Wissenschaftskommunikation: den öffentlichen Vortrag, den populärwissenschaftlichen Artikel, den Kommentar. Nie war die Schatztruhe der Vermittlungs- und Dialogformen reicher bestückt als heute, und es ist absehbar, dass mit fortschreitender Diversifizierung der Medien weitere Prunkstücke hinzukommen werden, nicht zuletzt durch das Internet. Wissenschaftlern gestattet die zunehmende Vielfalt, ihre institutionelle wie auch persönliche Kommunikation zu professionalisieren: wechselnde Zielgruppen passgenau mit den für sie relevanten Inhalten zu versorgen, sie mit der eigenen Arbeit, ihren Zielen und Herausforderungen vertraut zu machen, Ressentiments vorzubeugen, Entscheidungen im eigenen Sinne zu beflügeln usw.
Als Gesellschaft profitieren wir von der wachsenden Mitteilungskompetenz der Experten. In Ländern wie Deutschland, arm an Bodenschätzen und maßgeblich von Fortschritten in Wissenschaft und Entwicklung abhängig, ist es ein hohes Gut, wenn Forscher ihre Einsichten und Ideen weiten Teilen der Bevölkerung verständlich machen können, präsent sind im öffentlichen Diskurs, Rollenvorbilder abgeben für Kinder und Jugendliche – auch um den Nachwuchsproblemen in manchen Disziplinen aktiv zu begegnen. Außerdem profitiert jeder Wissenschaftler, der gelernt hat, sich versiert mitzuteilen, davon unmittelbar in der Lehre: Wer das große ABC der Wissenschaftskommunikation beherrscht, hält bessere Vorlesungen und weckt in Übungsgruppen und Seminaren mehr Aufmerksamkeit, sorgt für mehr Aha-Erlebnisse.
Dass die Kommunikation von Wissenschaft wichtig ist, haben in den letzten Jahren auch viele Wissenschaftsorganisationen erkannt. So wurden zahlreiche Initiativen gestartet, um den öffentlichen Dialog über Forschung zu fördern. Die meisten haben lokalen oder regionalen Charakter: Science Festivals, lange Nächte der Wissenschaft, Jugendakademien usw. Doch auch auf nationaler und internationaler Ebene bewegt sich Einiges. Angeregt durch den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft wurde 1999 die Initiative Wissenschaft im Dialog (WiD) gegründet, die sich seitdem in zahlreichen Projekten um die Interaktion von Wissenschaft und Öffentlichkeit bemüht. Seit dem Jahr 2000 gibt es nationale und seit 2009 internationale – von der UNESCO ausgerufene – „Jahre der Wissenschaft“. 2000 verlieh die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) erstmals den Communicator-Preis, der seither jährlich einem Wissenschaftler für besondere Exzellenz in der breitenwirksamen Darstellung seiner Arbeit zuerkannt wird. Seit 2003 läuft die MS Wissenschaft im Auftrag von WiD in den Sommermonaten verschiedene deutsche Städte an; im Bauch des umgebauten Binnenfrachtschiffes befindet sich ein Science Center mit jährlich wechselnden Ausstellungen. Von 2005 bis 2011 kürte der Stifterverband sieben Mal eine deutsche „Stadt der Wissenschaft“, in der Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Museen, Stiftungen, Unternehmen und weitere Partner jeweils für zwölf Monate regionale Feuerwerke der Wissenschaftskommunikation zündeten.
„Wissenschaft im Dialog“ ist das deutsche Pendant ähnlicher Anstrengungen im angloamerikanischen Raum wie „Public Understanding of Science“ oder „Public Engagement with Science and Technology“. In den USA hat die Bewegung nach einigen Jahren eine wichtige Akzentverschiebung erfahren. So stellte die amerikanische Akademie der Wissenschaften AAAS fest, dass der öffentlichen Auseinandersetzung mit Wissenschaft eine Auseinandersetzung der Wissenschaftler mit der Öffentlichkeit vorauszugehen habe. 2010 stellte die AAAS ein entsprechendes Empfehlungspapier mit dem Titel „Scientists’ Understanding of the Public“ vor. Darin werden die Wissenschaftler aufgerufen, sich in die Interessen, Motive und Befindlichkeiten ihrer jeweiligen Zielgruppen hineinzuversetzen, bevor sie in die Tasten oder zum Mikrofon greifen (amacad.org/projects/sciUnderstand.aspx). Dies ist auch das Credo des vorliegenden Buches.
„Wissenschaftskommunikation“ ist kein scharf umrissener Begriff. Ich gebrauche ihn in diesem Buch in einer allgemeinen Lesart. Demnach fallen darunter alle kommunikativen Akte, die wissenschaftliche Themen zum Gegenstand haben: Tage des offenen Labors ebenso wie populäre Sachbücher, Wissenschaftsblogs und einschlägige Hörfunk- wie Fernseh-Sendungen; Ausstellungen, Podiumsdiskussionen und Podcasts genauso wie Artikel in Wissenschaftsmagazinen. So fassettenreich die medialen Formen, so verschieden die Adressaten. Das können im konkreten Fall so unterschiedliche Gruppen sein wie Chemielehrer an Gymnasien im Raum Hannover, Eltern von Mädchen im Grundschulalter mit Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, der Stadtrat von Regensburg, an Informatik interessierte 12- bis 14-Jährige aus den neuen Bundesländern, die Gutachter eines Förderantrags, Kollegen aus der Physik, Leser einer regionalen Tageszeitung, Hörer von DRadio Wissen usw.
Dieses Buch entstand über mehrere Jahre meiner Tätigkeit als Chefredakteur für die Wissenschaftsmagazine Gehirn&Geist und Spektrum der Wissenschaft, des Onlineportals Spektrum.de sowie als Gründer des Blogportals SciLogs.de. Die genannten Zeitschriften präsentieren Artikel, die von führenden Wissenschaftlern abgefasst werden – recherchiert und journalistisch bearbeitet von Fachredakteuren; Spektrum.de ist ein tagesaktuelles Informationsangebot, dessen Beiträge fast ausschließlich von Wissenschaftsjournalisten geschrieben werden; auf SciLogs.de schließlich bloggen zahlreiche Wissenschaftler verschiedener Fachgebiete über Fragen rund um Forschung und Gesellschaft.
In Kommunikationsseminaren für Wissenschaftler – u.a. im Rahmen des Klartext-Preises für verständliche Wissenschaft der Klaus Tschira Stiftung – habe ich die Vermittlung von handwerklichem Knowhow in Medienpraxis über Jahre erprobt und weiter entwickelt. Auch aus diesem Erfahrungsschatz schöpfe ich in diesem Buch – sowie aus etlichen Gesprächen über einzelne Aspekte der Wissenschaftskommunikation mit Kollegen und weiteren Experten. So danke ich Dr. Henrike Hartmann von der VolkswagenStiftung und Dr. Manfred Nießen von der DFG für ihre hilfreichen Anmerkungen zum Exkurs über Drittmittelanträge. Meinen Kollegen Lars Fischer von SciLogs.de sowie Spektrum.de und Dr. Markus Elsner von Nature Biotechnology danke ich für ihr Feedback zu den Kapiteln über soziale Netzwerke bzw. Fachartikel. Steve Ayan, Redaktionsleiter bei Gehirn&Geist, und Dr. Daniel Lingenhöhl, Redaktionsleiter bei Spektrum.de, haben meine Ausführungen zu Metaphern und Vergleichen bzw. zu Kommentaren und Rezensionen gegengelesen. Dr. Hartwig Hanser, Redaktionsleiter bei Spektrum der Wissenschaft, las das Kapitel über populärwissenschaftliche Artikel. Mein Kollege Joachim Marschall von Gehirn&Geist beäugte die allgemeinen Regeln für gutes Formulieren. Antje Findeklee von Spektrum.de warf einen kritischen Blick auf das Interview-Kapitel sowie die 10 Thesen zur Zukunft der Wissenschaftskommunikation, die das Buch beschließen. Beatrice Lugger gab mir Feedback zur Einleitung und zum Ausblick. Dr. Janina Fischer schließlich las nicht nur das Kapitel über Vorträge, sondern gleich das komplette Manuskript. Karsten Kramarczik hatte die Idee für die Covergestaltung und Alice Krüssmann manchen guten Rat in Fragen der Urheberrechte bei Bildern. Ihnen allen gebührt mein Dank. Besonders danke ich meinem Lektor Dr. Gregor Cicchetti, der dieses Buchprojekt von Beginn an mit großer Sympathie und viel Engagement begleitete, sowie Sarah Zimmermann für die Cartoons.
Neckarhausen, im Oktober 2011
Anmerkung zu den Quellenangaben
Das vorliegende Buch ist gespickt mit praktischen Beispielen aus der Wissenschaftskommunikation. Manche Kapitel – etwa jene zu Überschrift und Vorspann – führen besonders viele Veranschaulichungen aus diversen Quellen an. Um sie nicht mit den vollständigen Quellenangaben zu überfrachten, ist in Klammern stets nur das Medium angegeben, aus der das jeweilige Beispiel stammt – etwa Süddeutsche Zeitung. Die vollständigen Quellenangaben – z.B. Süddeutsche Zeitung, 14.04.2011, S. 16 – sind im Quellenverzeichnis am Ende des Buches aufgelistet.
1) In diesem Buch wird durchweg die männliche Sprachform verwendet. Alle Aussagen gelten jedoch für Frauen und Männer gleichermaßen. Wann immer von Forschern, Ingenieuren, Bürgern usw. die Rede ist, sind stets „Forscherinnen und Forscher“, „Ingenieurinnen und Ingenieure“, „Bürgerinnen und Bürger“ usw. gemeint.
Teil I
Grundlagen
Kapitel 1
Mediale Formen
Meldung, Interview, Reportage, Kommentar, Bericht, Rezension – all diese und weitere Typen von Beiträgen kennen Sie aus Zeitungen und Zeitschriften ebenso wie aus Hörfunk, Fernsehen, Internet. Traditionell bezeichnet man sie als journalistische Formen. Im Zeitalter von Blogs, Podcasts und sozialen Netzwerken ist dieser Begriff jedoch überholt. Die Journalisten haben die Hoheit über das Publizieren teilweise abgegeben, Berichte oder Buchkritiken etwa veröffentlichen längst nicht mehr nur sie. Daher ist in diesem Buch in einer allgemeinen Lesart von medialen Formen die Rede. Sich ihrer bedienen kann prinzipiell jeder.
Das Internet hat die Zutrittsbarrieren zum medialen Betrieb drastisch schrumpfen lassen. Darüber hinaus findet der Ruf nach Dialog mit der Öffentlichkeit zunehmend Widerhall in den Säulengängen und Laboren der akademischen Einrichtungen. Längst nutzen daher auch Wissenschaftler verschiedene mediale Formen, um sich mitzuteilen: halten öffentliche Vorträge, arbeiten bei der Erstellung von Pressemeldungen mit, diskutieren neue Bücher in ihren Blogs. Wer den Dialog mit „der Gesellschaft“ pflegen möchte, ist nicht mehr auf Journalisten angewiesen, braucht weder Sendemast noch Druckerpresse, um unterschiedlichste Personengruppen zu erreichen. Die rasante Entwicklung der digitalen Medien beschert uns immer buntere Sträuße von Information und Meinung zu wissenschaftlichen Themen – mit allen Vor- und Nachteilen. Ein Nachteil besteht darin, dass auch Inhalte publiziert und von Suchmaschinen zu Tage gefördert werden, die den Fachleuten des jeweiligen Gebiets die Haare zu Berge stehen lassen. Umgekehrt gibt es wunderbare, teils von Forschern selbst kreierte Beispiele für innovative Wissenschaftskommunikation, die noch vor Jahren so nicht vorstellbar waren.
Einen journalistischen Beitrag macht nicht die Form aus, sondern die Art und Weise, wie er entsteht, welche Standards er einhält. Hinter einem journalistischen Beitrag stecken vor allem Unabhängigkeit in der Sache, um die es geht, und sorgfältige Recherche. Journalisten sollten jede verwendete Information durch mindestens zwei glaubhafte Quellen abgesichert haben, bevor sie sie publizieren. Zudem sollten sie ihre Beiträge klar als darstellend oder als kommentierend kennzeichnen – und die damit verknüpften Versprechen auch einhalten. Außerdem haben sie das Vier-Augen-Prinzip zu beherzigen: Um Fehler jedweder Art zu vermeiden, muss mindestens ein weiterer Redakteur alle Teile eines Beitrags vor der Veröffentlichung noch einmal geprüft haben. Dass Journalisten darüber hinaus gute Überschriften zimmern können, der Aufbau ihrer Beiträge eingeübten Standards gehorcht, sie eine flotte Schreibe pflegen, um auch komplizierte Sachverhalte anschaulich zu vermitteln – all das versteht sich von selbst, schließlich sind sie Kommunikationsprofis.
Das sind Wissenschaftler nicht. Sie sind auch nicht unabhängig, wenn sie über ihre eigene Forschung und deren Ziele Auskunft geben. Dennoch sind sie aufgerufen, Wissenschaftskommunikation zu betreiben – jedenfalls sofern ihre Forschung öffentlich gefördert wird oder gesellschaftlich relevant ist. Diese Legitimationspflicht erkennen immer mehr Forscher an (siehe Teil V).
Weitere mediale Formen sind der Essay, das Feature, das Porträt, der Nachruf, der Drittmittelantrag, das Gutachten, der Fachartikel, die Pressemeldung, der Newsletter, das (wissenschaftliche) Poster, die Schautafel (zu einem Ausstellungsexponat), der (Werbe-)Flyer, aber ebenso das Foto und die Infografik, der öffentliche Vortrag und die Podiumsdiskussion. Und sie alle können Wissenschaft zum Inhalt haben.
Die entscheidende Frage lautet: Welche mediale Form eignet sich, welche Inhalte für welche Leser, Zuschauer, Hörer, Besucher oder Nutzer so aufzubereiten, dass der Funke überspringt? Die Antwort hängt entscheidend von der konkreten Zielgruppe ab und der jeweiligen Wirkung, die jemand in dieser Zielgruppe hervorrufen möchte.
Kapitel 2
Die Zielgruppe
Eigentlich sagt der Name alles: Es gibt eine Gruppe, und diese stellt das Ziel dar. Das Ziel für ein Produkt oder einen kommunikativen Akt. Doch so einfach ist die Sache nicht. Denn wie ist die Zielgruppe genau umrissen? Und wie lautet das Ziel, das es zu erreichen gilt?
In zahllosen „allgemein verständlichen“ Vorträgen sprechen Wissenschaftler jahraus, jahrein konsequent über die Köpfe ihres Publikums hinweg. Das Auditorium dämmert vor sich hin, keiner wagt, der Koryphäe laut zu sagen, dass sie nicht eine einzige Grafik mit leserlichen Stichworten versehen hat, dass die Aussprache völlig überhastet ist und die bemühten Veranschaulichungen so hilfreich wie eine Sonnenbrille im dunklen Keller. Ein weiteres Beispiel: Mancher Experte reibt sich verwundert die Augen, wenn die Redaktion eines populären Wissenschaftsmagazins seine liebevoll aufgefädelten Endnoten gnadenlos aus dem Manuskript streicht – ja, schlimmer noch: den Artikel stattdessen mit Illustrationen in schrillen Farben garniert. Das sei bei Nature aber anders, bekommt der Redakteur zu hören. Bingo! Nature führt ja auch eine andere Zielgruppe im Gepäck!
Wer kommuniziert richtet sich immer – dessen bewusst oder nicht – an eine Zielgruppe. Diese kann winzig sein wie bei einem privaten Tagebuch. Oder riesig wie bei Wikipedia. Sie kann scharf umrissen sein wie die der Zeitschrift Der Urologe. Oder eher diffus wie bei etlichen Weblogs. Sie kann zu 100 Prozent namentlich bekannt sein wie bei den meisten Briefen oder E-Mails, die Sie schreiben. Oder so anonym wie die der Tagesschau.
Wie viel Fachchinesisch verträgt die Zielgruppe? Eine gewagte Antwort auf diese Frage präsentierte Bild am Sonntag am 19.07.2009.
Oft leitet sich die Zielgruppe direkt von dem Medium ab, in dem die Kommunikation stattfindet. Wer etwa in der Zeitschrift Gehirn&Geist publiziert, erreicht mit seinem Beitrag Menschen, die sich stark für psychologische und neurowissenschaftliche Forschung interessieren, ja mehrheitlich sogar eine berufliche Affinität zum Thema haben, Therapeuten sind, Pädagogen oder Ärzte etwa. All das und noch manches mehr über ihr Publikum wissen die Magazin-Macher aus Leserbefragungen und Marktforschung. Und dieses Wissen spielt eine Rolle für sie: bei der Themen- und Autorenauswahl ebenso wie bei der textlichen Bearbeitung der Manuskripte, dem Redigieren.
Damit es nicht zu bösen Überraschungen bei den Wissenschaftlern kommt, die für Gehirn&Geist schreiben und deren Texte vor Drucklegung noch bearbeitet werden, liefert die Redaktion ihnen frühzeitig einige Informationen über die Zielgruppe, die es zu erreichen gilt. Das Motto, das den Manuskriptleitlinien voransteht, lautet: „Der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler!“ Denn dies ist der Kardinalfehler, den es auszuschalten gilt, noch bevor ein Autor in die Tasten greift: Zu oft haben Wissenschaftler den falschen Adressaten vor dem geistigen Auge, wenn es ans Kommunizieren geht. Für gewöhnlich sitzt er im Büro gleich nebenan.
Wer sich aufmacht, Wissenschaft zu kommunizieren, sollte sich von vornherein darüber im Klaren sein, wen er konkret ins Visier nimmt bzw. vorgesetzt bekommt. Sofern man es selbst in der Hand hat, kann von der Frage nach der Zielgruppe sogar die Wahl des Mediums abhängen: Wer etwa die Lehrer seiner Region über neue Erkenntnisse in Didaktik der Naturwissenschaften – das eigene Forschungsgebiet – informieren möchte, braucht sich nicht den Kopf darüber zu zerbrechen, wie er bloß mit seinem Thema in die Frankfurter Allgemeine kommt. Die regionale Tageszeitung, digitale Netzwerke für Pädagogen oder spezialisierte Newsletter kommen weit eher in Betracht. Sie sind verfügbarer und haben obendrein weniger Streuverluste. Noch besser geeignet ist vielleicht eine Veranstaltung im eigenen Institut mit Vortrag und Diskussion. Dazu eingeladen wird mittels Flyer- oder E-Mail-Aussendung an die Fachlehrer der Schulen vor Ort.
Oder stellen Sie sich eine provinzialrömische Archäologin vor, die dafür brennt, ihre Forschung möglichst vielen Menschen nahe zu bringen. Um ihre Karriere voranzutreiben, muss sie zunächst einmal in den einschlägigen Fachpublikationen veröffentlichen (Zielgruppe: einige Dutzend nationale und internationale Kollegen des eigenen Forschungszweigs). Darüber hinaus könnte sie die Redaktion von Spektrum der Wissenschaft kontaktieren und anfragen, ob es Interesse an einer Darstellung und Einordnung neuer Funde zum antiken Kölner Hafen gibt. Ist das der Fall, wird sie als Autorin beauftragt und muss zu einem verabredeten Zeitpunkt einen Beitrag abliefern, den am Ende mehrere hunderttausend Leser mit Gewinn lesen sollen. Die wenigsten davon sind in Archäologie vorgebildet, und nur eine Minderheit hat einen regionalen Bezug zu Köln. Um gezielt Menschen aus dem Rheinland auf ihr Thema zu stoßen, könnte die Forscherin daher zusätzlich einen Redakteur des Kölner Stadtanzeigers oder von Radio Köln anrufen und zu einem Hintergrundgespräch ins Institut einladen – woraus sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein Interview über ihre spannenden Forschungsbefunde ergäbe. Und zuletzt könnte unsere emsige Wissenschaftskommunikatorin auch noch einen Weblog über „Köln zur Römerzeit“ eröffnen. Dessen einzelne Beiträge, die Posts, fänden wiederum auch Menschen außerhalb der Region Köln spannend – vor allem solche, die gern Nachfragen stellen, eigenes Wissen beisteuern und mitdiskutieren.
Ein solcher Vierklang der Wissenschaftskommunikation – Fachpublikation, populärwissenschaftlicher Artikel, Interview für regionale Medien und ein eigener Blog – wäre unschwer denkbar, bedeutet aber Aufwand. Denn auch wenn das Thema stets dasselbe bleibt (der antike Kölner Hafen) – jedes einzelne Engagement zielt auf eine spezifische Zielgruppe ab, die sich in puncto Vorwissen, Interessen und Mediennutzung von den anderen unterscheidet. Nicht minder müssen sich zwangsläufig die entsprechenden Beiträge unterscheiden! Die Variablen heißen: mediale Form, Ansprache, Länge, inhaltliche Tiefe, Umgang mit Fachtermini, Art der Bebilderung usw.
Häufig freilich geht die Initiative zu kommunizieren gar nicht von den Wissenschaftlern selbst aus. Sie werden vielmehr dazu eingeladen oder gedrängt: Der Dekan möchte, dass sich der Fachbereich endlich an der Kinderuni beteiligt; die Pressestelle bittet um den längst zugesagten Beitrag für die Alumni-Zeitung. Der typische Fall aber ist das Interview. Hier bringt das anfragende Medium die Zielgruppe praktischerweise gleich mit, und man muss sich keine Gedanken mehr über sie machen. – Muss man nicht? Und ob! Auch hier besteht die Anforderung darin, die eigenen Redebeiträge passgenau auf ein vorgegebenes Publikum zuzuschneiden (siehe Kapitel 19).
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























