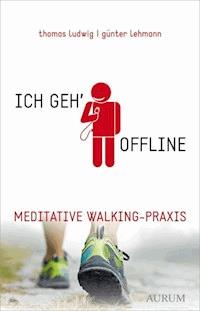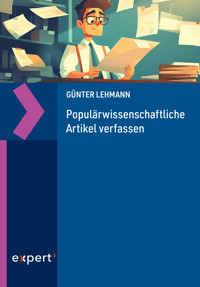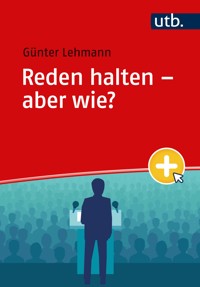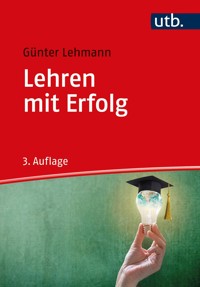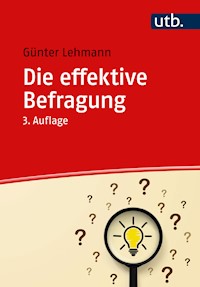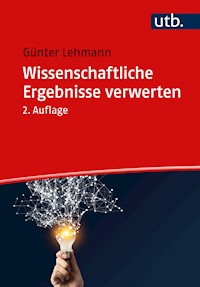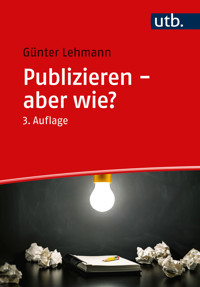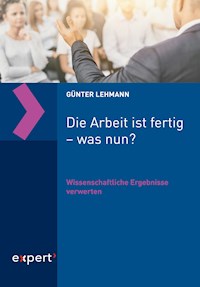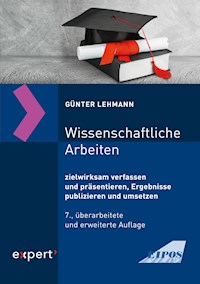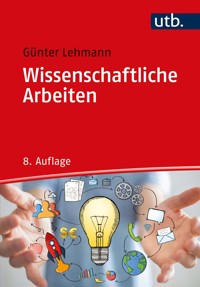
28,99 €
Mehr erfahren.
Wissenschaftliche Arbeiten sind eine Herausforderung. Um sie erfolgreich zu meistern, bedarf es fachlicher Kompetenz und fundierter Schreibkenntnisse. Ein systematisches, methodisch begründetes Vorgehen bei der Wahl und Bearbeitung des Themas, eine effektive Organisation bei der Anfertigung der Arbeit und eine angemessene Berücksichtigung bestimmter Vorschriften beim Gliedern und Zitieren sind dabei essenziell. Der Übersichtsband begleitet die Studierenden von der Planung der Arbeit, über das Schreiben bis zur Abschlusspräsentation und darüber hinaus. Neben umfangreichen Handlungsorientierungen für das Anfertigen einer wissenschaftlichen Arbeit enthält das Buch auch Empfehlungen für das Präsentieren der erreichten Arbeitsergebnisse und für die Weiterverwertung der fertiggestellten Arbeit. Das Buch ist ein Begleiter durch das ganze Studium bis zum Berufseinstieg und darüber hinaus. Es bietet eine ausführliche Zusammenfassung von der Planung der wissenschaftlichen Arbeit bis zur Verwertung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
utb 5872
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Brill | Schöningh – Fink · Paderborn
Brill | Vandenhoeck & Ruprecht · Göttingen – Böhlau Verlag · Wien · Köln
Verlag Barbara Budrich · Opladen · Toronto
facultas · Wien
Haupt Verlag · Bern
Verlag Julius Klinkhardt · Bad Heilbrunn
Mohr Siebeck · Tübingen
Narr Francke Attempto Verlag – expert verlag · Tübingen
Psychiatrie Verlag · Köln
Ernst Reinhardt Verlag · München
transcript Verlag · Bielefeld
Verlag Eugen Ulmer · Stuttgart
UVK Verlag · München
Waxmann · Münster · New York
wbv Publikation · Bielefeld
Wochenschau Verlag · Frankfurt am Main
Prof. Dr. paed. habil. Günter Lehmann studierte Bauwesen und Berufspädagogik. Als Hochschullehrer und langjähriger Direktor eines freien Instituts hat er über 30 Jahre Diplomand:innen, Promovierende und Habilitierende betreut. Seit mehr als 20 Jahren bereitet er Teilnehmende an Bachelor-, Master- und Promotionsstudien auf das Anfertigen und Präsentieren wissenschaftlicher Arbeiten vor.
Günter Lehmann
Wissenschaftliche Arbeiten
zielwirksam verfassen und präsentieren, Ergebnisse publizieren und umsetzen
8., überarbeitete und erweiterte Auflage
Umschlagabbildung: © sdecoret – stock.adobe.com
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
DOI: https://www.doi.org/10.36198/9783838558721
© expert verlag 2022
– ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG
Dischingerweg 5 · D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.expertverlag.de
eMail: [email protected]
Einbandgestaltung: Atelier Reichert, Stuttgart
utb-Nr. 5872
ISBN 978-3-8252-5872-6 (Print)
ISBN 978-3-8385-5872-1 (ePDF)
ISBN 978-3-8463-5872-6 (ePub)
Meiner Frau in Dankbarkeit gewidmet.
Inhaltsübersicht
Vor- und Geleitworte
1Nicht ernstgemeinte Ratschläge für das wissenschaftliche Arbeiten
2Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten
3Grundstrukturierung der wissenschaftlichen Arbeit
4Erhebung von Daten
5Methodischer Exkurs
6Planen der Arbeit, Erstellen des Exposés
7Arbeit mit der Literatur
8Bestandteile der Arbeit
9Grafische Gestaltung
10Stil und Sprache
11Erstellen des Manuskripts
12Kriterien für die Beurteilung wissenschaftlicher Arbeiten
13Präsentieren der Arbeit
14Publizieren von Ergebnissen
15Umsetzen von Ergebnissen
16Schlusswort
Quellenverzeichnis
Verzeichnis der weiterführenden Literatur
Abbildungsverzeichnis
Sachwortverzeichnis
Vorwort
Wissenschaft ist grundsätzlich öffentlich. Ohne das Publizieren, Diskutieren und Lehren der wissenschaftlichen Ergebnisse vollzieht sich keine Wissenschaftsentwicklung. Zum wissenschaftlichen Arbeiten gehört demzufolge neben dem Erkennen sehr wesentlich das Vermitteln des Erkannten.
Für Studierende in Bachelor-, Magister- und Masterprogrammen sowie für Promovenden im Graduiertenkolleg oder in der Aspirantur stellt das Verfassen und Präsentieren ihrer wissenschaftlichen Arbeit mit Prüfungscharakter eine besondere Anforderung dar. Sehr unterschiedlich ist dabei ihr Erfahrungshintergrund. Häufig liegt die letzte größere wissenschaftliche Arbeit einige Zeit zurück, so dass eine Auffrischung hilfreich sein kann.
Die Empfehlungen in diesem Buch richten sich besonders auch an Personen, die berufsbegleitend im Rahmen einer Fortbildung ihre wissenschaftliche Professionalität erweitern oder erhöhen wollen. Sie sind sich zwar ihrer hohen fachlichen Qualifikation bewusst, trauen aber – zu Unrecht – ihrem Denken nicht die Qualität „wissenschaftlich“ zu und erst recht nicht ihrer Fähigkeit, zu publizieren. Das veranlasst mitunter zu schwülstigen Darstellungen, die sich zum Beispiel durch höchst komplizierte Schachtelsätze und Häufung von wenig gebräuchlichen Fremdwörtern auszeichnen. Aber Öffentlichkeit der Wissenschaft erfordert: Formuliere einfach und klar, nimm Rücksicht auf die Zeit deines Lesers!
Der vorliegende Ratgeber behandelt neben der formalen Gestaltung auch die systematische Anlage einer wissenschaftlichen Arbeit, abgeleitet aus den Etappen der Erkenntnisgewinnung (Forschungsfrage – Annahme – Material- und Feldforschung – Erkenntnis – Schlussfolgerung). Dabei stehen Handlungsorientierungen vor Handlungsbegründungen. Sie beziehen sich unter anderem auf:
das Finden der wissenschaftlichen Fragestellung(en) und das Formulieren einer bearbeitbaren Aufgabenstellung,
das wissenschaftliche Argumentieren und den Einsatz des methodischen Instrumentariums,
das Erheben von Daten und die Arbeit mit der Literatur,
die formale Gestaltung der Arbeit,
die überzeugende Präsentation in Vortrag und Diskussion sowie
das Publizieren und Umsetzen der Ergebnisse.
Der Ablauf der Themenbearbeitung, das methodische Vorgehen und der Stil wissenschaftlicher Arbeiten unterscheiden sich von Fachgebiet zu Fachgebiet und sicher auch zwischen den graduellen Stufen. Dennoch besitzen die Ratschläge übergreifenden Charakter, fokussieren allerdings im methodischen Bereich vornehmlich Arbeiten in den Wirtschafts-, Technik-, Sozial- und Erziehungswissenschaften. Die rasche Entwicklung der Textverarbeitungssoftware hat den Autor bewogen, auf dieses Thema hier zu verzichten und dafür die aktuelle Fachliteratur zu empfehlen.
Dabei sind Wiederholungen notwendig, die nicht als Redundanz empfunden werden sollen. Das Buch ist so aufgebaut, dass auch der eilige Leser ohne Studium des gesamten Textes anlassbezogen in den einzelnen Teilen, Kapiteln und Abschnitten Rat holen kann. Das sehr detaillierte Inhaltsverzeichnis soll bei auszugweisem Lesebedarf eine schnelle Orientierung ermöglichen.
In diesem Buch wird durchweg die männliche Sprachform verwendet. Alle Aussagen gelten selbstverständlich für Frauen und Männer gleichermaßen. Wenn also von Teilnehmern, Verfassern, Autoren oder Lesern die Rede ist, sind stets „Teilnehmerinnen und Teilnehmer“, „Leserinnen und Leser“ etc. gemeint.
An dem Buch hat eine Reihe von Personen tatkräftig mitgewirkt. Mein besonderer Dank gilt den Herren Prof. Dr. Volker Oppitz und Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Gerd-Bodo von Carlsburg für die zahlreichen inhaltlichen Anregungen, Herrn Dr. Peter Schoenball und Frau Ingrid Lehmann für die gründliche Durchsicht des Manuskripts und Frau Antje Albani für die Text-, Bild- und Einbandgestaltung.
Dem Autor bleibt zu wünschen, dass die Leser von dem Buch in einer Weise profitieren, die für ihre erfolgreiche wissenschaftliche Arbeit förderlich ist.
Prof. Dr. Günter Lehmann
Vorwort zur 7. Auflage
Die wissenschaftliche Arbeit ist geschrieben, mit Erfolg verteidigt – und nun? Abgesehen von Arbeiten im betrieblichen Auftrag ruhen die meisten von ihnen in den Archiven der Hochschulen und der Gutachter sowie im Bücherschrank des Verfassers. Wertvolle Ergebnisse bleiben ungenutzt, weil unbekannt. Deshalb sollen entsprechende Beiträge in der 7. Auflage das Bemühen um das Bekanntmachen der erzielten wissenschaftlichen Ergebnisse anregen.
In Fortsetzung des kurzen Teils zum Publizieren in der 6. Auflage werden im Kapitel 14.6 ausgewählte praktische Tipps für das Veröffentlichen von wissenschaftlichen Ergebnissen in Publikationsorganen angeboten.
Ein neuer Teil 15 ist dem Umsetzen von Ergebnissen aus Dissertationen, Master- und Bachelorarbeiten in die Praxis der Organisation gewidmet. Die entsprechenden Empfehlungen basieren vor allem auf aktuellen Erfahrungen von Absolventen.
Im Teil 3 ist eine Schrittfolge zur Themenfindung mit Illustration ausführlich beschrieben. Der Abschnitt 3.2.3 bietet die SWOT-Analyse zur Themenwahl an.
Kapitel 3.3 enthält Ergänzungen zur Arbeit mit Begriffen in der wissenschaftlichen Arbeit. Insbesondere werden Empfehlungen zum Darstellen begrifflicher Zusammenhänge und zur geschlechtsspezifischen Schreibweise angeboten.
Im neuen Kapitel 6.7 werden Vorschläge zur Betreuung wissenschaftlicher Arbeiten unterbreitet. Dabei wird vor allen die Arbeit mit dem Betreuer reflektiert.
Eine Neubearbeitung erfolgte im Kapitel 13.5 zur Frage- und Diskussionsrunde. Die Ausführungen wurden stärker auf die konkrete Situation in der Disputation der wissenschaftlichen Arbeit konzentriert.
Prof. Dr. Günter Lehmann
Vorwort zur 8. Auflage
Wenn man davon ausgeht, dass sich immer mehr Menschen im Internet informieren, dann liegt die Bedeutung von Blogartikeln auf der Hand. Das Thema der Graduierungsarbeit bietet zahlreiche Möglichkeiten, in einem Blog die Quellen, Wege und Ergebnisse der eigenen Untersuchung bekanntzumachen, aber auch mit anderen Standpunkten zu vergleichen und neuere Entwicklungen vorzustellen. Das Textformat ist kurz, stilsicher und suchmaschinenoptimiert. In einem neuen Abschnitt 14.3.9 werden Gestaltungsvorschläge für das Verfassen eines Blogs unterbreitet. Mit Blick auf die gute Lesbarkeit des Textes wird das Messen mit dem Flesch-Index angeregt.
Für die gründliche Durchsicht des gesamten Buches sowie die Ideen zur Umschlaggestaltung danke ich Frau Karina Kowatsch und Herrn Patrick Sorg.
Prof. Dr. Günter Lehmann
Geleitwort
Graduierungsstudien an den Universitäten und Hochschulen stellen den Anspruch, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern in Haus-, Projekt-, Bachelor-, Master- und Magisterarbeiten sowie Dissertationen zugleich auch Wissen zu ergänzen, zu erweitern oder gar neues Wissen zu erwerben als auch öffentlich mitzuteilen. Jeder Studierende, der damit befasst ist, weiß es zu schätzen, wenn er in dieser Richtung gezielte Unterstützung erfahren kann.
Ein Blick in das Literaturangebot auf dem Gebiet des Anfertigens und Präsentierens wissenschaftlicher Arbeiten erschließt eine größere Anzahl von Leitfäden, Handbüchern, Ratgebern etc. Nahezu allen ist gemeinsam, dass sie stets einzelne Aspekte des wissenschaftlichen Arbeitens besonders hervorheben, wie beispielsweise Arbeitsplanung, Materialerhebung oder Manuskripterstellung. Der Vorzug dieses vorliegenden Elaborats besteht jedoch in der Geschlossenheit der Betrachtung. Ausgehend vom Credo des Verfassers, dass Wissenschaft nur coram publico legitimiert sei, werden alle Aspekte einer wissenschaftlichen Arbeit im Hinblick auf ihre Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit diskutiert.
Ein weiterer Vorzug dieses Bandes liegt in seiner Orientierung hinsichtlich der wachsenden Anzahl von Fach- und Führungskräften, die in berufsbegleitenden Graduierungsstudien ihre wissenschaftliche Professionalität ausbauen bzw. erweitern wollen. Insbesondere wird die Intention des Verfassers deutlich, für diesen Personenkreis mit seinen wissenschaftlichen Arbeiten den Technologietransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu intensivieren. So entspringen gerade Innovationen nicht nur durch das Schaffen neuen Wissens, sondern eigens auch durch das Übertragen bestehenden Wissens auf neuartige Zusammenhänge sowie das Umsetzen der Ergebnisse in Innovationen.
Die angebotenen Handlungsorientierungen für wissenschaftliche Arbeiten belegen die langjährige Praxis des Autors auf dem Gebiet wissenschaftlichen Arbeitens. Das Erscheinen der bereits 7. Auflage unterstreicht die Wertschätzung einer Leserschaft, die durch die Nutzung dieser ratgebenden und anwendungsunterstützenden Lektüre eine große Hilfestellung erfährt.
Mit der Ergänzung des Anfertigens und Präsentierens durch das Publizieren und Umsetzen der Ergebnisse erfährt das Buch eine echte Bereicherung und lässt es zu einem Unikat in der einschlägigen Fachliteratur werden.
Heidelberg, im August 2018Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Gerd-Bodo von Carlsburg
Inhaltsverzeichnis
1Nicht ernst gemeinte Ratschläge für das wissenschaftliche Arbeiten
2Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten
3Grundstrukturierung der wissenschaftlichen Arbeit
3.1Vorbemerkung
3.2Problemformulierung/Fragestellung
3.2.1Finden der Problemformulierung
3.2.2Klären des Problemverständnisses
3.2.3Formulieren des Arbeitsthemas
3.2.4Bestimmen und Abgrenzen von Begriffen
3.3Problembearbeitung/Fragebearbeitung
3.3.1Wissenschaftliche Argumentation
3.3.2Vier Schritte der Problembearbeitung
3.4Problemlösung/Antwort
3.5Checkliste
4Erhebung von Daten
4.1Material für die Erhebung
4.2Primärmaterial
4.2.1Quellen
4.2.2Instrumente
4.3Sekundärmaterial
4.3.1Quellen
4.3.2Instrumente
4.3.3Dokumentation
4.4Etappen der Erkenntnisgewinnung
4.5Checkliste
5Methodischer Exkurs
5.1Empirischer Forschungsprozess
5.2Empirische Forschungsmethoden
5.3Statistische Analysen
5.3.1Kennzeichnung
5.3.2Beschreibende Statistik
5.3.3Schließende Statistik
5.3.4Längsschnitt- und Querschnittanalyse
5.4Klinische Studien
5.5Checkliste
6Planen der Arbeit, Erstellen des Exposés
6.1Kennzeichnung
6.2Zeit planen
6.3Ressourcen planen
6.4Kosten planen
6.5Untersuchungsdesign
6.6Exposé als Schreibplan und Diskussionsgrundlage
6.7Betreuung nutzen
6.8Checkliste
7Arbeit mit der Literatur
7.1Literaturauswahl und -bewertung
7.1.1Angemessen auswählen
7.1.2Korrekt auswerten
7.2Lesen und Exzerpieren
7.2.1Lesetechniken
7.2.2Richtiges Exzerpieren und Ordnen
7.3Zitierweise
7.3.1Adäquat zitieren
7.3.2Korrekt zitieren
7.4Checkliste
8Bestandteile der Arbeit
8.1Übersicht der formalen Bestandteile
8.2Vortexte
8.3Inhaltsverzeichnis
8.4Einleitung
8.5Herleitung der Aufgabenstellung
8.6Hauptteil
8.7Schluss
8.8Verzeichnisse
8.8.1Quellenverzeichnis (obligatorisch)
8.8.2Verzeichnis weiterführender Literatur (optional)
8.8.3Fachwortverzeichnis (optional)
8.8.4Abkürzungsverzeichnis (optional)
8.8.5Abbildungsverzeichnis (optional)
8.8.6Weitere Verzeichnisse (fakultativ)
8.9Anhang
8.10Anlagen
9Grafische Gestaltung
9.1Anforderungen
9.2Darstellungsformen
9.2.1Diagramme
9.2.2Tabellen
9.2.3Schaubilder
9.2.4Weitere Darstellungen
9.3Checkliste
10Stil und Sprache
10.1Vorbemerkungen
10.2Wortwahl
10.2.1Fach- und Fremdwörter
10.2.2Modewörter
10.3Umgangssprache
10.4Satzbildung
10.5Textverständlichkeit
10.6Checkliste
11Erstellen des Manuskripts
11.1Schreiben der Rohfassung
11.1.1Formulieren des Textes
11.1.2Schreiben mit Leserbezug
11.1.3Strukturieren der einzelnen Kapitel
11.2Überarbeiten bis zur Endfassung
11.2.1Überprüfen der vollständigen Fragebeantwortung
11.2.2Kontrolle der Wort- und Satzverständlichkeit
11.2.3Aufbereiten nach wissenschaftlichen Standards
11.2.4Empfehlungen für das Format
11.3Layoutvorschläge
11.4Korrektur vor der Endfassung
11.5Checkliste
12Kriterien für die Beurteilung wissenschaftlicher Arbeiten
12.1Anlage des Kriterienensembles
12.2Kriterienübersicht
13Präsentieren der Arbeit
13.1Ratschläge für ein gelungenes Scheitern der Präsentation
13.2Das Grundmodell
13.3Hauptschritte bei der Vorbereitung
13.3.1Ziele formulieren
13.3.2Analyse der Teilnehmer
13.3.3Bearbeitung des Inhalts
13.3.4Visualisieren von Inhalten
13.3.5Erstellen des Vortragsmanuskripts
13.3.6Erstellen des Teilnehmermaterials
13.3.7Beachten des Zeitfaktors
13.4Der Vortrag
13.4.1Grundstruktur
13.4.2Einleitungsteil
13.4.3Hauptteil
13.4.4Schlussteil
13.5Frage- und Diskussionsrunde
13.5.1Grundstruktur
13.5.2Teilnehmer aktivieren
13.5.3Fragen beantworten
13.5.4Einwände behandeln
13.5.5Diskussion zusammenfassen
13.6Nachbereitung
13.6.1Einschätzung vornehmen und einholen
13.6.2Überarbeitung einleiten
13.6.3Nachkontakte planen
13.7Rhetorische Mittel
13.7.1Übersicht
13.7.2Verständliche Informationen
13.7.3Anschauliche Information
13.7.4Sprechtechnik
13.7.5Körpersprache
13.7.6Ausdrucksmittel Kleidung
13.8Checkliste
13.9Konflikte beherrschen
13.9.1Kennzeichnung
13.9.2Präsentator
13.9.3Teilnehmer
13.9.4Medien/Technik
13.10Gestalten des Abstracts
13.11Präsentieren von Postern
14Publizieren von Ergebnissen
14.1Kennzeichnung
14.1.2Arbeitspapiere
14.1.3Tagungs- und Konferenzbeiträge
14.1.4Zeitschriftenartikel/Bücher
14.1.5Open-Access-Publikationen
14.2Ausgewählte Textformate
14.2.1Abstracts
14.2.2Poster
14.2.3Rezension
14.2.4Tagungsbericht
14.3Tipps für den Einsteiger
14.3.1Vorbemerkung
14.3.2Verlage
14.3.3Ablehnungsquote
14.3.4Fachwissenschaftlicher Artikel
14.3.5Internet
14.3.6Konventionen
14.3.7Argumentation
14.3.8Populärwissenschaftlicher Artikel
14.3.9Blogartikel
15Umsetzen von Ergebnissen
15.1Kennzeichnung
15.2Erfolgsfaktoren für das Umsetzen
15.3Ansprechpartner in der Organisation
15.3.1Gruppenbildung
15.3.2Aussagen von besonderer Bedeutung
15.3.3Checkliste
15.4Gruppendiskussion
15.4.1Anlass
15.4.2Kennzeichnung
15.4.3Moderation
15.4.4Verlaufsphasen
15.5Präsentation
15.6Bedingungen für den Umsetzungserfolg
16Schlusswort
Quellenverzeichnis
Verzeichnis der weiterführenden Literatur
Abbildungsverzeichnis
Sachwortverzeichnis
1Nicht ernst gemeinte Ratschläge für das wissenschaftliche Arbeiten
Wer in der Schule schreiben gelernt hat, kann auch wissenschaftlich arbeiten. Das Leben enthält so viele Episoden, die alle einer wissenschaftlichen Bearbeitung harren.
Gehe spontan auf dein Ziel los, belaste dich nicht mit langwierigen Überlegungen zu möglichen Hindernissen auf dem Weg dahin und verliere dich nicht in endloser Prüfung, welches dieser Hindernisse schon überwunden ist. Kleingeister, die sich tagelang in Bibliotheken oder im Internet tummeln, verlieren nur kostbare Zeit und lassen sich außerdem durch angeblich schon Erkanntes verunsichern.
Wer glaubt, ein Alibi zu benötigen, sollte ein, aber maximal zwei Fachbücher wählen, die einen gewissen Bezug zum eigenen Thema haben. Dabei sind ältere Auflagen deshalb zu empfehlen, weil die meisten Leser sie nicht mehr kennen. Diese Bücher schlachte gründlich aus. Zitiere möglichst wörtlich längere Passagen; wozu eigene Interpretationen finden, wenn andere bereits etwas treffend gesagt haben, denn das hieße ja, das Fahrrad zum zweiten Mal zu erfinden. Übrigens: Man kann auch zur Abwechslung hier und da mal auf die „Gänsefüßchen“ verzichten, dies merkt sowieso keiner.
Besonders nützlich sind diese Fachbücher für den eigenen Literaturnachweis. Übernimm am besten die Quellen- und Literaturverzeichnisse im vollen Wortlaut, denn sie haben offenbar vor der Fachöffentlichkeit bereits bestanden. Ergänze sie lediglich durch die für die eigene Beweisführung verwendete Praktiker- und Unterhaltungsliteratur. Auch Zitate aus der Boulevard-Presse gehören dazu, denn sie widerspiegeln das wahre Leben.
Schlage dich nicht mit dem Unterschied zwischen These und Hypothese herum. Wozu erst mühselig Belege für eigene Behauptungen sammeln, wenn man persönlich zutiefst von deren Richtigkeit überzeugt ist. Damit regst du deine Leser zum Sammeln von Beweisen an – dafür oder dagegen ist nebensächlich, denn nur die bringen die Wissenschaft voran, die den Sack voll Kartoffeln ausschütten, nicht die, die die Kartoffeln wieder einsammeln.
Vor allem sollte man sich nicht von den üblichen Gliederungsmodellen beeinflussen lassen. Die Arbeit wird abwechslungsreicher, wenn man numerisch und alpha-numerische miteinander mischt und mindestens fünf Abstufungen in der Gliederung vorsieht. Und fällt dir zu einer Überschrift kein passender Kommentar ein, dann lasse ihn weg. Was nicht dasteht, kann nicht durchfallen. Sollte dies dem Gutachter nicht gefallen, hat er wenigstens einen Kritikpunkt gefunden.
Wenn du deine Leser überraschen willst, entwickele Originalität im Aufbau der Arbeit. Mache es ganz anders, als es üblich ist. Beginne mit einer gründlichen Vorstellung deiner Person, deiner bisherigen Leistungen und Referenzen, knüpfe daran eine Würdigung der Hilfe durch deine Großeltern, Eltern, Gattin/Gatte und deine Kinder und schließe mit einer Laudatio auf den/die Gutachter ab. Das rührt den Leser an und schließt für die Lektüre deiner Arbeit auf.
Verzichte also auf die übliche Einleitung, denn du weißt aus eigener Erfahrung, dass die sowieso keiner liest. Die Leute wollen nicht mit deinen Zielen, Problemstellungen, Vorgehensweisen und Begriffsabgrenzungen gelangweilt werden – sie brennen darauf, deine Behauptungen kennenzulernen.
Diese nun sollten ihrem wissenschaftlichen Wert entsprechend gewichtig formuliert werden. Wo käme man hin, wenn jeder sofort deren Erkenntnisschwere bewältigen könnte. Schreibe also nicht einfach: „Gegenwärtig steigt die Arbeitslosigkeit“, sondern drücke dies „wissenschaftlich“ aus: „Die Akkumulation involontär nicht in Arbeitsrechtsverhältnissen gebundener Erwerbspersonen stellt zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein beachtliches Phänomen dar.“ Gefällig sind auch solche Bekenntnisse wie: „Ich glaube zutiefst an unsere State of the Art-Kernkompetenzen, um den Paradigma/sic/wechsel der ausdifferenzierten Motivationsfaktoren zu wagen.“ Entscheidend ist hier nicht, zu verstehen, was du glaubst, sondern, dass du glaubst. Glaubhaft sind auch deine Ankündigungen, die „optimalste Lösung“ zu finden oder eine „absolut sichere Zukunftsprognose“ anzubieten. Und verwende die Begriffe „komplex“ und „kompliziert“ im Zweifelsfall synonym; den Unterschied kennt ohnehin keiner. Also: Formuliere deine Hypothesen kraftvoll, blumig und mit der unverzichtbaren Übertreibung, damit sie anschaulich werden. So begegnest du Zweiflern und Nörglern wirkungsvoll.
Sollte der wissenschaftliche Betreuer hartnäckig auf der Definition der in der Arbeit verwendeten Begriffe bestehen, dann gib wenigstens an dieser Stelle nach. Konzentriere Dich dabei auf die Erläuterung von Begriffen, deren Bedeutung unstrittig ist, wie beispielsweise „Analyse“, „Formel“ oder „Matrix“. Dabei schätzt es der Leser einer wissenschaftlichen Arbeit besonders, wenn ihm der Begriff „Matrix“ wie folgt erklärt wird: „Rechteckig angeordnetes System von irgendwie zusammengehörenden Zahlen.“ Sollte jemand gar Rechtschreibefehler kritisieren, verweise auf das Versagen des Rechtschreibeprogramms deines Computers. Dafür kann man dich nun wirklich nicht verantwortlich machen.
Lasse keine Zweifel am Erkenntnisfortschritt und der Originalität deiner Arbeit aufkommen. Es ist schon ein Verdienst, Erkenntnisse aus zwei Fachbüchern jetzt in einem eigenen Werk zusammenzuführen. Das Aufwerfen neuer Fragestellungen kann zu erheblichen Verwirrungen führen und Literaturkritik schafft nur böses Blut. Eine eigene Rechtschreibung, die Verwendung weitgehend unbekannter Fremdwörter, eine unkonventionelle Zitierweise und eine originelle Mischung von Gliederungsmodellen machen deine Arbeit zu einem Unikat in der „wissenschaftlichen Literatur“ – und ersparen dir mit großer Sicherheit die Aufnahme in die anstrengende „scientific community“.
2Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten
Mit der Übernahme einer wissenschaftlichen Prüfungsarbeit in einem Bachelor-, Master- oder Promotionsstudium hat sich der Teilnehmer zugleich zu dem Auftrag bekannt, einen Beitrag zur Entwicklung der jeweiligen wissenschaftlichen Disziplin zu leisten. Seine wissenschaftliche Arbeit soll zeigen, dass er in der Lage ist, eine Problem- bzw. Fragestellung selbständig unter Anwendung wissenschaftlicher und praktischer Erkenntnisse und Methoden zu bearbeiten und zu präsentieren. Im Mittelpunkt steht dabei der Erkenntnisfortschritt.
Natürlich gibt es unterschiedliche Stufen wissenschaftlichen Arbeitens, die sich weniger kategorial, sondern eher graduell voneinander unterscheiden. Nach einer „Gemeinsamen Erklärung der europäischen Bildungsminister“ 1999 in Bologna und 2001 in Prag hat sich weitgehend die in der Abb. 1 dargestellte Struktur der Abschlüsse im europäischen Hochschulraum etabliert.
Abb. 1: Struktur der europäischen Hochschulabschlüsse
Danach sind folgende wissenschaftliche Prüfungsarbeiten zu unterscheiden:
Bachelor-Arbeit (Bachelor-Thesis),
Master-Arbeit (Master-Thesis),
PhD-Arbeit (Dissertation).
Unabhängig von den graduellen Unterschieden sollen alle wissenschaftlichen Arbeiten
eine für andere erkennbare Fragestellung nachvollziehbar behandeln (intersubjektive Nachvollziehbarkeit);
zur Erweiterung des Erkenntnisstandes (neue Aussagen) in Theorie und Praxis mit dem Anspruch der Allgemeingültigkeit beitragen, wobei vor allem vorhandenes Wissen auf neuartige Zusammenhänge zu übertragen ist;
dem aktuellen Wissensstand entsprechende und dem Forschungsgegenstand adäquate Methoden nachprüfbar anwenden und darstellen;
die genutzten Quellen richtig und vollständig offenlegen und
die Erkenntnisse mit ihren Nutzenaspekten verständlich formulieren und öffentlich mitteilen (NIEDERHAUSER, J., 2000, S. 4/5).
Von jeder wissenschaftlichen Arbeit kann erwartet werden, dass sie einen Beitrag zum Erkenntnisfortschritt leistet und dabei Eigenständigkeit (Originalität) erkennen lässt. Dabei bedeutet Erkenntnisfortschritt nicht automatisch das Entwickeln einer neuen Theorie (was ohnehin selten gelingt), sondern auch
das Aufdecken von Zusammenhängen zwischen bereits erkannten Sachverhalten,
das Verifizieren bisher ungesicherter Erkenntnisse bzw. das Falsifizieren bisher als sicher geltender Erkenntnisse,
das Feststellen von Erkenntniswidersprüchen bzw. -lücken,
das Erkennen neuer Fragestellungen oder
die begründete Literaturkritik.
PREISSNER, A. (2012, S. 173) macht auf die unterschiedliche Sichtweise von Wissenschaft und Praxis aufmerksam: „Wissenschaft analysiert die Methode, gleich mit welchem Ergebnis.“ Sie zielt auf die Weiterentwicklung und das Testen von Methoden, Modellen, Gesetzen, Konzepten. „Praxis will ein bestimmtes Ergebnis, gleich mit welcher Methode.“ So ist beispielsweise eine Lösung zur Erfüllung von Unternehmenszielen zu finden.
Eigenständigkeit im Sinne von Originalität der wissenschaftlichen Arbeit bezieht sich auf
eigene Wege bei der Datenerhebung und Belegung der Behauptungen,
das Darstellen des Vorgefundenen, der erzielten Ergebnisse und des methodischen Informationsgewinns und
die Bestimmung der verwendeten Begriffe.
Betrachtet man im Lichte dieser Ansprüche die graduellen Stufen wissenschaftlicher Arbeiten, so lassen sich folgende Eingrenzungen vornehmen:
Die Komplexität der behandelten Fragestellung, ihr innovativer und substanzieller Charakter nimmt mit steigender Niveaustufe zu. Demgegenüber nehmen thematische Einschränkungen eindeutig ab: Ziele, Problem- und Fragestellungen werden zunehmend selbständig gewählt.
Ebenso nimmt der Anspruch an theoretischer Fundierung mit steigender Niveaustufe zu, die Erwartung an einen erkennbaren Beitrag zur Entwicklung der jeweiligen Wissenschaftsdisziplin wächst mit zunehmender Niveaustufe.
Mit Blick auf die Besonderheiten von Autoren wissenschaftlicher Arbeiten in berufsbegleitenden Studiengängen spielen Praxisbezug und Problemlösungsanteil nahezu gleichermaßen eine wichtige Rolle. Im Unterschied zu Dissertationen, die einer wissenschaftlichen Karriere dienen, wollen auch Masterarbeiten im betrachteten postgradualen Bereich eher mit ihrer Zielsetzung und Problemstellung die gesellschaftliche Praxis ihres Fachs als ihr Fach selbst erreichen (Winter, W., 2005, S. 7). Bachelorarbeiten sind vor allem auf die Beantwortung praktischer Fragestellungen gerichtet.
Deutliche Unterschiede zwischen den drei Niveaustufen bestehen im Umfang und in der Bearbeitungszeit. Obwohl einrichtungs- und disziplinabhängig gelten die folgenden Orientierungswerte:
–Bachelorarbeiten
Umfang: 40 Seiten A4 +/- 10 %Bearbeitungszeit: 3–4 Monate
–Masterarbeiten
Umfang: 70 Seiten A4 +/- 10 %Bearbeitungszeit: 6 Monate
–PhD-Arbeiten
Umfang: 100 Seiten A4 +/- 10 %Bearbeitungszeit: ab 2 Jahre
Für alle Stufen gemeinsam gelten die Ansprüche an die Eigenständigkeit der Untersuchung, die Nachprüfbarkeit der Methoden, die Offenlegung der Quellen sowie die verständliche Formulierung und öffentliche Mitteilung der Ergebnisse.
Der Anspruch an Öffentlichkeit gilt generell für die wissenschaftliche Arbeit. Schon Goethe behauptet in seinen „Maximen und Reflexionen“: „Die Deutschen, und sie nicht allein, besitzen die Gabe, die Wissenschaften unzugänglich zu machen.“ Genau darin steckt ein häufig feststellbares Problem – nämlich Aussagen über wissenschaftliche Ergebnisse so zu kodieren, dass sie der Fachöffentlichkeit nur mit Mühe oder gar nicht zugänglich sind. Es ist deshalb nicht zutreffend, Wissenschaftlichkeit primär mit Abstraktion und formaler Sprache zu kennzeichnen. Der Psychologe O. KRUSE (2004, S. 72) sagt zu Recht: „Wissenschaft ist primär eine soziale Handlung.“ Und er führt dazu weiter aus, dass die Wissenschaft mit der Veröffentlichung unseres Denkens beginnt. Das aber bedeutet, das Denken nicht mehr als Privatsache anzusehen, sondern als eine gesellschaftliche Aufgabe des Gewinnens von Erkenntnissen. Dazu gehört mit Sicherheit auch Mut. Wissenschaft erfordert sowohl den Mut, selbständig zu denken, als auch den Mut, die Ergebnisse des Denkens öffentlich zu machen, d. h. sich auf die Kommunikation mit der Öffentlichkeit einzulassen.
Damit sich eine Öffentlichkeit mit dem Verfasser einer wissenschaftlichen Arbeit – unabhängig auf welcher Stufe – auf eine Kommunikation einlässt, sei diesem ans Herz gelegt:
Angemessene Kürze und Respekt vor der Zeit des Lesers.
Einfaches und eindeutiges Vokabular; komplizierte Ausdrücke nur dort, wo einfache nicht zutreffen.
Übrigens: Wer seine Arbeit aus Geheimhaltungsgründen für die Öffentlichkeit sperrt (Arbeit mit Sperrvermerk bedeutet Ausschluss von der Bibliotheksausleihe), wird von der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen. Dem kann mit einer Verbannung der Geheimnisse in die Anlagen der Arbeit begegnet werden.
3Grundstrukturierung der wissenschaftlichen Arbeit
3.1Vorbemerkung
Die geläufige Grobstruktur eines Textes oder eines Vortrages, also die Einteilung in Einleitungsteil, Hauptteil und Schlussteil, lässt sich auch auf die wissenschaftliche Arbeit übertragen.
In der einschlägigen Literatur wird diese Grobstruktur mit Bezug auf die wissenschaftliche Arbeit modifiziert, wobei die Ansichten von BÄNSCH und STROHDECKER den Vorschlägen des Autors am nächsten kommen, wie Abb. 2 zeigt.
Abb. 2: Ausgewählte Grundstrukturen wissenschaftlicher Arbeiten
Die folgenden Ausführungen in diesem Teil folgen dem Strukturvorschlag in der rechten Spalte (LEHMANN) der Abb. 2.
3.2Problemformulierung/Fragestellung
3.2.1Finden der Problemformulierung
Erfahrungsgemäß steht mancher Verfasser einer wissenschaftlichen Arbeit am Anfang vor der Schwierigkeit, das Problem, das er lösen will, die Frage(n), die er beantworten will, die Aufgabe, die er lösen will, präzise zu formulieren. Zwei Fehler werden hierbei begangen:
Man hat ein allgemeines Ziel für die wissenschaftliche Arbeit vor Augen und nun wird versucht, dieses Ziel möglichst vollständig zu erreichen. Bald stellt sich heraus, dass für die Zielerreichung sehr verschiedene Probleme auf sehr unterschiedlichem Wege zu lösen sind. Täglich treten neue Aspekte hinzu, das Untersuchungsfeld weitet sich aus, wird immer unübersichtlicher, den Verfasser verlässt der Mut.
Der Verfasser formuliert relativ rasch ein Problem, das ihm für das Erreichen des allgemeinen Ziels geeignet erscheint. Bald stellt er im Ergebnis der Literaturdurchsicht fest, dass dieses Problem längst gelöst ist. Oder er erkennt im Zuge der Problemlösung dessen geringen Einfluss auf die Zielerreichung. Fazit: Der Verfasser muss neu starten.
Der zuletzt genannte Fehler lässt sich mit einem einfachen Beispiel veranschaulichen:
Ein Unternehmer möchte den Umsatz seines Unternehmens erhöhen. Was hindert ihn daran? Nehmen wir an, der Kundenkreis stagniert. Rasch kommt er zu der Problemformulierung/Fragestellung: Wie kommen mehr Kunden zu mir? Dieses Vorgehen entspricht der linken Graphik in Abb. 3.
Aber verschenkt sich der Unternehmer hier nicht die Möglichkeit, mehrere Problemformulierungen für das Überspringen des Hindernisses zu finden? Gibt es tatsächlich nur eine Möglichkeit, den Kundenkreis zu erweitern? Sicher nicht, denn weitere Fragestellungen könnten lauten:
Wie komme ich zum Kunden?
Welche neuen Produkte sprechen neue Kunden an?
Wie kann ich durch Qualitätsverbesserung die Anzahl der Remittenten reduzieren?
Jetzt eröffnet sich ein Feld für die Zielerreichung, das nach Prüfung des bereits Vorhandenen wirklich neue, für die Überwindung des Hindernisses tragfähige Lösungen verspricht. Dieses Vorgehen entspricht der rechten Graphik in Abb. 3.
Abb. 3: Zwei Wege zum Finden der Problemformulierung
Häufig besitzen die ersten Themenvorstellungen den Charakter übergreifender Zielstellungen, zu deren Erfüllung die Arbeit nur einen Einzelbeitrag leisten kann. Diesen Beitrag nach dem prinzipiellen Vorgehen nach Abb. 3 schlüssig aus mehreren Möglichkeiten auszuwählen und in eine bearbeitbare Aufgaben- bzw. Fragestellung zu überführen, ist ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg zum Erfolg.
Dazu wird die schrittweise Beantwortung der folgenden Fragen empfohlen:
Schritt 1:
Wozu will ich mit meiner wissenschaftlichen Arbeit einen Beitrag leisten?
–Das ist die Frage nach einem übergreifenden Ziel (keinesfalls mit dem Thema identisch).
Schritt 2:
Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es für das Erreichen des übergreifenden Ziels?
–Das führt zu mehreren Fragestellungen (nicht bei einer Fragestellung stehen bleiben).
Schritt 3:
Welche von diesen Fragestellungen sind bereits (weitgehend) beantwortet?
–Das erfahre ich im Ergebnis der Literaturrecherche und der Konsultation von Dozenten und anderen Fachleuten.
Schritt 4:
Welche der noch weitgehend unbeantworteten Fragen untersuche ich im Ergebnis einer Auswahl?
–Wesentliche Auswahlkriterien: Bezug zu einem Fach des Studienganges, eigenes Interesse, Zugangsmöglichkeiten zu notwendigen Daten, Neuigkeits- bzw. Schwierigkeitsgrad, Verwertungsinteressen Dritter (z. B. Promoter).
–Damit bestimme ich eine Aufgabenstellung als Arbeitsthema für meinen Beitrag zum Erreichen des übergreifenden Ziels.
Schritt 5:
Welche der unbeantworteten Frage untersuche ich im Ergebnis der Auswahl nicht?
–Damit verweise ich zugleich auf Themen für künftige wissenschaftliche Arbeiten (Forschungsperspektive).
Schritt 6:
Wie kann ich die gewählte Aufgabenstellung (Arbeitsthema) so präzisieren, dass sie unter den gegebenen Prüfungsbedingungen (z. B. wissenschaftlicher Anspruch, verfügbare Bearbeitungszeit) als Thema meiner wissenschaftlichen Arbeit bearbeitbar wird oder bleibt?
–Prüfkriterien: Begriffliche Eingrenzung, örtliche und/oder räumliche Einschränkung, institutionelle Eingrenzung, zeitliche Begrenzung, methodisches Vorgehen, spezifizierte Aspekte.
Abb. 4 illustriert ein Beispiel für das Ableiten einer Aufgabenstellung entsprechend der vorgestellten Schrittfolge.
Abb. 4: Beispiel für eine Schrittfolge zur Themenfindung (Hindernisrecherche)
Ein Blick auf die im Schritt 6 genannten Prüfkriterien zeigt, dass ihr Einsatz jeweils die stärkere Konkretisierung oder auch Erweiterung des Themas in Abhängigkeit vom Typ der wissenschaftlichen Arbeit (Haus-, Bachelor- oder Masterarbeit) ermöglicht. Hinter dem im Beispiel formulierten Thema stehen beispielsweise folgende Forschungsfragen: „Was kennzeichnet die nächtliche …?“ oder „Welche Faktoren bestimmen die nächtliche …?“.
In Schritt 5 wurde auf eine Fragestellung hingewiesen, die in der eigenen Arbeit nicht beantwortet, sondern einer späteren Bearbeitung empfohlen wird.
Eine wichtige Quelle für Arbeitsthemen ist die persönliche Lebens- und Arbeitswelt des Autors. Darüber hinaus bieten die Themenlisten der Hochschulinstitute und ihrer Forschungscluster zahlreiche Anregungen. In Abb. 5 sind weitere Möglichkeiten in Anlehnung an VOSS, R. (2011, S. 64 f.) dargestellt.
Abb. 5: Themenquellen für wissenschaftliche Arbeiten mit Prüfungscharakter
Allen auf diesem Weg gefundenen Themen ist in der Regel gemeinsam, dass sie weder dem inhaltlichen Anspruch der jeweiligen Prüfungsarbeit noch den zeitlichen Bedingungen und dem Bearbeitungsumfang entsprechen.
Für das Finden eines bearbeitbaren Arbeitsthemas (Problemformulierung/ Fragestellung) gibt es eine Reihe von Instrumenten, von denen hier die folgenden vorgestellt werden sollen:
(1)Wissenschaftliches Tagebuch,
(2)Hindernisrecherche,
(3)Ideengrafik (Mindmap),
(4)Zielbaum,
(5)Typisierung,
(6)Interpersonelles und literaturbasiertes Vorgehen.
(1) Wissenschaftliches Tagebuch
Das Wissenschaftliche Tagebuch oder auch Wissenschaftliches Journal (ESSELBORNKRUMBIEGEL, H.; S. 36) dient dem Sammeln der verschiedensten Impulse für die wissenschaftliche Arbeit. Es sollte zum frühestmöglichen Zeitpunkt in einem fest gebundenen Heft angelegt werden. Wesentliche Quellen für solche thematischen Impulse sind in Abb. 5 dargestellt.
Je nach Zeit und Interesse wird in diesem Tagebuch alles notiert, was man an neuen Erkenntnissen, Erfahrungen und Meinungen aufnimmt und damit Schritt für Schritt zu einer Ideensammlung für die Arbeit führt.
So werden in einem wissenschaftlichen Tagebuch beispielsweise dokumentiert:
Notizen aus Vorträgen, Seminaren, Gesprächen,
Fragen, die noch ohne Antwort sind,
Beispiele, Konfliktsituationen,
Beobachtungen,
Gliederungsansätze,
Zielvorstellungen,
Buchtitel, Bibliographien, Zeitungsausschnitte,
Ideen für Analogien,
Textfragmente,
Hypothesen,
Zitate, Geschichten
u. a. m.
Wichtig ist, dass sich der Bearbeiter das Gesammelte zu eigen macht, damit ständig arbeitet, es prüft, kritisiert, verschiedene Aussagen miteinander verknüpft und anwendet (KRUSE, O., 2004, S. 37). Daraus resultieren Impulse für das Generieren von Ideen, unterstützt beispielsweise durch den Perspektivenwechsel, durch das Assoziieren, das Finden von Analogien oder die Bisoziation. Im Folgenden werden diese vier Techniken kurz erläutert.
Der Perspektivwechsel
Das Wesen des Perspektivwechsels (auch Kopfstand genannt) besteht darin, dass die Ausgangsformulierung einer Aussage unter einem anderen Blickwinkel gesehen wird, also beispielsweise auf den Kopf gestellt wird. Daraus entstehen häufig Ansätze für neue Ideen. So war die Umkehrung der Aussage „Wenn Du Menschen führen willst, musst Du ihnen vorangehen.“ in „Wenn Du Menschen führen willst, musst Du hinter ihnen gehen.“ der Anstoß für die Technik des moderierten Problemlösens. Andere Beispiele (QUISKI, F.; SKIRL, S.; SPIESS, G., 1973, S. 125):
Aus dem Handel
–Ausgangsformulierung: Wie kommt der Kunde zu mir?
–Neue Formulierung: Wie komme ich zum Kunden?
–Ergebnis: Etablierung des Versandhandels, Versand von Katalogen!
Aus dem Marketing
–Ausgangsformulierung: Wie kann ich das, was ich produziere, verkaufen?
–Neue Formulierung: Was muss ich produzieren, um die Wünsche der Kunden zu befriedigen?
–Ergebnis: Ausrichten der Produktion nach den Ergebnissen der Marktforschung!
Aus der Erziehung
–Ausgangsformulierung: Wie verhindere ich, dass das Kind den Christbaum demoliert? (Traditionelle Lösung: Kind in das Laufgitter).
–Neue Formulierung: Wie kann ich das Kind vor dem Christbaum schützen?
–Ergebnis: Den Christbaum in das Laufgitter setzen!
Aus der Technik
–Ausgangsformulierung: Wie kann man Walnüsse von außen öffnen, ohne den Inhalt zu beschädigen?
–Neue Formulierung: Wie kann man Walnüsse von innen aus öffnen?
–Ergebnis: In die Walnuss eingefülltes Gas wird zur Explosion gebracht oder die Walnuss wird in ein Vakuum eingebracht!
Das Assoziationsverfahren
Die Assoziation wird mitunter auch als die Vorstufe des kreativen Denkens bezeichnet. Ihr Wesen besteht im Verknüpfen von vorhandenen Erfahrungen und Vorstellungen untereinander. Die Auseinandersetzung mit einem Problem aktiviert Muster, die Einfluss auf die Problemlösung besitzen. Diese Muster entstehen aus der Erfahrung früherer Problemlösungsprozesse sowie aus gesellschaftlichen Normativen und erzieherischer Beeinflussung. Durch die Verknüpfung bisher getrennt gesehener Denkmuster entstehen so genannte Assoziationsketten, die zu einer neuen Kombination, mitunter zu sehr originellen Lösungen des Problems führen können.
Auch das Prinzip des Humors, insbesondere des Witzes, stellt nichts anderes als die Verbindung zwischen zwei bisher getrennt gesehenen Mustern dar. Das kommt beispielsweise deutlich in dem folgenden Kalauer zum Ausdruck:
Frage:„Warum streuen die Ostfriesen Salz und Pfeffer auf den Fernsehapparat?“
Antwort:„Damit das Bild schärfer wird!“
Hier klicken deutlich zwei völlig unterschiedliche Denkmuster ineinander. Der Begriff „scharf“ hat im Denkmuster „Fernsehen“ einen völlig anderen Begriffsinhalt als im Denkmuster „Gewürze“. Durch die Kombination der beiden Muster entsteht der Lacheffekt.
Das Analogieverfahren
Die Analogie ist ein weiteres Verfahren zum Verlassen bisheriger Denkmuster, zum Generieren neuer Ideen, zum Finden origineller Lösungen. Ihr Wesen besteht darin, dass vorhandene Erfahrungen und Vorstellungen mit Bildern aus einem Bereich verknüpft werden, das dem Ausgangsproblem ähnlich ist. Also: Ähnliche Bilder sollen eine vorübergehende Distanzierung vom zu lösenden Problem bewirken.
Historische Berühmtheit erlangte das Analogieverfahren durch die Geschichte des Archimedes, der den Auftrag bekam, die Echtheit einer Goldkrone zu prüfen. Das spezifische Gewicht war damals bereits bekannt. Das Problem bestand in der Bestimmung des Volumens des sehr unregelmäßigen Körpers einer Krone. Archimedes beschäftigte sich lange Zeit mit dem Problem, ohne eine Lösung zu finden. Erst, als er eines Tages in die Badewanne stieg, sah er, dass sich der Wasserspiegel hob, als sein eigener unregelmäßiger Körper eintauchte. Jetzt hatte er einen Weg gefunden, das Volumen unregelmäßiger Körper zu bestimmen. Sein Freudenschrei „Heureka“ („Ich hab es“) ist legendär geworden. Die Problemlösung bei Archimedes kam dadurch zustande, dass er Beobachtungen während des Badens im Analogieschluss auf das zu lösende Problem übertrug.
Beispiel für den Ablauf des Analogieverfahrens:
1. Schritt:
Klarmachen der Problemstellung
Ablösung des traditionellen Stöpsels durch einen neuartigen Verschluss für die Thermosflasche. Als Bedingungen für die neue Lösung gelten:
Deckel muss beim Ausgießen nicht mehr entfernt werden.
Bänder, Ketten oder Scharniere sind zu vermeiden.
Verschluss ist leicht zu reinigen.
2. Schritt:
Distanz schaffen zum Ausgangsproblem durch Auswahl und Analyse von Analogien
Auswahl von Verschlüssen in der Natur
–Augenlid/Iris,
–Poren,
–Blüte,
–After,
–Mund,
–Muschel.
Analyse, beispielsweise der Iris als Teil des Auges
–zieht sich zusammen, dehnt sich aus,
–besteht aus dehnbarem Stoff, der das Öffnen und Schließen ermöglicht,
–ist mit der Iris einer Kamera vergleichbar,
–vergrößert und verkleinert sich.
3. Schritt:
Herstellen der Verbindung zum Ausgangsproblem und Ableiten von Lösungsansätzen
Die Iris besteht aus einem dehnbaren Material, das sich öffnet und schließt. Nimmt man einen langen Ballon und dreht ihn in der Mitte, so erhält man zwei klar voneinander getrennte Teile. Dieses Verschlussprinzip wurde auf Thermosflaschen übertragen und erfolgreich auf den Markt gebracht (QUISKI, F.; SKIRL, S.; SPIESS, G.; 1973, S. 64).
Das Bisoziationsverfahren
Die Bisoziation stellt ein Verfahren dar, das zum Finden außergewöhnlicher Ideen und Lösungen anregen soll. Ihr Wesen besteht darin, dass vorhandene Erfahrungen und Vorstellungen im Unterschied zum Analogieverfahren nicht mit ähnlichen Bildern, sondern mit willkürlich gewählten Bildern verknüpft werden, die zunächst überhaupt nichts mit dem Ausgangsproblem zu tun haben. Die willkürlichen Bilder werden gewählt, um sich dadurch zu neuen Ideen anregen zu lassen. Wohlgemerkt, die Auswahl der Bilder erfolgt völlig willkürlich, beispielsweise ein Ei, aus dem ein Küken schlüpft, ein Flugzeug, eine Giraffe, ein sprudelnder Bach, ein Computer oder eine Messuhr. Wichtige Gesichtspunkte bei der Wahl des Bildes sind:
Das Bild sollte relativ einfach sein.
Das Bild ist für den Bearbeiter interessant, er beschäftigt sich gern damit.
Das Bild ist für den Bearbeiter beschreibbar; er kann es analysieren (Das Bild „Messuhr“, siehe Abb. 64., löst beispielsweise nicht die erwarteten Effekte aus, wenn der Bearbeiter Prinzip, Aufbau und Funktionsweise der Messuhr nicht kennt.).
Das Bild hat mit dem Ausgangsproblem zunächst überhaupt nichts zu tun.
Ein historisches Beispiel für die Bisoziation lieferte Kekulé, der die chemischen Strukturen untersuchte. Eines Tages beschäftigte er sich unter Loslösung von seinem Untersuchungsproblem ausführlich mit dem Bild von sechs ineinander verwobenen Schlangen. Dieses Bild verknüpfte er mit seinem Ausgangsproblem und entdeckte schließlich die Formel für die ringförmige Struktur des Benzol-Moleküls. Er war der Erste, der die rein kettenförmige Anordnung chemischer Strukturen erkannte. Es entstand eine neue Betrachtungsweise, die der Weiterentwicklung der Chemie bedeutsame Impulse gab. Also: Ein willkürlich gewähltes Bild half dem Experten, die gedankliche Blockade zu durchbrechen.
Beispiel für den Ablauf des Bisoziationsverfahrens:
1. Schritt:
Klarmachen der ProblemstellungWie kann eine Werbeagentur regelmäßig neue Kunden gewinnen?
2. Schritt:
Distanz schaffen zum Ausgangsproblem durch Auswahl und Beschreibung eines beliebigen Bildes
Auswahl:Beispielsweise das Bild eines verführerischen Mädchens.
Beschreibung:Verführerische Mädchen haben etwas Geheimnisvolles. Man erahnt ihre Fähigkeiten, ohne Genaueres zu wissen; man ist an ihnen interessiert. Sie sind im Grunde so wie alle anderen, verstehen aber ihre Vorzüge mit Geschick zu verkaufen. Man fühlt sich wie ein Voyeur, wenn man ihre Bewegungen beobachtet. Ein verführerisches Mädchen schafft Gerüchte.
3. Schritt:
Verknüpfen des Bildes mit dem Ausgangsproblem und Ableiten von Lösungsvorschlägen
Statt so: Die Agentur sollte auf alle Kunden wie ein verführerisches Mädchen wirken.
Lösungsvorschlag: Alle Frauen in der Agentur sollen auf Kunden verführerisch wirken, stellen persönliche Beziehungen zum Kunden her. – Oberflächlich, wenig originell.
Lösungsvorschlag: Regelmäßige kostenlose Veranstaltungen von namhaften Marketing- und Werbespezialisten als eine ständige Serviceleistung für vorhandene und potentielle Kunden.
Zusatztipp: Der Bearbeiter kann den Effekt der Bisoziation vergrößern, wenn er zwei bis drei Personen dazu gewinnt, mit ihm gemeinsam diese drei Schritte zu vollziehen.
(2) Hindernisrecherche
Ausgangspunkt der Hindernisrecherche ist zunächst die Zielvorstellung des Verfassers einer wissenschaftlichen Arbeit. Aber an der Zielerreichung hindert ihn beispielsweise ein fehlendes Konzept. Das Problem wird als Hindernis auf dem Weg zum Ziel verstanden. Nunmehr gilt es für das Hindernis, also für das zu lösende Problem, nicht nur eine, sondern möglichst zahlreiche sinnvolle Formulierungen zu finden.
Die Abb. 6 macht die Hindernisrecherche an einem Beispiel deutlich.
Abb. 6: Hindernisrecherche „Positives Betriebsergebnis“
Danach umfasst die Recherche folgende Schritte:
1. Schritt: Formulierung des Ziels
Erreichen eines positiven Betriebsergebnisses im Unternehmen.
2. Schritt: Finden mehrerer Problemformulierungen
Welche neue Werbekampagne könnte den Absatz verbessern?
Welche Diversifikationsmöglichkeiten gibt es für die Produkte?
Wie kann die Qualitätskontrolle verbessert werden?
An welchen Stellen können die Kosten gesenkt werden?
Welche Mitarbeiter müssen auf welchen Gebieten für welche Aufgaben qualifiziert werden?
3. Schritt: Analyse der formulierten Probleme
im Hinblick
auf den Grad ihrer bisherigen Lösung (Feldforschung, Situationsanalyse, Literaturstudium) und
ihrer Zielerreichungspotenz.
4. Schritt:
Entscheidung für das bzw. die zu bearbeitende(n) Problem(e) und Formulierung der Aufgabenstellung für die Untersuchung
Im Ergebnis der Analyse erweist sich die Werbekampagne als besonders potent für die Zielrealisierung.
Als Aufgabenstellung wird formuliert: Entwicklung einer neuen Absatzstrategie (Produkte, Preise, Wege) als Beitrag zum Erreichen eines positiven Betriebsergebnisses.
Die zwei in Abb. 7 und 8 grafisch dargestellten Beispiele sollen das Vorgehen bei der Hindernisrecherche veranschaulichen.
Abb. 7: Finden einer Aufgabenstellung als Beitrag zur regionalen Vernetzung
Abb. 8: Finden einer Aufgabenstellung als Beitrag zur Orientierung des Immobilienportfolios
(3) Ideengrafik (Mindmap)
Eine weitere Möglichkeit, um zur Problemformulierung/Fragestellung vorzudringen, besteht im Anfertigen einer Ideengrafik (auch Clustering genannt) mit Hilfe des Mindmaps, das in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts von dem Engländer Tony Buzan entwickelt wurde. Dabei werden aus einem zentralen Impuls assoziative Ideen entwickelt (ESSELBORN-KRUMBIEGEL, H., 2002, S. 38).
Das übliche Vorgehen bei der Ideengenerierung wird überwiegend von der linken Gehirnhälfte geleistet, die das rationale, analytische Denken steuert. Damit wird aber im Grunde die andere Hälfte der Leistung des Gehirns unterdrückt. Mit dem Mindmap wird nun zugleich die rechte Gehirnhälfte aktiviert. Sie erfasst das Ganze und verbindet zur Ganzheit, entwickelt das bildhafte, analoge und assoziative Denken. Im Mindmap wird die Leistung des Gehirns dadurch verbessert, dass beide Gehirnhälften zusammenarbeiten. Dadurch tauchen originelle Impulse und ungewohnte Gedankenverbindungen auf.
Für das Mindmap werden folgende Regeln empfohlen:
(1)Schreibe den zentralen Begriff aus der übergreifenden Zielstellung der wissenschaftlichen Arbeit zum Gewinnen neuer Erkenntnisse in die Mitte eines quergelegten Blattes und umgebe den Begriff mit einer Ellipse, einem Kreis oder einer Wolke.
(2)Verwende nur Schlüsselwörter und keine vollständigen Sätze. Damit wird der Phantasie mehr Raum für neue Ideen eröffnet.
(3)Vom zentralen Begriff ausgehend werden jetzt alle Ideen aufgeschrieben, die assoziativ dazu einfallen. Verfolge dabei zunächst einen Zweig des Mindmap, belege ihn mit möglichst vielen Einfällen und verbinde diese mit Linien.
(4)Zeichne die Äste und Zweige des Mindmap immer nur so lang, wie die verwendeten Schlüsselwörter sind. Die so erzielte Einheit von Zeichnung und Wort ist harmonischer und prägt sich leichter ein.
(5)Sobald in einem Zweig des Mindmap die Einfälle ausgehen, wende dich wieder ausgehend vom Zentrum einem nächsten Zweig zu und belege ihn mit Ideen, die dir dazu einfallen.
(6)Entwickle die Ideen aus dem Zentralen Begriff heraus ohne Anspruch auf eine logische Ordnung. Gebe dich einer spontanen Ideenproduktion hin, entfalte deine Gedanken ungehindert und schalte dabei den „inneren Kritiker“ aus. Versuche nichts zu erzwingen, wenn der Gedankenstrom vorübergehend stocken sollte.
(7)Schaue immer wieder auf das Mindmap und warte dabei auf weitere Einfälle.
(8)Sind die Einfälle erschöpft, prüfe die einzelnen Zweige und Äste der Ideenentwicklung und wähle jene aus, aus der die Problemformulierung und schließlich die Aufgabenstellung deiner wissenschaftlichen Arbeit entwickelt werden soll.
Im nachfolgenden Beispiel sind diese Regeln angewendet worden. Das Vorgehen wird in den Abb. 9 und 10 dargestellt.
Abb. 9: Finden der Problemformulierung mit Mindmap (in Anlehnung an KLEIN, R.: 2003, 6.4.1, S. 6)
Eine wissenschaftliche Untersuchung will einen Beitrag leisten zur Förderung von Lernprozessen durch Schreibübungen (Ziel der Untersuchung). Aus der Zielformulierung wird das Wort „Schreibübungen“ als zentraler Begriff in der Mitte des quergelegten Blattes mit Großbuchstaben – SCHREIBÜBUNGEN – platziert. Vom zentralen Begriff werden nun alle assoziativen Ideen aufgeschrieben. Jeder Zweig wird zunächst einzeln verfolgt und mit Einfällen belegt – beispielsweise Zweig „Arten“ mit den Einfällen „Briefe“, „E-Mail“, „Aufsätze“ usw.
Nachdem die Ideenimpulse erschöpft sind, wird die für die Untersuchung besonders geeignete Problemformulierung gesucht. Dafür wird der Zweig „Prozess“ ausgewählt.
Abb. 10: Ableiten der Aufgabenstellung
Dem Zweig „Prozess“ wird nun die folgende Problemformulierung zugeordnet: „Welche typischen Muster weisen Schreibübungsprozesse auf?“ Für die Problemlösung ergeben sich der Verästelung in dem Mindmap folgend zwei Möglichkeiten: Entweder werden die Schreibübungsprozesse nach den ihnen innewohnenden Algorithmen untersucht, wobei wiederum logische und psychologische Abläufe zu unterscheiden sind. Oder die Schreibübungsprozesse werden in Projekten, beispielsweise der Wissenschaften (Wirtschaftswissenschaften, Technikwissenschaften, Sozialwissenschaften usw.) untersucht. In dem vorliegenden Beispiel fällt die Entscheidung für das Letztere. Das führt schließlich zur Aufgabenstellung für die wissenschaftliche Arbeit: „Untersuchung von Schreibübungsprozessen in Projekten der Wirtschaftswissenschaften.“