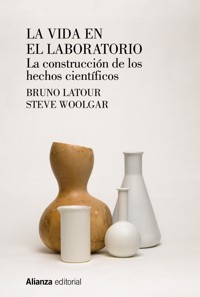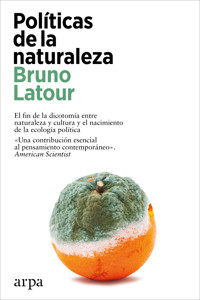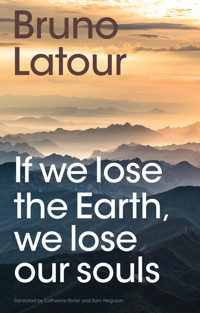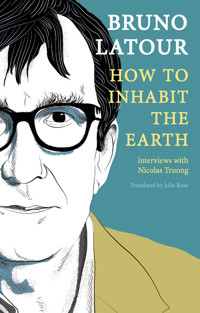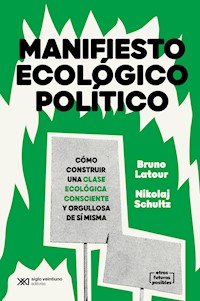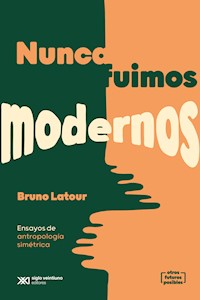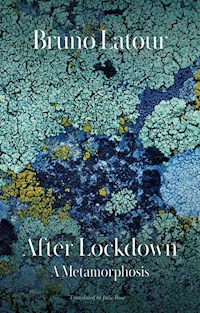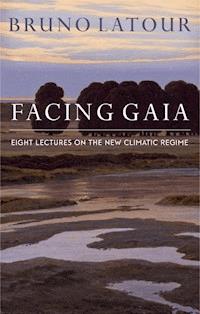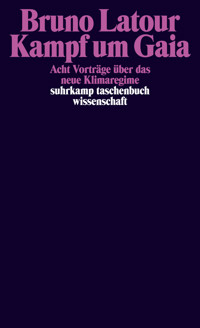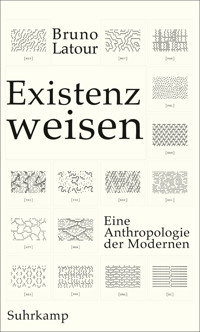15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Als im März 2020 wegen des Corona-Virus Ausgangsbeschränkungen verhängt wurden, fanden sich viele Menschen wie verwandelt. Sie saßen zwischen ihren wohlbekannten Wänden und fragten sich: Was ist mit mir, was ist mit uns geschehen? Die wechselseitige Abhängigkeit von anderen wurde ihnen ebenso bewusst wie die von einer Umwelt, die längst keine natürliche mehr ist.
In Bruno Latours Essay steht Kafkas Figur Gregor Samsa allegorisch für unsere Situation im Angesicht von Pandemie und Klimawandel. Wir sind auf dem Erdboden der Tatsachen gelandet und haben realisiert, dass es kein Zurück in die alte, von grenzenloser Mobilität und Ressourcenraubbau geprägte Normalität geben kann. Stattdessen müssen wir uns neu in jener hauchdünnen Kritischen Zone verorten, die Leben auf dem Planeten Erde ermöglicht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Titel
3Bruno Latour
Wo bin ich?
Lektionen aus dem Lockdown
Aus dem Französischen von Achim Russer und Bernd Schwibs
Suhrkamp
Widmung
5Für Lilo, den Sohn Sarahs und Robinsons Für die Teilnehmer des Projekts Où atterrir?
Motto
9Hast du erkannt, wie breit die Erde sei? Sage an, weißt du das alles?Das Buch Hiob 38,18
Übersicht
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
7Inhalt
Cover
Titel
Widmung
Motto
Inhalt
1. Ein Termite-Werden
2. Eingesperrt an einem immerhin recht geräumigen Ort
3. »
Erde
« ist ein Eigenname
4. »
Erde
« ist ein weiblicher Name, »
Universum
« nicht
5. Erzeugungsstörungen auf allen Ebenen
6. »Hienieden« – allerdings gibt es kein Oben
7. Die Ökonomie wieder an die Oberfläche gelangen lassen
8. Ein Territorium beschreiben – aber an Ort und Stelle
9. Das Auftauen der Landschaft
10. Vermehrung der sterblichen Körper
11. Reprise der Ethnogenesen
12. Höchst sonderbare Schlachten
13. Sich in alle Richtungen zerstreuen
14. Um etwas mehr darüber zu erfahren
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Fußnoten
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
3
5
9
7
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
109
110
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
111. Ein Termite-Werden
Es gibt viele Möglichkeiten anzufangen. Zum Beispiel wie ein Romanheld, der, aus einer Bewusstlosigkeit erwachend, sich die Augen reibt und verstört murmelt: »Wo bin ich?« Gar nicht so leicht für ihn, sich klarzumachen, wo er sich befindet, vor allem wenn er nach einem so langen Lockdown mit einer Maske vor dem Gesicht das Haus verlässt und von den seltenen Passanten nur einen scheuen Blick erhascht.[1]
Vor allem entmutigt, nein, entsetzt ihn, dass der Mond – seit gestern Abend ist er voll und hell – das Einzige ist, was er noch betrachten kann, ohne sich elend zu fühlen. Die Sonne? Unmöglich, ihre Wärme zu genießen, ohne sofort an den Klimawandel zu denken. Die Bäume, die sich im Wind biegen? Bei ihrem Anblick quält ihn die Furcht, dass sie vertrocknen oder unter der Säge enden. Selbst der Regen vermittelt ihm Schuldgefühle: »Sie wissen doch, dass wir bald überall 12Wassermangel haben werden!« Sich am Anblick einer Landschaft erfreuen? Wo denken Sie hin – wir sind doch für diese ganzen Verschmutzungen verantwortlich, und wenn Sie sich noch für den goldenen Weizen begeistern, dann nur, weil Sie vergessen haben, dass die Agrarpolitik der Europäischen Union den Klatschmohn ausgerottet hat; dort, wo die Impressionisten noch ein schönes Gewimmel malten, sehen Sie bloß die Auswirkungen der Gemeinsamen Agrarpolitik vor sich, die das bestellte Land in Wüsten verwandelt hat … Wahrhaftig, nur noch der Anblick des Monds kann seine Sorgen dämpfen: Zumindest für seine Umlaufbahn, für seine Phasen fühlt er sich in keiner Weise verantwortlich; das ist das letzte Schauspiel, das ihm geblieben ist. Wenn sein Glanz dich derart bewegt, dann deswegen, weil du weißt, dass du an seiner Bahn unschuldig bist. Wie du es früher warst, wenn du dir Felder, Seen, Bäume, Flüsse und Berge angeschaut hast, Landschaften, ohne an die Auswirkungen zu denken, die noch dein geringstes Tun und Lassen auf sie hat. Früher. Es ist gar nicht so lange her.
Wenn ich aufwache, fühle ich mich von Qualen heimgesucht, wie sie der Held von Kafkas Erzählung Die Verwandlung empfand, der sich im Schlaf in eine Schabe, einen Krebs oder eine Kakerlake transformiert hat. Zu seinem Entsetzen ist es ihm von einem Tag auf den anderen unmöglich geworden aufzustehen, um wie gewöhnlich arbeiten zu gehen; er verkriecht sich unter sein Bettzeug; er hört seine Schwester, seine Eltern, seinen Chef an die Schlafzimmertür klopfen, die 13er sorgfältig abgeschlossen hat; er kann sich nicht mehr erheben; sein Rücken ist hart wie Stahl; er muss lernen, seine zappelnden Beinchen oder Scheren zu beherrschen; er merkt nach und nach, dass keiner mehr versteht, was er sagt; sein Körper hat neue Ausmaße angenommen; er empfindet sich als ein »ungeheueres Ungeziefer«.
Mir ist, als hätte auch ich eine wirkliche Verwandlung durchgemacht. Ich erinnere mich noch, wie unschuldig ich früher mitsamt meinem Körper herumreisen konnte. Jetzt spüre ich einen langen CO2-Schweif, den ich hinter mir herziehen muss, der mir verbietet, ein Flugticket zu kaufen und wegzufliegen, und der inzwischen alle meine Bewegungen einschränkt, so dass ich kaum wage, meine Tastatur zu benutzen, aus Furcht, ich könnte irgendeinen fernen Gletscher zum Schmelzen bringen. Aber seit Januar ist es noch schlimmer geworden, denn außerdem treibe ich, wie man mir unablässig wiederholt, eine Aerosolwolke vor mir her, deren feine Tröpfchen winzige Viren verbreiten, die in die Lungen geraten und meine Nachbarn töten können – sie würden in den Betten der überfüllten Krankenhäuser ersticken. Ich muss lernen, vorn und hinten gewissermaßen einen Panzer täglich schlimmer werdender Konsequenzen mit mir herumzuschleppen. Wenn ich mich, unter meiner Operationsmaske mühsam atmend, anstrenge, die Abstandsregeln einzuhalten, komme ich fast nicht voran und nicht sehr weit, denn sobald ich meinen Einkaufswagen zu füllen versuche, wird mir noch elender: Diese Tasse Kaffee zer14stört in den Tropen ein Stück Boden; dieses T-Shirt bringt in Bangladesch ein Kind in Not; von dem blutigen Steak, das ich immer so gerne aß, steigen Methanwolken auf, die die Klimakrise weiter beschleunigen. Ich stöhne, winde mich, fassungslos von dieser Verwandlung – wann werde ich endlich aus diesem Albtraum aufwachen, wieder werden, was ich früher war: frei, anständig, mobil? Ein Mensch alten Schlags, zum Teufel! Im Lockdown meinetwegen, aber bloß für ein paar Wochen; nicht für immer, das wäre wirklich zu grauenvoll. Wer möchte schon wie Gregor Samsa enden, der zur großen Erleichterung seiner Eltern in einem Winkel vertrocknet ist?
Und doch, eine Verwandlung hat durchaus stattgefunden, und es sieht nicht so aus, als könne man, aus diesem Albtraum erwachend, weitermachen wie zuvor. Einmal Lockdown, immer Lockdown. Das »ungeheuere Insekt« muss lernen, in schiefer Lage voranzukommen, sich mit seinen Nachbarn, seinen Verwandten zusammenzuraufen (vielleicht wird ja auch die Familie Samsa anfangen zu mutieren?), alle peinlich berührt von ihren Fühlern, ihren Ausdünstungen, ihren Virus- und Gasschwaden, alle mit ihren Prothesen klappernd, grässlich mit ihren aufeinanderprallenden Stahlflügeln lärmend. »Aber wo bin ich denn?«: Anderswo, in einer anderen Zeit; ein anderer, Angehöriger eines anderen Volks. Wie soll ich mich daran gewöhnen? Tastend natürlich – wie sonst?
Kafka lag ganz richtig: Wenn ich lernen will, mich zu orten und heute eine Bilanz zu ziehen, ist das Schabe-15Werden ein recht guter Ausgangspunkt. Die Insekten sind überall im Aussterben begriffen, aber Ameisen und Termiten gibt es immer noch. Warum nicht ihren Fluchtlinien folgen, um zu sehen, wohin das uns führt?
Die pilzzüchtenden Termiten befähigt ihre Symbiose mit Pilzen, die auf die Verdauung von Holz spezialisiert sind – den berühmten Termitomyces –, aus zerkauter Erde weitläufige Nester zu errichten, in denen sie für eine Art Klimatisierung sorgen. Ein tönernes Prag, in dem jeder Brocken Nahrung in wenigen Tagen den Verdauungskanal jeder Termite durchläuft. Die Termite hat Ausgangssperre, sie lebt sogar in einem exemplarischen Lockdown: Sie verlässt ihren Bau nie! Allerdings hat sie ihn, Krume um Krume bespeichelnd, selbst hergestellt. Daher kann die Termite auch überallhin – wenn sie nur ihren Bau ein wenig weiter ausdehnt. Sie umhüllt sich damit, rollt sich in den Termitenbau ein, der zugleich ihr Inneres und ihre Art ist, eine Außenwelt zu haben, gewissermaßen eine Erweiterung ihres Körpers; Wissenschaftler würden von einem zweiten »Exoskelett« sprechen, das das erste ergänzt (den Panzer, die Segmente und die gelenkigen Beinchen).
Das Adjektiv »kafkaesk« hat eine unterschiedliche Bedeutung, je nachdem, ob damit eine einsame, ohne Nahrung in einem kerkerhaften Universum aus trockenem, braunem Lehm isolierte Termite gemeint ist oder ein Gregor Samsa, der schließlich rundum zufrieden sein Erdhaus verdaut, das Hunderte von Millionen seiner Verwandten und Landsleute aus ver16zehrtem Holz errichtet haben, ein kontinuierlicher Strom, von dem er sich im Vorübergehen einige Moleküle angeeignet hat. Das wäre, nach vielen anderen, eine weitere Verwandlung der berühmten Erzählung Die Verwandlung. Aber dann würde ihn keiner mehr als »Ungeheuer« betrachten; keiner würde mehr versuchen, ihn, Papa Samsas Beispiel folgend, wie eine Kakerlake zu erschlagen. Vielleicht muss ich ihn mit anderen Gefühlen ausstatten, wie man es, freilich aus ganz anderen Gründen, mit Sisyphos getan hat, und verkünden: »Man muss sich Gregor Samsa als glückliches Insekt vorstellen …«
Dieses Insekt-Werden, Termite-Werden würde das Entsetzen dessen zu besänftigen erlauben, der, um sich zu beruhigen, nur den Mond betrachten kann, weil der das einzige ihm nahe Wesen ist, um das er sich keine Sorgen zu machen braucht. Wenn dir angesichts der Bäume, des Windes, des Regens, der Dürre, des Meeres, der Flüsse – und natürlich der Schmetterlinge und der Bienen – derart elend wird, weil du dich verantwortlich für sie fühlst, ja im Grunde schuldig, ihre Zerstörer nicht bekämpft zu haben; weil du in ihre Sphäre eingedrungen bist, ihre Bahn gekreuzt hast. Es ist wahr: Auch du, tu quoque, hast sie verdaut, verändert, verwandelt; hast aus ihnen deine Innenausstattung gemacht, deinen Termitenbau, deine Stadt, dein Prag aus Zement und Stein. Aber warum sollte dir dabei so unbehaglich zumute sein? Nichts ist dir mehr fremd; du stehst nicht mehr allein; du verdaust in aller Ruhe ein paar Moleküle von dem, was in deine Eingeweide 17gelangt, nachdem es den Stoffwechsel Hunderter von Milliarden Verwandter, Verbündeter, Landsleute und Mitbewerber passiert hat. Du bist nicht mehr in deiner alten Kammer, Gregor, du kannst überall hin. Warum gräbst du dich weiterhin vor Scham ein? Du bist entkommen; mach weiter so; belehre uns!
Mit deinen Fühlern, deinen Gliedmaßen, deinen Ausdünstungen, deinen Abfällen, deinen Mundwerkzeugen, deinen Prothesen wirst du vielleicht endlich ein Mensch! Und ausgerechnet deine Eltern, die beunruhigt, erschrocken an deine Tür klopfen, sogar deine herzensgute Schwester Grete – sind nicht gerade sie zu Unmenschen geworden, indem sie sich geweigert haben, ihrerseits zu Insekten zu werden? Sie haben sich elend zu fühlen, nicht du. Haben Klimawandel und Pandemie nicht sie, die sich nicht verwandelt haben, in »Ungeheuer« transformiert? Man hat Kafkas Novelle verkehrt herum gelesen. Stellte man Gregor auf seine sechs haarigen Beinchen, dann ginge er endlich aufrecht und könnte uns beibringen, wie wir uns dem Lockdown zu entwinden haben.
Seit wir sprechen, ist der Mond untergegangen; deine Sorgen scheren ihn nicht; er steht ihnen fern, aber anders als zuvor. Du bist nicht so recht überzeugt? Du fühlst dich immer noch elend? Dann habe ich mir nicht genug Mühe gegeben, dich zu beruhigen. Du fühlst dich sogar noch schlechter? Du hasst diese Verwandlung? Willst wieder ein Mensch alten Schlags werden? Du hast Recht. Selbst wenn wir Insekten geworden wären, wir wären immer noch schlechte Insekten, un18fähig, uns weit fortzubewegen, eingesperrt in unser Kämmerlein.
Dieses »Zurück zur Erde« macht mich ganz schwindelig. Es gehört sich nicht, uns zur Landung zu drängen, wenn man uns nicht sagt, wo wir aufsetzen können, ohne zu zerschellen, was aus uns werden wird, mit wem man sich verbunden fühlen soll und mit wem nicht. Ich hatte es zu eilig. Das ist der Nachteil, wenn man von einem Unfallort ausgeht: Ich kann mich nicht mehr per GPSlokalisieren; kann mir keinen Überblick mehr verschaffen. Aber das Glück im Unglück will, dass es genügt, dort anzufangen, wo man ist, ground zero, und versucht, der ersten Fährte im Gestrüpp zu folgen, um zu sehen, wohin sie einen führt. Wir brauchen uns nicht zu beeilen, wir haben noch etwas Zeit herauszufinden, wo wir uns einnisten können. Natürlich habe ich meine schöne Stentorstimme verloren, die von oben herab dem ganzen Menschengeschlecht die Leviten las; meine Sprache läuft Gefahr, zu einem grässlichen Piepsen zu werden wie die Gregors für die Ohren seiner Eltern, das ist das Dumme an diesem Tier-Werden. Aber worauf es ankommt, ist, die Stimmen derer vernehmbar zu machen, die sich in der mondlosen Nacht vorwärtstasten und miteinander zu verständigen versuchen. Andere Landsleute werden diesen Rufen vielleicht folgen.
192. Eingesperrt an einem immerhin recht geräumigen Ort
»Wo bin ich?«, stöhnt, wer als Insekt erwacht. Vermutlich in der Stadt, wie die Hälfte meiner Zeitgenossen. Folglich finde ich mich in einer Art ausgedehntem Termitenbau wieder: einem komplexen Gebilde aus Mauern, Wegen, Aufbereitungsanlagen, Nahrungsflüssen, Kabelnetzen, die sich unterirdisch in die Ferne verzweigen wie die Gänge der Termiten, die ihnen helfen, in das solideste Gebälk selbst weit entfernter Holzhäuser einzudringen. In gewisser Weise bin ich in der Stadt immer »bei mir zu Hause« – zumindest in einem winzigen Teil: Diese Wand habe ich gestrichen, diesen Tisch aus dem Ausland mitgebracht, aus Versehen habe ich die Wohnung meines Nachbarn unter Wasser gesetzt, die Miete habe ich bezahlt. Das sind so einige ganz kleine Spuren, auf immer dem Rahmen des Pariser Kalksteins, den Merkmalen, Falten und Reichtümern dieses Orts hinzugefügt. Betrachte ich den Rahmen, dann sehe ich für jeden Stein einen Städter, der ihn gefertigt hat; gehe ich von den Städtern aus, finde ich für jede ihrer Handlungen eine Spur, die sie im Stein hinterlassen haben – dieser große Fleck an der Wand, zwanzig Jahre später, ist von mir, dieses Graffiti 20ebenfalls. Was die anderen für einen anonymen und kalten Ausschnitt halten, ist – jedenfalls für mich – geradezu ein Gesamtwerk.
Mit der Stadt ist es wie mit dem Termitenbau: Wohnstätte und Bewohner bilden eine Kontinuität – mit jener sind auch diese definiert. Die Stadt ist das Exoskelett seiner Bewohner, so wie diese eine Wohnstätte hinter sich lassen, wenn sie fortziehen oder verdorren – zum Beispiel wenn man sie auf dem Friedhof begräbt. Ein Städter ist in seiner Stadt wie ein Einsiedlerkrebs in seinem Gehäuse. »Wo bin ich also?« In meinem und durch mein und teils dank meinem Gehäuse. Der Beweis: Ich kann nicht einmal meine Lebensmittel zu mir hinaufbringen ohne den Fahrstuhl, der mich dazu befähigt. Sollte der Städter also ein »Aufzugsinsekt« sein, ähnlich wie »Webspinnen« durch ihr Netz definiert sind? Allerdings müssen die Eigentümer auch die Maschinerie gewartet haben. Hinter dem Mieter eine Prothese; hinter der Prothese wiederum Eigentümer und Wartungspersonal. Und so weiter und so fort. Der unbelebte Rahmen und die ihn Belebenden sind eins. Ein völlig nackter Städter existiert so wenig wie eine Termite ohne Termitenbau, eine Spinne ohne Netz oder ein Indianer, dem der Wald zerstört wurde. Ein Termitenbau ohne Termite ist ein Haufen Schmutz, wie die schicken Viertel während des Lockdowns, als wir an allen diesen prachtvollen, aber unbewohnten und unbelebten Gebäuden vorüberschlenderten.
Wenn die Stadt der Lebensweise des Städters nicht gerade äußerlich ist, kann ich dann weiter weg auf etwas 21stoßen, das wirklich außerhalb ist? Letzten Sommer hat ein befreundeter Geologe uns am Fuße des Grand Veymont, im Vercors, demonstriert, dass die Spitze dieser prächtigen Felswand ein einziger Friedhof von Korallen ist, ein weiterer riesiger Verdichtungsraum, der seit Langem von seinen Bewohnern verlassen worden war, deren Reste, aufgetürmt, zusammengepresst, vergraben, dann wieder nach oben gelangt, erodiert, hängend, diesen schönen urgonischen Kalk geschaffen haben, dessen mit feinen Kristallen durchwirkter weißer Stein unter der Lupe glänzte. Diese Kalksteine nannte er »bioklastisch«, was heißt: »aus Überresten von Lebewesen gemacht«. Sollte es also gar keinen Bruch geben, wenn ich, aus dem nur allzu bioklastischen städtischen Termitenbau kommend, in jenes Tal im Vercors gelange, das einst ein Gletscher quer durch einen Friedhof unzähliger Lebewesen geschnitten hat? Auf einmal fühle ich mich schon weniger entfremdet; ich kann immer weiter krabbeln. Meine Tür ist nicht mehr verschlossen.
Zumal die riesigen Ameisenhaufen, die alle hundert Meter den Aufstieg zum Grand Veymont markieren, mich daran erinnern, dass auch hier ein geschäftiges städtisches Leben herrscht. Gregor dürfte sich weniger einsam fühlen, seit sein segmentierter Körper sich im Einklang mit seinem steinernen Prag befindet, in dem jedes Kristallkörnchen das Echo eines Ozeans sich aneinander reibender Schalentiere in sich aufbewahrt. Zurück lässt er seine Familie, eingekerkert in ihrem Zuhause, ihren armseligen, wie altertümliche Scherenschnitte umrissenen Menschenkörpern.
22Als er in seinem Zimmer war, litt Gregor darunter, ein Fremder unter den Seinen zu sein; eine Wand und Schlösser reichten aus, ihn einzusperren. Als Insekt ist er nun in der Lage, durch die Wand zu gehen.[2] Sein Zimmer, sein Haus sind für ihn jetzt Kugeln aus Lehm, Stein und Schutt, die er zum Teil verzehrt, dann ausgeschieden hat und die ihn in seinen Bewegungen nicht mehr einengen. Nach Lust und Laune kann er jetzt ausgehen, ohne dass man sich über ihn belustigt. Die Stadt Prag, ihre Brücken, Kirchen, Paläste: nichts mehr als etwas größere Erdklumpen älteren Datums, auch stärker sedimentiert, alles künstliche, hergestellte Dinge, hervorgegangen aus den Kauwerkzeugen seiner zahlreichen Landsleute. Was mir vielleicht das Insekt-Werden erträglich machen wird, ist die Tatsache, dass ich, wenn ich mich von der Stadt aufs Land begebe, auf weitere Termitenhügel stoße, auf Berge aus Kalkstein, die genauso künstlich sind, zudem größer, älter, noch stärker sedimentiert im Zuge raffinierten und erfindungsreichen Wirkens zahlloser mikroskopisch kleiner Wesen. Der Eingesperrte entsperrt sich auf wundersame Weise. Er findet zurück zu großer Bewegungsfreiheit.
Folgen wir diesem engen Gang, verlängern wir diese winzige Intuition, gehorchen wir beharrlich dieser son23derbaren Anweisung: Wenn ich vom Termitenbau in die Stadt, von der Stadt in die Berge gehen kann, ist es dann auch möglich, in den Raum zu gelangen, in dem der Berg, so mein früherer Eindruck, lediglich »lag«?
Wenn die Arbeit des Ameisenhaufens für eine Ameise wie eine sie umgebende Blase ist, die ihre Temperatur aufrechterhält und ihre Luft reinigt, so verhält es sich für die beim schweren Aufstieg zum Grand Veymont ächzende Véronica nicht anders. Der Sauerstoff, den sie einatmet, kommt nicht von ihr selbst, als müsste sie die schweren Sauerstoffflaschen wie die Bezwinger des Annapurna auf ihrem Rücken mit sich schleppen. Andere als sie, zahlreich und verborgen, bieten ihr – für den Augenblick – kostenlos an, ihre Lungen damit zu füllen. Die sie – immer noch für den Augenblick – vor der Sonne schützende Ozonschicht bildet über ihr eine Kuppel, die aus der Arbeit gleichermaßen unsichtbarer, gleichermaßen unzähliger und älterer Akteure hervorgeht – zweieinhalb Milliarden Jahre lang waren Bakterien am Werk. Deswegen macht das CO2, das sie ausatmet, sie nicht zu einer Fremden, einem »ungeheueren Ungeziefer«, sondern zu einer Atmenden inmitten von Milliarden Atmender, von denen einige die Gelegenheit nutzen, das Holz des Buchenwalds zu erzeugen, in dessen Schatten sie verschnauft. So wird diese Wanderin zu einer Fußgängerin in einer riesigen Metropole, durch die sie an einem schönen Nachmittag streift. Wenn auch draußen, in der Einöde, ist sie doch inmitten eines Verdichtungsraums, den sie niemals verlassen könnte, ohne auf der Stelle zu ersticken.
24Was für ein Schock für Gregor, als er bemerkt, dass die Kunstfertigkeit, das Engineering, die Freiheit, nein, die Pflicht zu erfinden, auch in dem anzutreffen ist, was er als Luft, als Atmosphäre, als den blauen Himmel wahrgenommen hat, als er noch, wie seine erbärmlichen Eltern, nur ein auf einen Scherenschnitt reduziertes Menschenwesen war. Damit es eine Kuppel über seinem Haupt gibt, damit er nicht erstickt, wenn er ausgeht – aber er »geht« ja gerade nicht mehr »aus« –, bedarf es immer noch zahlloser Arbeiter, immer noch mikroskopischer Wesen, immer noch subtiler Gefüge, immer noch vielfältiger Anstrengungen, um das Himmelszelt an seinem Platz zu halten; es ist immer noch eine lange, immens lange Geschichte von Kunstfertigkeiten erforderlich, damit es einfach einen Rand gibt, ein breites, halbwegs stabiles Blätterdach, und er dort einige Zeit überlebt. Wenn ich von Gregor, dem Ungeziefer, rasch lernen will, wie ich mich verhalten soll, dann muss ich von der Annahme ausgehen, dass ich die Arbeit der lebenden Organismen und deren Fähigkeit, die Existenzbedingungen um sich herum zu verändern, Nischen, Sphären, Umgebungen, Klimablasen zu schaffen, besser anhand von technischen Einrichtungen, Fabriken, Lagern, Häfen, Laboren erfasse. Mit ihnen begreift man am besten die Natur der »Natur«; sie ist nicht in erster Linie »grün«, nicht »organisch«; sie setzt sich vor allem aus den Produkten von Kunstfertigkeiten und aus denen zusammen, die über solche Fertigkeiten verfügen – vorausgesetzt, man lässt ihnen genügend Zeit.
25Seltsamerweise kommen die Geologie- oder Biologiehandbücher nicht aus dem Staunen darüber heraus, dass die lebenden Organismen »das Glück hatten«, auf der Erde die idealen Bedingungen vorzufinden, um sich seit Milliarden von Jahren zu entwickeln: die richtige Temperatur, die richtige Entfernung zur Sonne, das richtige Wasser, die richtige Luft. Von ernsthaften Wissenschaftlern sollte man allerdings erwarten können, dass sie sich eine derart providentielle Version der Übereinstimmung zwischen den Organismen und ihrer »Umwelt«, wie sie es nennen, mit weniger Überschwang zu eigen machen. Das geringste Tier-Werden führt zu einer anderen, weitaus bodenständigeren Sicht: Es gibt gar keine »Umwelt«. Es ist, als würde man einer Ameise zu ihrem Glück gratulieren, sich in einem Ameisenhaufen zu befinden, der durch eine glückliche Fügung so warm, so angenehm belüftet ist und so häufig von Abfällen gereinigt wird! Wüsste man die Ameise zu befragen, würde sie wohl antworten, dass sie und Milliarden ihrer Artgenossen es waren, die diese »Umwelt« hervorgebracht haben, so wie die Stadt Prag von ihren Bewohnern herrührt. Jene Vorstellung von Umwelt ergibt kaum Sinn, da sich nie die Grenze ziehen lässt, die einen Organismus von dem trennt, was ihn umgibt. Eigentlich umgibt uns nichts, alles wirkt darauf hin, dass wir atmen. Die Geschichte der Lebewesen erinnert uns daran, dass sie es waren, die diese ihrer Entwicklung so »zuträgliche« Erde ihren Absichten gemäß gestaltet haben – Absichten, die so gut kaschiert sind, dass sie selbst sie gar 26nicht kennen! Blindlings haben sie den Raum um sich herum gekrümmt, haben sich gleichsam in ihn gebogen, eingegraben, eingerollt, eingehüllt.
Nun bin ich doch etwas besser orientiert, denn ich beginne, mich dem zu nähern, was wirklich »außerhalb« ist. Wenn in den Erzählungen meiner Kindheit Schiffbrüchige an einem Ufer strandeten (so wie Cyrus Smith in Jules Vernes Die geheimnisvolle Insel