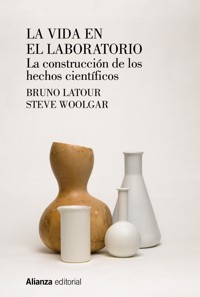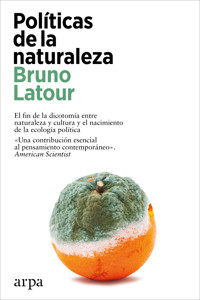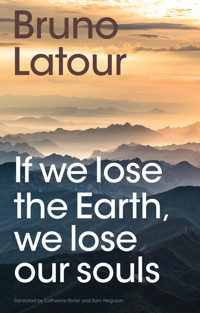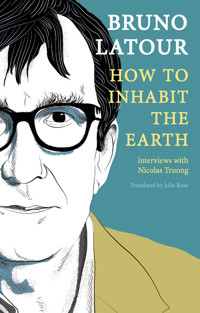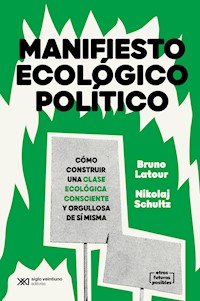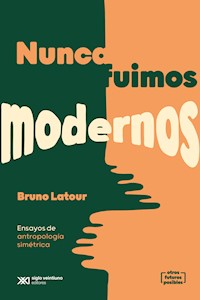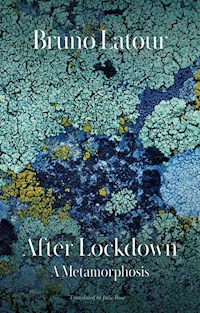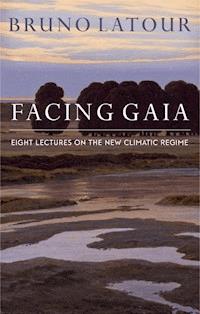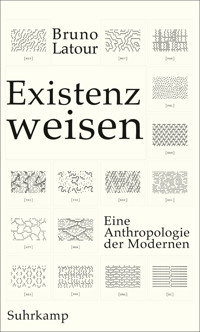
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Vor zwanzig Jahren hatte der französische Soziologe und Philosoph Bruno Latour konstatiert: »Wir sind nie modern gewesen«, und sich an einer »symmetrischen Anthropologie« jenseits der Trennung von Natur und Kultur versucht. Nun legt er sein zweites Hauptwerk vor, das dieses faszinierende Projekt mit einer »Anthropologie der Modernen« fortschreibt und den verschiedenen Existenzweisen von Wissenschaft, Technologie, Recht, Religion, Wirtschaft und Politik in der modernen Welt nachspürt. Ein großes Panorama der Modi moderner Existenz. Latour setzt für dieses Projekt bei der globalen Verflechtung aller Lebensbereiche an, die heute nicht zuletzt am Problem des Klimawandels sichtbar wird. Zugleich zeigt sich aber an diesem Problem auch, dass es verschiedene Handlungssphären gibt, die jeweils eigene Existenzweisen besitzen: Politiker, die sich mit dem Klimaproblem befassen, sind eben keine Wissenschaftler, die Klimaforschung betreiben, und Unternehmer orientieren sich zunächst an den Maßgaben der Wirtschaftlichkeit; wissenschaftliche Ergebnisse werden daher nicht einfach in politische und ökonomische Handlungen übersetzt. Dennoch sind für Latour diese verschiedenen Existenzmodi nicht unabhängig voneinander, sondern durchdringen einander und kreieren gemeinsam Probleme, die es in der Folge auch gemeinsam zu lösen gilt. Es bedarf daher einer neuen Form der »Diplomatie«, die zwischen den einzelnen Existenzweisen vermittelt. Nicht weniger als die Zukunft unseres Planeten steht auf dem Spiel und nicht weniger als eine solche diplomatische Vermittlung versucht dieses grundlegende und wegweisende Buch zu leisten. Auf dass wir endlich modern werden!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 951
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Vor zwanzig Jahren konstatierte der französische Soziologe und Philosoph Bruno Latour: »Wir sind nie modern gewesen« und versuchte sich an einer »symmetrischen Anthropologie« jenseits der Trennung von Natur und Kultur. Nun legt er ein Werk vor, das dieses faszinierende Projekt mit einer »Anthropologie der Modernen« fortschreibt und den verschiedenen Existenzweisen von Wissenschaft, Technologie, Recht, Religion, Wirtschaft, Kunst und Politik in der modernen Welt nachspürt.
Er setzt für dieses Projekt bei der globalen Verflechtung aller Lebensbereiche an, die heute nicht zuletzt am Klimawandel sichtbar wird. Zugleich zeigt dieses Problem auch, daß es verschiedene Handlungssphären gibt, die jeweils eigene Existenzweisen besitzen: Politiker, die sich mit dem Klimaproblem befassen, sind keine Wissenschaftler, die Klimaforschung betreiben, und Unternehmer orientieren sich zunächst an den Maßgaben der Wirtschaftlichkeit; wissenschaftliche Ergebnisse werden daher nicht einfach in politische und ökonomische Handlungen übersetzt. Die verschiedenen Existenzmodi verfolgen unterschiedliche Werte. Für Latour durchdringen sich die Existenzmodi und kreieren gemeinsam Probleme, die es gemeinsam zu lösen gilt. Es bedarf daher einer neuen Form der »Diplomatie«, die zwischen den einzelnen Existenzweisen vermittelt. Nicht weniger als die Zukunft unseres Planeten steht auf dem Spiel, und nicht weniger als eine solche diplomatische Vermittlung versucht dieses grundlegende und wegweisende Buch zu leisten.
Bruno Latour ist Professor am Sciences Politiques Paris und Begründer der Akteur-Netzwerk-Theorie. Er hat zahlreiche Preise und Ehrungen erhalten, zuletzt 2013 den Holberg-Preis.
Zuletzt sind erschienen:
Die Hoffnung der Pandora, stw 1595
Das Parlament der Dinge, 2001
Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft, 2007 und stw 1967
Die Ökonomie als Wissenschaft der leidenschaftlichen Interessen (mit Vincent Lépinay), 2010
Jubilieren, 2011
Bruno Latour
Existenzweisen
Eine Anthropologie der Modernen
Aus dem Französischenvon Gustav Roßler
Titel der Originalausgabe: Bruno Latour, Enquête sur les modes d'existence. Une anthropologie des modernes © Éditions La Découverte, Paris, 2012
Die Veröffentlichung erfolgt mit freundlicher Unterstützung des Französischen Ministeriums für Kultur – Centre National du Livre und der Maison des sciences de l'homme.
Ouvrage publié avec le concours du Ministère francais chargé de la culture – Centre National du Livre et la Maison des sciences de l'homme.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2014
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe 2014
© Suhrkamp Verlag Berlin 2014
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Satz: Satz-Offizin Hümmer GmbH, Waldbüttelbrunn
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner nach einem Entwurf von Donato Ricci
Umschlagfoto: Donato Ricci@AIMEproject
Inhalt
Gebrauchsanweisung für die in Gang befindliche kollektive Untersuchung
Danksagung
Überblick
Einleitung:VON NEUEM VERTRAUEN IN DIE INSTITUTIONEN HABEN?
Eine schockierende Frage, gerichtet an einen Klimatologen (32), die dazu zwingt, die Werte von ihrer Wiedergabe in den Berichten der Praktiker zu unterscheiden (38). Zwischen Modernisieren und Ökologisieren müssen wir uns entscheiden (40), indem wir ein anderes Koordinatensystem vorschlagen (43). Was dazu führt, eine imaginäre diplomatische Szene zu definieren (46): in wessen Namen verhandeln (47) und mit wem verhandeln (49)? Die Untersuchung gleicht zunächst einer über Sprechakte (52), während sie lernt, verschiedene Existenzmodi ausfindig zu machen (55). Das Ziel besteht zunächst darin, ein zwischen Ökonomie und Ökologie umherirrendes Volk zu begleiten (58).
Teil I:Wie sich eine Untersuchung über die Existenzmodi der Modernen ermöglichen läßt
Kapitel 1:ZUNÄCHST DEN UNTERSUCHUNGSGEGENSTAND DEFINIEREN
Eine Forscherin bricht auf zur Feldforschung bei den Modernen (66), ohne die Grenzen von Bereichen zu respektieren, dank des Begriffs Akteurnetzwerk (68), denn dadurch läßt sich das Netzwerk als Resultat vom Netzwerk als Prozeß unterscheiden (69). Die Untersuchung definiert einen ersten Existenzmodus, das Netzwerk [NET], durch einen besonderen Paß (73). Aber das Netzwerk [NET] hat eine Grenze: Es bestimmt die Werte nicht genauer (75). Durch seinen besonderen Fortbewegungsmodus bietet das Recht eine Vergleichsmöglichkeit (78). Es existiert eine Definition der Grenze, die weder vom Begriff des Bereichs noch dem des Netzwerks abhängt (79). Ein Vergleich wird möglich mit dem Modus der Erweiterung der objektiven Erkenntnis (80). Damit läßt sich eine Situation definieren durch eine Erfassung vom Typ [NET] plus ein besonderes Verhältnis zwischen Kontinuitäten und Diskontinuitäten (82). Dank eines dritten Typs von Paß, des religiösen, versteht die Forscherin, wieso die Werte so schwer aufzuspüren sind (84), und zwar aufgrund der sehr besonderen Verbindungen mit der Institution (86), was dazu nötigen wird, eine Geschichte der Werte und ihrer Interferenzen zu berücksichtigen (88).
Kapitel 2:DIE DOKUMENTE DER UNTERSUCHUNG ZUSAMMENTRAGEN
Die Untersuchung beginnt mit dem Aufspüren von Kategorienfehlern (92), nicht zu verwechseln mit den Fehlern ersten Grades (93); einzig die Fehler zweiten Grades sind für uns von Bedeutung (95). Ein Modus besitzt einen Typ des Wahrsprechens, der ihm eigen ist (98), wie man am Beispiel des Rechts sieht (100). Von wahr und falsch kann also innerhalb wie außerhalb eines Modus die Rede sein (101), sofern man zunächst die Bedingungen des Gelingens und Mißlingens für jeden Modus definiert (103) sowie seinen Interpretationsschlüssel beziehungsweise seine Präposition (104). Auf diese Weise wird man von jedem Modus in seiner eigenen Tonalität sprechen können (106), was auch aus der Etymologie von »Kategorie« hervorgeht (106) und wovon der Kontrast zwischen dem Anspruch des Rechts und dem der Religion zeugt (107). Die Untersuchung verbindet das Erfassen vom Typ Netzwerke [NET] mit dem Erfassen vom Typ Präpositionen [PRÄ] (110), indem sie Kreuzungen definiert, die eine Kreuztabelle bilden (111). Eine ziemlich besondere Kreuzung: [NET·PRÄ] (112) wirft ein Problem der Kompatibilität mit der Akteur-Netzwerk-Theorie auf (113). Rekapitulation der Untersuchungsbedingungen (114). Rational ist, was dem Faden der verschiedenen Gründe folgt (115).
Kapitel 3:EINE GEFÄHRLICHE VERÄNDERUNG DER KORRESPONDENZ
Beginnen wir mit dem Schwierigsten, der Frage der Wissenschaft (120), indem wir die Prinzipien der Methode anwenden, Pässe ausfindig zu machen (123), die es erlauben, zwei unterschiedliche Existenzmodi auseinanderzuhalten (124). Die Beschreibung eines gewöhnlichen Wanderwegs: das Beispiel eines Ausflugs auf den Mont Aiguille (125) wird dazu dienen, die Referenzketten und die unveränderlichen Mobile zu definieren (129), indem sich zeigen läßt, daß die Referenz weder am Erkenntnissubjekt noch am Erkenntnisobjekt festgemacht ist (130). Die Vorstellung einer Korrespondenz zwischen Subjekt und Objekt vermengt zwei verschiedene Pässe (135), weil es klar ist, daß Existierendes nicht die unveränderlichen Mobile durchlaufen muß, um im Sein fortzubestehen (136). Auch wenn es für die Ausweitung der Referenzketten [REF] keine Grenze gibt (138), gibt es sehr wohl zwei Existenzmodi, die sich tatsächlich wechselseitig antworten, ko-respondieren (141). Man muß also neue Gelingensbedingungen registrieren (141), die eine andere Verteilung zwischen Sprache und Existenz autorisieren werden (144), was besonders klar ist beim prinzipiellen Beispiel, dem Labor (145). Daher das Hervortreten eines neuen Existenzmodus: [REP] für Reproduktion (148) und eine Kreuzung [REP·REF], die schwer im Blick zu behalten ist (150), vor allem, wenn man dem Eindringen von Doppelklick widerstehen muß (151).
Kapitel 4:LERNEN, RAUM ZU LASSEN
Um den verschiedenen Modi ausreichend Raum zu lassen (156), muß man zunächst versuchen, die Existierenden entsprechend dem Modus der Reproduktion [REP] zu erfassen (157), indem man aus diesem Modus eine Trajektorie neben den anderen macht (159), um die merkwürdige Vorstellung eines alles übergreifenden materiellen Raums zu vermeiden (162). Wenn denjenigen, die allen Raum eingenommen haben, trotzdem Platz fehlt (163), so liegt das daran, daß sie den Begriff der Materie nicht entwirren konnten (166), indem sie guten Gebrauch von der Kreuzung der beiden Existenzmodi [REP·REF] machen (166). Sobald man aber beginnt, die beiden Bedeutungen des Wortes »Form« zu unterscheiden (167), die Form, die die Konstanten aufrechterhält, und die Form, die den Hiatus der Referenz verringert (168), gewinnt man langsam eine nicht formalistische Beschreibung des Formalismus (169), die leider durch eine dritte Bedeutung des Wortes Form wieder verwischt wird (171). Damit riskiert man, sich über den Parcours der Wesen der Reproduktion zu täuschen (172), weil man Gefahr läuft, in der Idee der Materie zwei unterschiedliche Parcours zu verwechseln (174). Eine formalistische Beschreibung der Wanderung auf den Mont Aiguille (175) demonstriert durch reductio ad absurdum eine Verdoppelung der Dinge (177), welche zur Aufteilung zwischen primären und sekundären Qualitäten führen wird (178). Aber sobald der Ursprung dieser Bifurkation in primäre und sekundäre Qualitäten ausfindig gemacht ist (179), wird sie eine Hypothese, die zu sehr mit der Erfahrung im Widerspruch steht (180), und die Magie des Rationalismus verflüchtigt sich (182), weil man die Existierenden nicht mehr mit der Materie verwechseln kann (183), einer Materie, die der Welt genausowenig gerecht wird wie dem »Erleben« (185).
Kapitel 5:VOM AUFLÖSEN EINIGER SPRACHVERLEGENHEITEN
Wenn wir mit dem Schwierigsten anfangen mußten (190), so aufgrund eines Willens, direkt zu sprechen, was den Formalismus mit dem Schließen von Diskussionen verbindet (191). Auch wenn das direkte Sprechen sich nicht auf die Ansprüche der Referenz [REF] stützen kann (192), führt es zur Disqualifizierung aller anderen Modi (194), weil es ein gefährliches Amalgam zwischen der Erkenntnis und der Politik schafft [REF·POL] (196), das dazu zwingt, den Faden der Erfahrung aufzugeben, um Diskussionen zu beenden (196). Glücklicherweise haben wir eine Methode, die erlaubt, eine Kreuzung zu erkennen (199), die in der Politik ein eigenes Wahrsprechen [POL] herauszuarbeiten vermag (200), dem an der kontinuierlichen Wiederaufnahme eines Kreises liegt (202), den der Parcours der Referenz nicht korrekt beurteilen kann (203). Man muß demnach einen Pluralismus der Typen des Wahrsprechens anerkennen (205), um das merkwürdige Amalgam der »unbestreitbaren Tatsachen« zu durchkreuzen (207) und so der natürlichen Sprache ihre Ausdrucksfähigkeiten zurückzugeben (209). Bleibt das Schwierigste: auf die Trennung der Worte und der Dinge zurückzukommen (210), indem man sich von der Materie befreit, das heißt der res ratiocinans (212), und sich so neue Analyse- und Unterscheidungsvermögen gibt (214), um von den Werten zu sprechen, ohne die Realität in Klammern zu setzen (215). Die Sprache ist gut artikuliert, wie die Welt, deren sie sich annimmt (216), sofern man sich in acht nimmt vor dem Begriff des Zeichens (218). Es handelt sich wohl um Existenzmodi, und es gibt mehr als zwei davon (219), was dazu nötigt, die Geschichte der Interferenzen zwischen Modi zu berücksichtigen (221).
Kapitel 6:EINEN KLEINEN FABRIKATIONSFEHLER BEHEBEN
Die Schwierigkeit einer Untersuchung bei den Modernen (226) liegt an der Unmöglichkeit, die Fabrikation der Fakten positiv zu verstehen (227), was kurioserweise ein heimliches Einverständnis zwischen dem kritischen Geist und der Suche nach den Grundlagen zur Folge hat (230). Es ist demnach auf den Begriff der Konstruktion zurückzukommen, indem man drei Merkmale unterscheidet: (233) 1: Die Handlung verdoppelt sich (233); 2: Die Richtung der Handlung ist ungewiß (234); 3: Die Handlung läßt sich als gut oder schlecht qualifizieren (235). Dem Konstruktivismus gelingt es nicht, die Merkmale einer guten Konstruktion festzuhalten (235). Es ist also überzugehen zum Begriff der Instauration (236), um aber instaurieren zu können, bedarf es der Wesen, die für etwas einstehen (238), was eine terminologische Unterscheidung impliziert zwischen dem Sein-als-Sein und dem Sein-als-anderes (239) und daher mehrere Formen von Andersheiten oder Alterierungen (240). Man findet sich mit einem Problem der Methode konfrontiert (241), was dazu zwingt, nach einem anderen Ursprung für das Scheitern des Konstruktivismus zu suchen (242): dem Ikonoklasmus und dem Kampf gegen die Fetische (243). Alles sieht so aus, als hätte die Gewinnung des religiösen Werts die Idole mißverstanden (244) aufgrund der widersprüchlichen Anweisung eines nicht von Menschenhand gemachten Gottes (245), was zu einem neuen Kult führt, dem Antifetischismus (247), wie auch zu dem Glauben an den Glauben der anderen (249), der aus dem Wort rational einen Kampfbegriff gemacht hat (250). Man muß jetzt versuchen, den Glauben an den Glauben zu beenden (251), indem man die doppelte Wurzel der doppelten Sprache der Modernen ausfindig macht (253), die von der unwahrscheinlichen Verbindung zwischen Wissen und Glauben herrührt (255). Ein Willkommen den Wesen der Instauration (257). Nichts als die Erfahrung, aber auch nicht weniger als die Erfahrung (260).
Teil II:Wie sich der Pluralismus der Existenzmodi nutzen läßt
Kapitel 7:DIE WESEN DER METAMORPHOSE WIEDERHERSTELLEN
Wir werden vom ontologischen Pluralismus profitieren (266), wenn wir an gewisse unsichtbare Wesen heranzukommen versuchen (267). Es gibt genausowenig eine unsichtbare Welt wie eine »sichtbare Welt« (269), wenn man sich bemüht, die Netzwerke [NET] zu erfassen, die Produzenten von Innerlichkeit sind (269). Weil die Autonomie der Subjekte von »außen« zu ihnen kommt (272), ist es besser, ohne Innenwelt und ohne Außenwelt auszukommen (274). Rückkehr zur Erfahrung der Emotion (275), was erlaubt, die Ungewißheit über das Ziel aufzuspüren (277) und die Macht der Seelenwandler und anderer »Psychotropen« (279). Diese Wesen sind gut eingeführt in den therapeutischen Dispositiven (281) und insbesondere im Laboratorium der Ethnopsychiatrie (282). Die Wesen der Metamorphose [MET] (284) haben eine anspruchsvolle Form des Wahrsprechens (285) und besondere ontologische Anforderungen (287), die rational verfolgt werden können (287), sofern man nicht das Urteil von Doppelklick [DK] auf sie anwendet (289). Ihre Originalität liegt in einem bestimmten Muster von Alterierung (290), was erklärt, wieso die Unsichtbarkeit zu ihrem Anforderungsprofil gehört (292). Die Kreuzung [REP·MET] hat eine entscheidende Bedeutung (293), aber sie wurde vor allem von den anderen Kollektiven ausgearbeitet (294) und bietet so eine neue Verhandlungsgrundlage für die vergleichende Anthropologie (294).
Kapitel 8:DIE WESEN DER TECHNIK SICHTBAR MACHEN
Das merkwürdige Schweigen, mit dem man die Techniken übergeht (298) mitsamt ihrer besonderen Form von Transzendenz (300), verlangt außer einer Analyse in Netzwerk-Termini [TEC·NET] (303) das Aufspüren eines originellen Existenzmodus (306), der sich von der Reproduktion unterscheidet [REP·TEC] (307). Man muß auf die Erfahrung des technischen Umwegs zurückkommen (308), was Doppelklick und das Verhältnis Form/Funktion unkenntlich machen (310). Wenn man die Lehren aus der Kreuzung [REP·REF] hinsichtlich der Materie bedenkt (313), wird man die Technik nicht mehr mit den Objekten verwechseln, die in ihrer Spur zurückbleiben (316). Die Technik weist eine besondere Form von Unsichtbarkeit auf (316): das Labyrinth der Technik (318). Ihr Existenzmodus hängt von der List ab [MET·TEC] (319) aber ebenso von der Fortdauer der Wesen der Reproduktion [REP·TEC] (320). Das eigene Wahrsprechen von [TEC] (322) liegt an einer originellen Faltung (323) dank des Schlüsselbegriffs des Auskuppelns (325). Die Entfaltung dieses Modus gibt neuen Bewegungsspielraum (328).
Kapitel 9:DIE WESEN DER FIKTION SITUIEREN
Die Existenzmodi vervielfachen setzt voraus, die Bedeutung der Sprache zu entschärfen (332), die nur die Kehrseite der Bifurkation zwischen Worten und Welt ist (334). Um Sinn und Zeichen nicht zu vermengen (335), muß man auf die Erfahrung der Wesen der Fiktion [FIK] zurückkommen (337). Wesen, die durch die Institution des Kunstwerks überbewertet sind (338) und dennoch ihres ontologischen Gewichts beraubt (339). Die Erfahrung der Wesen der Fiktion [FIK] lädt dazu ein, ihnen eine eigene Konsistenz zuzuerkennen (340), eine originelle Trajektorie (342) wie auch ein besonderes Lastenheft (343). Diese Wesen stammen aus einer neuen Alterierung: dem Vibrieren Material/Figur (344), das ihnen einen besonders anspruchsvollen Modus des Wahrsprechens verleiht (346). Wir sind die Nachkommen unserer Werke (348). Das Absenden des Werks setzt ein Auskuppeln voraus (349), das sich von dem der Wesen der Technik unterscheidet [TEC·FIK] (350). Die Wesen der Fiktion [FIK] herrschen weit über das Kunstwerk hinaus (352), sie bevölkern insbesondere die Kreuzung [FIK·REF] (353), wo sie eine kleine Differenz erfahren, nämlich in der Disziplin der Figuren (355), welche das Mißverständnis der Korrespondenz hervorrufen wird (357). Wir können nun auf die Differenz zwischen Sinn und Zeichen zurückkommen (359) und einen Zugang zur artikulierten Welt wiederfinden (362).
Kapitel 10:DIE ERSCHEINUNGEN RESPEKTIEREN LERNEN
Um sensibel zu bleiben sowohl für den historischen Moment als auch für die Dosierung der Modi (366), muß die Anthropologin den Versuchungen des Okzidentalismus widerstehen (368). Gibt es einen eigenen Existenzmodus der Wesenheit (369)? Der verbreitetste von allen, derjenige, der von den Präpositionen ausgeht, indem er sie übergeht (371): auch die Gewohnheit [GEW] ist ein Existenzmodus (372) mit einem paradoxen Hiatus, der Immanenz produziert (374). Indem wir der Erfahrung einer achtsamen Gewohnheit folgen (375), sehen wir, wie dieser Existenzmodus dahin gelangt, Kontinuitäten zu bahnen (376) dank besonderer Gelingensbedingungen (377). Die Gewohnheit besitzt eine eigene ontologische Dignität (380), die daher stammt, daß sie verhüllt, aber nichts verbirgt (382). Nun wird der Abstand zwischen Theorie und Praxis besser verständlich (383), was erlaubt, eine nachsichtigere Definition von Doppelklick zu geben [GEW·DK] (385). Jedem Modus seine Weise, mit der Gewohnheit zu spielen (387). Dieser Existenzmodus kann helfen, die Institutionen positiv zu definieren (389) unter der Bedingung, die Generation derer, die sprechen, zu berücksichtigen (390) und die Versuchung des Fundamentalismus zu umgehen (392).
Abschluß des II. Teils:DIE EXISTENZMODI ORDNEN
Wo wir auf ein unvorhergesehenes Problem des Ordnens stoßen (396). Eine erste Gruppe ignoriert Objekt wie Subjekt (397). Kraftlinien und Abstammungslinien [REP] insistieren auf der Kontinuität (397) wie die Wesen der Metamorphose [MET] auf der Differenz (399) und die der Gewohnheit [GEW] auf der Sendung (400). Eine zweite Gruppe dreht sich um Quasi-Objekte (401); [TEC], [FIK] und [REF], am Ursprung der Äußerungsebenen n+1 (402), produzieren durch Rückwirkung eine Ebene n–1 (403). Diese Einteilung bietet eine befriedete Version des alten Verhältnisses Objekt/Subjekt (404) und daher eine andere mögliche Position für die Anthropogenese (405).
Teil III:Wie sich die Kollektive neu definieren lassen
Kapitel 11:DIE FÜR DAS WORT EMPFÄNGLICHEN WESEN EMPFANGEN
Wenn es unmöglich ist, nicht vom Religiösen zu sprechen (411), darf man sich nicht auf die Grenzen eines Bereichs des Religiösen verlassen (413), sondern sollte eher auf die Erfahrung der Krise in Liebesbeziehungen zurückkommen (416), die erlaubt, Engel zu entdecken, die Träger von Erschütterungen der Seele sind (419), sofern wir unterscheiden zwischen Behandeln und Retten, indem wir die Kreuzung [MET·REL] erkunden (420). Wir entdecken dann einen eigenen Hiatus (421), der erlaubt, Das Wort wiederaufzunehmen (422), ohne deshalb aber die Wege des Rationalen zu verlassen (424). [REL] definiert Wesen mit einem besonderen Anforderungsprofil (425), weil diese Wesen erscheinen und verschwinden (426) und Gelingensbedingungen besitzen, die besonders trennscharf sind (428), denn sie definieren eine Subsistenz, die sich auf keinerlei Substanz stützt (429), sondern sich durch eine eigene Form der Alterierung definiert: »Die Zeit ist erfüllt« (430) sowie durch einen eigenen Modus des Wahrsprechens (432). Eine mächtige Institution, die aber nur schwer zu schützen ist (433) sowohl gegen die Mißverständnisse der Kreuzung [REL·PRÄ] (435) als auch die der Kreuzung [MET·REL] (437) und die der Kreuzung [REF·REL], die ungerechtfertigte Rationalisierungen produziert (438). Die Rationalisierung produziert den Glauben an den Glauben (440) und führt zum Verlust sowohl der Erkenntnis wie des Glaubens (442) sowie zum damit zusammenhängenden Verlust der Ferne wie der Nähe (443) und zur überflüssigen Erfindung des Übernatürlichen (445). Daher ist es wichtig, stets die Begriffe der Metasprache zu präzisieren (447).
Kapitel 12:DIE PHANTOME DES POLITISCHEN ANRUFEN
Kann ein Kontrast verlorengehen? Der Fall des Politischen (450). Eine legitimerweise auf ihre Werte stolze Institution (451), aber ohne Einfluß auf die praktische Beschreibung (453); bevor man sie universalisieren kann, ist etwas Selbstprüfung erforderlich (454). Um zu vermeiden, die Vernunft in der Politik zu schnell preiszugeben [POL] (456), und um zu verstehen, daß es keine Krise der Repräsentation gibt (458), darf man die Unvernunft von [POL] nicht mehr eilfertig akzeptieren (459), sondern muß eher die Erfahrung des politischen Sprechens verfolgen (461). Eine objektorientierte Politik (462) erlaubt, die Quadratur des politischen Kreises wahrzunehmen (463) unter der Bedingung, gut zu unterscheiden zwischen dem Sprechen über Politik und dem politischen Sprechen (465). Man entdeckt dann einen besonderen Typ von Paß, der den unmöglichen Kreis bahnt (466), welcher einschließt oder ausschließt, je nachdem ob er wiederaufgenommen wird oder nicht (469). Eine erste Definition des Hiatus vom Typ [POL]: die Krümmung (471) und eine sehr besondere Trajektorie: die Autonomie (472). Eine neue Definition des Hiatus: die Diskontinuität (473) und ein besonders anspruchsvoller Typ von Wahrsprechen (476), den die Kreuzung [REF·POL] mißversteht (478). [POL] praktiziert eine sehr besondere Extraktion von Andersheit (479), die ein Phantom der Öffentlichkeit definiert (481) gegen die Figur der Gesellschaft (482), die das Politische noch monströser machen würde, als es ohnehin bereits ist (484). Wird man jemals die Sprache wieder erlernen können, um gut krumm zu sprechen (485)?
Kapitel 13:DIE PASSAGE DES RECHTS UND DIE QUASI-SUBJEKTE
Glücklicherweise besteht kein Problem, vom Recht juristisch zu sprechen (488), weil das Recht für sich selbst seine eigene Erklärung ist (489). Es bietet jedoch besondere Schwierigkeiten (491) durch seine merkwürdige Mischung aus Stärke und Schwäche (491), durch seine sehr wenig autonome Autonomie (493) und weil man es damit betraut hat, zu viele Werte zu tragen (494). Man muß demnach ein besonderes Protokoll aufstellen (495), um die Passage des Rechts zu verfolgen, die von den juristischen Mitteln ausgekleidet wird (496), und Gelingensbedingungen erkennen, die außerordentlich anspruchsvoll sind (499). Das Recht verknüpft die Äußerungsebenen wieder (501) dank eines sehr besonderen Formalismus (503). Jetzt läßt sich die Besonderheit der Quasi-Subjekte verstehen (506), indem wir lernen, ihre Beiträge zu respektieren: zunächst die der Wesen der Politik [POL] (508), dann der Wesen des Rechts [REC] (509) und schließlich der Wesen der Religion [REL] (510). Die Quasi-Subjekte bestehen alle in Äußerungsregimen, die sensibel für die Tonalität sind (511). Die Modi klassifizieren erlaubt, gut zu artikulieren, was man zu sagen hat (512) und endlich diese modernistische Obsession für die Differenz Subjekt/Objekt zu erklären (514). Neues Erschrecken der Anthropologin: die vierte Gruppe, der Kontinent der Ökonomie (516).
Kapitel 14:DIE ORGANISATION IN IHRER EIGENEN SPRACHE ARTIKULIEREN
Die zweite Natur widersetzt sich ganz anders als die erste (518), was es schwierig macht, die Ökonomie einzugrenzen (519), es sei denn, wir halten drei Diskrepanzen zur gewöhnlichen Erfahrung fest (521). Eine erste Diskrepanz betrifft die Temperatur: Kälte anstelle von Hitze (522). Die zweite Diskrepanz: ein leerer Platz anstelle einer überfüllten Agora (523). Die dritte Diskrepanz: keinerlei nachweisbarer Unterschied zweier Ebenen (525). So daß von einem Amalgam aus drei unterschiedlichen Modi auszugehen ist: [BIN], [ORG] und [MOR] (526). Die paradoxe Situation der Organisation [ORG] (527) läßt sich besser orten, wenn man von einem nur schwach ausgerüsteten Fall ausgeht (528), der erlaubt, herauszufinden, wie die Skripte uns »drunter und drüber« bringen (530). Organisieren ist notwendigerweise Re-organisieren/De-organisieren (532). Es gibt hier tatsächlich einen eigenen Existenzmodus (533) mit seinen expliziten Bedingungen des Gelingens und Mißlingens (534) und seiner besonderen Alterierung des Seins-als anderes: dem Rahmen (537). Man kann dann ohne eine Vorsehung auskommen, um die Skripte zu schreiben (539), unter der Bedingung, gut zu unterscheiden zwischen dem Stapeln und der Aggregation (541), und die Gesellschaft als phantomhaften Metaverteiler zu umgehen (542), indem man an der methodologischen Entscheidung festhält, wonach das Kleine das Große mißt (544), als einzigem Mittel, um die Dimensionierungsoperationen zu verfolgen (545). Nun kann man die Dispositive der Ökonomisierung in den Vordergrund rücken (548) und zwei unterschiedliche Bedeutungen von Eigentum unterscheiden (550), indem wir die leichte Hinzufügung der Berechnungsvorrichtungen verstehen (552). Zwei nicht zu verwechselnde Modi unter dem Begriff der ökonomischen Vernunft (554).
Kapitel 15:DIE WESEN DES LEIDENSCHAFTLICHEN INTERESSES MOBILISIEREN
Wo doch das Ganze stets den Teilen unterlegen ist (560), hat man mehrere Gründe, sich über die Erfahrung der Organisation zu täuschen (561): die Verwechslung mit dem politischen Kreis [POL·ORG] (561), die zwischen Organisation und Organismus [REP·ORG] (563), das technische Beschweren der Skripte [TEC·ORG] (565), die Verwechslung der ungleichen Verteilung der Skripte mit der Dimensionierung (568); dies alles führt zu einer umgekehrten Erfahrung des Sozialen (569). Wenn wir auf die Erfahrung dessen zurückkommen, was die Skripte in Bewegung setzt (570), ermessen wir, was man passieren muß, um zu subsistieren (571), wobei wir die Wesen des leidenschaftlichen Interesses entdecken [BIN] (574). Allerdings muß man mehrere Hindernisse bei der Wiedergabe dieser neuen Erfahrung beseitigen: zunächst den Begriff der Einbettung (576), dann den Begriff des Kalküls der Präferenzen (577), dann das Hindernis einer Objekt/Subjekt-Beziehung (578), viertens das Hindernis des Tauschs (579) und schließlich, als letztes Hindernis: den Warenkult (580). Dann taucht ein besonderer Modus der Alterierung des Seins auf (584) mit einem originellen Paß: dem Interesse und der Wertschätzung (586) und eigenen Gelingensbedingungen (588). Dieses Kneten der Existierenden (591) führt zum Rätsel der Kreuzung mit der Organisation [BIN·ORG] (591), die erlauben wird, die Materie von der zweiten Natur zu trennen (593).
Kapitel 16:DIE ERFAHRUNG DES SKRUPELS BELEBEN
Das Aufspüren der Kreuzung [BIN·ORG] (598) müßte dazu führen, ein Lob auf die Dispositive der Buchhaltung anzustimmen (599). Und dennoch behauptet die Ökonomie, die Werte durch Tatsachen zu berechnen, die wertfrei sind (602), was die Erfahrung, quitt zu sein, verwandelt (604) in ein Dekret der Vorsehung, fähig, das Optimum zu berechnen (605) und den Schauplatz zu leeren, wo Güter und Übel verteilt werden (606). Auch wenn die Frage der Moral sich bereits für jeden Modus gestellt hat (608) gibt es in der Ungewißheit über Zwecke und Mittel eine neue Quelle der Moral (611). Verantwortlich ist, wer einem Ruf antwortet (614) der nicht universell sein kann ohne die Erfahrung des Universums (616). Man kann also das Anforderungsprofil der moralischen Wesen aufstellen [MOR] (617) und ihren eigenen Modus des Wahrsprechens definieren: die Wiederaufnahme des Skrupels (618), und ihre besondere Alterierung: die Suche nach dem Optimum (620). Die Ökonomie verwandelt sich in eine Metaphysik (622), wenn sie zwei Typen von Berechnungen in der Kreuzung [REF·MOR] amalgamiert (622), was sie dazu bringt, eine Disziplin mit einer Wissenschaft zu verwechseln (624) die nur eine ökonomische Materie beschreiben würde (626). Damit setzt die Ökonomie jeder moralischen Erfahrung ein Ende (627). Es ist die vierte Gruppe, die Quasi-Objekte und Quasi-Subjekte miteinander verbindet (628), die der nicht enden wollende Krieg der sichtbaren und der unsichtbaren Hand mißversteht (631). Können die Modernen auf dem Gebiet der Ökonomie agnostisch werden (632) und die Institution der Ökonomie als Disziplin neu begründen (634)?
Schluß:KANN MAN EIN LOB ANSTIMMEN AUF DIE KOMMENDE ZIVILISATION?
Wir müssen durch eine Reihe von Tests die Prüfung definieren, welche die Untersuchung bestehen muß, soll sie nicht zum Scheitern verurteilt sein (640): Erster Test: Sind die aufgefundenen Erfahrungen teilbar (640)? Zweiter Test: Erlaubt das Auffinden eines Modus, die anderen Modi zu respektieren (642)? (Ach übrigens, wieso zwölf Modi plus drei?) (644) Dritter Test: Kann man andere Wiedergaben als die vom Autor vorgeschlagenen anregen (645)? Vierter Test: Läßt sich die Untersuchung in ein diplomatisches Dispositiv verwandeln (646), um Institutionen zu entwerfen, die den Modi angemessen sind (648), indem sie einen neuen Raum für die vergleichende Anthropologie eröffnet (648) durch eine Reihe von Verhandlungen über die Werte (650)? Für neue Kriege neue Friedensverhandlungen (651).
Tabelle der Existenzweisen
Glossar
»Si scires donum Dei«
Gebrauchsanweisung für die in Gang befindliche kollektive Untersuchung
Dieses Werk resümiert eine Untersuchung, die ich seit einem Vierteljahrhundert mit einer gewissen Hartnäckigkeit verfolge. Dank Europa habe ich eine Subvention erhalten, die bedeutend genug ist, um eine Plattform zu schaffen, die es Ihnen nicht nur ermöglichen wird, diesen provisorischen Bericht zu lesen, sondern auch die Untersuchung mittels eines Forschungsdispositivs zu erweitern, das Sie auf der Webseite <www.modesofexistence.org> finden. In der Einsamkeit begonnen, wird diese Arbeit inzwischen von einer kleinen Gruppe fortgesetzt, die sich unter dem Namen AIME zusammenfindet: An Inquiry Into Modes of Existence, welches die englische Übersetzung des französischen Akronyms EME darstellt: Enquête sur les Modes d'Existence. Wenn alles gutgeht, sollte die Plattform es erlauben, eine etwas umfangreichere Forschungsgemeinschaft zu mobilisieren.
Sobald Sie auf der Webseite registriert sind, verfügen Sie über die digitale Version dieses Werks, eine Version, die Ihnen Zugang zu den Anmerkungen, der Bibliographie, dem Index, dem Glossar sowie zu einer ergänzenden Dokumentation bietet.[1] Die Flexibilität des Digitalen, die inzwischen fest in den Gewohnheiten verankert ist, macht es möglich, die Leseformen zu multiplizieren, wobei man von einem kritischen Apparat profitiert, der sich in ständiger Entwicklung befindet, und in den Genuß von Kommentaren kommt, die Sie, die Leserinnen und Leser, nicht versäumen werden hinzuzufügen. (Die Begriffe in Großbuchstaben verweisen auf das digitale Glossar.) Das ganze Interesse und, selbstverständlich, die ganze Schwierigkeit der Sache liegen darin, daß Sie eingeladen sind, nicht nur das Werk zu lesen, sondern eine ziemlich neue Umgebung zu erkunden. Die Idee ist, Ihnen durch diese Schnittstelle genügend Zugriffsmöglichkeiten zu bieten, damit sie einige Erfahrungen nachvollziehen können, von denen ich behaupte, daß sie im Zentrum der Geschichte der Modernen stehen, während sich mit Hilfe der Berichte, in denen diese davon Rechenschaft glaubten geben zu müssen, diese Erfahrungen sehr schlecht erfassen lassen. Meiner Ansicht nach ist es dieser Widerspruch zwischen den Erfahrungen der Welt und den Berichten, in denen darüber – autorisiert durch die verfügbaren Metaphysiken – Rechenschaft gegeben wird, der es so schwierig macht, die Modernen auf empirische Weise zu beschreiben. Um diesen Widerspruch aufzulösen, schlage ich vor, unsere Aufmerksamkeit auf die Interpretationskonflikte um die verschiedenen Wahrheitswerte zu konzentrieren, mit denen wir jeden Tag konfrontiert sind. Wenn meine Hypothese stimmt, werden Sie bemerken, daß es möglich ist, verschiedene Existenzweisen oder Existenzmodi herauszuarbeiten, deren paarweise Kreuzungen zum Gegenstand einer empirischen – und somit teilbaren – Definition werden können. Zu dieser Teilhabe laden wir Sie ein, mittels der digitalen Umgebung, die für dieses Projekt ausgearbeitet worden ist.
Sobald andere Weisen, sich mit den Argumenten der Untersuchung vertraut zu machen, entdeckt sind, lassen sich ganz andere Antworten auf den ihr zugrundeliegenden Fragebogen vorschlagen. Dank der vorgeschlagenen Schnittstellen können Sie in jedem Modus und jeder Kreuzung von Modi navigieren und dort zunächst die Dokumente entdecken, die wir angefangen haben zu sammeln, bevor Sie Ihre hinzufügen. Das ganze Interesse der Übung beruht auf der Möglichkeit für andere Teilnehmer, ob sie nun das Buch gelesen haben oder nicht, die angefangene Arbeit durch neue Dokumente, neue Quellen, neue Zeugnisse weiterzuführen und vor allem die Fragen zu modifizieren, indem sie das Projekt in Abhängigkeit der zusammengetragenen Resultate berichtigen oder modulieren. Das Laboratorium steht nun weit offen, um neue Entdeckungen darin zu machen.
In einer letzten Etappe können Sie sogar, wenn Sie es wünschen, an einer originellen Form von Diplomatie teilnehmen, indem Sie andere Formen der Wiedergabe als meine vorschlagen, um die Erfahrungen zu interpretieren, die wir kollektiv nachzeichnen werden. Denn im Rahmen einer Reihe von Zusammentreffen werden wir, unterstützt von Vermittlern, uns bemühen, andere Versionen, andere Metaphysiken vorzuschlagen als in diesem provisorischen Bericht. Vielleicht werden wir sogar die Skizze anderer Institutionen anfertigen können, die besser geeignet sind, die Werte zu beherbergen, die wir definieren werden.
Dieses Projekt partizipiert an der Entwicklung der sogenannten »Digital Humanities« (digitalen Geisteswissenschaften), wie sie mit einem noch vagen Begriff genannt werden, deren tastender Stil zu den konventionelleren Stilen der Sozialwissenschaften und der Philosophie hinzutritt. Bei der Erforschung technischer Projekte habe ich zwar gelernt, daß man sich hüten muß, gleichzeitig auf allen Ebenen Innovationen durchzuführen, da sonst ganz sicher das Scheitern droht: und hier erkunden wir gleichzeitig methodische, begriffliche, stilistische und inhaltliche Neuerungen … Allein die Erfahrung wird uns lehren, ob dieser hybride Apparat, der neue Techniken des Lesens, Schreibens und der kollektiven Untersuchung verwendet, die empirische Philosophie, die er initiieren möchte, erleichtert oder erschwert. Unsere Zeit ist knapp, denn im August 2014 – ein Jahrhundert nach jenem anderen tragischen August 14 – müssen wir dieses Projekt abschließen, in dem wir das Abenteuer der Modernen anders zu beschreiben versuchen. Sie werden bereits verstanden haben, wieso es nicht in Frage kam, daß ich ganz allein versuchte, damit zu Rande zu kommen!
[1] Allerdings nur in französischer und englischer Fassung, doch findet sich auf der Website <www.modesofexistence.org> ebenfalls ein dreisprachiges Glossar, das zu den entsprechenden Begriffen führt. Es ist auch am Ende dieses Buches abgedruckt, S. 657ff.
Danksagung
Die Veröffentlichung dieses Werks wie auch die Entwicklung der Plattform AIME werden ermöglicht durch eine Foschungssubvention des Europäischen Forschungsrats (ERC N° 269 567). Ich danke der europäischen Forschungsmission von Sciences Po dafür, den Aufbau dieses Projekts von Anfang bis Ende unterstützt zu haben, wie auch der École des mines für die beiden vorlesungsfreien Jahre 1995 und von neuem 2005.
Überblick
Da ich die Schwierigkeit der Übung, der sich zu unterziehen ich die Leser bitte, nicht verbergen kann, werde ich versuchen, ihnen gleich zu Beginn die Bewegung des Ganzen zu liefern, damit sie wissen, wohin ich sie führen will – was ihnen vielleicht hilft, bei den schwierigen Passagen nicht aufzugeben. Ein Bergführer kann die kommenden Prüfungen ankündigen, die Hand reichen, die Pausen vermehren, Geländer und Seile hinzufügen, aber es steht nicht in seiner Macht, die Gipfel abzuflachen, die seine Leser mit ihm zu erklimmen bereit sind …
Ich habe diesen Untersuchungsbericht in drei Teile gegliedert. Im ersten möchte ich zunächst den Gegenstand (Kapitel 1), dann das notwendige Ausgangsmaterial (Kapitel 2) dieser Untersuchung festhalten. Ich muß ebenfalls die beiden prinzipiellen Hindernisse beiseite räumen, die alle unsere Anstrengungen, im Verständnis der Modernen voranzukommen, absurd und unverständlich erscheinen lassen könnten. Diese beiden Hindernisse hängen selbstverständlich zusammen, gleichwohl habe ich sie unterschieden und zunächst zwei Kapitel der Schlüsselfrage der objektiven Erkenntnis gewidmet – wieso hat das Aufkommen der Wissenschaft die Erfassung der anderen Modi so schwierig gemacht (Kapitel 3 und 4)? – und zwei weitere (Kapitel 5 und 6) der Frage nach den Verbindungen zwischen Konstruktion und Realität – wieso kann man nicht in einem Atemzug die Wörter wahr und gemacht aussprechen, das heißt vom gut Gemachten sprechen? Am Ende dieses Teils werden wir wissen, wie man über eine Pluralität von Typen von Entitäten richtig sprechen kann, indem wir uns dem Leitfaden der Erfahrung anvertrauen – dem Empirismus, so wie James ihn definiert hat: nichts als die Erfahrung, aber auch nicht weniger als die Erfahrung.
Nachdem so das Terrain bereitet und die Erfahrung wieder ein verläßlicher Führer geworden ist, nachdem die Sprache befreit worden ist von den Verlegenheiten, die so charakteristisch für die Geschichte der Modernen sind, werden wir, in einem zweiten Teil, in der Lage sein, von diesem Pluralismus der Existenzweisen zu profitieren, um uns zunächst von der Einteilung Subjekt/Objekt zu befreien. Die ersten sechs Existenzmodi, die wir so ausfindig machen werden, werden uns erlauben, der vergleichenden Anthropologie eine ganz andere Grundlage zu geben, denn gerade die anderen Kulturen haben vor allem diese Kontraste ausgearbeitet. Dies wird uns ermöglichen, das Auftauchen der Modi zu verstehen, die Fluktuation ihrer Werte, die Rückwirkungen, die das Auftauchen eines jeden von ihnen auf die Erfassung der anderen hatte. Ich werde die Gelegenheit nutzen, um diese Existenzmodi ein wenig systematischer anzuordnen, indem ich ein anderes Koordinatensystem vorschlage.
Ein System, das uns erlauben wird, in einem dritten Teil weitere sechs Modi ausfindig zu machen, die regionaler sind und näher an den Gewohnheiten der Sozialwissenschaften; diese werden uns auch dabei helfen, die beiden letzten großen Hindernisse für die Untersuchung zu bewältigen: den Begriff der Gesellschaft und, vor allem, den der Ökonomie, jener zweiten Natur, die wahrscheinlich besser als alles andere die anthropologische Besonderheit der Modernen definiert.
Wie zu Beginn der Prova d'orchestra von Fellini, wo jeder Musiker den angereisten Interviewern versichert, daß sein Instrument das einzige wahrhaft nützliche im ganzen Orchester sei, wird dieses Buch funktionieren, wenn der Leser jedesmal den Eindruck hat, daß jeder der Modi der beste, der differenzierteste, der bedeutendste, der rationalste von allen ist … Aber der wichtigste Test besteht darin, daß bei jedem Modus die Erfahrung, deren roten Faden ich wiederfinden will, sich wirklich von ihrer institutionellen Wiedergabe unterscheidet. Denn nur so lassen sich anschließend andere Formen der Wiedergabe vorschlagen, die befriedigender sind. Am Ende dieser beiden Teile werden wir eine endlich positive und nicht bloß negative Version derer liefern können, die »nie modern gewesen sind«: »Das ist es, was uns zugestoßen ist; das ist es, was es zu beerben gilt; und was werden wir mit dieser historischen Anthropologie, oder besser noch, dieser regionalen Ontologie jetzt anfangen?«
Was tun? Das ist Gegenstand der allgemeinen Schlußfolgerung, die zwangsläufig sehr kurz ist, denn sie hängt ab vom Schicksal der Plattform der kollaborativen Forschung, für die dieses Werk, bloßer Abriß einer Untersuchung, den Leser interessieren will. Diesmal verwandelt sich der Anthropologe in einen Protokollchef, um eine Reihe von »diplomatischen Vertretungen« vorzuschlagen, die es erlauben würden, das Ensemble der Werte zu beerben, die in den Teilen zwei und drei entfaltet worden sind – und die alle die so lokale und so besondere Geschichte der Modernen definieren –, aber in erneuerten Institutionen und erneuerten Regimen des Sprechens.
Dann, aber erst dann, könnte man sich »den anderen« zuwenden – den früheren »anderen«! –, um mit der Verhandlung zu beginnen über die Werte, die zu instituieren, aufrechtzuerhalten und, vielleicht, zu teilen sind. Wenn es uns gelänge, wüßten die Modernen endlich, was ihnen zugestoßen ist, was sie geerbt haben, die Versprechen, die zu halten sie bereit wären, die Kämpfe, auf die sie sich einstellen müssen. Zumindest wüßten die anderen endlich, woran sie mit ihnen wären. Gemeinsam könnten sie sich vielleicht besser darauf vorbereiten, dem Einbrechen des Globalen, des Globus die Stirn zu bieten, ohne irgend etwas ihrer Geschichte zu verleugnen. Das Universale wäre vielleicht in Reichweite, endlich.
Einleitung:VON NEUEM VERTRAUEN IN DIE INSTITUTIONEN HABEN?
Eine schockierende Frage, gerichtet an einen Klimatologen ▶ die dazu zwingt, die Werte von ihrer Wiedergabe in den Berichten der Praktiker zu unterscheiden.Zwischen Modernisieren und Ökologisieren müssen wir uns entscheiden ▶ indem wir ein anderes Koordinatensystem vorschlagen.Was dazu führt, eine imaginäre diplomatische Szene zu definieren: ▶ in wessen Namen verhandeln ▶ und mit wem verhandeln?Die Untersuchung gleicht zunächst einer über Sprechakte ▶ während sie lernt, verschiedene Existenzmodi ausfindig zu machen.Das Ziel besteht zunächst darin, ein zwischen Ökonomie und Ökologie umherirrendes Volk zu begleiten.
Bevor wir verstehen, wie wir zusammen, so hoffe ich, arbeiten werden, wenn wir diese neuen Mittel erkunden, die das Digitale uns zur Verfügung stellt, muß ich dem Leser einen Vorgeschmack von dem geben, worum es bei einer solchen Untersuchung gehen soll. Da das Allerkleinste nach und nach zum Größten führen kann, beginnen wir mit einer Anekdote.
EINE SCHOCKIERENDE FRAGE, GERICHTET AN EINEN KLIMATOLOGEN ▶
Um einen runden Tisch sitzen etwa fünfzehn französische Industrielle, verantwortlich für eine nachhaltige Entwicklung in verschiedenen Unternehmen. Ihnen gegenüber ein Forscher vom Collège de France, Spezialist für Klimafragen. Es ist Herbst 2010, es tobt ein Streit, ob der Klimawandel menschlichen Ursprungs ist oder nicht. Einer der Industriellen stellt dem Professor eine Frage, die ich ein wenig zu ungeniert finde: »Aber warum soll man Ihnen glauben, Ihnen mehr als den anderen?« Ich wundere mich. Warum stellt er mit seiner Frage, als handelte es sich um einen bloßen Meinungsstreit, die Spezialisten für das Klima auf dieselbe Stufe mit den sogenannten Klimaskeptikern – wobei man die schöne Vokabel »skeptisch« ein wenig in Mißkredit bringt? Verfügt er zufälligerweise über ein Meßinstrument, das dem des Spezialisten überlegen ist? Wie sollte dieser einfache Apparatschik fähig sein, die Positionen der Experten nach einem Kalkül des Mehr oder Weniger abzuwägen? Aber vor allem, wie wagt er es, von »Glauben« angesichts der Wissenschaften vom Klima zu sprechen? Wirklich, ich finde die Frage fast schockierend, vor allem von jemandem, dessen Metier darin besteht, sich für die ökologische Frage genauer zu interessieren. Ist die Debatte dermaßen ausgeartet, daß man vom Schicksal des Planeten sprechen kann, als befände man sich auf der Bühne einer Talkshow im Fernsehen, wo der Anschein erweckt wird, die verschiedenen Positionen gleich zu behandeln?
Ich frage mich, wie der Professor antworten wird. Wird er den peinlichen Frager zurechtweisen und ihn daran erinnern, daß es sich nicht um Glauben, sondern um Tatsachen handelt? Wird er von neuem die »unbestreitbaren Daten« wiederholen, die nur wenig Raum für Zweifel lassen? Aber zu meiner großen Überraschung antwortet er mit einem langen Seufzer: »Wenn man kein Vertrauen in die wissenschaftliche Institution hat, dann ist das sehr schwerwiegend.« Und dann macht er sich daran, vor seinem Auditorium die große Anzahl der Wissenschaftler aufzuzählen, die mit der Analyse des Klimas befaßt sind, er legt das komplexe System der Überprüfung der Daten, Artikel und Berichte dar, das Prinzip der Beurteilung durch die peers, das riesige Netz der Beobachtungsstationen, der Treibbojen, der Satelliten, der Computer, die den Informationsfluß sicherstellen – und erklärt schließlich noch an der Tafel die Fallstricke der Modelle, die zur Korrektur der Daten notwendig sind, sowie die sukzessiven Zweifel, die man in bezug auf jeden dieser Punkte beseitigen mußte. »Und, im anderen Lager«, fügt er hinzu, »was findet man dort? Keinen auf dem Gebiet kompetenten Forscher, der über die geeignete Ausrüstung verfügt.« Um auf die gestellte Frage zu antworten, hat sich der Professor demnach des Begriffs der Institution bedient, als sähe er darin das beste Instrument, um die Positionen gegeneinander abzuwägen. Er sieht kein höheres Berufungsgericht. Und daher fügt er hinzu, daß das »Vertrauen« in diese Ressource »zu verlieren« für ihn »sehr schwerwiegend« wäre.
Seine Antwort überrascht mich ebenso wie die Frage. Ich glaube nicht, daß ein Forscher vor fünf oder zehn Jahren – vor allem nicht ein französischer Forscher – in einer Situation der Kontroverse von einem »Vertrauen in die wissenschaftliche Institution« gesprochen hätte. Vielleicht hätte er auf die »Vertrauensintervalle« im statistischen Sinne hingewiesen, aber er hätte sich auf die Gewißheit berufen, eine Gewißheit, deren Herkunft er im Detail nicht vor einem solchen Auditorium hätte zu diskutieren brauchen; diese Gewißheit hätte ihm auch erlaubt, den Frager als Ignoranten und seine Gegner als irrational zu behandeln. Keine Institution wäre sichtbar gemacht worden; keine Berufung auf das Vertrauen wäre notwendig gewesen. Er hätte sich an eine höhere Instanz gewandt, an Die Wissenschaft mit großem Artikel. Wenn man sich auf sie beruft, gibt es nichts zu debattieren, weil man sich immer schon auf der Schulbank befindet, wo man lernen muß – oder schlechte Zensuren erhält. Muß man sich jedoch auf das Vertrauen berufen, so ist die Gesprächssituation eine völlig andere: Man muß die Sorge um eine fragile und delikate Institution teilen, die voller entsetzlich materieller und weltlicher Elemente steckt – die Öllobbies, die Peer-Beurteilung, die Zwänge der Modellbildung, die Satzfehler in den tausendseitigen Berichten, die Forschungsverträge, die Computer-Bugs usw. Nun zielt aber eine solche Sorge, und das ist der wesentliche Punkt, nicht darauf, die Forschungsresultate in Zweifel zu ziehen, sondern darauf, die Sicherheit zu erlangen, daß sie valide, robust sind und geteilt werden.
Daher meine Überraschung: Wie kann dieser Forscher vom Collège de France den Komfort aufgeben, den ihm die Berufung auf die unbestreitbare Gewißheit verleiht, und sich statt dessen auf das Vertrauen in die wissenschaftliche Institution stützen? Wer hat heutzutage noch Vertrauen in die Institutionen? Ist es nicht der schlechteste Moment, um vor aller Augen die fürchterliche Komplexität der unzähligen Büros, Versammlungen, Kolloquien, Gipfeltreffen, Modelle, Abhandlungen und Artikel herauszustellen, die unsere Gewißheiten über den anthropogenen Ursprung der Klimaveränderungen durchlaufen müssen? Das ist ein wenig so, als wenn ein Priester einem Katechumenen, der an der Existenz Gottes zweifelte, antwortete, indem er das Organigramm des Vatikans aufzeichnete, die bürokratische Geschichte der Konzilien und die zahlreichen Glossen der Abhandlungen des kanonischen Rechts darlegte … Auch scheint das dem Finger auf die Institutionen Zeigen heutzutage eher als Waffe zu deren Kritik dienen zu können, aber sicher nicht dazu, das Vertrauen in festgestellte Wahrheiten wiederherzustellen. Und dennoch: genau diese Verteidigungsstrategie wählte der Professor, um sich gegen diese zweifelnden Industriellen zu wehren.
Und er hat recht. In einer Situation lebhafter Kontroverse, wo es sich darum handelt, valide Erkenntnisse über derart komplexe Gegenstände wie das gesamte System der Erde zu gewinnen, Erkenntnisse, die zu radikalen Veränderungen in den intimsten Details der Existenz von Milliarden Menschen führen sollen, ist es unendlich sicherer, sich auf die wissenschaftliche Institution zu verlassen als auf die unbestreitbare Gewißheit. Aber auch unendlich riskanter. Welchen Mut mußte er aufbringen, um so den Stützpunkt zu wechseln …
Ich glaube dennoch nicht, daß der Professor sich sehr bewußt war, daß er von einer bestimmten Philosophie der Wissenschaften zu einer anderen übergegangen war. Eher denke ich, daß er nicht mehr die Wahl der Waffen hatte, weil seine Gegner, die Klimaskeptiker, ihrerseits davon sprachen, daß sie nur handeln würden, wenn sie vollständige Gewißheit erlangt hätten, und sie den Begriff der Institution nur verwendeten, um ihn in Verlegenheit zu bringen. Klagen sie nicht die Klimatologen an, eine »Lobby« unter anderen zu sein, die »Lobby« der Modellierer? Gefallen sie sich nicht darin, der Spur des Geldes zu folgen, das für die Klimaforschung erforderlich ist, wie auch den Netzwerken des Einflusses und der Klüngelei, wovon die E-Mails zeugen, die sie sich heimlich beschafft haben? Und sie ihrerseits, was machen sie, um zu wissen? Sie können sich offenkundig damit brüsten, gegen alle anderen recht zu haben, da Die Gewißheit »niemals eine Frage der Anzahl« ist. Jedesmal, wenn man auf die Vielzahl der Klimatologen und den Umfang ihrer Ausrüstung und ihres Budgets hinweist, empören sich die Klimaskeptiker indigniert gegen das, was für sie ein bloßes »Autoritätsargument« ist. Und machen wieder die große Geste: Die Gewißheit gegen Das Vertrauen, wobei sie sich auf die großgeschriebene Wahrheit berufen, die keine Institution je korrumpieren kann. Und drapieren sich mit den Gewändern der Galilei-Affäre: Hat er nicht ganz allein über die Institution, über die Kirche, über die Religion, über die wissenschaftliche Bürokratie der damaligen Zeit triumphiert? Derart in die Enge getrieben, hatte der Professor kaum noch die Wahl. Da die Gewißheit von seinen Feinden in Beschlag genommen ist und das Publikum anfängt, unhöfliche Fragen zu stellen; da das Risiko besteht, die Wissenschaft mit der Meinung zu verwechseln, greift er auf das zurück, was in Reichweite scheint: das Vertrauen in eine Institution, die er seit zwanzig Jahren von innen kennt und praktiziert und an der zu zweifeln er letztlich keinen Grund hat.
Aber wovon man niemals spricht. Darin liegt die Fragilität der Stütze, die er sich ausgesucht hat. Wenn ihm schien, daß ich ihn mit einem leicht ironischen Gesichtsausdruck betrachtete, als er um eine Antwort rang, möge er mir verzeihen, denn ich gehöre zu einem Forschungsbereich, den Forschungen über die Wissenschaft (die man auf denglisch als »SCIENCE STUDIES«[1] bezeichnet), die sich gerade bemühen, dem Begriff der wissenschaftlichen Institution eine positive Bedeutung zu verleihen. Nun wurde aber dieser Forschungsbereich in seinen Anfängen in den 1980er Jahren von vielen Wissenschaftlern nicht nur für eine Kritik an der wissenschaftlichen Gewißheit gehalten – was er tatsächlich war –, sondern auch an gesicherten Erkenntnissen – was er keineswegs war. Wir wollten verstehen, durch welche Instrumente, welche Maschinerie, welche materiellen, historischen, anthropologischen Bedingungen es möglich ist, Objektivität hervorzubringen. Und dies selbstverständlich, ohne irgendeine transzendente Gewißheit anzurufen, die, auf einen Schlag und ohne Diskussion, Die Wissenschaft gegen die Meinung hingestellt hätte. In unseren Augen hatte die wissenschaftliche Objektivität einen zu wichtigen Wert, um ihr als einzige Verteidigung das zu lassen, was man mit einem Allzweckwort den »RATIONALISMUS« nennt und dessen Wert allzuoft darin besteht, jede Diskussion abzubrechen, indem allzu hartnäckige Gegner der Irrationalität bezichtigt werden. Lange bevor die ökologischen Fragen ins Zentrum der Politik gerückt sind, ahnten wir bereits, daß der Unterschied zwischen dem Rationalen und dem Irrationalen nicht ausreichen würde, um die Dispute über die Bestandteile der GEMEINSAMEN WELT zu schließen. Wir hatten die Empfindung, daß die Frage der Wissenschaften ein wenig komplizierter sei und daß man über die Fabrik der Objektivität auf neue Weise Untersuchungen anstellen müßte. Und deshalb sind wir immer noch erstaunt – ich und meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich der Wissenschaftsgeschichte und -soziologie – über die Wut mancher Forscher angesichts dessen, was sie den »RELATIVISMUS« unserer Untersuchungen nennen, während wir nur versuchen, die Wissenschaft auf eine endlich realistische Verteidigung der Objektivität vorzubereiten, an der wir genausosehr hängen wie sie – wenn auch auf andere Weise.
Man wird daher meine leichte Verwunderung angesichts der Antwort des Klimatologen verstehen: »Sieh an, sieh da, nun sprechen Sie also positiv vom Vertrauen, das man in die wissenschaftliche Institution setzen muß … Aber, lieber Kollege, wann haben Sie jemals öffentlich die Notwendigkeit eines solchen Vertrauens beschworen? Wann haben Sie es akzeptiert, Ihre Fabrikationsgeheimnisse zu teilen? Wann haben Sie laut und deutlich dafür plädiert, daß die Praxis der Wissenschaften als eine fragile Institution verstanden werden sollte, die sorgsam unterhalten werden muß, wenn man Vertrauen in sie haben will? Sind nicht wir es, im Gegensatz zu Ihnen, die diese Arbeit die ganze Zeit über geleistet haben? Wir, deren Hilfe Sie mit einer gewissen Verstimmtheit beiseite schoben, indem Sie uns als Relativisten behandelten? Sind Sie wirklich bereit zu einem solchen Wechsel der Epistemologie? Werden Sie wirklich und endlich auf die Bequemlichkeit der Anklage der Irrationalität verzichten, dieses großen Mittels, um allen den Mund zu verbieten, die Streit mit Ihnen suchen? Ist es nicht ein wenig spät, um sich plötzlich ganz unvorbereitet in den Begriff des ›Vertrauens‹ zu flüchten?« Wenn ich an jenem Tag keine solchen Fragen an den Klimatologen richtete, so nicht, weil ich Angst hatte, meinerseits ungeniert zu sein, sondern weil keine Zeit mehr ist, um über den »Relativismus« der »science studies« zu disputieren. Diese ganze Angelegenheit ist zu ernst geworden für solche Zankerei. Wir haben dieselben Feinde, und wir müssen auf dieselben Dringlichkeiten antworten.
◀ DIE DAZU ZWINGT, DIE WERTE VON IHRER WIEDERGABE IN DEN BERICHTEN DER PRAKTIKER ZU UNTERSCHEIDEN.
Diese Anekdote erlaubt es, anzufangen zu verstehen, warum eine Untersuchung notwendig ist über den Platz, den man dem Schlüsselbegriff der INSTITUTION – und insbesondere der wissenschaftlichen Institution – zuweisen soll, während wir uns ökologischen Krisen gegenübersehen, deren Umfang und Neuheit bislang unbekannt waren. Wenn ich mich an eine solche Untersuchung gewagt habe, so weil man in der Antwort des Professors wenn nicht einen Widerspruch, so doch eine starke Spannung wahrnehmen kann zwischen dem WERT, den er verteidigen will – der Objektivität –, und dem vorgeschlagenen Bericht, in dem er diesen Wert definiert. Denn er scheint unschlüssig zu sein, ob er sich auf die Gewißheit oder auf das Vertrauen berufen soll, die beide, wie wir bemerken werden, vollkommen verschiedene Philosophien, nein: Metaphysiken, nein: Ontologien in Anspruch nehmen.
Ich weiß wohl, daß er nicht die Zeit hatte, diese Differenz richtig einzuschätzen; das ist nicht die Art von Präzision, die man von einem Klimatologen verlangt. Aber meine eigene Arbeit als Soziologe oder Philosoph oder Anthropologe (das Etikett ist nicht so wichtig) besteht darin, diese Diskrepanz so weit und so lange wie nötig zu vertiefen. Und, worin in meinen Augen die ganze Nützlichkeit dieses Projekts liegt, eine Lösung vorzuschlagen, um einen solchen Wert teilbar und dauerhaft zu machen. Wie man sehen wird, besteht der Vorschlag, den ich durch diese Untersuchung erkunde, darin, mittels einer Reihe von KONTRASTEN die Werte, die man verteidigen will, zu unterscheiden von den Berichten oder Darstellungen, die von ihnen im Laufe der Geschichte gegeben wurden, um dann zu versuchen, sie in Institutionen zu installieren, oder besser, zu instaurieren, die endlich für sie entworfen sind.
Ich weiß ganz genau, daß die Wörter »Wert« und »Institution« manche erschrecken könnten, daß sie sogar schrecklich reaktionär klingen können. Wie? Eine Rückkehr zu den Werten? Vertrauen in die Institutionen? War es denn nicht das, was wir schließlich hinter uns gelassen haben; das, womit wir ein Ende machten; das, was wir zu bekämpfen und sogar zu verachten gelernt haben? Und dennoch: Die weiter oben analysierte Anekdote zeigt, daß wir vielleicht wirklich in einer anderen Epoche leben. Der Umfang der ökologischen Krisen verpflichtet dazu, auf ein ganzes Ensemble von Reaktionen wieder zurückzukommen, oder sagen wir eher von konditionierten Reflexen, die uns jede Geschmeidigkeit rauben, um auf das, was kommt, zu reagieren. Von dieser Hypothese bin ich zumindest ausgegangen. Damit ein Forscher aus dem Collège de France von der Gewißheit zum Vertrauen umschwenkt, muß in der Tat etwas »Schwerwiegendes« passiert sein. Und ein solches Gewicht lastet auf dieser Arbeit.
Mein Ziel bei dieser Untersuchung ist es, ein Dispositiv zu schaffen, das ich DIPLOMATISCH nenne, welches erlauben würde, wenn ich es gut zu Ende führe (aber das kann ich nicht allein), diesem Forscher, der im Namen des »Rationalismus« angegriffen wurde, die Hilfe einer alternativen Definition für das, woran ihm liegt, anzubieten. Kann ich die Objektivitäten erfolgreich neu definieren durch das Vertrauen in eine wissenschaftliche Institution, ohne daß er das Empfinden haben müßte, den Wert verloren zu haben, für den er kämpft? Selbst wenn er sich, nachdem die Arbeit erledigt ist, auf eine ganz andere Philosophie der Wissenschaften wird stützen müssen. Und kann ich es mit ihm machen? Das ist der Einsatz dieser Untersuchung: die Erfahrung der Werte zu teilen, an denen meine Informanten zu hängen scheinen, aber indem ich ihnen anbiete, die Darstellung oder vielmehr die Metaphysik zu modifizieren, durch die sie ihre Erfahrung in den zu konfliktreichen Fällen auszudrücken versuchen, wo sie riskieren, sie zu verlieren, weil sie sie ungeschickt verteidigen. Kann man einigen dieser Konzepte, die wir zu schätzen gelernt haben, die Gelegenheit einer Entwicklung geben, welche der allzu enge Rahmen der Modernisierung ihnen nicht gegeben hat? Letztlich können sich die Ausdrücke der »nachhaltigen Entwicklung« und des »Artenschutzes« auch auf Konzepte anwenden lassen!
ZWISCHEN MODERNISIEREN UND ÖKOLOGISIEREN MÜSSEN WIR UNS ENTSCHEIDEN ▶
Warum können so viele Werte nicht mehr den Angriffen widerstehen? Aufgrund eines anderen Phänomens, das ich seit meiner Einführung in die Feldforschung, in Afrika, zu Beginn der 1970er Jahre zu dokumentieren versuche und das man durch einen Ausdruck bezeichnen kann, der lautet: »Ende der modernistischen Parenthese«. In allem, was folgen wird, stehen die Begriffe »Modernisierung« oder die »MODERNEN« im Gegensatz zur »ÖKOLOGIE«. Zwischen Modernisieren und Ökologisieren müssen wir uns entscheiden.
In einem vor mehr als zwanzig Jahren veröffentlichten Buch, Wir sind nie modern gewesen, hatte ich versucht, dem zu vieldeutigen Adjektiv »modern« eine präzise Bedeutung zu geben, indem ich als Prüfstein das Verhältnis verwendete, das man im 17. Jahrhundert zwischen zwei Welten aufzustellen begann, der der Natur und der der Gesellschaft, der Welt der nicht-menschlichen Entitäten und der Welt der Menschen. Das »Wir« im ein wenig zu hochtrabenden Titel bezeichnete weder ein bestimmtes Volk noch eine besondere Geographie, sondern alle diejenigen, die von der Wissenschaft einen radikalen Unterschied zur Politik erwarten. Alle diejenigen, gleich welche Erde sie zur Welt kommen sah, die sich an der Lende durch einen Zeitpfeil erfaßt fühlen, der so ausgerichtet ist, daß hinter ihnen eine archaische Vergangenheit liegt, die leider Tatsachen und Werte vermengt, und vor ihnen eine mehr oder weniger strahlende Zukunft, in der die Unterscheidung zwischen Tatsachen und Werten endlich klarer und deutlicher wäre. Modern ist derjenige, der von dieser Vergangenheit in diese Zukunft schreitet – schritt – mittels einer unaufhaltsam fortschreitenden »MODERNISIERUNGSFRONT«. Dank einer solchen Pionierfront, einer solchen Grenze konnte man sich erlauben, alles als »irrational« zu qualifizieren, von dem man sich losreißen mußte, und alles als »rational«, zu dem hin man sich wenden mußte, um fortzuschreiten. So war modern derjenige, der sich von den Bindungen seiner Vergangenheit emanzipierte, um zur FREIHEIT voranzuschreiten. Kurz, wer vom Dunkel ins Licht schritt – in die AUFKLÄRUNG. Wenn ich die Wissenschaft als Prüfstein verwendet habe, um dieses singuläre Koordinatensystem zu definieren, so weil jede Erschütterung in der Konzeption der Wissenschaften den ganzen Apparat der Modernisierung in Gefahr zu bringen drohte. Sobald man damit anfängt, von neuem Die Tatsachen und Die Werte zu vermischen, beginnt der Zeitpfeil sich zu unterbrechen, zu zögern, zu schwanken, sich in alle Richtungen zu verdrehen und einem Teller Spaghetti zu ähneln – oder vielmehr einem Schlangennest.
Man mußte kein großes Licht sein, um vor zwanzig Jahren die Empfindung zu haben, daß die Modernisierung ihrem Ende entgegenging, weil jeden Tag, jede Minute es zusehends schwieriger wurde, die Tatsachen und die Werte zu unterscheiden, da sich Menschen und Nicht-Menschen immer mehr verquickten. Ich lieferte seinerzeit zahlreiche Beispiele dafür, wobei ich von der Vervielfältigung der »Hybriden« aus Wissenschaft und Gesellschaft sprach. Seit mehr als zwanzig Jahren haben sich die wissenschaftlichen und technischen Kontroversen in Anzahl und Dimension zusehends weiter vermehrt und erstrecken sich nun sogar auf das Klima. Da die Geologen damit anfangen, den Begriff des »ANTHROPOZÄNS« zu verwenden, um die Epoche der Erdgeschichte zu bezeichnen, die dem Holozän folgt, ist es praktisch, künftig diese Vokabel zu verwenden, um in einem einzigen Wort die Bedeutung der Epoche zusammenzufassen, die von den wissenschaftlichen und industriellen Revolutionen bis heute reicht. Wenn die Geologen selbst, eher besonnene und ernsthafte Leute, aus dem Menschen eine Kraft machen, die es im Umfang mit den Vulkanen oder selbst der Tektonik der Erdplatten aufnehmen kann, dann ist etwas inzwischen sicher: Wir haben keinerlei Hoffnung mehr, morgen besser als gestern zu sehen, wie sich Wissenschaft und Politik definitv unterscheiden.
Folglich hat der Prüfstein, der dazu diente, die Vergangenheit von der Gegenwart zu trennen, die Front der Modernisierung hervortreten zu lassen, bereit, den Planeten zu umfassen und denen eine Identität anzubieten, die sich als »modern« empfinden, jede Effizienz verloren. Von nun an sind wir geladen, vor GAIA zu erscheinen. Gaia, jene merkwürdige Figur, die doppelt buntscheckig ist, da aus Wissenschaft und Mythologie bestehend, dient manchen Spezialisten dazu, die Erde, die uns umfaßt und die wir umfassen, zu bezeichnen, dieses Möbiusband, dessen Inneres und Äußeres wir gleichzeitig bilden, diesen wahrhaft globalen Globus, der uns bedroht, während wir gleichzeitig ihn bedrohen. Wenn ich, vielleicht übermäßig, die Atmosphäre dieses Untersuchungsprojekts dramatisieren wollte, würde ich sagen, daß es die Rückstöße der Modernisierungsfront aufzeichnen will, genau in dem Moment, wo diese plötzlich auf Gaia stößt.
Alles sieht so aus, als hätten die Modernen (ich verwende dieses Wort, um jenes Volk mit variabler Geometrie zu bezeichnen, das auf der Suche nach sich selbst ist) bislang Werte definiert, die sie recht und schlecht in wackeligen Institutionen untergebracht haben, die aus dem Stegreif konzipiert worden sind, um den Anforderungen der Modernisierungsfront zu entsprechen, wobei sie immer die Frage vor sich herschoben, zu wissen, wie sie Bestand haben sollten. Sie hatten eine Zukunft, aber sie beschäftigten sich nicht sehr mit der Nachwelt oder dem Kommenden. Was kommt? Was taucht unangekündigt auf, ohne daß sie es vorhergesehen zu haben scheinen? »Gaia«, das »Anthropozän«, der genaue Name ist nicht so wichtig, jedenfalls etwas, das sie auf immer des fundamentalen Unterschieds zwischen Natur und Gesellschaft beraubt, auf dem sie nach und nach ihr Koordinatensystem aufgebaut hatten. Ausgehend von diesem Ereignis kompliziert sich alles für sie: »Morgen«, murmeln jene, die aufgehört haben, entschieden modern zu sein, »morgen werden wir noch mehr Gemenge von Wesen berücksichtigen müssen, welche die Ordnung der Natur und die Ordnung der Gesellschaft miteinander vermengen werden; morgen, mehr noch als gestern, werden wir uns durch eine noch größere Anzahl Zwänge von Entitäten gebunden fühlen, von Entitäten, die immer zahlreicher und immer mannigfaltiger werden.« Damit hat die Vergangenheit die Form geändert, weil sie nicht archaischer als das ist, was uns entgegenkommt. Was die Zukunft angeht, so ist sie in Stücke zersprungen. Wir können uns nicht mehr wie früher emanzipieren. Eine ganz neue Situation: hinter uns Bindungen, vor uns noch mehr Bindungen. Die »Modernisierungsfront« ist aufgehoben. Ende der Emanzipation als einziges mögliches Schicksal. Und was schlimmer ist: »Wir« wissen nicht mehr, wer wir sind, und auch nicht mehr selbstverständlich, wo wir sind, wir, die wir geglaubt hatten, modern zu sein … Ende der Modernisierung. Man muß alles wiederaufnehmen.
◀ INDEM WIR EIN ANDERES KOORDINATENSYSTEM VORSCHLAGEN.