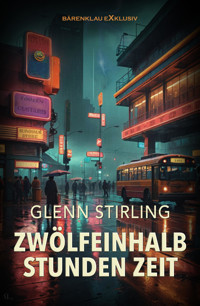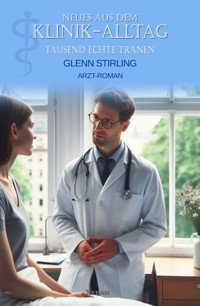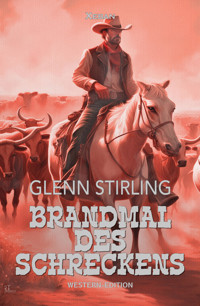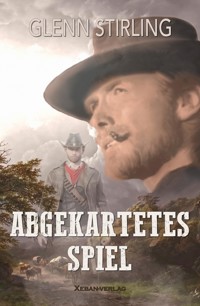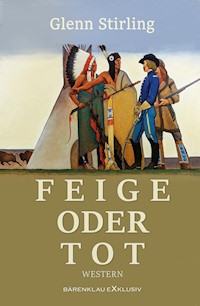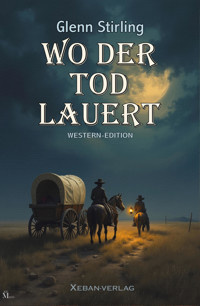
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: XEBAN-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Mein Name ist Carter. Jed Carter. Manche sagen, dass Ärger und Verdruss meine besten Freunde sind. Es heißt, die Luft sei verdammt bleihaltig, wo ich mich gerade aufhalte. Dabei bin ich nur ein Mann mit einer bewegten Vergangenheit, der in Ruhe gelassen werden möchte. Aber so langsam glaube ich, dass es mein Schicksal ist, immer mit einem Bein im Grab zu stehen …
Der heiße Süden lockte mich diesmal, und so machte ich mich auf den Weg, In Arizona war der Teufel los. General Crook war eingetroffen und versuchte mit allen Mitteln, den gnadenlos aber auch verzweifelt kämpfenden Geronimo und dessen Apachen zu besiegen. Ich wollte mich da nicht einmischen und versuchte nur, so viele Meilen zwischen Tucson und mich zu bringen wie möglich. Dieses Tucson glich einem Heerlager, zudem war es Sammelpunkt vieler Abenteurer geworden, von denen einige auf Indianerjagd gingen, um Skalps zu erwischen, für die man in Tucson Prämien zahlte. Erst dachte ich, so etwas ginge mich nichts an. Doch auf einmal steckte ich mitten in diesem Geschehen. Und es geschah in der Gluthölle der Gila-Wüste …
»Wo der Tod lauert« ist ein packender Western-Roman, wie ihn sich der Western-Fan wünscht, ein echter Glenn Stirling!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Glenn Stirling
Wo der Tod lauert
Western-Edition
Impressum
Neuausgabe
Copyright © by Authors
© Copyright dieser Lizenzausgabe by XEBAN-Verlag.
Verlag: Xeban-Verlag: Kerstin Peschel, Am Wald 67, 14656 Brieselang; [email protected]
Lizenzgeber: Edition Bärenklau / Jörg Martin Munsonius
www.editionbaerenklau.de
Cover: © Copyright by Steve Mayer, nach einem Motiv von eedebee (KI), 2025
Korrektorat: Sandra Vierbein
Alle Rechte vorbehalten!
Das Copyright auf den Text oder andere Medien und Illustrationen und Bilder erlaubt es KIs/AIs und allen damit in Verbindung stehenden Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren oder damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung erstellen, zeitlich und räumlich unbegrenzt nicht, diesen Text oder auch nur Teile davon als Vorlage zu nutzen, und damit auch nicht allen Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs nutzen, diesen Text oder Teile daraus für ihre Texte zu verwenden, um daraus neue, eigene Texte im Stil des ursprünglichen Autors oder ähnlich zu generieren. Es haften alle Firmen und menschlichen Personen, die mit dieser menschlichen Roman-Vorlage einen neuen Text über eine KI/AI in der Art des ursprünglichen Autors erzeugen, sowie alle Firmen, menschlichen Personen , welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren um damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung zu erstellen; das Copyright für diesen Impressumstext sowie artverwandte Abwandlungen davon liegt zeitlich und räumlich unbegrenzt beim XEBAN-Verlag. Hiermit untersagen wir ausdrücklich die Nutzung unserer Texte nach §44b Urheberrechtsgesetz Absatz 2 Satz 1 und behalten uns dieses Recht selbst vor. 13.07.2023
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Wo der Tod lauert
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Kurz-Vita des Autors
Eine kleine Auswahl der Romane von Glenn Stirling
Das Buch
Mein Name ist Carter. Jed Carter. Manche sagen, dass Ärger und Verdruss meine besten Freunde sind. Es heißt, die Luft sei verdammt bleihaltig, wo ich mich gerade aufhalte. Dabei bin ich nur ein Mann mit einer bewegten Vergangenheit, der in Ruhe gelassen werden möchte. Aber so langsam glaube ich, dass es mein Schicksal ist, immer mit einem Bein im Grab zu stehen …
Der heiße Süden lockte mich diesmal, und so machte ich mich auf den Weg, In Arizona war der Teufel los. General Crook war eingetroffen und versuchte mit allen Mitteln, den gnadenlos aber auch verzweifelt kämpfenden Geronimo und dessen Apachen zu besiegen. Ich wollte mich da nicht einmischen und versuchte nur, so viele Meilen zwischen Tucson und mich zu bringen wie möglich. Dieses Tucson glich einem Heerlager, zudem war es Sammelpunkt vieler Abenteurer geworden, von denen einige auf Indianerjagd gingen, um Skalps zu erwischen, für die man in Tucson Prämien zahlte. Erst dachte ich, so etwas ginge mich nichts an. Doch auf einmal steckte ich mitten in diesem Geschehen. Und es geschah in der Gluthölle der Gila-Wüste …
»Wo der Tod lauert« ist ein packender Western-Roman, wie ihn sich der Western-Fan wünscht, ein echter Glenn Stirling!
***
Wo der Tod lauert
Western von Glenn Stirling
1. Kapitel
Sie schienen aus der tiefstehenden Sonne zu kommen. So erkannte ich sie relativ spät. Zwanzig Reiter waren es ungefähr. Von meinem Lager zwischen den Felsen sah ich sie von der Wüste her näherreiten.
Jeder Fremde bedeutete in dieser Wildnis Gefahr, und mein erster Gedanke galt meinem Gewehr, meinem Pferd und einer guten Deckung.
Ich hatte den Tag über im Schatten der Felsen verbracht, um der mörderischen Hitze zu entgehen. Am Abend, wenn es abkühlte, wollte ich eigentlich weiter nach Süden, das heißt: nach Mexiko hineinreiten. In dieser Felsregion war ich schon einmal mit Jim Trenton gewesen. Ich kannte mich hier gut aus. Es wimmelte von guten Verstecken, und es lag weit abseits einer menschlichen Siedlung.
Ich hatte das alte Fernrohr aus der Satteltasche gezogen und blickte damit auf die Reiter, die durch die weite Talsenke zu den Felsen herauf kamen.
Sie würden nicht direkt auf mich stoßen, denn das Lager war ziemlich versteckt. Das hatte ich schon deshalb getan, um mich am Tag vor Überraschungen zu schützen. Hier im Grenzgebiet zwischen Arizona und Mexiko gab es mexikanische Bandoleros ebenso wie streunende Apachen. Aber ich sollte schon sehr bald noch eine weitere Gattung kennenlernen, von der ich bisher nur gehört hatte.
Durch mein Spektiv sah ich die Reiter, und etwas fiel mir sofort auf. Einer der Reiter war gefesselt.
Eine Frau!
Durch das Glas sah ich den riesigen Strohhut, den sie auf dem Kopf trug. Ihr Kleid war bunt, der Rock gerafft, sodass man die nackten Beine bis über die Knie sehen konnte. Man hatte sie ihr zusammengefesselt, und sie hockte im Damensitz auf einem Männersattel, aus dem sie nur nicht stürzen konnte, weil man sie daran festgebunden hatte. Die Arme waren ihr auf dem Rücken zusammengebunden. Langes schwarzes Haar quoll unter dem Hut hervor, aber das Gesicht lag im Schatten der Hutkrempe, sodass ich es nicht erkennen konnte.
Die Männer an ihrer Seite, ich zählte neunzehn, ritten auf verstaubten, abgehetzten Pferden, deren Fellfarbe man nur noch ahnen konnte. Es waren ausdauernde, kräftige Tiere, aber auch sie zeigten deutliche Spuren eines harten langen Rittes.
Die Reiter waren ebenso verstaubt wie die Pferde, ich sah Bärte in ihren Gesichtern, und ich erkannte die Waffen. Jeder von ihnen besaß ein Gewehr, jeder trug einen Revolver, und einige hatten Messer an Schnüren um den Hals hängen wie Amulette. In diesem Augenblick dämmerte es mir, was das für Männer waren: Skalpjäger.
Es waren Weiße, keine Mexikaner. Einer von ihnen, vielleicht der Anführer, besaß außer einer Winchester noch ein doppelläufiges Schrotgewehr. Er hatte es quer vor sich im Sattel liegen, und die Mündungen zeigten auf die Frau.
Die Zügel des Schecken, auf dem die Frau ritt, waren am Sattelhorn des Mannes festgemacht, der die Schrotflinte hielt.
Was ich sehen konnte, war noch nicht zu viel. Sie waren einfach noch zu weit weg, und die Hitze ließ die Luft flimmern, sodass ich alles nur unscharf erkennen konnte.
Sie kamen noch näher, und nun sah ich etwas von der Frau. Sie hob einmal den Kopf, blickte zu den Felsen empor, zwischen denen ich mich befand. Ich sah ihr Gesicht; ein schönes Gesicht. Das Gesicht einer Indianerin.
Ein paar Augenblicke lang war ich wie verzaubert von diesem Anblick. Ich hatte schon viele Indianer gesehen. Die meisten der Frauen gehörten nicht zu den Schönheiten. Aber diese junge Frau hatte etwas, was mich regelrecht bannte, und ich fragte mich, was die Männer veranlasst hatte, sich an einer solchen Frau zu vergreifen.
Die ganze Reiterschar hielt jetzt auf einen Einschnitt zu, der etwa hundert Schritt links von mir lag. Er führte zwischen den Felsen in ein Tal, und in diesem Tal hatte ich auch schon einmal mit Jim Trenton gelagert, aber es bot wenig Deckungsmöglichkeiten, war viel zu groß für einen einzelnen Mann, um darin zu lagern. Doch eine so große Gruppe hätte es sich leisten können, mitten in der Wüste ein Lager zu errichten, Feuer zu machen und sonst etwas zu tun, was auf sie aufmerksam machte. Aber ich vermutete, dass sie den Schatten suchten, obgleich die Nacht bevorstand, die Nacht, in der ich eigentlich reiten wollte.
Ich ahnte schon, dass daraus nichts würde. Jedenfalls brauchte ich keine Sekunde darüber nachzudenken, was ich tun musste. Aber im Augenblick hatte ich keine Chance. Gegen neunzehn schwer bewaffnete Männer konnte ich selbst mit ein paar gut gezielten Schüssen nur Selbstmord begehen. Der Frau würde ich nicht helfen können. Nicht jetzt und nicht im offenen Kampf. Also hieß es abwarten.
Zuerst einmal musste ich mich um mein Pferd kümmern, um den Fuchswallach, den ich mir erst vor zwei Wochen gekauft hatte. Ein ruhiges ausdauerndes Tier, für die Wüste wie gemacht. Und ich hatte Erfahrungen in der Wüste gesammelt. Nicht erst, als ich mit Jim Trenton durch sie gezogen war. Schnelle, rassige Pferde zählten in der Wüste nicht, da kam es auf ganz andere Eigenschaften an. Ein Wüstenpferd musste in der Lage sein, mit wenig Wasser auszukommen, und mit fast ebensowenig Nahrung. Es brauchte nicht sehr schnell zu sein, musste dafür aber enorme Ausdauer besitzen. Der Fuchs war so ein Tier. Jetzt allerdings musste ich ihn wegbringen, damit er nicht durch Zufall von irgendwelchen Posten dieser Bande dort beobachtet wurde. Also verließ ich meine Stellung, schob das Spektiv zusammen und brachte den Fuchs unter eine überhängende Stelle, die man von den höheren Felsen aus nicht erkennen konnte. Dann zog ich mein Gewehr aus dem Scabbard des Sattels, der neben mir lag. Auch den Sattel schaffte ich an einen versteckten Platz, räumte meine Feuerstelle ab und beseitigte alle Spuren, die darauf hinwiesen, dass hier in letzter Zeit jemand gelagert hatte. Danach kletterte ich in die Felsen hinauf. Noch konnte ich es mir erlauben, an der den Reitern abgewendeten Felsseite emporzuklettern, noch hatten sie selbst jene Schlucht nicht erreicht, in der sie, wie ich vermutete, lagern würden.
Während ich noch kletterte, hatten sie wohl inzwischen den Taleinschnitt erreicht, und ich hörte das Trappeln der vielen Hufe auf dem felsigen Untergrund bis zu mir herauf ins schartige Gestein.
Es war eine schweißtreibende Arbeit. Der Felsen schien zu glühen. Die Nachmittagshitze hatte den Stein noch einmal richtig heiß werden lassen. Aber es blieb mir keine Wahl, als auf der Seite zu klettern, die der Sonne zugewendet war. Anderenfalls hätten mich womöglich die Reiter erkennen können.
Als ich endlich auf der flachen Plattform des Felsens anlangte, war ich in Schweiß gebadet. Mein Atem ging rasselnd, und ich kniete ein paar Sekunden lang, um Luft zu schöpfen. Dann kroch ich über die Plattform hinweg zur anderen Seite, von der aus man hinunter in die Schlucht sehen konnte, in der sich die Reiter befanden.
Sie hatten inzwischen diese Schlucht erreicht, bildeten eine Art Traube um die Gefangene herum und hielten dann auf einen Felsvorsprung zu, der wie eine Nase aus der Felswand herausragte, an deren oberstem Rand ich lag. Diese Felswand hüllte auch das ganze Tal in tiefen Schatten.
Drei Reiter verließen den Pulk der anderen und ritten zum Talende hin. Dort hinten, das wusste ich, gab es eine schmale Gasse, durch die man noch tiefer in die Felsregion hineingelangte. Ich fürchtete schon, die drei wollten dort hineinreiten, um sich irgendwo da zu verkriechen. Sie verschwanden auch, kehrten aber nach einiger Zeit wieder zurück. Inzwischen war die Gefangene vom Pferd losgebunden und vor diese Felswand gestellt worden.
Einer der Männer schlug mit einem Fäustel schwere Haken in die Haarrisse der Felsnase. Ich fragte mich schon, was das zu bedeuten hatte, da bekam ich schon die Antwort. Ein zweiter Mann schlang ein Lasso um die Haken und fesselte dann die Gefangene an diese Haken.
Die übrigen Männer schienen sich zunächst überhaupt nicht um die Frau zu kümmern. Ich konnte von hier oben aus alles sehen, und trotzdem hatte ich keine Chance einzugreifen. Sie waren neunzehn Mann, und selbst wenn ich in rasender Schnelligkeit einige von ihnen durch Gewehrschüsse niederstrecken konnte, wäre es mir nicht möglich gewesen, im besten Fall mehr als sechs Mann zu erwischen. Die anderen dreizehn hätten Deckung gefunden und wären mir mit absoluter Sicherheit zum Verhängnis geworden.
Wenn ich dieser Frau da unten helfen wollte, dann musste ich anders vorgehen, und dazu war ich fest entschlossen. Zunächst aber bestand die Gefahr, von den Männern entdeckt zu werden. Damit dies nicht geschah, zog ich meinen kleinen Taschenspiegel, der mir in dieser Beziehung schon oft gute Dienste erwiesen hatte, heraus, legte mich etwas zurück und beobachtete, was unten im Tal geschah.
Die Männer machten in etwa zehn Schritt Entfernung von der Gefangenen ein Lagerfeuer. Es war schwierig, in dieser Gegend Brennmaterial zu finden, und so sah ich fünf von ihnen herumstreunen, um verdorrte Kakteen oder Gesträuch zu finden, was aus den Felsspalten wuchs und in der Hitze verdorrt war. Es dauerte einige Zeit, bis sie genug Brennmaterial gefunden hatten, dann entzündeten sie ein Feuer. Der Qualm stieg zu mir empor und kroch über das Plateau hinweg, dass ich alle Mühe hatte, nicht husten zu müssen.
Inzwischen war die Sonne hinter dem Horizont versunken. Die ganze Kuppel des Himmels leuchtete wie glühendes Eisen. Aber von einer Sekunde zur anderen breitete sich ein tiefes Violett von Osten her über das ganze Himmelszelt aus, und die Nacht, die hier in diesen Breiten ohne den langen Übergang einer allmählichen Dämmerung eintrat, übernahm das Regiment.
Auf dem Rücken liegend und rot wie eine Apfelsinenscheibe tauchte der Mond auf. Ein Stück oberhalb von ihm ebenfalls wie ein goldenes Licht: der Abendstern.
Das Feuer brannte jetzt rauchlos. Es erhellte das ganze Tal, und ich konnte es mir wieder leisten, etwas nach vorn zu kriechen und direkt hinunterzuspähen.
Sie waren alle neunzehn vor der Gefangenen versammelt. Einer von ihnen, jener mit der Schrotflinte, sagte etwas, das ich hier oben nicht verstand. Daraufhin setzten sie sich im Kreis um das Feuer herum und begannen zu essen. Einer von ihnen hatte über dem Feuer ein Dreibein errichtet, an dem ein Topf hing. Der Duft von Kaffee stieg bis zu mir herauf, und mir lief das Wasser im Mund zusammen – bei dem Gedanken an frischen heißen Kaffee.
Allmählich wurde es kühler. Die Männer unten tranken Kaffee, keiner von ihnen schien sich um die Gefangene zu kümmern, die wie reglos in ihren Fesseln stand. Nach einer Weile aber kam Bewegung in die Männer. Bis auf drei standen sie auf, zogen die Sattelgurte ihrer Pferde wieder stramm, gaben den Tieren noch einmal zu saufen, indem sie aus ihren Feldflaschen Wasser in ihre Hüte gossen und die Pferde daraus tränkten. Wenig später saßen die Männer auf und ritten aus dem Tal heraus. Sie wählten den Weg, den sie gekommen waren; doch drei, jene drei am Feuer, blieben zurück. Ich frohlockte schon, da sah ich, wie am Talausgang zwei der Reiter zurückblieben, während die anderen offensichtlich wieder in die Wüste hineinzogen.
Mir kam der Gedanke, dass diese junge Indianerin als eine Art Köder dienen sollte. Andererseits verstand ich das System nicht, nach dem diese Männer dort unten vorgingen. Zumal jetzt jene zwei, die am Eingang zurückgeblieben waren, nun auch den Ritt fortsetzten und den anderen folgten.
Ich fragte mich noch, was sie wohl dort am Schluchteingang getrieben haben konnten, da brachte mich der Zufall darauf. Es war wirklich nur ein Zufall. Der Feuerschein erhellte nicht nur die Felswände, sondern wies mich auch auf einen hellen Strich hin, der etwa in Gürtelhöhe quer über den Engpass hinweg verlief, durch den die Reiter eben geritten waren. Ich hielt es schon für eine Halluzination, da begann ich zu begreifen, um was es sich handelte: ein Seil!
Sie hatten ein Seil quer über den Weg gespannt, und nun ritten sie weiter in die Wüste, aber dort sah ich sie nicht mehr, es war einfach zu dunkel dazu. Noch stand die Sichel des Mondes zu tief, um spärliches Licht zu spenden. Die Reiter wurden von der Dunkelheit über der Wüste verschluckt. Und ich sah nur jene drei dort unten um das Feuer herum und die Indianerin.
Jetzt stand einer der drei auf, ein Messer blitzte in seiner Hand.
Ich schob mein Winchestergewehr etwas weiter zum Rand des Felsens, bereit, rasch Ziel zu fassen und abzudrücken. Aber ein unbestimmtes Gefühl warnte mich. Früher habe ich über solche Gefühle immer gelacht, aber die Jahre in der Wildnis haben mich gelehrt, dass man auf seinen Instinkt etwas geben kann, vor allem, wenn es ein geschulter Instinkt ist.
Mir gingen diese zwei nicht aus dem Kopf, die das Seil gespannt hatten. Ob sie wirklich den anderen gefolgt waren? Oder sich vielleicht noch in der Nähe befanden?
Einen Hinweis bekam ich, als ich nach rechts blickte. Etwas oberhalb vom Schluchtzugang flogen Stärlinge auf. Vögel, die eigentlich nur am Tag fliegen. Kleine Sänger, die sich in der Nacht nicht aus ihrem Nest trauen. Und jetzt waren sie aufgeflogen. Etwa in halber Höhe des Felsens musste das sein.
Der nächste Hinweis kam, bevor der Mann mit dem Messer unten bei dem Mädchen angelangt war. Und dieser Hinweis kam von der anderen Seite der Schlucht, auch etwa in halber Höhe des Felsens. Dort sah ich eine Bewegung gegen den etwas helleren Hintergrund der Wüste. Eine Gestalt kletterte dort, hielt aber jetzt inne und schien sich auf einer Art Felssims niederzulassen.
Ich begann nun zu ahnen, um was es hier ging. Diese Schlucht war eine Falle, in die man jemand hineinlocken wollte. Dieser »Jemand« konnte aber keinesfalls aus der Richtung kommen, in die die Reiter jetzt geritten waren.
Bevor ich mir weitere Gedanken machen konnte, geschah dort unten etwas anderes. Der Mann mit dem Messer war bei der Gefangenen angelangt, ich hörte sein Lachen bis zu mir herauf, dann setzte er das Messer am Kleid der Gefangenen an und schlitzte es auf. Er tat es so geschickt, dass er offensichtlich nicht einmal die Haut des Mädchens berührte.
Die beiden anderen standen jetzt auf und gesellten sich zu ihrem Kumpan. Während er noch damit beschäftigt war, das Kleid der Gefangenen, die sich nicht rühren konnte, aufzufetzen, rissen die anderen die Stoffstücke vom Leib der Frau. Es dauerte nur Sekunden, bis sie völlig nackt dastand; und noch immer gefesselt.